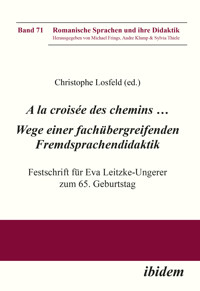
A la croisée des chemins … Wege einer fachübergreifenden Fremdsprachendidaktik E-Book
26,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ibidem
- Kategorie: Fremdsprachen
- Serie: Romanische Sprachen und ihre Didaktik
- Sprache: Deutsch
Eva Leitzke-Ungerer ist seit 2006 Professorin für Didaktik der romanischen Sprachen am Institut für Romanistik der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. In dieser Zeit hat sie nicht nur zahlreiche Studierende auf ihre berufliche Tätigkeit grundlegend vorbereitet, sondern durch ihre umfangreichen Forschungsarbeiten einen wesentlichen Beitrag zur Didaktik der romanischen Sprachen geleistet. Um ihr Wirken zu würdigen, haben ihre Kollegen und Freunde beschlossen, ihr anlässlich ihres fünfundsechzigsten Geburtstages diese Festschrift zu schenken. Die 16 im Band veröffentlichten Beiträge spiegeln das Wirken von Eva Leitzke-Ungerer wider, indem sie Probleme der allgemeinen Fremdsprachendidaktik und deren Konkretisierung im schulischen Kontext, ihre sprach-, literatur- und kulturwissenschaftliche Orientierung und nicht zuletzt die Bedeutung von Film und Musik für den Fremdsprachenunterricht thematisieren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 527
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
ibidem-Verlag, Stuttgart
Inhaltsverzeichnis
A la croisée des chemins…
Fremdsprachendidaktik und ihre Konkretisierung im schulischen Kontext
Sprachmittlung in der schriftlichen Abiturprüfung Spanisch – unterschiedliche Konzepte oder bildungsstandardskonform?
Authentizität auf dem Prüfstand – Fremdsprachenunterricht in einer sich verändernden Welt
Sprachwissenschaftliche Orientierung der Fremdsprachendidaktik und Mehrsprachigkeit
Authentizität im Französischen: Zur Rolle von Aussprache und Phrasemen für die Entwicklung von Sprechkompetenz
Sprachenübergreifendes Lernen – das Projekt Brücken zwischen Lehrwerken in Deutschland
Literaturwissenschaftliche Orientierung der Fremdsprachendidaktik unter EInbeziehung neuerer Formen wie Comics
Eine alte Erzählung neu gelesen – Die performative Lektüre eines mittelalterlichen ejemplo im Spanischunterricht der Oberstufe
Charles Bovary oder: Die Möglichkeit der Romantik. Figurenmodellierung und Sprachreflexion in Flauberts Madame Bovary
Ma maman est en Amérique, elle a rencontré Buffalo Bill: Die Förderung medienästhetisch-analytischer und -kreativer Kompetenzen durch die Medienkombination bande dessinée im fremdsprachlichen Französischunterricht
Kulturwissenschaftliche Orientierung der Fremdsprachendidaktik
« On peut avoir un message du genre "PS : lave la cuisine" » Blicke auf Frankreich – Blicke auf Deutschland: Was Studierende eines binationalen Studiengangs über unsere (akademischen) Kulturen denken
Sigmund Freud lernt Spanisch
Migrar. Weggehen. “A striking and unique piece of art that tells an important story” – nicht nur für den Fremdsprachenunterricht
Elf Wahrheiten und ein Todesfall: Amara Lakhous’ Scontro di civiltà per un ascensore a piazza Vittorio. Kulturdidaktische Lesarten und Lernaufgaben für den Italienischunterricht der Sekundarstufe II
La question de la (dé)colonisation en cours de français langue étrangère
Film und Musik im Fremdsprachenunterricht
François Ozons Frantz im Französischunterricht
Connexion en cours – die Arbeit mit der Webserie als Beitrag zur Filmbildung im Französischunterricht
Le langage du cœur dans une chanson des années 1960: Das Chanson „D’abord je n’ai vu...“ von Frida Boccara im Französischunterricht der Sekundarstufe II
Sergej Prokofjews „Петя и волк“ im fächerverbindenden Unterricht – Vorschläge für eine Vernetzung der Fächer Darstellendes Spiel, Musik und Spanisch
Schriftenverzeichnis von Eva Leitzke-Ungerer
Schriftenverzeichnis
A la croisée des chemins…
Christophe Losfeld (Halle)
Automne 2008. Dans un couloir de l’Institut de Langues romanes de l’Université de Halle, je croisai Mme la Professeure Leitzke-Ungerer que je me permis d’aborder. Etant passé depuis peu de l’Université à l’enseignement secondaire, j’avais décidé de modifier un peu mon cadre de travail, passant de la littérature et de la civilisation à leur enseignement dans un contexte scolaire, et de m’intéresser, par conséquent, davantage à la didactique. Désireux donc, de changer un peu de discipline, l’idée me vient de proposer mes services à Eva Leitzke-Ungerer, qui ne me connaissait pas encore.
Un instant, je la vis hésiter, cette hésitation tenant peut-être aux relations parfois compliquées, dans le milieu universitaire, entre tenants de disciplines différentes. Mais le même jour, je reçus un courrier dans lequel elle acceptait ma proposition.
Plus de dix ans déjà que perdure cette coopération, une coopération fructueuse, fondée sur le respect mutuel et un approche semblable de l’enseignement, une coopération qui a abouti, entre autres, à l’organisation d’une section commune lors d’un grand colloque ou d’un module universitaire consacré à l’enseignement bilingue, une coopération, enfin, qui n’aurait guère été possible sans les qualités scientifiques et humaines d’Eva Leitzke-Ungerer.
Les premières, elle les a acquises et approfondies durant une formation commencée à l’Institut de langues romanes et celui de philologie anglaise de l’Université de Munich. C’est dans ce dernier qu’elle a assumé aussi, entre 1984 et 1990, les fonctions de maître-assistant et où elle a passé aussi sa thèse de troisième cycle en linguistique anglaise, avant de passer une année comme lectrice au Westfield Collège de l’Université de Londres. Au terme de celle-ci, et après une année dans un lycée de Munich et un congé parental, elle est devenue chargée de cours à l’Université de Rostock où elle a soutenu sa thèse de Doctorat d’Etat en didactique de la langue française. Avant même la soutenance, elle avait commencé à assurer un remplacement de chaire professorale pour la didactique des langues romanes à l’Université de Göttingen. A peine Docteur d’Etat, elle a assuré un pareil remplacement à l’Institut de langues romanes de l’Université de Halle, où elle a été nommée Professeure à partir de mars 2006. Depuis cette date, elle a formé plusieurs centaines d’étudiants et les a préparés aux tâches d’enseignement.
Cette faculté à passer d’un domaine à l’autre – ce dont témoigne de manière impressionnante son parcours de formation –, de se placer à l’intersection de différentes disciplines ainsi qu’à faire entrer en un productif dialogue les différents champs qu’elle a cultivés et explorés, est l’un des signes de la curiosité intellectuelle d’Eva Leitzke-Ungerer et de son ouverture d’esprit. L’un et l’autre l’ont amenée, au cours de sa carrière, à s’intéresser à des sujets aussi divers que la notion de variété dans l’enseignement de langues romanes (où sa formation de linguistique lui a été d’une grande utilité), à la transmission de phénomènes civilisationnels, au traitement de textes littéraires en cours de langue et à leur rapport à d’autres formes d’art comme le cinéma où le théâtre.
Et comment ne pas évoquer aussi son engagement pour l’enseignement de matières non linguistiques en langue étrangères ? A une époque où cette forme d’enseignement, pour être pratiquée de plus en plus souvent, n’en faisait pas moins l’objet de vives critiques dans la didactique universitaires, elle s’est engagée sans réserves pour la promouvoir à l’Université de Halle, en créant et dirigeant un module de formation destiné à sensibiliser étudiants et enseignants à la spécificité de cette pratique. En l’espace de cinq années, pas moins de 130 étudiants ont profité, à ce jour, des enseignements de ce module.
Et si, dans l’enseignement supérieur des lettres, de la linguistiques et des langues romanes, les représentants des différentes spécialités ont souvent une langue de prédilection, l’une des caractéristiques d’Eva Leitzke-Ungerer est d’avoir effectué des recherches avec le même fruit et un égal bonheur tant en français qu’en espagnol ou encore en italien.
Il suffit, pour s’en convaincre, de consulter son imposante bibliographie (reproduite à la fin du volume) qui ne recense pas moins de dix monographies qu’elle a rédigées ou de recueils qu’elle a édités ou coédités, textes qui reflètent l’amplitude de son œuvre, à l’instar des quarante articles qui y sont aussi mentionnés.
Ses qualités de chercheur, et c’est là un aspect vraiment décisif pour quiconque travaille dans l’enseignement supérieur, elle parvient dans ses cours à les transmettre à des étudiants à la formation desquels elle travaille intensément, et cela sans négliger la dimension humaine de sa tâche. Chaque étudiante, chaque étudiant est pour elle une personnalité unique dont les capacités doivent être développées individuellement. Cet intérêt porté à chacune et chacun d’entre n’est pas sans expliquer la reconnaissance qu’éprouvent pour elle ceux qui ont bénéficié de son enseignement, un enseignement qui tireprofit des travaux de recherches qu’elle entreprend régulièrement et poursuit avec une remarquable assiduité. Et même à un moment où certains se reposent sur leurs lauriers, attendant une retraite bien méritée, elle a repris un nouveau cycle de recherches consacrées au théâtre dans l’enseignement des langues étrangères.
La qualité de son enseignement, tout autant que celle de ses recherches explique qu’elle soit une conférencière recherchée dans les colloques, et aussi une collègue qu’on convie volontiers à intervenir dans le cadre de semestre d’enseignements à l’étranger. C’est ainsi que ces dernières années, elle a enseigné plusieurs mois à l’université de Salamanque, de Séville en Espagne ou à celle de La Plata, en Argentine.
Ces interventions, comme la productivité dont elles témoignent, sont à mettre en rapport, évidemment, avec le réseau qu’elle a constitué au cours de sa carrière, nouant avec des collègues venus d’Allemagne et de l’étranger des liens professionnels qui, parfois, sont devenus aussi des liens d’amitié. Ces deux dimensions apparaissent incontestablement dans les dix-huit contributions rassemblées dans le présent volume qui reflètent dans le même temps la plupart des différents domaines auxquels elle s’est consacrée en près de quarante ans de carrière :
Les problèmes généraux de la didactique des langues étrangères
La linguistique et son intérêt pour la didactique des langues étrangères
La didactique et ses liens à la littérature sous toutes ses formes
La didactique dans ses rapports à la civilisation
Musique, chanson et théâtre et leur exploitation en milieu scolaire
Les auteurs de ces contributions ont voulu te rendre hommage, chère Eva, à un moment où, à l’instar de ce qu’a été ta carrière universitaire, tu te trouves à la croisée des chemins. Géographiquement d’abord, puisque après avoir vécu douze années essentiellement en Saxe-Anhalt, tu déplaces peu à peu ton pôle de vie pour retrouver ta Bavière natale. Biographiquement aussi, puisque traditionnellement, l’anniversaire que tu fêtes cette année marque sans doute un changement profond dans une existence. Et nous nous réjouissons que cet anniversaire te permette de te dégager d’un certain nombre d’obligations parfois pesantes, car cela te permettra de poursuivre ton chemin scientifique et de continuer ton travail de recherche. Etre, aujourd’hui, comme tu l’es, à la croisée des chemins ne signifie pas, surtout pour toi, s’arrêter, mais s’élancer vers des horizons nouveaux.
Très cordialement,
Christophe Losfeld
Fremdsprachendidaktik
und ihre Konkretisierung
im schulischen Kontext
Sprachmittlung in der schriftlichen Abiturprüfung Spanisch – unterschiedliche Konzepte oder bildungsstandardskonform?
Frank Schöpp (Würzburg)
1. Einleitung
Aufgaben zur Sprachmittlung sind in Deutschland fester Bestandteil des Unterrichts der modernen Fremdsprachen, sie fehlen in keinem nach 2010 erschienenen Lehrwerk für den schulischen Unterricht und begegnen Lernenden auch in den zentralen Abschlussprüfungen. Allerdings ergibt eine Durchsicht aktuell verwendeter Lehrwerke und von den großen Verlagen angebotener Übungsaufgaben, dass das Konzept der Sprachmittlung keineswegs einheitlich definiert ist. Tatsächlich kann Caspari (2013, 37) im Rahmen einer Analyse von 45 Aufgaben aus Lehrwerken, Aufgabensammlungen sowie im Internet zugänglichen Materialien zeigen, „dass sich in den Aufgaben ganz unterschiedliche Konzepte von ‚Sprachmittlung‘ niederschlagen“. Inwieweit bei allen in ihrer Typologie enthaltenen Aufgaben tatsächlich von ‚Sprachmittlung‘ gesprochen werden kann, ist sicher diskussionswürdig (vgl. z.B. die Aufgaben zur Sprachmittlung als Überprüfungsform lexikalischer und grammatischer Kenntnisse). Zu Recht weisen Caspari & Schinschke (2017, 181) auf die Gefahr hin, dass bei zahlreichen Aufgaben
der mit der Sprachmittlung verbundene Anspruch so stark reduziert wird, dass die Sprachmittlungssituation lediglich als ‚Verpackung‘ für eine Übung bzw. Überprüfung eines anderen Kompetenzbereichs fungiert.
Die Folge sind mit dem Etikett ‚Sprachmittlung‘ versehene Aufgaben, die auf die Entwicklung einer anderen als der ‚klassischen‘ Sprachmittlungskompetenz abzielen. Casparis Forderung, die Aufgaben müssten durch eine Information bezüglich der durch sie zu entwickelnden Kompetenz(en) erweitert werden, so dass sowohl Lehrkräfte als auch Schüler wissen, welcher Kompetenzbereich jeweils im Fokus steht, verdient in jedem Fall Unterstützung (2013, 41).1
In der (deutschsprachigen) fachdidaktischen Diskussion über die Sprachmittlung besteht größtenteils Einigkeit, dort ist es vor allem die Frage nach der Abgrenzung der Sprachmittlung von der Translation, also dem Dolmetschen und Übersetzen, an der sich die Geister scheiden.2 So schreibt beispielsweise Schilling (2015, 72), „Sprachmittlung/mediación und Übersetzen/(profes-sionelles) Dolmetschen unterscheiden sich erheblich“ und listet eine Reihe von Unterschieden auf, während Siepmann (2013, 204) sich in seinem Beitrag zum Ziel setzt,
wissenschaftlich einwandfrei nachzuweisen, dass trotz aller theoretischen Abgrenzungsbemühungen die Sprachmittlung im Fremdsprachenunterricht nichts anderes ist als Translation (Übersetzen und Dolmetschen). Der Unterschied zwischen den beiden Begrifflichkeiten ist lediglich ein gradueller, der sich vor allem am Grad der Professionalität der erwarteten Leistung festmachen lässt. Andere häufig postulierte Unterscheidungsmerkmale erweisen sich bei genauerer Betrachtung als irrelevant.
Für die schulische Praxis scheint diese Auseinandersetzung allerdings von sekundärem Interesse zu sein. Erfreulicherweise besteht im fachdidaktischen Diskurs hinsichtlich einer für Lehrkräfte wesentlich bedeutenderen Frage, nämlich der nach den Charakteristika gelungener Sprachmittlungsaufgaben, weitestgehend Konsens.
2. Kriterien für gelungene Sprachmittlungsaufgaben
Die im Zentrum dieses Beitrags stehende Analyse von Sprachmittlungsaufgaben in den Abiturprüfungen ausgewählter Bundesländer erfordert eine Kriterienliste. Eine ganze Reihe nach 2005 erschienener Publikationen beschäftigen sich mit der Frage, was eine gute Sprachmittlungsaufgabe ausmacht (z.B. Gebauer & Kieweg 2008, Hallet 2008, Caspari & Schinschke 2012, Kolb 2016, Fäcke & Tesch 2017) – mit ähnlichen Ergebnissen. Stellvertretend für diese Beiträge sei hier auf den Kriterienkatalog von Philipp & Rauch (2014, 14) verwiesen, der fünf zentrale Aspekte enthält:
1.Schaffung einer konkreten realitätsnahen Situation, in die die Lernenden tatsächlich geraten können;
2.konkretes Informationsbedürfnis der Gesprächspartnerinnen und -partner, das sich in einem präzise formulierten Arbeitsauftrag wiederfindet; Einforderung einer Anpassung der zu mittelnden Informationen an den Wissensstand der Adressatinnen und Adressaten;
3. authentisches Material als Textgrundlage;
4.keine Verwendung von Wörterbüchern und keine oder nur wenige Vokabelhilfen;
5.für Prüfungsaufgaben gilt: Bezug zur aktuellen Unterrichtsthematik gewährleistet das Verfügen über den notwendigen Wortschatz und die erforderlichen Textsortenkenntnisse
Mit Blick auf Sprachmittlungsaufgaben in Abiturprüfungen sind diese Kriterien nicht allesamt von gleicher Relevanz. Bei der Konzeption von Abschlussprüfungen ist selbstverständlich darauf zu achten, dass die Lernenden über die zum Verstehen eines Textes erforderlichen lexikalischen Kenntnisse sowie Textsortenkenntnisse verfügen und ein Bezug zu den relevanten Unterrichtsthematiken besteht. Insofern ist dieses Kriterium (obiger Punkt 5) keines, das sich spezifisch auf Sprachmittlungsaufgaben bezieht.
Was die Verwendung von Wörterbüchern betrifft (Punkt 4), so wird diese von den jeweiligen Kultusministerien geregelt. Im Kontext der Sprachmittlung sprechen sich die meisten Vertreter der Didaktiken der sprachlichen Fächer gegen den Rückgriff auf zweisprachige Wörterbücher in Prüfungssituationen aus, da diese die Schüler bei jeder noch so kleinen lexikalischen Unsicherheit zum Nachschlagen animieren. Dennoch stehen sie den Lernenden in den zentralen Abschlussprüfungen der Länder zur Verfügung. Die Folge ist, dass sich die lernendenseitig vorhandene Strategienkompetenz nicht mehr nach-vollziehen und folglich auch nicht bewerten lässt.
Dass die Sprachmittlung auf der Grundlage authentischen Sprachmaterials erfolgt (Punkt 3), und zwar möglichst schon im Anfangsunterricht, lässt sich mit der gewünschten Realitätsnähe begründen, schließlich handelt es sich um eine Aktivität, die für die Mehrheit der Schüler eine größere lebensweltliche Relevanz besitzen dürfte als die stilistische Analyse eines Textauszugs.
Ein wirklich zentrales Charakteristikum guter Sprachmittlungsaufgaben ist das Vorhandensein eines konkreten Informationsbedürfnisses des Gesprächs-partners, das sich in einem präzise formulierten Arbeitsauftrag widerspiegelt (vgl. Punkt 2). Dieser Aspekt findet sich unter dem Begriff der ‚Adressatenorientierung‘ auch bei anderen Autoren wieder. Um diese Adressaten-orientierung in einer Sprachmittlung gewährleisten zu können, muss die Aufgabenstellung ausreichende Informationen zum Gesprächspartner enthalten, d.h. sein Interesse am Text muss klar nachvollziehbar sein. Darüber hinaus sehen Philipp & Rauch (2014, 14) die „Einforderung einer Anpassung der zu mittelnden Informationen an den Wissensstand der Adressatinnen und Adres-saten“ als wesentlich an. Die Aufgabenstellung sollte die Lernenden in die Lage versetzen „die inhaltlichen und kulturellen Kenntnisse, Erfahrungen und Erwartungen der Adressaten erschließen [zu] können“ (Caspari & Schinschke 2017, 196). Diese müssen bei der Sprachmittlung unbedingt berücksichtigt werden, denn nicht jede Information eines Textes ist für jeden Gesprächspartner gleichermaßen relevant.3
Das erste Kriterium in der Aufstellung von Philipp & Rauch (2014) betrifft den situativen Rahmen der Aufgabenstellung, der ausreichend Identifikationspotenzial für die Prüflinge bieten und wirklichkeitsnah gestaltet sein sollte. Dabei ist unbedingt darauf zu achten, dass die Beschreibung der fiktiven Situation zu den Ausführungen über den Adressaten und sein Informations-bedürfnis passt.
Es zeigt sich sehr klar, dass die Frage, ob eine Sprachmittlungsaufgabe als gelungen bewertet werden kann, in erster Linie von ihrer Aufgabenstellung abhängt. Wird in der Aufgabenstellung eine konkrete, lebensnahe Situation geschaffen und enthält sie Angaben zum Informationsbedürfnis des Adressaten? Auch Pfeiffer (2013, 49) betrachtet diese beiden Aspekte als essentiell und fasst treffend zusammen, dass
als echte Sprachmittlungsaufgaben nur solche gelten [können], die ein Mindestmaß an Informationen zu einer Situation und einem Adressaten bieten. Aufgaben, die keinerlei Kontextinformationen bereitstellen, trainieren kein situations- und adressatengerechtes Übertragen, […].
Folgerichtig findet sich auch in den Kann-Beschreibungen der Bildungsstandards für die fortgeführte Fremdsprache (Englisch/Französisch) für die Allgemeine Hochschulreife (KMK 2012, 19) die Betonung der Situations- und Adressatenorientierung sowie zusätzlich des damit in engem Zusammenhang stehenden Zwecks der Sprachmittlung:
Die Schülerinnen und Schüler können – auch unter Verwendung von Hilfsmitteln und Strategien – wesentliche Inhalte authentischer mündlicher oder schriftlicher Texte, auch zu weniger vertrauten Themen, in der jeweils anderen Sprache sowohl schriftlich als auch mündlich adressatengerecht und situationsangemessen für einen bestimmten Zweck wiedergeben.
Bei der prototypischen schulischen Sprachmittlung in der Sekundarstufe II findet folglich eine schriftliche oder mündliche Vermittlung mit einer relativ konkreten Kontextualisierung statt – unter Nennung des Adressaten, der Situa-tion und des Zwecks (Kolb 2016, 57).4
Zusätzlich zu den Informationen über die Situation und den Adressaten nennen Caspari & Schinschke (2017, 196) zwei weitere Kriterien für gelungene Sprachmittlungsaufgaben: zum einen die Wahl der passenden Textsorten (Aus-gangs- und Zieltext)5, zum anderen die Vertrautheit der zu mittelnden Inhalte.6
Die Autorinnen halten fest:
Entscheidend für die Qualität einer Sprachmittlungsaufgabe ist letztlich das Zusammenwirken dieser vier Elemente, also die Stimmigkeit bzw. Passgenauigkeit zwischen Situation, Adressat, Inhalt und Textsorte (loc. cit.).
Bisher noch nicht genannt, aber in vielen Beschreibungen der Charakteristika gelungener Sprachmittlungsaufgaben enthalten, ist der Verweis darauf, dass die Schüler eine echte Mittlerfunktion einnehmen. Bereits im Gemeinsamen euro-päischen Referenzrahmen für Sprachen (Europarat 2001, 89) heißt es:
Bei sprachmittelnden Aktivitäten geht es den Sprachverwendenden nicht darum, seine/ ihre eigenen Absichten zum Ausdruck zu bringen, sondern darum, Mittler zwischen Gesprächspartnern zu sein, die einander nicht direkt verstehen können, weil sie Sprecher verschiedener Sprachen sind […].
Mit Blick auf die Analyse der Sprachmittlungsaufgaben kann also Folgendes festgehalten werden:
Gegenstand der Analyse sind die Aufgabenstellungen; Fragen, die die deutschen Ausgangstexte betreffen, spielen nur insofern eine Rolle, als geprüft wird, ob es sich um authentisches Material handelt, d.h. nicht für didaktische oder Prüfungszwecke erstellte Texte.
Damit eine Aufgabenstellung als gelungen bewertet werden kann, muss sie Angaben zur Situation, zum Adressaten, zum Informationsbedürfnis des Adressaten und zur geforderten Textsorte enthalten.7
3. Sprachmittlung als Bestandteil der Abiturprüfung
Prüfungsdidaktisch ist zunächst festzuhalten, dass die Sprachmittlung stets aus dem Deutschen in die Fremdsprache erfolgt. Des Weiteren findet im Abitur von den vier möglichen medialen Kombinationsmöglichkeiten ausschließlich die schriftliche Sprachmittlung ausgehend von einer schriftlichen Vorlage Berücksichtigung.8 Bei den deutschen Ausgangstexten handelt es sich in allen Fällen um journalistische Sachtexte, die in einigen Fällen leicht gekürzt wurden. Abgesehen von diesen allgemein gültigen Charakteristika ist der Stellenwert der Sprachmittlung in den Abiturprüfungen der einzelnen Länder jedoch alles andere als einheitlich. In den meisten Bundesländern ist eine Sprachmittlungsaufgabe obligatorischer Bestandteil der schriftlichen Abiturprüfung, so beispielsweise in Bayern, Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt. In Baden-Württemberg hingegen ist das Vorkommen einer Sprachmittlungsaufgabe im Abitur möglich, aber nicht zwangsläufig. Und in Hessen wiederum können die Prüflinge sowohl im Grund- als auch im Leistungskurs zwischen drei Aufgabenvorschlägen wählen, von denen nur einer eine Sprachmittlung beinhaltet, so dass diese bewusst umgangen – oder eben auch bewusst gewählt – werden kann.9
Der gezielte Vergleich der Teilaufgaben zur Sprachmittlung in den Abituraufgaben verschiedener Bundesländer kann zeigen, welches Konzept von Sprachmittlung die für die Prüfungsaufgaben Verantwortlichen jeweils zu Grunde legen. Mit Blick auf die angestrebte Vereinheitlichung des Abiturs erlaubt dieser Vergleich – selbstverständlich in einem begrenzten Rahmen – eine Darstellung des state of the art von Sprachmittlungsaufgaben in zentralen Abiturprüfungen und vermag eventuell vorhandene Diskrepanzen zwischen den Aufgabenformaten klar zu benennen. Aus Platzgründen muss die Analyse der Sprachmittlungsaufgaben auf drei Bundesländer, Baden-Württemberg, Bayern und Hessen, sowie eine Fremdsprache, Spanisch, beschränkt werden. Die Entscheidung für das Spanische ist seiner Popularität geschuldet: Der Unterricht in keiner anderen schulischen Fremdsprache hat in den beiden ersten Dekaden des 21. Jahrhunderts eine auch nur in Ansätzen ähnlich erfolgreiche Ent-wicklung genommen: Lernten im Schuljahr 2002/03 an allgemeinbildenden Schulen in Deutschland noch 151.692 Schüler Spanisch, so waren es im Schuljahr 2017/18, bereits 444.539 (Statistisches Bundesamt 2003 & 2018). Die Zahl der Spanischlerner hat sich damit in nur 15 Jahren beinahe verdreifacht. Noch ist der Abstand zum Französischen, der nach Englisch und vor Latein meist gelernten Fremdsprache, groß, die Konkurrenzsituation um die Position der zweiten modernen Fremdsprache dürfte sich aber in den kommenden Jahren zuspitzen. Zudem dürfte es eine Frage der Zeit sein, bis das Spanische auch Einzug in die Realschulen hält.
Was die Wahl der Bundesländer betrifft, so fällt diese mit Baden-Württemberg und Bayern auf zwei bevölkerungsreiche Länder, in denen Spanisch als dritte und spät einsetzende Fremdsprache gelernt werden kann. In Hessen hingegen wird Spanisch außer als dritte und spät beginnende Fremdsprache auch als zweite und vereinzelt sogar als erste Fremdsprache10 angeboten. Eine Folge dieser unterschiedlichen Schulsprachenpolitiken ist, dass im Schuljahr 2017/18 in Hessen 39.131 Schüler Spanisch lernten, während die Zahlen für Bayern und Baden-Württemberg mit 31.703 bzw. 35.469 deutlich darunter lagen (Statistisches Bundesamt 2018, 100). Angesichts der Gesamtzahl der Schüler an allgemeinbildenden Schulen lässt sich erahnen, in welchem Umfang das Fach Spanisch wachsen könnte, würden die beiden südlichen Bundesländer das Fach auch als zweite Fremdsprache zulassen.11
Für die Analyse werden im Folgenden die baden-württembergischen, bayerischen und hessischen Abituraufgaben der Jahre 2015, 2016, 2017 und 2018 im Fach Spanisch auf ihre Teilaufgaben zur Sprachmittlung hin untersucht. Im Vordergrund steht dabei die Frage, inwieweit die Aufgabenstellungen die im fach-didaktischen Diskurs seit Ende der 2000er Jahre diskutierten Kriterien für gelungene Sprachmittlungsaufgaben sowie die Modellierung der Sprachmittlung in den Bildungsstandards (KMK 2012) berücksichtigen, d.h. konkret, inwieweit sie Angaben zur Situation, zum Adressaten, zum Informationsbedürfnis des Adressaten und zur geforderten Textsorte enthalten. Mit Caspari (2013, 41) werden diese Informationen als Voraussetzung für gelungene Schülerprodukte bewertet:
Je mehr Informationen über die Situation, den Empfänger, die Textsorte und den Zweck gegeben werden, umso passgenauer kann der Sprachmittler den Zieltext gestalten. Zumindest für das Überprüfen dieser in der Realität sehr häufigen Sprachmittlungssituation sollten daher unbedingt alle diese Angaben gegeben werden.
Die schriftliche Abiturprüfung in Baden-Württemberg
Die schriftliche Abiturprüfung in Baden-Württemberg setzt sich aus den Anforderungsbereichen Textverständnis und Textproduktion zusammen. Letztere umfasst eine Aufgabe zur Reorganisation oder Analyse oder Sprachmittlung sowie einen Kommentar oder eine gestaltende Interpretation. Im hier interessierenden Zeitraum zwischen 2015 und 2018 fand die Sprachmittlung nur einmal, nämlich 2016, Eingang in die schriftliche Abiturprüfung.
2016
Compare la situación de Rodrigo en Alemania (Texto B) con la de los jóvenes españoles en Berlín (Texto A).
Partiendo de ambos textos, destaque los factores que pueden facilitar la integración de los trabajadores extranjeros en su nuevo entorno.
Diese Aufgabenstellung ist gleich in mehrfacher Hinsicht mit dem Konzept der Sprachmittlung der Bildungsstandards (KMK 2012) sowie dem fachdidaktischen Diskurs unvereinbar. Sie bezieht sich sowohl auf den bereits im Rahmen der ersten Aufgabe, der Comprensión de texto, behandelten spanischen Sachtext (A) als auch auf den deutschen Text (B). Die Prüflinge sollen zunächst die Situation der in den Texten beschriebenen spanischen Jugendlichen vergleichen, bevor sie im Anschluss, ausgehend von beiden Texten, Faktoren für eine gelingende Integration ausländischer Arbeitnehmer in ihre neue Umgebung nennen. Es ist leicht ersichtlich, dass hier kein Adressat angegeben wird – und damit zwangsläufig auch kein Informationsbedürfnis eines Adressaten vorhanden ist. In den Bildungsstandards für die Allgemeine Hochschulreife (KMK 2012, 18) lautet der erste Standard des grundlegenden Niveaus der funktionalen kommunikativen Teilkompetenz Sprachmittlung allerdings:
Die Schülerinnen und Schüler können mündlich und schriftlich
Informationen adressatengerecht und situationsangemessen in der jeweils anderen Sprache zusammenfassend wiedergeben […]
Für eine Prüfungsaufgabe ist diese Aufgabe also denkbar ungeeignet, sie über-prüft – aus fremdsprachendidaktischer Sicht – keinesfalls die Sprachmittlungs-kompetenz der Schülerinnen und Schüler.
Die schriftliche Abiturprüfung in Bayern
Anders als in Baden-Württemberg ist eine Aufgabe zur Sprachmittlung in Bayern obligatorischer Bestandteil einer jeden Abiturprüfung. Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass die Aufgabenstellungen jeweils auf Deutsch formuliert sind. Im Jahr 2015 konnten die Abiturienten letztmalig zwischen einer Sprachmittlung und einer Übersetzung aus der Fremdsprache ins Deutsche12 wählen, seit 2016 ist die Sprachmittlung damit obligatorisch.
2015
Bearbeiten Sie die folgende Aufgabe, indem Sie einen zusammenhängenden Text von ungefähr 250 Wörtern auf Spanisch schreiben und sich der relevanten Informationen der deutschen Textvorlage bedienen.13
Im Rahmen eines Austauschprogramms mit Spanien nehmen Sie im Sozialkundeunterricht der Partnerschule an einem Projekt zur aktuellen Situation Kubas teil. Ihre Aufgabe ist es, gemeinsam mit Ihrem Kurs eine Stellwand mit zum Thema passenden Informationen zu gestalten. Sie haben online den nachstehenden Artikel gefunden, den Sie für Ihre Arbeitsgruppe unter Berücksichtigung folgender Aspekte zusammenfassen:
Veränderungen hinsichtlich unternehmerischer Handlungsspielräume
Gilberto Valldares‘ gesellschaftliches Engagement
2016
Eine Sprachenschule in Málaga schreibt einen Wettbewerb für Schulabgänger aus, bei dem es einen zweiwöchigen Sprachkurs zu gewinnen gibt. Als Wettbewerbsbeitrag sollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Artikel zum Thema ‚El Bachillerato en mi país‘ verfassen. Von Ihrem Austauschpartner wissen Sie, dass in Spanien der Schulabschluss nicht generell wie in Deutschland mit einer aufwändigen Abiturfeier begangen wird. Deshalb gefällt Ihnen die Idee, über Abiturfeiern in Deutschland zu berichten.
Verfassen Sie Ihren Beitrag auf der Grundlage von Informationen, die Ihnen der untenstehende Zeitungsartikel liefert. Finden Sie eine passende Überschrift und berücksichtigen Sie inhaltlich folgende Aspekte:
Gestaltung der Abibälle in Deutschland heute
Erklärungsansätze für deren Gestaltung
Rolle der Organisatoren
2017
Ein Schulprojekt zum Thema ‚Freiwilligenarbeit‘ an Ihrer spanischen Partnerschule soll über die vielfältigen Möglichkeiten informieren, die es in den verschiedenen europäischen Ländern gibt. Ihr/e spanische/r Freund/in hat Sie daher gebeten, ihn/sie mir Informationen zu diesem Thema aus der deutschen Presse zu unterstützen. Bei Ihrer Recherche sind Sie auf den Artikel „Freiwillige vor!“ in der Süddeutschen Zeitung gestoßen, von dem Sie ihm/ihr in einer E-Mail berichten. Gehen Sie darin auf folgende Aspekte ein:
die neue Art des Reisens und ihre Anbieter
Motive der Teilnehmer und Vorurteile, die sich für sie ergeben
das besondere Interesse der Organisatoren an den Berufstätigen
2018
Ein spanischer Freund/eine spanische Freundin, der/die gerade sein/ihr Studium abgeschlossen hat, trägt sich mit dem Gedanken, in Deutschland Arbeit als Ingenieur/in zu suchen. Im Internet ist er/sie auf nachstehenden Artikel aus der Süddeutschen Zeitung gestoßen, den er/sie nicht im Detail versteht, und bittet Sie daher um Hilfe. In einer E-Mail erläutern Sie auf Basis des Zeitungsartikels die Erfahrungen spanischer Auswanderer in Deutschland und die Gründe ihrer Rückkehr nach Spanien. Darüber hinaus schildern Sie die wirtschaftliche Situation, die die Rückkehrer dem Artikel zufolge in Spanien vorfinden.
Aus Gründen der besseren Übersicht sind die vier zentralen Kriterien, die eine Aufgabenstellung enthalten sollte, nachfolgend tabellarisch dargestellt.
Situation
Adressat
Informationsbedürfnis
Textsorte
Austausch mit Spanien, Teilnahme am Sozialkundeunterricht; Projekt zur aktuellen Situation Kubas; Gestaltung einer Stellwand
span. Mitschüler
Zusammenfassen eines deutschen Textes; besonderes Interesse an Veränderungen hinsichtlich unternehmerischer Handlungsspielräume und am gesellschaftlichen Engagement eines erfolgreichen Frisörs
Ausgangstext:
Zeitungsartikel
Zieltext:
informativer Sachtext
span. Sprachenschule schreibt Wettbewerb aus: ‚El Bachillerato en mi país‘; Teilnehmer sollen Artikel schreiben
span. Sprachenschule
Gestaltung der Abibälle in Deutschland heute; Erklärungsansatz dafür; Rolle der Organisatoren
Ausgangstext: Zeitungsartikel
Zieltext: Artikel für Wettbewerb
Schulprojekt an span. Partnerschule zum Thema ‚Freiwilligenarbeit‘; Wunsch nach Informationen aus der deutschen Presse
span. Freund
neue Art des Reisens und ihre Anbieter; Motive der Teilnehmer, Vorteile, die sich für sie ergeben; Interesse der Organisationen an Berufstätigen
Ausgangstext: Zeitungsartikel
Zieltext:
span. Muttersprachler hat Probleme bei Lektüre eines deutschen Zeitungsartikels
span. Freund
Erfahrungen span. Emigranten in Deutschland, Gründe für ihre Rückkehr nach Spanien; wirtschaftliche Situation, die Rückkehrer vorfinden
Ausgangstext: Zeitungsartikel
Zieltext:
Bereits der Umfang der Aufgabenstellungen im bayerischen Abitur legt das Vorhandensein einer Vielzahl von Informationen zum Rahmen, innerhalb dessen die Sprachmittlung erfolgt, nahe. Tatsächlich enthält jede der vier Aufgaben hinreichende Angaben zur Situation, zum Adressaten, seinem Infor-mationsbedürfnis sowie zur geforderten Textsorte. In allen Fällen ist klar ersichtlich, dass von den Prüflingen die adressaten- und situationsgerechte Übertragung ausgewählter Informationen des deutschen Ausgangstextes erwartet wird. In Bezug auf die zu sprachmittelnden Informationen ist festzuhalten, dass alle Aufgabenstellungen hierzu konkrete Angaben enthalten. Auch die Textsorte, in der die Sprachmittlung zu verfassen ist, wird genannt (2016, 2017, 2018) bzw. lässt sich von den Prüflingen erschließen (2015). Interessant ist die Verwendung der Operatoren in den Aufgabenstellungen. Lediglich in der Prüfung aus dem Jahr 2015 erscheint der Operator ‚zusammenfassen‘, der im Kontext von Sprachmittlungsaufgaben suboptimal ist, da er eine nicht gewollte Nähe zum resumen nahelegt. Auf Grund der angegebenen Präzisierung ist jedoch auch diese Aufgabenstellung als ‚gelungen‘ zu bewerten. Die drei anderen Aufgabenstellungen enthalten die Operatoren ‚verfassen + Textsorte‘, ‚berücksichtigen + Aspekte‘, „berichten von + gelesenem Text‘, ‚eingehen auf + Aspekte‘, ‚erläutern + gelesene Informationen‘ und ‚schildern + Situation‘. Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die bayerischen Aufgabenstellungen in vorbildlicher Weise die Kriterien für gelungene Sprachmittlungsaufgaben umsetzen und dabei in Einklang mit den Bildungsstandards stehen.
Die schriftliche Abiturprüfung in Hessen
In der schriftlichen Abiturprüfung Spanisch müssen hessische Schüler sowohl im Grund- als auch im Leistungskurs aus insgesamt drei Vorschlägen einen zur Bearbeitung auswählen. Zwei der Vorschläge enthalten reine Textaufgaben, beim dritten handelt es sich um die so genannte ‚kombinierten Aufgabe‘, die aus einer im Umfang verkürzten Textaufgabe in Verbindung mit einer Aufgabe zur Sprachmittlung besteht. Anders als in Baden-Württemberg und Bayern ist die Sprachmittlung in Hessen also kein obligatorischer Bestandteil der Abiturprüfung.
2015 GK
Su amigo/a español/a se interesa por el tema de las mujeres en puestos directivos en Alemania. Usted ha encontrado este artículo en la prensa alemana. Resúmalo.
2015 LK
Su amigo/a español/a quiere saber qué información tienen los alemanes sobre la situación en España. Usted ha encontrado este artículo en un periódico alemán. Resúmalo.
2016 GK
Su amigo/a español/a que vive en la costa andaluza quiere saber cómo se habla de la inmigración ilegal hacia España en otros países. Usted ha encontrado este artículo en un periódico alemán. Resúmalo.
2016 LK
Usted está trabajando en España para una revista juvenil. La redacción quiere publicar un artículo sobra cómo se evalúa a los jovenes en la prensa. Usted ha encontrado este [artículo] en un periódico alemán. Resúmalo.
2017 GK
Su amigo/a chileno/a se interesa por el tema de la discriminación en Alemania. Usted ha encontrado este artículo en un periódico alemán. Resúmalo.
2017 LK
Usted está trabajando en España para un periódico local. La redacción quiere publicar una serie de artículos sobre la situación actual de la emigración española. Usted ha encontrado este artículo. Resúmalo.
2018 GK
Usted quiere visitar el Valle de los Caídos con un/a amigo/a latinoamericano/a que no sabe nada sobre este lugar. Resúmale este artículo.
2018 LK
Su amigo/a chileno/a ha encontrado este artículo en un periódico digital alemán. Como en el título se menciona el nombre de una persona conocida en Chile, quiere obtener más información. Resúmale el artículo.
Bereits bei der ersten Durchsicht der Aufgabenstellungen fällt ihr geringer Umfang auf, der in deutlichem Kontrast zu den ausführlichen bayerischen Formulierungen steht. Dies lässt erste Defizite in Bezug auf die genannten Kriterien für gelungene Aufgabenstellungen erahnen. Tatsächlich enthalten einige Prüfungs-aufgaben gar keine Beschreibung der Situation (z.B. die aus dem GK und dem LK 2015), andere weisen maximal einen Satz aus, so etwa die Aufgaben für den LK in den Jahren 2016 und 2017: „Usted está trabajando en España para una revista juvenil / un periódico local.“
Die Angaben zu den Adressaten und deren Informationsbedürfnis erschöpfen sich in sechs der acht Klausuren auf „un/a amigo/a“ und dessen bzw. deren in wenigen Worten zusammengefasstes Interesse für ein bestimmtes Thema, z.B. „el tema de la discriminación en Alemania“ (GK 2017) oder „el nombre de una persona conocida en Chile“ (LK 2018). In zwei anderen Klausuren (LK 2016 und LK 2017) besteht das Zielpublikum in der Leserschaft einer Jugend-zeitschrift bzw. einer lokalen Zeitung, deren Redaktionen die Veröffentlichung von Texten zu einem bestimmten Thema, z.B. „la situación actual de la emi-gración española“ (LK 2017), planen.
Sehr interessant ist schließlich der Operator, der in allen acht Aufgabenstellungen enthalten ist: ‚resumar‘. Formulierungen wie ‚Resúmalo‘ (sechsmal) und ‚Resúmale el/este artículo‘ (zweimal) ohne jegliche Konkretisierung sind ein klarer Beleg für ein Konzept von Sprachmittlung, in dem das Zusammen-stellen der für eine bestimmte Person relevanten Informationen eines Textes keinen Platz hat. Hier wird von den Prüflingen eine pauschale Zusammen-fassung des Ausgangstextes verlangt. Der in den Klausuren verwendete Ope-rator ‚resumar‘ ohne jegliche Einschränkung auf für die Adressaten wichtige Informationen lässt darauf schließen, dass die Sprachmittlungssituation im hessischen Landesabitur lediglich die Funktion eines situativen Rahmens erfüllt, jedoch weder für den Inhalt noch für die Form der Prüfungsleistung von Bedeutung ist (vgl. Punkt 3.2.4.1 in der Aufgabentypologie von Caspari 2013). Zudem ist z.T. unklar, in welcher Textsorte der Zieltext zu verfassen ist. Soll bei den Aufgaben aus dem Jahr 2015 der Zeitungsartikel im Rahmen einer E-Mail zusammengefasst werden? Oder sollen sich die Lernenden am klassischen resumen orientieren? Mit einem Einleitungssatz, der den Titel des Zeitungsartikels, den Namen der Zeitung, in der er erschienen ist, und das Erscheinungsdatum enthält? Diese offenen Fragen und die oben aufgezeigten Charakteristika der hessischen Aufgaben belegen zweifelsfrei, dass letztere keines der zuvor diskutierten Kriterien für gelungene Sprachmittlungsaufgaben erfüllen und auch nicht den Ausführungen der Bildungsstandards entsprechen.
4. Schlussbemerkungen
Die Analyse der Abituraufgaben zur schriftlichen Sprachmittlung in drei Bundesländern hat gezeigt, dass ihnen völlig unterschiedliche Konzepte von Sprachmittlung zu Grunde liegen. Ist diese konzeptuelle Vielfalt im Bereich der Übungsaufgaben insbesondere in den ersten Lernjahren noch zu einem gewissen Grad nachvollziehbar, so ist sie in Abiturprüfungen schlicht inakzeptabel. Mit Blick auf die Vergleichbarkeit der Allgemeinen Hochschulreife in den deutschen Bundesländern lässt sich festhalten, dass diese im Bereich der Sprachmittlung im Fach Spanisch nicht gewährleistet ist. Ohne eine Wertung bezüglich des Grads des Anspruchs vornehmen zu wollen, kann festgehalten werden, dass das Verfassen eines spanischen resumen auf der Basis eines deutschen Ausgangstextes andere Anforderungen an die Abiturienten stellt als eine ‚echte‘ Sprachmittlung, bei der die Schüler aus der Beschreibung der Situation, in der etwas gemittelt werden soll, sowie des Adressaten, für den gemittelt wird, erkennen müssen, welche Informationen des Ausgangtextes sie berücksichtigen müssen, welche entfallen können oder einer Kürzung bedürfen, welche Erläuterungen eventuell zusätzlich erforderlich sind und in welchem Sprachduktus ihr Zieltext zu verfassen ist. Vor diesem Hintergrund scheint die Entwicklung und Umsetzung weiterer Strategien für die Implementierung der Bildungsstandards dringend geboten. Der Aufbau von Abituraufgabenpools für alle Fächer wäre sicher ein Schritt in die richtige Richtung.
Bibliographie
CASPARI, Daniela. 2013. „Sprachmittlung als kommunikative Situation. Eine Aufgabentypo-logie als Anstoß zur Weiterentwicklung eines Sprachmittlungsmodells“, in: Reimann, Daniel & Rössler, Andrea. edd. Sprachmittlung im Fremdsprachenunterricht. Tübingen: Narr, 27-43.
CASPARI, Daniela & SCHINSCHKE, Andrea. 2012. „Sprachmittlung: Überlegungen zur Förderung einer komplexen Kompetenz“, in: Fremdsprachen Lehren und Lernen 41, H. 1, 40-53.
CASPARI, Daniela & SCHINSCHKE, Andrea. 2017. „Sprachmittlung“, in: Tesch, Bernd & von Hammerstein, Xenia & Stanat, Petra & Rossa, Henning. edd. Bildungsstandards aktuell: Englisch/Französisch in der Sekundarstufe II. Braunschweig: Bildungshaus Schulbuchverlage (Westermann, Schroedel, Diesterweg, Schöningh, Winklers), 179-200.
FÄCKE, Christiane & TESCH, Bernd. 2017. Die standardisierte Abschlussprüfung Französisch. Prüfungsaufgaben in Theorie und Praxis. Seelze: Kallmeyer in Verbindung mit Klett.
EUROPARAT. 2001. Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: Lernen, lehren, beurteilen. Berlin et al.: Langenscheidt.
GEBAUER, Stephanie & KIEWEG, Werner. 2008. „‚Frag ihn bitte mal für mich ob, …‘. Sprachmittlungsaufgaben erstellen und bewerten“, in: Der fremdsprachliche Unterricht Englisch 42, H. 93, 20-27.
HALLET, Wolfgang. 2008. „Zwischen Sprachen und Kulturen vermitteln. Interlinguale Kommunikation als Aufgabe“, in: Der fremdsprachliche Unterricht Englisch 42, H. 93, 2-7.
KOLB, Elisabeth. 2016. Sprachmittlung. Studien zur Modellierung einer komplexen Kompetenz. Münster & New York: Waxmann.
KULTUSMINISTERKONFERENZ. 2012. Bildungsstandards für die fortgeführte Fremdsprache (Englisch/Französisch) für die Allgemeine Hochschulreife. http://www.kmk.org/fileadmin/ veroeffentlichungen_beschluesse/2012/2012_10_18-Bildungsstandards-Fortgef-FS-Abi. pdf, Zugriff: 15.4.2019.
LEITZKE-UNGERER, Eva. 2008. „Informelles Dolmetschen zwischen zwei Fremdsprachen – Vorschläge für Mehrsprachigkeit im Unterricht“, in: Frings, Michael & Vetter, Eva. edd, Mehrsprachigkeit als Schlüsselkompetenz: Theorie und Praxis in Lehr- und Lernkontexten. Stuttgart: ibidem, 239-255
PFEIFFER, Alexander. 2013. „Was ist eine sinnvolle Sprachmittlungsaufgabe? Ein Instrument zur Evaluation und Erstellung von Aufgaben für den Fremdsprachenunterricht“, in: Reimann, Daniel & Rössler, Andrea. edd. Sprachmittlung im Fremdsprachenunterricht. Tübingen: Narr,
PHILIPP, Elke & RAUCH, Kerstin. 2014. „Sprachmittlung – neue Herausforderungen für die Sekundarstufe II“, in: Französisch heute 45, H. 1, 12-18.
SCHILLING, Sigrid. 2015. „Sprachmittlung in modernen Lehrwerken“, in: Grünewald, Andreas & Roviró, Bárbara & Bermejo Muñoz, Sandra. edd. Spanischunterricht weiterentwickeln, Perspektiven eröffnen. E/LE hacia el futuro – Desarrollando perspectivas. Trier: Wissenschaftlicher Verlag, 71-84.
SCHÖPP, Frank. 2015. „Abituraufgaben zur schriftlichen Sprachmittlung im Prüfungsfach Italienisch“, in: Nied Curcio, Martina & Katelhön, Peggy & Bašić, Ivana. edd. Sprachmittlung – Mediation – Mediazione linguistica. Berlin: Frank & Timme, 99-115.
SCHRADER, Heide. 2013. „Schriftliche Sprachmittlung im Abitur Französisch. Eine Aufgabe mit Anspruch“, in: Reimann, Daniel & Rössler, Andrea. edd. Sprachmittlung im Fremdsprachenunterricht. Tübingen: Narr, 184-193.
SIEPMANN, Dirk. 2013. „Sprachmitteln (Mediation) im Fremdsprachenunterricht: eine kritische Bestandsaufnahme aus übersetzungswissenschaftlicher Sicht und Vorschläge für eine verbesserte Praxis“, in: Bürgel, Christoph & Siepmann, Dirk. edd. Sprachwissenschaft – Fremdsprachendidaktik: Neue Impulse. Baltmannsweiler: Schneider, 189-208.
STATISTISCHES BUNDESAMT. 2003. Allgemeinbildende Schulen. Schuljahr 2002/03. Wiesbaden. https://www.destatis.de/GPStatistik/receive/DESerie_serie_00000110, Zugriff: 15.04.2019.
STATISTISCHES BUNDESAMT. 2018. Allgemeinbildende Schulen. Schuljahr 2017/18. Wiesbaden. https://www.destatis.de/GPStatistik/receive/DESerie_serie_00000110, Zugriff: 15.04.2019.
TROVATO, Giuseppe. 2016. Mediación lingüística y enseñanza de español/LE. Madrid: Arco/Libros.
1 Jeweils die weibliche und die männliche Form beider Geschlechter zu nennen, kann die Lesbarkeit eines Textes erheblich stören. Zudem wird heute von einer Vielzahl geschlechtlicher Identitäten ausgegangen, so dass dieses bipolare System ohnehin nicht länger haltbar ist. Inwieweit das Gender-Sternchen eine sinnvolle sprachliche Repräs-entationsform jenseits des binären Systems darstellt, ist sicher Geschmackssache. Da ich Formulierungen wie „Informationen über den Adressaten/die Adressatin“ oder „Infor-mationen zum/zur Gesprächspartner*in“ im vorliegenden Text vermeiden möchte, ver-wende ich ganz altmodisch die männliche Form und meine damit stets alle Personen. Zur stilistischen Variation wird dort, wo es sich anbietet, auf genderneutrale Personen-bezeichnungen wie „die Lehrenden“ zurückgegriffen.
2 Wie der Beitrag von Trovato (2016) zeigt, unterscheidet sich der fachdidaktische Diskurs in anderen Ländern von dem im deutschsprachigen Raum. Trotz terminologischer Identität (vgl. den Titel: „La mediación lingüística como competencia integradora en la didáctica de E/LE: una aproximación a las tareas de mediación oral y escrita“) stehen divergierende Konzepte hinter dem Begriff der mediación.
3 Informationen sind in der Tat nie an sich wichtig, sondern immer nur im Hinblick auf eine bestimmte Situation und einen bestimmten Adressaten. Wie Gebauer & Kieweg (2008, 21) betonen, sollte bei der Auswahl der im schulischen Rahmen zu Übungs- oder Prüfungs-zwecken zu mittelnden Texte stets darauf geachtet werden, dass diese immer „auch Infor-mationen enthalten, die für die Aufgabenstellung irrelevant sind“.
4 Legt man den für die Arbeit im Fremdsprachenunterricht allgemein akzeptierten erweiterten Textbegriff auch für Sprachmittlungsaufgaben zu Grunde, schließen die in den Bildungsstandards genannten „Inhalte authentischer mündlicher oder schriftlicher Texte“ auch Bilder oder Bild-Text-Kombinationen als Vorlagen mit ein.
5 Die Autorinnen meinen damit, dass die zur Situation passenden Textsorten im Unterricht eingeübt worden sein müssen und dass sie den Lernenden in ihren zentralen Merkmalen bekannt sein sollen (Caspari & Schinschke 2017, 196).
6 Dieser letzte Aspekt stellt allerdings in gewissem Maße einen Widerspruch zu den Bildungsstandards dar, in denen, wie gesehen, auch das Mitteln der wesentlichen Inhalte „zu weniger vertrauten Themen“ vorgesehen ist.
7 Für die Bewertung von Sprachmittlungsaufgaben, auf die hier leider nicht näher ein-gegangen werden kann, bedeutet dies selbstverständlich, dass es keine objektiv richtigen Lösungen gibt. Die Auswahl der zu mittelnden Inhalte hängt von jedem einzelnen Prüfling und seiner individuellen Beurteilung der Situation und des Informationsbedürfnisses des Adressaten ab. Aus diesem Grund werden in der Regel in Prüfungen andere als im Erwar-tungshorizont aufgeführte Lösungen als gleichwertig gewürdigt, wenn sie der Aufgaben-stellung entsprechen, inhaltlich korrekt und nachvollziehbar sind. Vgl. Caspari & Schinschke (2017, 198f.): „Vieles ist Einschätzungssache, insbesondere die Frage, welche Inhalte für den Gesprächspartner im Einzelnen relevant sind bzw. sein könnten, oder welche zusätzlichen Erläuterungen er möglicherweise für das Verständnis benötigt. Umso wichtiger ist es daher, […], in der Aufgabenstellung möglichst präzise Informationen über die Situation den Empfänger, die Textsorte und den Zweck der Sprachmittlung zu geben, deren Berücksichtigung dann auch zur Bewertung herangezogen werden können.“
8 Fäcke & Tesch (2017, 116) sprechen in ihren Ausführungen zur standardbasierten Abiturprüfung Französisch in Bezug auf die Entscheidung für die schriftliche Sprachmittlung von einem Dilemma, „das darin besteht, dass die schriftliche Sprachmittlung noch dazu vom Deutschen ins Französische in der Realität wesentlich seltener vorkommt als die münd-liche Sprachmittlung“.
9 Erstmalig im Jahr 2020 ist in Hessen die Sprachmittlung verpflichtender Bestandteil der schriftlichen Abiturprüfung in den Grund- und Leistungskursen der modernen Fremdsprachen.
10 Als erste Fremdsprache kann Spanisch etwa an der Elisabethenschule in Frankfurt am Main oder der Heinrich-Schütz-Schule in Kassel gelernt werden.
11 Im Schuljahr 2017/18 besuchten in Baden-Württemberg 1.118.045 Schüler eine allgemein-bildende Schule, in Bayern waren es 1.258.074 und in Hessen 631.945 (Statistisches Bundesamt 2018, 28ff).
12 Die Aufgabenstellung für die Übersetzung ist auf Spanisch formuliert und lautet erwar-tungsgemäß ‚Traduzca el texto siguiente‘.
13 Dieser Abschnitt ist in allen bayerischen Aufgabenstellungen enthalten, aus Platzgründen wird er hier jedoch nur einmal aufgeführt.
Authentizität auf dem Prüfstand – Fremdsprachenunterricht in einer sich verändernden Welt
Michael Schneider (Halle)
1. Hinführung
In diesem Aufsatz soll der Begriff ‚Authentizität‘ in mehrfacher Hinsicht auf den Prüfstand gestellt werden: einerseits systematisch-strukturell bezogen auf den Begriff selbst und die Auseinandersetzungen mit dem Konzept, andererseits inhaltlich bezogen auf den konkreten Fremdsprachenunterricht. Es wird also gefragt, was unter Authentizität verstanden werden kann und inwiefern bestimmte Forderungen an den Fremdsprachenunterricht im Zusammenhang mit Authentizität tatsächlich ‚authentisch‘ sind.
‚Authentizität‘ ist ein Konzept mit vielen Ausprägungen und Dimensionen. Auch die Eingrenzung auf Fremdsprachenerwerb und Fremdsprachendidaktik zieht keine Einheitlichkeit der Bedeutung der Begrifflichkeit ‚Authentizität/ authentisch‘ nach sich. In der einschlägigen Literatur wird immer wieder versucht, die Verwendung des Begriffs zu kategorisieren. Gilmore (2007) beispielsweise, als einer der neueren Autoren, auf den sich recht viele Nachfolger beziehen (Will 2018, 115), teilt in acht Kategorien ein. Allerdings muss man sich fragen, was er eigentlich kategorisiert. Er selbst redet von „inter-related meanings“ (Gilmore 2007, 98), De Florio-Hansen (2010) nennt dasselbe „Aspekte“ (De Florio-Hansen 2010, 264) und Will (2018) führt die Aufzählung Gilmores unter der Bezeichnung „categorization of concepts“ und schreibt in dem Zusammenhang von „conceptual authenticity“ (Will 2018, 11). Joy (2011) nimmt eine eigene Kategorisierung vor und bezeichnet sie als „different types of authenticity“, zu denen er „text authenticity“, „task authenticity“, „learner authenticity“ und „classroom authenticity“ zählt (Joy 2011, 10ff.). Will (2018) führt Gilmore fort und erarbeitet „a new conceptual taxonomy for authenticity in EFL“ (Will 2018, 58), die er als stärker konzeptgeleitet als Gilmores ansieht.
Alle scheinen von verschiedenen Bedeutungen bzw. Typenvon Authentizität zu schreiben, aber, so kann man sich fragen, ist z.B. „the language produced by native speakers for native speakers in a particular language community“ (Gilmore 2007, 98) ein meaning, eine Bedeutung von Authentizität? Sind Text- oder Aufgabenauthentizität (Joy 2011) wirklich Authentizitätstypen? Gilmore selbst leitet seine Aufzählung ein mit: „Authenticity relates to“, worauf die Einteilung folgt. Er stellt also eigentlich einen Bezug zwischen Authentizität und etwas anderem her. Hier soll nun angesetzt werden, um diese Problematik genauer zu fassen. Dafür sind einige grundlegende Überlegungen vonnöten.
2. Systematische Betrachtungen zum Begriff ‚Authentizität‘ und seiner Verwendung
‚Authentizität‘ steht nicht für sich allein, sondern bezieht sich immer auf etwas, ist eine Art Attribut für etwas, für eine Sache, einen Sachverhalt oder eine Person. Je nach Begriff, mit dem es verbunden wird, – aber auch je nach Kontext – nimmt die Begrifflichkeit ‚Authentizität/authentisch‘ unterschiedliche Bedeutungen an. Insofern ist es problematisch, ‚Authentizität‘ an sich definieren zu wollen. Dies soll anhand mehrerer Beispiele verdeutlicht werden:
Authentisch ist ein Text, wenn er für ein Zielpublikum in der entsprechenden Sprache geschrieben wird (Kriterium: Natürlichkeit/ natürliche Verwendung).
Authentisch ist ein Text, der nicht als Fiktion geschrieben wurde (Kriterium: inhaltliche Realität).
Authentisch ist eine Situation, die stattgefunden hat (Kriterium: Existenz/Realität).
Authentisch ist eine Situation, in der sich die Menschen so verhalten, wie sie es normalerweise tun. (Kriterium: Wahrscheinlichkeit/ Glaubhaftigkeit).
Authentisch ist eine Person, wenn sie in Wirklichkeit lebt oder gelebt hat und nicht (im Rahmen einer Geschichte) erfunden wurde (Kriterium: Existenz).
Authentisch ist eine Person, die ihrer Meinung treu bleibt und entsprechend handelt (Kriterium: Konsistenz).
Die Aussagen ließen sich auch mit dem Substantiv ausdrücken, so z.B.: Die Authentizität einer Person besteht darin, dass sie ihrer Meinung treu bleibt und entsprechend handelt.
Wie man anhand der wenigen Beispiele erkennen kann, ist die Bedeutungsspanne des Begriffs ‚Authentizität/authentisch‘ sehr breit, kann sich der Begriff auf verschiedene Entitäten beziehen und geht mit diesen Entitäten eine Verbindung ein, die nicht zu einem eindeutigen Denotat führen muss: Eine authentische Person kann je nach Kontext eine real existierende oder eine in sich widerspruchsfreie Person sein.
In dem jetzt abgesteckten Feld zeichnet sich das Problem ab, das sich in der Forschungsliteratur abbildet. Die Typologien oder Taxonomien der verschiedenen Autoren setzen an den jeweiligen Verbindungen zwischen Authentizität und dem Bezugsfeld an und sind eigentlich keine Typologien von Authentizität selbst. Eine Typologie von Authentizität müsste sich mit dem Kriterium beschäftigen, warum etwas als authentisch angesehen wird. Mit den vorgenannten Beispielen ließe sich folgende Typologie von Authentizität erstellen:
Authentizität kann beruhen auf: 1. Natürlichkeit, 2. inhaltlicher Realität, 3. lebensweltlicher Existenz, 4. Glaubwürdigkeit, 5. innerer Stimmigkeit.
Obwohl die auf deutschen Beispielen basierende Liste vollkommen willkürlich entstanden ist und keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit haben kann, besteht sie bereits aus fünf Kategorien und ließe sich vermutlich um einige weitere sinnvolle Kategorien ergänzen. Hieran erkennt man die alltagssprachlichen Konnotationen, die auch in einen wissenschaftlichen Diskurs hineingetragen werden. Es ist somit einleuchtend, warum der Begriff in seiner Anwendung auf den Bereich der Fremdsprachendidaktik so viele Probleme der präzisen Verwendung aufwirft.
Die Beispiele zeigen also Folgendes: 1. Es ist eine Präzisierung notwendig, worauf sich Authentizität beziehen soll. ‚Authentizität‘ an sich hat zu wenig Konturen, als dass man daraus sinnvolle Schlussfolgerungen ziehen könnte. Auch eine Formulierung wie „Authentizität im Fremdsprachenunterricht“ ist in jedem Falle zu allgemein, um damit direkt zu arbeiten. 2. Es ist sehr wohl sinnvoll, die spezifischen Bereiche abzustecken, die im Diskurs der Fremdsprachendidaktik als authentisch gelten können und deren Einsatz für die Verbesserung der Lernergebnisse erfolgversprechend erscheinen, wie dies beginnend in den 1970er Jahren z.B. mit Texten von Widdowson (1978) über Edelhoff (1985), Gilmore (2007) und viele andere bis hin zu Will (2018) gemacht wurde. Allerdings sollte man sich dessen bewusst sein, dass es sich nicht um Typologien von Authentizität handelt. Die Antworten, die gegeben wurden, beziehen sich meist auf die Frage: Wer oder was kann authentisch sein und inwiefern? Und sie geben mehrheitlich keine Antwort auf die Fragen: Was ist Authentizität? oder Welche Typen von Authentizität gibt es?
Die Kategorisierung der Anwendungsbereiche von Authentizität wie sie vorgenommen wurde, ist dennoch gewinnbringend, da nur durch eine prinzipielle Übereinstimmung hinsichtlich der Kategorien und Verwendungsweisen begriffliche Unschärfen und daraus folgende Missverständnisse vermieden werden können.
Buendgens-Kosten (2013) ist eine derjenigen, die auch begrifflich und nicht nur inhaltlich, Bereiche von Authentizität definieren (vgl. schon im Titel „three domains of ‚realness‘“) und das Attribut des Authentischen genauer zu fassen suchen. Sie beschreibt den Gegensatz von Authentizität als ein dem Objekt inhärentes Merkmal einerseits und ein dem Objekt zugeschriebenes Merkmal, das aus sozialen Aushandlungsprozessen resultiert, andererseits.
When we say that an object, text, person, or activity is authentic, we can mean two different things. On the one hand, it can be interpreted as a description of the object, text, person, or activity itself. In that sense, an object can be authentic as it can be red, or made of wood, or weigh a pound. On the other hand, we can view authenticity not as a feature of an object, text, person, or activity but as the end result of a social negotiation process. In that sense, an object is authentic in a similar way as it would be beautiful or valuable. (Buendgens-Kosten 2013, 273)
Ihre Darstellung geht davon aus, dass die beiden Verwendungsweisen in der Literatur vorkommen und nicht scharf voneinander getrennt werden. Sie selbst bezeichnet die zweite Verwendung als zutreffender. Dies ist einleuchtend, wenn man sich ein Beispiel vor Augen führt: Im Zusammenhang mit Fremdsprachendidaktik ist oft von der Authentizität von Texten die Rede. Die Belegung von Texten mit dem Merkmal ‚authentisch‘ ist aber lange nicht so voraussetzungslos wie die Zuordnung des Merkmals ‚hölzern‘ für einen Gegenstand. Aufgrund der (oben dargestellten) Bedeutungsvielfalt des Begriffs ‚authentisch‘ ist eine Einigung darauf vonnöten, was darunter verstanden werden soll1, ein Schritt, der bei dem Begriff ‚hölzern‘ nicht nötig ist, da vermutlich jeder darunter dasselbe versteht. Dies zeigt nochmals, dass allgemeine Aussagen zu Authentizität nur begrenzt tragen und unterstreicht die Notwendigkeit, sich auf abgegrenzte Bereiche zu konzentrieren.
3. Konzeptuelle Überlegungen zur Authentizität im Hinblick auf Fremdsprachendidaktik
Der nun folgende kurze Blick auf die Forschungsarbeit zu ‚Authentizität‘ bleibt kursorisch und beleuchtet das Thema punktuell und ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Für eine intensivere Auseinandersetzung sei auf Wills Studie verwiesen, die die Forschungschronologie sehr ausführlich analysiert (Will 2018, v.a. 147-223). Hier soll es nach dem allgemein fremdsprachendidaktischen Überblick um spezifische Konzepte gehen, die im Zusammenhang mit dem Lehren von romanischen Sprachen diskutiert wurden.
Zunächst wurde Authentizität im Zusammenhang mit der Fremdsprachendidaktik seit den 1970er Jahren häufig auf Texte bzw. Materialien bezogen (Will 2018, 14; Leitzke-Ungerer 2010, 11). Schon Mitte der 1980er Jahre brachte Breen auch andere Bereiche des Fremdsprachenlernens in Zusammenhang mit Authentizität (Lerner, Aufgabe, aktuelle soziale Situation im Klassenraum, Breen 1985, 61). Edelhoff (1985), der sich v.a. auf authentische Texte beruft, schließt seinerseits aber auch die „Authentizität der Situation“ mit ein, die er in erster Linie als solche Situation begreift, in der der Lerner als er selbst sprechen kann. Er unterscheidet von der authentischen die simulierte Situation, in der der Lernende aber ebenfalls authentisch handeln soll (Edelhoff 1985, 27f.).
Gilmore als vielfach rezipierter Autor sieht die Authentizität verortet „in either the text itself, in the participants, in the social or cultural situation and purposes of the communicative act, or some combination of these“ Gilmore (2007, 98). Leitzke-Ungerer greift diese Auffassung auf und schreibt:
Authentizität ist demnach eine Qualität, die diverse Aspekte einer Kommunikationssituation betrifft: die Situation als ganzes, unter besonderer Berücksichtigung ihrer sozialen oder kulturellen Aspekte und der von den Teilnehmern intendierten Absichten und Ziele, die beteiligten Personen, die miteinander kommunizieren, mit anderen Worten: die Sprecher und ihre Adressaten, und schließlich die Texte, also die sprachlichen Äußerungen selbst, die in der Situation ausgetauscht, d.h. produziert und rezipiert, werden und die, vereinfacht ausgedrückt, eine sprachliche und eine inhaltliche Seite haben, die es im Unterricht zu berücksichtigen gilt. Leitzke-Ungerer (2010, 12)
Damit sind die wesentlichen Bereiche benannt, die im Zusammenhang der Fremdsprachendidaktik als authentisch bezeichnet werden können. Etwas anders ausgedrückt könnte man formulieren: Das Attribut ‚Authentizität‘ lässt sich v.a. auf Texte (im Sinne eines weiten Textbegriffs), auf Sprache (gemeint sind Sprachstrukturen und Sprachverwendung), auf Situationen bzw. Interaktionen, auf (kulturelle) Inhalte und auf Menschen beziehen, die an der Interaktion beteiligt sind.
Die folgenden Ausführungen, die den Sammelband Authentizität im Unterricht romanischer Sprachen (Frings & Leitzke-Ungerer 2010) in den Blick nehmen, sollen nun einige spezifische Begrifflichkeiten und Konzepte wie ‚simulierte Authentizität‘ und ‚Authentizität der Lernsituation‘ beleuchten und gleichermaßen die Probleme zeigen, die sich durch konzeptuelle Unstimmigkeiten zwischen verschiedenen Autoren ergeben.
Leitzke-Ungerer stellt in ihrer Einführung die oben genannten Bereiche in einen zweifachen Bezugsrahmen: die Zielkultur und den Lernkontext. Diese Fokussierung auf die Dualität von zielkultureller und lernkontextbezogener Authentizität lässt die ‚Situation‘ dann zwar mitschwingen, nimmt sie jedoch in gewisser Weise aus dem Fokus, bzw. verstärkt sie im Bereich lernkontextbezogener Authentizität.
Zur Beschreibung zielkultureller Authentizität bedient sich Leitzke-Ungerer v.a. des Textbegriffs. In der Weiterführung und mit Blick auf didaktische Texte fasst sie zielkulturelle Authentizität als „einen hohen Grad an Übereinstimmung mit zielsprachlichen Normen“ (Leitzke-Ungerer 2010, 14) auf. Eine solche Form der Authentizität erscheint also nicht als absolut, sondern graduell auch in didaktischen Texten realisiert. Leitzke-Ungerer spricht dabei von „konstruierte[r] [...] zielkulturelle[r] Authentizität“ (ebd.).
Die lernkontextbezogene Authentizität orientiert sich bei dieser Herangehensweise v.a. an der Lernsituation, in der situativ im Klassenraum entstandene Notwendigkeit zur Kommunikation genutzt wird, um die Als-Ob-Situation des Kommunikationsbedarfs im Fremdsprachenunterricht zuweilen mit echtem Kommunikationsbedarf zu überwinden. Authentisch ist hier, so muss man es verstehen, das Bedürfnis zu kommunizieren oder, wie es im herangezogenen Zitat von Edelhoff heißt, die „Möglichkeiten für die Lernenden [..] als sie selbst kommunikativ zu handeln“ (Edelhoff 1985, 27).
Andrea Rössler prüft in ihrem Aufsatz die Authentizität von Lehrwerksdialogen, um schließlich Vorschläge zu authentischer Mündlichkeit zu machen. Dabei schickt sie voraus, dass es sich bei Lehrwerksdialogen gar nicht um authentische Texte im engeren Sinn handeln kann, da letztere im Zielsprachenkontext entstanden sein müssen, um genau in diesem sprachlichen und kulturellen Kontext auch rezipiert zu werden. Dies widerspreche der Intention von Lehrwerksdialogen, so dass der Begriff ‚simulierte Authentizität‘2 angebracht sei, „um im Begriff selbst hervorzuheben, worum es im Kern gehen soll, nämlich eine möglichst effektive Vorbereitung auf authentische Kommunikationssituationen.“ (Rössler 2010, 29f.) Sie greift auch auf das Konzept ‚authentische Sprechanlässe und sprachliche Interaktionen‘ – eine Art authentische Lernsituation also – zurück, das sie folgendermaßen definiert:
Authentische Sprechanlässe für einzelne Französischlerner und authentische sprachliche Interaktionen zwischen mehreren Französischlernern sind solche, die es den Lernern ermöglichen, als sie selbst in der Zielsprache zu sprechen und zu agieren. (Rössler 2010, 29)
Die ‚authentischen Sprechanlässe und authentischen Interaktionen‘ scheinen die bei Leitzke-Ungerer benannte ‚authentische Lernsituation‘ darzustellen und ließen sich in deren zweifachem Bezugsrahmen in die lernkontextbezogene Authentizität einordnen. Da Rössler aber die Bezugsebene ‚Lehrwerksdialoge‘ wählt und bei diesen eine simulierte Authentizität auf drei Ebenen annimmt, nämlich auf Ebene der Kommunikationssituation, der Diskursmuster und des verwendeten Sprachstils, müssen auch die Sprechanlässe und Interaktionen im Rahmen der Lehrwerksdialoge deshalb authentisch sein, weil die Simulation der Authentizität auf den drei Ebenen abläuft und funktioniert. Dies wäre deutlicher, wenn bei Rössler stehen würde, „die es den Lernern [in Zukunft] ermöglichen [...]“. Demnach bezieht die Lernsituation bei Rössler ihre Authentizität nicht aus einem realen Kommunikationsbedürfnis der Lernenden, sondern aus der Vergleichbarkeit der Lernsituation mit einer authentischen Kommunikationssituation.
Anders formuliert könnte man wohl mit Rössler sagen: Authentische Sprechanlässe und authentische sprachliche Interaktionen sind solche, deren Kommunikationssituationen sich in vergleichbarer Form in der Realität finden lassen, in deren Umsetzung realistische Diskursmuster verwendet werden und die in einem Sprachstil stattfinden, der für die Situation angemessen ist, weil er in der Wirklichkeit für entsprechende Situationen Anwendung findet. Im Fokus steht bei Rössler also weniger der Moment der Interaktion während des Fremdsprachenunterrichts, der die Lernsituation authentisch macht, als vielmehr die in die Zukunft gedachte wirklichkeitsgetreue Anwendbarkeit der entsprechenden Situation. Dies drückt sich auch im oben genannten Zitat mit dem Begriff „Vorbereitung“ aus („Vorbereitung auf authentische Kommunikationssituationen“ s.o.).
Die Authentizität der Lernsituation, die bei Rössler und Leitzke-Ungerer gemeint, wenn auch begrifflich bei Rössler nicht so formuliert ist, wird also ganz offensichtlich je nach Autor anders gefasst: einerseits als spontan entstandenes Bedürfnis nach Kommunikation im Unterricht (z.B. „Kannst du mal das Licht anmachen? Es ist zu dunkel.“), das zu Übungszwecken direkt nach dem Entstehen in der Fremdsprache gestillt werden soll und andererseits als Relevanz und Anwendbarkeit einer Übungssituation bzw. eines kommunikativen Inhalts für das zukünftige Bewältigen realer sprachlicher Situationen im fremdsprachlichen Kontext. Die letztgenannte Bedeutung ist u.a. auch bei Bechtel & Roviró gemeint, wenn sie in Anlehnung an Ellis von „Situationsauthentizität“ sprechen (Bechtel & Roviró 2010, 210).
Wenn ich mich nun der Anwendung des Konzepts der ‚Authentizität‘ zuwende, möchte ich mich auf diesen eingegrenzten Bereich der von Bechtel & Roviró so benannten „Situationsauthentizität“ beschränken. Es geht mir also um die Relevanz und Anwendbarkeit einer Übungssituation bzw. eines kommunikativen Inhalts für das zukünftige Bewältigen realer sprachlicher Situationen im fremdsprachlichen Kontext. Da der Begriff „Situationsauthentizität“ allerdings mit der „Authentizität der Situation“ von Edelhoff (1985, 27) verwechselt werden könnte, scheint es mir angebracht, die Benennung zu ergänzen: Situationsauthentizität als Kommunikationsrelevanz.
4. Situationsauthentizität als Kommunikationsrelevanz
Wenn es um die Relevanz von Fremdspracheninhalten und authentische Sprachverwendung geht, ist häufig die Rede von Mündlichkeit. Echte Kommunikation finde mündlich statt und Sprachwissen und grammatikillustrierende Sätze mit wenig kommunikativem Gehalt würden die Schüler nicht dazu befähigen, kommunikative Kompetenz zu erwerben.
Aber selbst auf Mündlichkeit gerichtete Unterrichtsinhalte wie Lehrwerksdialoge stellen nicht in jedem Fall authentische Kommunikationsmuster zur Verfügung. So kann z.B. der von Rössler analysierte Dialog aus Découvertes1 (2004, 56) „nur sehr bedingt als Modell [...] dienen“ (Rössler 2010, 33). Dies liegt u.a. daran, dass die meisten Merkmale gesprochener Sprache getilgt werden, der Dialog also mit konzeptioneller Schriftlichkeit arbeitet, und dass das Handlungsmuster ‚Wegauskunft‘ stark verkürzt wird und mehrere wesentliche Schritte fehlen. Die Bedenken Rösslers lassen sich in vollem Maße nachvollziehen.
Da es eine Neuausgabe von Découvertes gibt, kann man überprüfen, ob der Verlag und seine Autoren die Kritik wahrgenommen und als Reaktion ein brauchbareres Handlungsmuster zur Wegbeschreibung bzw. Wegauskunft in das neue Lehrbuch eingebracht haben.
Das Resultat ist frappierend. Der folgende Dialog ist das einzige schriftliche Muster zu diesem Thema:
Marie cherche l’Interclub.
A trois heures et quart, Marie téléphone à Alex.
Marie: Allô? Alex, c’est Marie! Je suis devant le collège. Tu es où?
Alex: Je suis déjà à l’Interclub avec mes copains de judo.
Marie: Mais c’est où, l’Interclub?
Alex: Ce n’est pas loin. Va à droite, puis tourne à gauche après la boulangerie. Va tout droit et au café, tourne à droite. Traverse le carrefour: L’entrée est dans la rue à gauche.
Marie: Ok, j’arrive! A plus! (Découvertes 1 2012, 82)
Wie man sehen kann, gibt es gar kein Muster ‚Wegauskunft‘, sondern nur ein auf eine einzige Wortäußerung reduziertes Muster ‚Wegbeschreibung‘. Diese Wegbeschreibung ist abstrakt, da sie überhaupt keine Straßennamen nennt und auch nicht durch die Skizze eines Stadtplanauszugs unterstützt wird. Sie klärt nicht den genauen Standpunkt und die Richtung, in die Marie zu Anfang schaut. Damit bleibt der Startpunkt im Unklaren und die gesamte Wegbeschreibung wird irreal. Sie ist im Imperativ Singular verfasst, so dass die Person geduzt wird und das Muster sich nicht direkt auf einen Dialog mit einem Unbekannten übertragen lässt. Die Situation kann nicht als authentisch bezeichnet werden, da die Diskursmuster sich ebenfalls nicht an einem Telefongespräch zwischen Jugendlichen orientieren: Erwartbar wären sowohl Straßennamen als auch Orientierungspunkte mit Eigennamen (wie z.B.: le café Les Deux Magots), die Frage nach bekannten Punkten (Tu connais xy?) und deren Verwendung für die weitere Erklärung. Vom Sprachstil Jugendlicher und konzeptueller Mündlichkeit ist keine Spur.
Trotz dieser Mankos soll dieser Dialog auch in dieser Ausgabe von Découvertes als Modell dienen. Allein zwei zusätzliche kurze Hörmuster bereiten die eigene Erstellung von Dialogen zur Wegauskunft noch mit vor. Diese Hörtexte sind keine Dialoge, sondern reine Antworten auf die Frage nach dem Weg.3 Das heißt, es gibt zwar im ‚On-dit-Kasten‘ sprachliches Material, aber kein einziges ausformuliertes Modell für eine Frage nach dem Weg, geschweige denn ein einigermaßen real erscheinendes Gesamtmuster für Wegauskünfte.
Der Blick auf die Neuausgabe ist enttäuschend, da das Muster die Anforderungen an eine authentische Situation in noch geringerem Maße erfüllt als der Vorgänger von 2004.
Mit dem Blick von 2019 und dem dazugehörigen Erfahrungshorizont auf den Dialog von Marie und Alex ergeben sich noch mehr Probleme hinsichtlich der simulierten Authentizität dieses Dialogs. Es lässt sich eine Frage stellen, die Rössler im Jahr 2010 an den von ihr analysierten Dialog noch nicht stellen konnte, nämlich die nach der Relevanz des Musters überhaupt.
Würden Marie und Alex 2019 so kommunizieren? Ausgangspunkt der Situation sind zwei Jugendliche mit jeweils einem Mobiltelefon. Dabei ist heute nur vorstellbar, dass es sich jeweils um ein Smartphone handelt, da sogenannte Tastenhandys für Jugendliche den Nostalgiewert eines Grammophons haben. Von Jugendlichen werden die Smartphones eher selten zum Telefonieren genutzt. Verbreiteter ist die Kommunikation über schriftliche Nachrichten. Wenn Marie tatsächlich ein bestimmtes Ziel nicht kennt, wäre es deutlich wahrscheinlicher, dass Alex ihr eine Nachricht mit der Zieladresse oder den Zielkoordinaten schickt. Marie könnte sich nun vom ‚Navi‘ (GPS) leiten lassen. Alex lässt also von ihrem Smartphone den Standpunkt bestimmen und schickt z.B. eine Nachricht in folgender Form: 48° 51' 30.132" N 2° 17' 40.132" E. Damit aber hat sich der Kommunikationsbedarf erübrigt.
Wenn sich dies auch für den Nahbereich im eigenen Heimatort und zwischen Freunden noch anzweifeln ließe, erscheint es doch mehr als wahrscheinlich in Hinblick auf die Orientierung in einer fremden Stadt. Gibt es heute noch Jugendliche, die zur Orientierung an einem unbekannten Ort nach dem Weg fragen? Dies ist schon in der eigenen Sprache äußerst unwahrscheinlich. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass sich in der Praxis des Fremdsprachenunterrichts die Situation ergibt, dass das Problem für manche Jugendliche nicht mit der Übertragung des Musters in die Fremdsprache beginnt und an sprachlichen Hürden scheitert, sondern mit einer Wegbeschreibung auf Deutsch im eigenen Heimatort, die zur Vorbereitung der fremdsprachlichen Erarbeitung dienen soll. Es fehlt die Übung für diese Art des Denkens.
Versetzt man sich im Sinne dieser Überlegungen in die Rolle der Lernenden, muss einem ein Muster wie das der Wegauskunft vollkommen unnütz erscheinen und es stellt sich die Frage nach dem Sinn einer solchen sprachlichen Übung. Wozu soll ein Jugendlicher Sprachmaterial in der Fremdsprache erarbeiten und üben, für das er weder in der eigenen noch in der zu lernenden Sprache eine Anwendungsmöglichkeit erkennt?
Angesichts der digitalen Möglichkeiten und der damit verbundenen Überformung des Alltags wird die Einübung des Handlungsmusters ‚Wegauskunft‘ – Inbegriff von kommunikativer Orientierung zu Zeiten der kommunikativen Wende – zu einer (in den Augen unserer anwendungs- und kompetenzorientierten Gesellschaft) ‚nutzlosen‘ Rezitation eines Rabelais-Textes.
Auch De Florio-Hansen (2010) nimmt die Kommunikationssituation ‚Wegbeschreibung‘ als Beispiel, um den unzureichenden Auf- und Ausbau von Diskurskompetenz in Lehrwerken zu kritisieren. Sie bezeichnet solche Situationen als ‚Domains‘. Unter Berücksichtigung der oben genannten Faktoren ist ihre ähnlich wie bei Rössler gelagerte Kritik allerdings im Begriff, von dem Lauf der Zeit überholt zu werden.





























