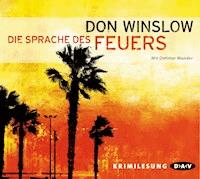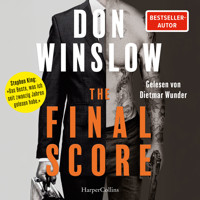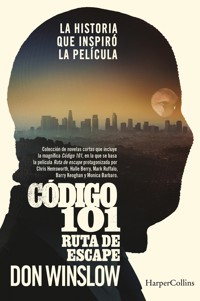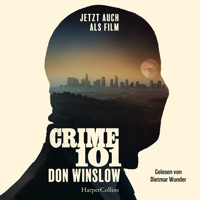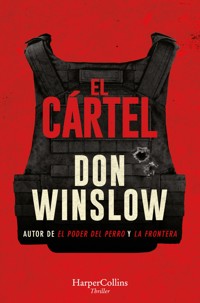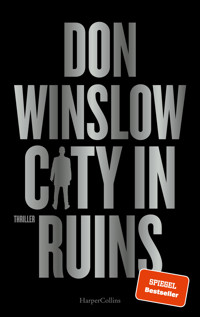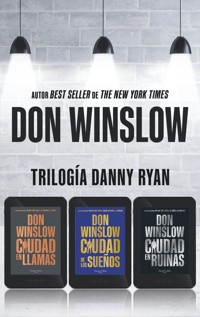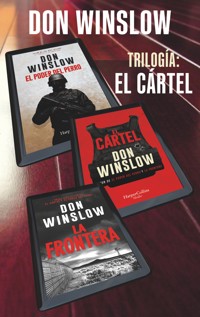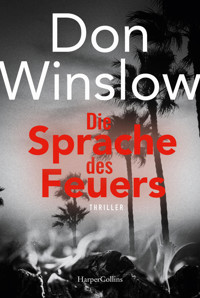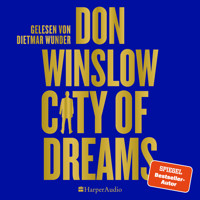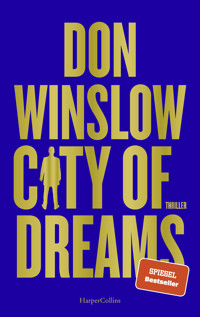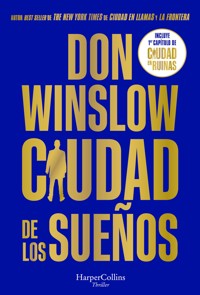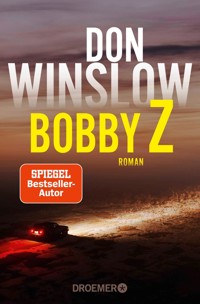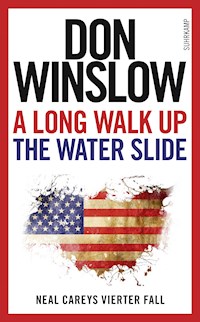
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Krimi
- Serie: Neal-Carey-Serie
- Sprache: Deutsch
Neal Carey hat die Frau fürs Leben gefunden und ein Zuhause und könnte jetzt endlich seine Doktorarbeit beenden, wären da nicht Joe Graham und die »Bank«, die wieder einmal eine Gegenleistung dafür erwarten, dass sie Neals Leben finanzieren. Der neue Auftrag scheint immerhin mehr als einfach zu sein: Neal soll aus der großmäuligen Tussi Polly Paget eine seriöse Lady machen, bevor sie gegen einen landesweit bekannten Fernsehmoderator aussagt. Aber natürlich wird es alles andere als einfach, denn nicht nur Neal wünscht sich nach wenigen Tagen Pollys Tod – allerdings meinen die anderen es wirklich ernst. Die anderen, das sind übrigens ein ehemaliger FBI-Agent, ein verhaltensgestörter Killer und die Mafia – um nur ein paar zu nennen …
Alle Titel der Neal-Carey-Serie:
London Undercover (Neal Carey 1)
China Girl (Neal Carey 2)
Way Down on the High Lonely (Neal Carey 3 – angekündigt unter dem Titel Holy Nevada)
A Long Walk Up the Water Slide (Neal Carey 4 – angekündigt unter dem Titel Lady Las Vegas)
Palm Desert (Neal Carey 5)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 345
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Neal Carey hat die Frau fürs Leben gefunden und ein Zuhause und könnte jetzt endlich seine Doktorarbeit beenden, müsste er nicht für die »Bank« wieder einmal eine Gegenleistung dafür erbringen, dass sie sein Leben finanziert. Der neue Auftrag scheint immerhin mehr als einfach zu sein: Neal soll aus der großmäuligen Tussi Polly Paget eine seriöse Lady machen, bevor sie gegen einen landesweit bekannten Fernsehmoderator aussagt. Während Polly Neal auf die Palme treibt, versuchen ein ehemaliger FBI-Agent, ein verhaltensgestörter Killer und die Mafia, Polly unter die Erde zu bringen.
Don Winslow wurde 1953 in New York geboren. Bevor er mit dem Schreiben begann, verdiente er sein Geld unter anderem als Kinobetreiber, Fremdenführer auf afrikanischen Safaris und chinesischen Teerouten, Unternehmensberater und immer wieder als Privatdetektiv. Er wurde vielfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Deutschen Krimi Preis 2011 für Tage der Toten. Don Winslow lebt mit seiner Frau in Kalifornien.
Conny Lösch lebt als Übersetzerin in Berlin. Sie hat u.a. Bücher von William McIlvanney, Elmore Leonard und Ian Rankin ins Deutsche übertragen.
Zuletzt sind von Don Winslow im Suhrkamp Verlag erschienen: London Undercover (st 4580), China Girl (st 4581) und Way Down on the High Lonely (st 4582).
DON WINSLOW
A LONG WALKUP THE WATER SLIDE
Neal Careys vierter Fall
Aus demamerikanischen Englischvon Conny Lösch
Suhrkamp
Die Originalausgabe erschien 1994 unter dem Titel
A Long Walk up the Water Slide
bei St. Martin’s Press, New York
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2016
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuchs 4583
© Suhrkamp Verlag Berlin 2016
© 1994, Don Winslow
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Umschlagmotiv: FinePic®, München
Umschlaggestaltung: Werbeagentur ZERO, München,
nach Entwürfen von cornelia niere, münchen
eISBN 978-3-518-74006-4
www.suhrkamp.de
Für Buddy
»Auch heute nimmt jeder an öffentlichen Hinrichtungen teil, durch die Zeitung.«
Elias Canetti, Masse und Macht
»Motive? Es gibt nur drei Motive:Gier, Lust und Gier.«
Anonym
Prolog
Hätte er bloß den Kaffee nicht gerochen.
Neal lag noch im Bett, als ihm der köstliche Duft in die Nase kroch.
Er verharrte in dem angenehmen Zustand zwischen Schlafen und Wachen, genoss den Samstagmorgen und war froh, dass er nicht aufstehen musste. Der Kaffee roch allerdings wirklich verdammt gut. Das war keine Instant-Plörre, die Karen noch schnell auf dem Weg zur Arbeit aufgegossen hatte, sondern dieser ganz besondere, den sie neulich in Reno gekauft hatten. Echter Wochenendkaffee, Hazelnut oder vielleicht sogar Kenia AA, und Neal glaubte, auch einen Hauch Schokolade zu erkennen.
Wenn’s eine spezielle Hausmarke war, musste Karen früh aufgestanden sein und ihn gemahlen haben, was ungewöhnlich war, denn samstags schlief sie auch gerne aus. Neal dachte an ihr glänzend schwarzes Haar und ihre blauen Augen und beschloss, in die Küche zu gehen, Kaffee zu trinken und sie dabei anzusehen. Sie könnten ausgiebig frühstücken, anschließend raus in die Berge fahren und ein bisschen wandern, oder rüber zur Ranch der Milkowskis, zwei Pferde borgen und am Sandy Creek entlangreiten, ein hübsches Plätzchen für ein Picknick suchen. Der Morgen hatte das Potenzial, ein herrlicher Septembertag in der als The High Lonely bekannten Steppe im Norden Nevadas zu werden – und Neal Carey war zum ersten Mal in seinem Leben kein bisschen einsam.
Der Kaffee roch einfach zu gut.
Neal rollte aus dem Bett, öffnete die Tür und hörte eine Stimme.
Die Stimme: So beruhigend, wie ein Stein auf einer Käsereibe.
»Sehr gut«, sagte sie gerade. »Deine eigene Mischung?«
Neal hörte Karen antworten: »Halb Hazelnut, halb Macadamia.«
Macadamia, aha.
»Und die Muffins …«, sagte die Stimme. »Köstlich.«
»Die hat Neal gebacken«, sagte Karen.
Neal blieb einen Augenblick hinter der Schlafzimmertür stehen, dann ging er durch das kleine Wohnzimmer und stellte sich in den Eingang zur Küche.
Karen bemerkte ihn zuerst.
»Honey«, sagte sie, »schau mal, wer da ist.«
»Hallo, Sohn«, sagte Joe Graham.
Es ist nicht nur die Stimme, dachte Neal, es liegt auch am Grinsen, diesem provokanten, spöttischen Grinsen, wie eine Ratte im Abfallhaufen.
»Hallo, Dad«, erwiderte Neal.
Karen drückte Neal ein Küsschen auf die Wange und reichte ihm einen Becher Kaffee.
Vielleicht sollte ich endlich mal versuchen, von dem Zeug runterzukommen, dachte er. Stinkt verbrannt, macht Bauch- und Kopfschmerzen.
Dann zog er sich einen Stuhl heran und setzte sich an den Tisch.
Das war sein größter Fehler. Er hätte wieder ins Bett gehen, sich die Decke über den Kopf ziehen und sich weigern sollen, herauszukommen, bis Joe Graham in zehntausend Metern Höhe im Flieger nach New York saß. Hätte er das gemacht, hätte er Polly Paget nie kennengelernt, Candyland nie gesehen und wäre ganz bestimmt keine verdammt lange Wasserrutsche hochgeklettert.
Aber er machte es nicht.
Er schnupperte am Kaffee.
Und trank.
Teil 1 POLLYGATE
1
»Kleiner, der Job ist ganz einfach«, sagte Joe Graham und biss in seinen Toast, »das kriegst sogar du hin.«
»Noch Orangensaft, Joe?«, fragte Karen. Sie stand mit einer Karaffe in der Hand hinter ihm. Sie hatte Rühreier, Bratkartoffeln und Roggentoast gemacht und Graham außerdem Kaffee, Saft und Muffins vorgesetzt.
Neal bedachte sie mit einem bösen Blick. In den neun Monaten, die sie jetzt zusammenlebten, hatte Karen ihm genau ein Mal Frühstück serviert – verkohlte Poptarts.
Meist kochte Neal.
Aber kaum taucht Graham hier auf, dachte er, verwandelt sie sich in Aunt Bee.
Karen erwiderte seinen Blick. Aber es war nicht der Blick einer gutmütigen alten Köchin, sondern ein echter Karen-Hawley-Blick: »Lass mich bloß in Ruhe, ich mache Frühstück für wen ich will.«
Außerdem liebte Karen Joe Graham. Das kleine Koboldgesicht war einfach so verdammt niedlich, und die Armprothese ließ ihn so hilflos wirken. Ihr gefiel, dass er auf sich selbst und die Menschen in seiner Umgebung achtete, und sie kannte die Geschichte, wie er aus dem verwahrlosten kleinen Neal einen ganz anständigen Erwachsenen gemacht hatte. Karen behandelte Graham wie einen geliebten Schwiegervater, obwohl er gar nicht Neals richtiger Vater und sie nicht Neals Ehefrau war.
Aber heutzutage sind Familien eben so.
»Was soll das sein? Machst du jetzt auf Serpico?«, fragte Graham.
Er hatte Neal noch nie mit langen Haaren gesehen, von dem Vollbart mal ganz zu schweigen. Und das alte Hemd über der ausgewaschenen Jeans? Der Junge war offensichtlich im falschen Jahrzehnt hängengeblieben.
»Alles nur Tarnung«, nuschelte Neal.
Es war ihm peinlich. Ursprünglich hatte er mit dem Bart und den langen Haaren tatsächlich seine Identität verschleiern wollen, aber mit der Zeit hatte er Gefallen an seinem neuen Look gefunden. Oder besser an dem damit verbundenen Lebensgefühl: Er war jetzt viel entspannter und lockerer, nicht mehr ständig auf der Hut, wie in den siebenundzwanzig Jahren davor.
»Mir gefällt’s«, sagte Karen. Sie fuhr ihm mit den Fingern durch die Nackenhaare. »Aber vielleicht sollte ich dir heute Abend mal die Spitzen schneiden. Sieht schon ein bisschen zottelig aus.«
Sehr schön, dachte Graham. Schön für den Jungen, endlich hat er jemanden gefunden. Wenn ich ihn sonst irgendwo abgeholt habe, hatte er sich immer hinter riesigen Bücherstapeln, Karteikarten und schlimmen Erinnerungen verschanzt. Und Selbstmitleid in sich reingefressen wie Eiskrem. Jetzt lebt er mit einer gestandenen Frau zusammen, die ihn so sehr liebt, dass sie sich keinen Blödsinn von ihm gefallen lässt. Deshalb hat er auch keine Chance, sich leid zu tun − morgens schlägt er die Augen auf, und sie ist da.
»Willst du arbeiten?«, fragte Graham.
»Dad, ich dachte …«
»Seit wann denkst du?«, fragte Graham. Neal zu beleidigen, hielt er für so was wie seine Pflicht.
»Ist ganz was Neues«, erklärte Neal. »Ich hab mir überlegt, dass ich mich aus dem aktiven Berufsleben zurückziehen möchte.«
Er hatte intensiv darüber nachgedacht, seit er abgedrückt hatte und ein Mann tot in den Schnee gefallen war. Danach hatte er sich in Karen Hawleys Schlafzimmer verzogen und war wochenlang nicht mehr rausgekommen, hatte sich vor dem FBI, der Highway Patrol und der Polizei versteckt.
Aber dann passierte etwas sehr Seltsames: nichts.
Als er endlich den Kopf wieder rausstreckte – inzwischen mit langen Haaren und einem Vollbart – interessierte sich niemand für ihn. Polizei tauchte nicht auf, keiner stellte Fragen, in ganz Austin, Nevada, sagte niemand etwas dazu.
Und jetzt führte Neal ein eigenes Leben.
»Wie alt bist du, achtundzwanzig?«, fragte Graham.
»Wenn man für die Friends arbeitet, muss man in Hundejahren rechnen«, sagte Neal. »Eigentlich bin ich hundertsechsundneunzig.«
Friends war die Kurzform für Friends of the Family, ein privates Unternehmen des Bankiers Ethan Kitteredge, mit dem er wohlhabenden Klienten aus gewissen Notlagen half, was meist damit endete, dass Neal und Graham in ebensolche gerieten. Neal war der letzten gerade erst entkommen und nicht besonders scharf darauf, gleich wieder in irgendein Schlamassel reinzurasseln.
Außerdem bin ich glücklich, dachte Neal. Ich stehe morgens auf, mache Karen was zu essen, dann setze ich mich an meinen Schreibtisch und arbeite bis mittags über Smollett. Entweder koche ich danach was, oder ich gehe runter zu Brogan, esse ein Sandwich und trinke ein Bier, arbeite anschließend wieder bis zum späten Nachmittag, bis es Zeit fürs Abendbrot wird. Dann kommt Karen nach Hause, und wir essen gemeinsam, meist muss sie noch ein paar Hausaufgaben korrigieren. Vielleicht sehen wir danach noch ein bisschen fern, oder wir gehen gleich ins Bett. Mir gefällt mein Leben.
»Ich hab mir überlegt, von der Columbia hierher zu wechseln«, sagte Neal, »meinen Abschluss in Nevada zu machen.«
Meinen Abschluss zu machen: Irgendwie klang das fast unwirklich. Seit sechs Jahren versuchte er jetzt schon, seinen Master hinzubekommen, aber durch seine Tätigkeit für die Friends war er ein paar Mal gewaltig von seinem Ziel abgelenkt worden. Am liebsten wollte er eines Tages irgendwo an einem kleinen College Englisch unterrichten.
»Hast du die Schecks bekommen?«, fragte Graham.
Neal nickte. Er war erst wenige Wochen abgetaucht gewesen, als ein Päckchen mit einer neuen Identität eintraf, die Papiere waren auf einen jungen Mann namens Thomas Heskins ausgestellt. Wenige Tage später folgten die ersten Schecks ungefähr in der Höhe von Neals früherem Monatsgehalt.
Karen runzelte die Stirn, denn die Schecks waren ein heikles Thema zwischen ihnen. Neal verdiente mehr Geld, indem er zu Hause hockte und über seiner Arbeit zum Thema »Tobias Smollett: Literarischer Außenseiter« brütete, als Karen mit über fünfzig Wochenstunden an der Grundschule. Typisch Neal Carey: Er wollte seinen Master machen und sich anschließend gleich in einen Graduiertenstudiengang einschreiben.
Karen Hawley liebte Neal Carey sehr, aber er war dabei, das Pferd vom Schwanz aufzuzäumen, das war sein Problem. Und jetzt, wo sie ein Freisemester hatte, war es auch ihres.
»Die Schecks«, erklärte Graham, »waren nicht als Pension gedacht, sondern eher als eine Art Entschädigung, solange du dich verstecken musstest.«
Waren?, dachte Neal. Das klang nicht gut.
»Was willst du mir eigentlich sagen, Dad?«, fragte Neal.
»Ich will sagen, wenn du möchtest, kannst du auch wieder Neal Carey sein.«
Wieso sollte ich?, dachte Neal.
»Wen habt ihr dafür schmieren müssen?«, fragte Neal.
Das ›ihr‹ bezog sich auf Ethan Kitteredges Bank in Providence, Rhode Island.
»Die üblichen Verdächtigen«, sagte Graham. Politiker in Washington zu kaufen war so schwierig wie ein Zeitschriftenabo abzuschließen, nur verlängerte sich der Vertrag leider nicht von allein. Abgesehen davon schienen die Bundesbehörden aber auch nicht besonders scharf auf den Fall zu sein. Wenn ihnen jemand den Gefallen tat, einen dreckigen Neo-Nazi wie Cal Strekker aus dem Weg zu räumen, dann mussten sie sich mit einem weniger herumschlagen. Graham wusste nicht mit Sicherheit, ob Neal ihnen diesen besonderen Dienst wirklich erwiesen hatte – sie hatten nie darüber gesprochen –, aber als Joe Graham Neal Carey das letzte Mal gesehen hatte, war er Strekker mit einem Gewehr in die Steppe hinaus gefolgt.
»Ed findet, es wird Zeit, dass du wieder was tust für dein Geld«, sagte Graham.
Ed war Ed Levine, Leiter des New Yorker Büros der Friends, für das Graham arbeitete und Neal meistens nicht.
»Wer wird vermisst?«, seufzte Neal. »Wen soll ich suchen?«
Darauf lief es meistens hinaus.
Graham grinste sein dreckiges Rattengrinsen und sagte: »Das ist ja das Schöne.«
»Was ist das Schöne?«, fragte Neal. Nachgeben und freiwillig fragen war einfacher, als stumm zu ertragen, wie Graham die Sache endlos in die Länge zog.
»Du musst niemanden suchen«, erwiderte Graham. »Wir haben sie schon gefunden.«
»Und das heißt …?«, fragte Neal.
Graham grinste.
»Du sollst ihr Englisch beibringen.«
»Wem? Wieso? Wo kommt sie denn her?«
»Aus Brooklyn«, erwiderte Graham.
»Bleibt ›wem‹ und ›wieso‹?«, beharrte Neal.
»Nimmst du den Job an?«, fragte Graham.
Er wollte nicht mehr verraten, bevor Neal sich nicht bereit erklärt hatte, den Auftrag anzunehmen.
Mh-mh, dachte Neal. Ich sage ja, und dann erzählst du mir, ihr habt sie in der Äußeren Mongolei in einem Frauengefängnis aufgespürt, und ich soll mich dort einschleusen, ihr die englische Sprache beibringen und anschließend auf dem Rücken eines Kamels quer durch die Sowjetunion mit ihr fliehen.
»Ich hab mich zur Ruhe gesetzt«, erklärte Neal.
»Wie viel?«, fragte Karen Graham.
Neal hob die Augenbrauen, sah sie direkt an.
»Wir haben doch darüber gesprochen, dass wir hinten vielleicht eine größere Terrasse anbauen wollen«, erklärte sie.
Neal wandte sich wieder an Graham. »Ist sie Zeugin vor Gericht?«
»Kann sein«, erwiderte Graham.
»Kann sein?«
Graham sagte: »Kommt drauf an, wie gut du deinen Job machst.«
»Wer ist sie?«, fragte Neal. »Eliza Doolittle?«
Graham bohrte seine künstliche Hand in die gesunde. Eine Angewohnheit, in die er stets verfiel, wenn er nervös oder ungeduldig wurde.
»Bist du jetzt dabei oder nicht?«, fragte er.
»Hat die Mafia ihre Finger im Spiel?«, fragte Neal. Mafiazeugen waren heikel. Bewegte man sich in ihrem Umfeld, lief man schnell Gefahr, ermordet zu werden. »Irgendeine Mafiosofreundin wurde von ihrem Verlobten verprügelt, ist jetzt so stinksauer, dass sie auspacken will, und ich soll sie auf Vordermann bringen, stimmt’s?«
»Weit gefehlt«, behauptete Graham.
»Und wo muss ich hin?«
»Auch das ist ganz wunderbar. Du musst nicht mal das Haus verlassen. Wir bringen sie her.«
»Hierher?«, fragte Neal.
»Hierher?«, wiederholte Karen.
»Hierher«, bekräftigte Graham.
Neal lachte und wandte sich an Karen. »Also, was ist dir deine Terrasse wert?«
Auch Graham sah Karen an und schenkte ihr sein kriecherischstes Lächeln. »Wir glauben, dass du eine wichtige Rolle dabei spielen könntest.«
Karen schenkte Graham eine frische Tasse Kaffee ein, setzte sich neben ihn und legte ihm einen Arm um die Schulter.
»Weißt du, Joe«, sagte sie. »Wenn ich mir diese Terrasse so vorstelle, sehe ich auch einen Whirlpool aus Zedernholz.«
Neal prustete laut los vor Lachen.
»Die gefällt mir«, sagte Graham. »Zu Scherzen aufgelegt wie du, aber irgendwie mag ich sie.«
»Kann ich verstehen, ich mag sie auch«, pflichtete Neal ihm bei. Ich liebe sie, dachte er.
Graham sagte: »Okay, dann sprechen wir also von einer Terrasse mit Whirlpool.«
»Das war einfach. Also, wer ist die geheimnisvolle Zeugin?«, fragte Neal.
Graham legte eine Kunstpause ein. Dann kaute er seinen letzten Happen Toast achtundzwanzig Mal und verkündete: »Polly Paget.«
Karens große blaue Augen wurden noch größer.
»Polly Paget wird im ganzen Land gesucht«, sagte Neal. »Hätte ich mir denken können, dass ihr sie habt.«
Graham zuckte mit den Schultern.
»Wo ist sie?«, fragte Neal.
»Draußen im Wagen.«
»Du hast sie draußen im Wagen sitzen lassen?!«, schrie Karen. »Wofür hältst du sie? Dein Gepäck?«
»Sie hat geschlafen.«
Karen boxte Graham in die Schulter und stürmte zur Tür hinaus.
»Aua«, sagte Graham und guckte ein kleines bisschen beleidigt.
»Zu Karens schmutzigen kleinen Geheimnissen gehört, dass sie das People Magazine liest. Stimmt das denn alles?«, fragte Neal und nahm sich einen Blaubeermuffin.
»Polly Paget behauptet es«, erwiderte Graham und rieb sich die Schulter.
Neal mampfte den Muffin. Grahams Antwort bedeutete, dass er nicht wusste, ob er glauben sollte, was Polly Paget Jackson Landis vorwarf.
2
Polly Paget war eine von mehreren Sekretärinnen im Mitarbeiterinnenpool von Jack Landis’ New Yorker Büro, und laut Polly hatte Jack schon öfter darin geplanscht.
An sich nicht weltbewegend. Polly war nicht die erste Sekretärin, die kaum zwanzig Wörter pro Stunde tippte, dafür aber die Abgesichertheit einer Staatsbeamtin genoss, und sie würde auch nicht die letzte Sekretärin sein, die häufiger auf dem Schreibtisch lag, als daran arbeitete. Was Polly Paget zu einer Ausnahmeerscheinung machte, war ihre Behauptung, ihr Chef habe sie vergewaltigt.
Wobei sie damit sicher nicht einmal in die Zeitung gekommen wäre, hätte es sich bei besagtem Vorgesetzten nicht um keinen Geringeren als Jack Landis höchstpersönlich gehandelt, dem Gründer, Präsidenten und Hauptanteilseigner des Family Cable Network. Außerdem hingebungsvoller Ehemann von Candy Landis, mit der gemeinsam er die ausgesprochen beliebte Sendung Familienzeit mit Jack und Candy moderierte. Neal wusste selbst nicht, ob er Polly die Geschichte abnahm.
Würde aber passen, dachte Neal.
»Dis is aba süß dis Häusschen, Leute«, sagte Polly, als Karen ihren Koffer in die Küche stellte. »Meine Fresse, ohne Scheiß, aba escht weit ab vom Schuss, oda? Wir sin gefahn un gefahn un da wa nix, wo de ma hättst schoppen könn. Habta ma’n Klo für misch? Muss ma escht dringend.«
Polly Paget war ein wandelndes Klischee. Ihre rotbraune Mähne war mächtig – hochtoupiert, geföhnt und mit Haarspray zu einem riesigen roten Heiligenschein modelliert, der an eine Ölraffinerie bei Sonnenuntergang erinnerte. Ihr Gesicht war hübsch, der Mund breit, ihre langen Schneidezähne wirkten wie Reißzähne, was ihrem Aussehen etwas leicht Bedrohliches verlieh. Die lange, schmale Nase war römisch gebogen. Neal musste zugeben, dass sie sexy Katzenaugen hatte. Von dichten roten Brauen überdacht, funkelten sie unter zahlreichen Schichten von Mascara, Eyeliner und falschen Wimpern. Alles an Polly schrie »Schlampe«.
Sie war groß – gut einsachtundsiebzig, hatte lange Beine, kleine Brüste und breite Schultern. Insgesamt hatte sie definitiv größere Ähnlichkeit mit dem Wolf als mit dem Lamm.
Die Klamotten machten es nicht besser. Sie steckte von Kopf bis Fuß in Denim, als hätte sie sich für ihren Ausflug in den Wilden Westen eigens in Schale geworfen. Dazu viel Schmuck aus Silber und Türkis und knallrote Fingernägel, so lang, dass sie nicht hätte tippen können, selbst wenn sie gewollt hätte.
»Habta ma Lohschen?«, fragte sie, als sie aus dem Badezimmer kam. »Krieg sonst voll trockne Hände. Hab isch escht manschma Probleme mit. Ohne Lohschen wern die voll rissisch. Hab auch welsche inna Tasche, aber draußen im Wahng.«
Neal zuckte zusammen. Polly konnte kein »ch« aussprechen; Endungen auf »l« und »r« existierten nicht für sie, und offensichtlich saß ein kleiner Bauchredner in ihrer Kehle, der es so aussehen ließ, als würden ihre Worte aus der Nase kommen.
Karen sagte: »Ich glaube, ich hab noch Lotion im Schlafzimmer. Ich hole sie mal.«
»Ich komme mit«, sagte Neal.
Im Schlafzimmer fand Karen die Lotion, während Neal die Kommodenschubladen durchwühlte.
»Was suchst du denn?«, fragte Karen.
»Den Revolver«, erwiderte Neal. »Willst du eine Kugel oder zwei?«
Karen lächelte und packte Neal an der Schulter.
»Was für eine unglaubliche Mähne!«, flüsterte sie. »Ich wollte schon immer mal eine Frau mit einer solchen Wahnsinnsmähne kennenlernen.«
»Aber wolltest du auch einen Monat lang mit ihr zusammenwohnen?«
Karen sah ihn streng an.
»Neal, sie wurde vergewaltigt!«
»Sie sagt, sie wurde vergewaltigt.«
Karen blickte sehr ernst aus ihren blauen Augen und packte ihn noch fester an der Schulter.
»Neal Carey«, sagte sie, »wenn eine Frau sagt, sie wurde vergewaltigt, dann wurde sie vergewaltigt.«
Nicht unbedingt, dachte Neal.
Eigentlich war es noch ein bisschen zu früh für ein Bier, aber es war auch ein bisschen zu früh, um einen neuen Fall anzunehmen, und deshalb hatte Neal nur ein minimal schlechtes Gewissen, als er die Flasche aufmachte. Breschnew, ein riesiger schwarzer Hund von zweifelhafter Abstammung, hob seinen Kopf zirka zwei Zentimeter vom Fußboden und knurrte, bis Neal einen Dollar auf den Tresen legte. Brogan, sein Besitzer und Namensgeber des schmuddeligen Saloons, schnarchte in einem alten Sessel, den er irgendwann einmal vom Sperrmüll gerettet hatte.
Neal hatte nie erlebt, dass Brogan den Sessel aus einem anderen Grund verlassen hätte, als um aufs Klo zu gehen – wobei einige Bewohner Austins aufgrund olfaktorischer Hinweise bereitwillig geschworen hätten, dass er nicht einmal deshalb immer aufstand.
Brogan sägte immer lauter. Er hatte den Kopf in den Nacken gelegt und sabberte.
»Schläft er, oder tut er nur so?«, fragte Graham.
Neal sah Breschnew an, der ihn seinerseits nicht aus den Augen ließ.
»Der schläft. Wenn Kundschaft in der Kneipe ist, wechseln sie sich ab. Der Hund pennt nur, wenn Brogan wach ist.«
»Den Hund kann man doch bestimmt bescheißen, oder?«
»Diesen nicht.«
Neal machte eine zweite Flasche auf, kam wieder auf die andere Seite des Tresens und setzte sich zu Graham, der gerade dabei war, die schmierige Tischplatte mit einem Taschentuch abzuwischen.
»Gibt’s denn in der ganzen Stadt keinen sauberen Laden?«, maulte Graham.
»Doch, der macht aber erst abends auf«, erwiderte Neal. »Also, was hat die Bank mit Polly Paget zu tun?«
Karen hatte sie eine Weile aus dem Haus geschickt, damit »Polly zur Ruhe kommt«. Neal vermutete, sie wolle ihr helfen, ihren Koffer auszupacken, einen Platz für ihre Schminksachen zu finden, und ihr alle möglichen Informationen aus der Nase ziehen.
»Kann ich ein Glas haben?«, fragte Graham.
»Wahrscheinlich hat Brogan sogar irgendwo eins, aber ich glaube kaum, dass du daraus trinken möchtest«, erwiderte Neal. Von Brogans Biergläsern hätte man Fingerabdrücke aus fünfzehn Jahren nehmen können.
Graham zog ein frisches Taschentuch aus der Jackentasche und wischte den Flaschenhals damit ab. Dann nahm er einen vorsichtigen Schluck und sagte: »Jack Landis ist Mehrheitseigner von Family Cable Network. Peter Hathaway, der größte Minderheitseigner, ist Kunde der Bank und will Mehrheitseigner werden. Er ist angepisst, weil er findet, Jack habe den Bogen überspannt. Und dann ist da noch Candyland.«
Candyland. Neal schmunzelte. Er hatte bei Familienzeit mit Jack und Candy schon von Candyland gehört.
Candyland sollte ein riesiger »Ferienpark für Familien« draußen bei San Antonio werden – wenn es denn mal fertig werden sollte. Dafür fehlten nämlich noch ein paar Millionen Dollar, weshalb Jack und Candy ihren treuen Zuschauern unermüdlich Immobilienanteile anzudrehen versuchten. Überweisen Sie fünfhundert Dollar und erwerben Sie Anteile an einer Ferienwohnung. Jack und Candy unterbreiteten das Angebot ungefähr alle zwölf Sekunden. Wenn es um Kohle für Candyland ging, waren sie unersättlich.
»Eine einzige Katastrophe«, sagte Graham. »Sie haben das Budget in jeder Hinsicht überzogen, und jetzt wird das Geld knapp.«
»Wollen sie das Ding wirklich bauen?«
Graham zuckte mit den Schultern.
»Lass mich raten«, sagte Neal. »Die Bank hat auch was reingesteckt.«
»Ja, natürlich«, erwiderte Graham. »Der Minderheitseigner will mit der Bank zusammenarbeiten und die Sache wieder geraderücken. Aber wie feuert man das beliebteste Ehepaar von ganz Amerika?«
»Schwierig«, erwiderte Neal. »Wenn allerdings rauskäme, dass er seine Sekretärin vergewaltigt hat …«
»Bingo«, sagte Graham.
»Und sagt Polly die Wahrheit?«, fragte Neal.
»Keine Ahnung«, erwiderte Graham.
»Die Bullen ham mir nisch geglaubt«, erzählte Polly Karen. »Klar, über ein Jahr hatt isch was mit dem, und plötzlich behaupte isch, dass er mich vergewaltigt hat. Aber isch schwör bei Gott, er hat’s getan.«
Karen half Polly, ihre Unterwäsche in dem kleinen Gästezimmer zu verstauen. Keine leichte Aufgabe. Polly hatte sehr viel Unterwäsche.
»Ehrlich gesagt ist Jack sowieso nicht so toll in der Kiste«, fuhr Polly fort, »aber wie auch, der ist mit einem Kühlschrank verheiratet – so hat er seine Frau immer genannt. Isch mein, wie soll er da Übung ham? Der hat eine gebraucht, okay, und irgendwie war er escht nett zu mir. Also sind wir imma, wenn er in New York war, zu mir und ham’s gemacht … und noch ma und noch ma und noch ma … aber isch hab mich danach ganz schlecht gefühlt. Ich mein, das hat doch zu nix geführt, und seine Frau hat im Fernsehen erzählt, dass sie Kinder ham will, aber das hat nisch geklappt, und dabei lieg ich mit ihrem Kerl im Bett und hör’s mir an. Er wollte immer vögeln, wenn er mit ihr im Fernsehen lief, was isch gruselig fand. Die waren echt süß zusammen, so mit Schätzchen hier und Schätzchen da, wie die Turteltauben; und gleichzeitig nagelt er mich. Findste das nicht auch gruselig?«
»Total«, sagte Karen.
»Sogar Gloria findet’s gruselig, das ist meine beste Freundin und die treibt’s viel wilder als isch. Aber egal, nach einer Weile hab ich gesagt: ›Jack, ich fick nicht mehr, wenn der Fernseher läuft.‹ Da isser stinksauer geworden. Wir haben uns getrennt, aber er kam doch wieder an und war so süß, und wir sind auch wieder ins Bett, aber nicht mehr bei Familienzeit mit Jack und Candy. Das wird nämlich aufgezeichnet und gar nicht live gesendet.«
»Das hab ich mir jetzt gerade schon gedacht«, sagte Karen. Sie reichte Polly einen BH, der eher an ein Forschungsprojekt am MIT als an ein Kleidungsstück erinnerte.
Polly hielt ihn hoch und erklärte: »Mit dem Geld lass ich mir auf jeden Fall die Titten machen, ich hab mir nämlich überlegt, dass ich’s in Hollywood versuchen will, und ohne Titten kommst du da nicht weiter. Ich meine, ich hab natürlich welche, aber da brauchst du richtig dicke Dinger.«
Sie hob die Hände und demonstrierte, welche Größe ihr vorschwebte.
Karen zuckte zusammen. »Ich finde, du siehst toll aus«, behauptete sie.
»Ehrlich? Ooooch, wie lieb«, sagte Polly. »Manchmal finde ich, ich seh aus wie eine billige Schlampe. Die Bullen haben das auch gedacht, dass ich’s drauf angelegt hab, weißt du, aber das stimmt nicht. Ich hab Jack gesagt, es ist vorbei. Ich war fertig mit ihm, und er wollte noch ein letztes Mal, aber ich hab gesagt, nein. Er wollte sich nicht damit abfinden, also hat mich das Arschloch gepackt und festgehalten und ihn einfach reingeschoben, und wenn mich nicht alles täuscht, ist das Vergewaltigung, oder nicht?«
»Ich denke schon.«
»Denke ich auch, aber versuch das mal den Bullen klarzumachen. Die gucken dich an, als hättest du sie nicht mehr alle. Aber wir werden schon sehen, wer sie nicht mehr alle hat.«
Neal wahrscheinlich, wenn er sich das einen Monat lang anhören muss, dachte Karen.
»Dann hast du das Arschloch also verklagt«, sagte Karen.
»Sonst zahlt er ja nicht«, sagte Polly, »und ich brauch das Geld, hab ja meinen Job verloren, und außerdem bin ich als Sekretärin ehrlich gesagt sowieso beschissen. So schnell finde ich bestimmt nichts Neues mehr, jetzt wo mich alle im ganzen Land hassen.«
»Ich hasse dich nicht«, sagte Karen. Sie kam sich bescheuert vor, aber irgendwie hatte sie das Gefühl, dass es gesagt werden musste. Außerdem meinte sie es ehrlich. Irgendwie mochte sie Polly Paget.
»Den Rest kennt man ja«, sagte Graham zu Neal. »Polly geht zu irgendeinem schmierigen Winkeladvokaten, der erst mal sämtliche Klatschzeitungen verständigt und denen seinen Namen buchstabiert.«
Neal erinnerte sich an die Schlagzeilen, die er an der Kasse des einzigen Supermarkts in ganz Austin gesehen hatte: »Luder vergewaltigt«, »Sekretärin lässt Sexbombe platzen«, »Jacks Liebesnest«, »Alles gelogen, sagt Candy Landis«, »Candy steht zu ihrem Mann«. Danach stürzten sich die Fernsehsender drauf – der Ton war ein bisschen verhaltener, die voyeuristische Gier aber kaum geringer: »Langzeitgeliebte erhebt Vergewaltigungsvorwürfe gegen Senderchef Jack Landis. Verdacht auf finanzielle Unstimmigkeiten. Anonymes Vorstandsmitglied fordert Ermittlungen.«
Dann reagierte Jack. Behauptete, Medienkonkurrenten wollten ihn vernichten. Die Schmutzjournaille wolle ihn in den Dreck ziehen. Die sonst so zugeknöpfte Candy brach mitten in der Sendung in Tränen aus – wer konnte nur so gemein sein und ihr so etwas antun? Polly Paget sei nur Mittel zum Zweck. Family Cable Network bleibe weiterhin bestehen. Candyland würde gebaut! Frenetischer Applaus. Vereinzelte Menschen im Publikum weinten ungeniert. Es war so schön.
Dann organisierte Pollys Anwalt eine Pressekonferenz. Polly gab ein Statement ab. Sie sah schlimm aus vor der Kamera und klang noch schlimmer. Die Presse fiel über sie her. Sie kam hart, kalt und berechnend rüber − ein billiges Luder. Es war schrecklich.
In diesem Moment, erklärte Graham Neal, habe der Minderheitseigner Ethan Kitteredge in der Bank angerufen. Kitteredge habe Pollys Anwalt eine Abfindung gezahlt, eine andere Kanzlei engagiert und Polly Paget von der Bildfläche verschwinden lassen.
Die Presse drehte durch. Eine verschollene Polly Paget war viel besser als eine allgegenwärtige. Die wildesten Spekulationen machten die Runde. Wo steckte Polly? Warum hatte sie sich aus dem Staub gemacht? Wurde sie bedroht? War das der Beweis für ihre Unaufrichtigkeit? Wo versteckte sie sich?
»Wir haben eine falsche Polly in ein Flugzeug nach L.A. gesetzt«, erklärte Graham, »und sind mit der echten Polly nach Providence gefahren. Zehn Tage hat sie sich bei Kitteredge im Haus versteckt, während seine Anwälte sie auf Herz und Nieren geprüft haben. Dort wurde entschieden, dass wir deine Dienste in Anspruch nehmen wollen. Ein Privatflugzeug hat uns nach Reno gebracht, und hier sind wir.«
Polly zu verstecken hatte sich als genialer Schachzug erwiesen. Solange sie nicht da war und den Mund aufmachte, konnte der Minderheitseigner die ausgehungerte Presse mit Geschichten über Kostenüberziehungen, exorbitante Ausgaben und unsaubere Buchhaltung füttern, während die Journalisten der Affäre einen zugkräftigen Namen gaben: »Pollygate«.
Und auch Polly profitierte von der Magie der Medien. In ihrer Abwesenheit stieg sie vom Luder zum Sexsymbol auf, verwandelte sich in eine geheimnisvolle Mischung aus Garbo und Monroe. Weitläufige Bekannte verkauften Berichte für vierstellige Beträge. Verwackelte Schnappschüsse brachten noch mehr. In der neuen Anwaltskanzlei gingen flutartig Angebote ein, die allesamt unbeantwortet blieben – Fernsehinterviews, Zeitschriftenstorys, Fotostrecken.
Ein Medienspektakel, ein Riesenrummel. Das Einzige, was Pollygate fehlte, war Polly.
3
»Wo ist sie?«
Candy Landis stellte die Frage, als erwartete sie tatsächlich eine Antwort.
Ihr Mann Jack stand vor dem bodentiefen Eckfenster, das sie eigens hatten einbauen lassen und genoss die Aussicht auf den River Walk und Fort Alamo. Sie fand, er sah gut aus, wie er dort stand, das schwarze Haar noch immer dicht, der Rücken gerade, und auch der Bauch wölbte sich nur ein ganz kleines bisschen über den Gürtel.
Charles Whiting räusperte sich und fing noch einmal von vorne an. »Sie hat ihre New Yorker Wohnung in Begleitung eines großen, kräftigen Weißen verlassen und ist in eine schwarze Limousine mit getönten Scheiben gestiegen.«
»Getönt? Wieso getönt?«, fragte Jack.
»Schwarz, damit man nicht durchgucken kann, Schatz«, sagte Candy Landis.
»Getönt, aha.« Wiederholte Jack Landis noch einmal. »Fahren Sie fort.«
»Die Limousine ist zum La Guardia Airport gefahren, wo Miss Paget in Begleitung desselben Weißen ausgestiegen ist. Anschließend ist die Zielperson zum Erste-Klasse-Schalter von American Airlines …«
»Welche Zielperson?«
»Miss Paget.«
»Wieso Ziel?«, fragte Jack Landis. »Was für ein Ziel? Wurde denn geschossen?«
»Das sagt man so beim FBI«, erklärte Candy. »Hab ich recht, Chuck?«
»Der Begriff wird allgemein in der Polizeiarbeit verwendet, Mrs Landis.«
»Und was dann?«, erkundigte sich Jack Landis und beobachtete eine junge Frau mit langen Rehbeinen auf dem River Walk.
Charles Whiting räusperte sich erneut. Während seiner Dienstzeit beim FBI hatte er mehrmals dem Direktor höchstpersönlich Bericht erstatten müssen, war aber noch nie derart häufig unterbrochen worden. Wenigstens machte er immer noch eine ausgezeichnete Figur. Mit vierundfünfzig Jahren hielt er sich mit seiner Größe von einsneunzig noch kerzengerade. Und selbst im grauen Anzug sah man seinen Schultern die fünfzig Liegestütz täglich deutlich an. Seine leicht angegrauten Schläfen verliehen ihm die Aura des Erfahrenen, seine blauen Augen waren klar und sein Blick geradeheraus.
»Die Zielperson ist in ein Flugzeug nach Los Angeles gestiegen«, erklärte er, »dann …«
Whiting hielt inne.
»Fahren Sie fort, Chuck«, bat Candy Landis.
»Nun … Danach haben wir sie verloren, Ma’am.«
»Verloren? Verloren?!«, schrie Jack Landis. »Was hat sie denn gemacht, ist sie mit dem Fallschirm abgesprungen!«
»Sie war … äh … nicht mehr dieselbe, als sie aus dem Flugzeug stieg, Sir.«
»So geht es mir oft nach langen Flügen«, sagte Candy. Jack schenkte ihr einen Blick, der vernichtend sein sollte. Es aber nicht war.
Zu seiner Enttäuschung wirkte Candy so gefasst wie immer. Ihr herzförmiges Gesicht war frisch geschminkt, ihr Lippenstift perfekt aufgetragen und jedes einzelne ihrer blonden Haare exakt platziert und mit viel Spray fixiert. Wie gewöhnlich trug sie ein Kostüm, eine maßgeschneiderte Jacke, einen Rock, der bis übers Knie reichte, eine weiße Bluse mit rundem Kragen und kleinem roten Schleifchen.
Eine verdammt hübsche Frau, dachte Jack, aber so anschmiegsam wie eine bemalte Statue.
Charles Whiting platzte in die betretene Stille. »Als sie aus dem Flieger stieg, stellte sich heraus, dass es gar nicht Polly Paget war.«
»War dieser besagte Weiße noch dabei?«, fragte Landis spitz.
»Ja, Sir.«
»Dann wurde sie in der Limousine ausgetauscht?«
»Das nehmen wir an, Sir.«
»Zu dumm, dass Sie das nicht angenommen haben, bevor sie verschwunden ist, oder, Chuck?«
Chuck vermutete, Landis habe die Frage rhetorisch gemeint, und verzichtete auf eine Antwort. Beim FBI hatte er sich an solche Bemerkungen gewöhnt. Der Direktor war drauf abgefahren.
Die nächste Frage war allerdings keinesfalls rhetorisch.
»Wer steckt hinter alldem?«, fragte Candy.
Jack Landis drehte sich langsam um, die Hände ausgebreitet, den Mund in gespieltem Erstaunen geöffnet.
»Ach, Leute«, sagte Jack. »Wir wissen doch, wer ein Interesse daran hat, oder? Verdammte Scheiße, man muss nicht Efrem Zimbalist jr. sein, um draufzukommen, dass Peter Hathaway das verlogene Luder benutzt, um mir meinen Sender abzuluchsen. Und weil ihr die Geschichte nicht abgekauft wurde, hat er sie schnell verschwinden lassen, damit die Öffentlichkeit nicht kapiert, wer dahintersteckt. Glaubt mir, Pollygate ist gegessen.«
»Ist es nicht, Jackson«, erklärte Candy geduldig. »Die Restaurantumsätze sinken, die Lizenzangebote sind rückgängig, und wir verkaufen praktisch überhaupt keine Ferienwohnungen in Candyland mehr.«
Jack schmunzelte. »Okay, aber ich wette, die Quoten für die Sendung sind gestiegen. Dann holen wir eben mit der Werbung wieder rein, was wir am anderen Ende einbüßen.«
»Nicht mal annähernd«, erklärte Candy. Sie hatte sich drei Tage lang mit dem Rechnungsprüfer über die Zahlen gebeugt. »Die Quoten sind top, aber unsere Werbekunden sind mehrheitlich familienorientierte Unternehmen, die ungern mit einem Skandal in Verbindung gebracht werden wollen.«
»Dann gewinnen wir eben neue Werbekunden«, fauchte Jack. »Welche mit Eiern in der Hose.«
Whiting krümmte sich innerlich angesichts der vulgären Ausdrucksweise. Candy dagegen zuckte mit keiner ihrer perfekt modellierten Wimpern.
»Scheiß drauf, die Frau ist verschwunden«, sagte Jack. »Beweist das nicht, was ich von Anfang an gesagt habe, dass sie sich die ganze Sache ausgedacht hat?«
Candy erwiderte: »Tatsächlich zeigen die Umfrageergebnisse, dass ihre Glaubwürdigkeit seit ihrem Verschwinden in der öffentlichen Meinung um sechs Prozentpunkte gestiegen ist.«
»Gestiegen?«, schrie Jack.
»Gestiegen«, erwiderte Candy. »Dreiundsechzig Prozent der Umfrageteilnehmer halten es für ›höchstwahrscheinlich‹, dass du mit ihr geschlafen hast …«
»Hab ich nicht.«
»Und vierundzwanzig Prozent glauben, du hast sie vergewaltigt. Überleg dir das, mein Lieber: Wenn diese Zahlen auch für die Ansichten der Vorstandsmitglieder repräsentativ sind …«
»Ich bin der verfluchte Vorsitzende dieses verfluchten Vorstands!«
»Vielleicht nicht mehr lange, mein Lieber«, sagte Candy ruhig. »Wenn wir den Trend nicht umkehren, wird Peter Hathaway bald Vorsitzender sein. Er hat bereits dreiundvierzig Pro…«
»Ich weiß, ich weiß!«, brüllte Jack. »Für wen hältst du dich, eine Prozenteprophetin? Sag lieber, was wir machen sollen?«
»Wir müssen Miss Paget dazu bringen, öffentlich einzugestehen, dass sie gelogen hat.«
»Lass Sie doch gleich in unserer Sendung auftreten«, blaffte Jack.
»Wenn es sein muss, auch das«, sagte Candy und setzte hinzu: »Mein Lieber.«
Jack Landis starrte auf das Fort hinunter. Verdammt, dachte er, ich weiß, wie sich die armen Schweine gefühlt haben. Und wenn es gar nicht Hathaway ist, der Polly versteckt hält? Wenn das Justizministerium sie unter seine Fittiche genommen hat? Oder, schlimmer noch, die Talkshow-Konkurrenz? Verdammt, dieser geile alte Bock Mike Wallace würde Polly Paget bestimmt allzu gerne ein paar seiner 60 Minuten widmen.
Und ich auch, dachte Jack. Wenn wir schon von geilen alten Böcken sprechen, ich wäre definitiv dabei.
Er vermisste den Sex mit Polly. Sie war wild im Bett, einfach wild. Was sie da so alles anstellte … ohne nachzudenken oder es sich vorher zu überlegen, ganz verrückt hatte sie ihn damit gemacht. Die roten Haare flogen herum, und ihre irren grünen Augen sprühten …
Nicht wie dieser Kühlschrank hier, obwohl sie sich weiß Gott Mühe gab. Aber das war’s auch schon. Alles, was Candy im Schlafzimmer veranstaltete, hatte sie in einer Zeitschrift oder einem Buch gelesen. Man konnte ihr beim Nachdenken über »Techniken« schon fast zuhören. Im Schlafzimmer agierte sie mit der Spontaneität eines Metronoms.
Candice Hermione Landis sah ihren Mann an und wusste genau, was er dachte.
Jackson Hood Landis war in East Texas in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen und hatte eine Wahnsinnsangst, dorthin zurückzukehren. Candice selbst war in Beaumont als Sprössling der Mittelschicht groß geworden, ihr Vater war Pfarrer gewesen und hatte gerade genug Geld verdient, um sie noch an die St Martin’s University zu schicken, bevor er einem Herzinfarkt erlag. Ihre Mama war der Ansicht, Candice sei unter ihren Möglichkeiten geblieben, als sie dem Geschäftsmann Jack Landis das Eheversprechen gab, aber Candice liebte ihn nun mal, und das war’s.
Sie und Jack sparten und arbeiteten und kauften sich ein kleines Restaurant in San Antonio, dann noch eins und noch eins, bis Jackson das Zauberwort hörte: Franchising. Schon bald gab es im ganzen Land Jack’s Family Diners (»Gutes Essen für wenig Geld«), und plötzlich waren Jack und Candice reich – sehr reich, reich wie die Ölscheichs, so reich, dass sie nicht mehr wussten, was sie mit ihrem Geld machen sollten.
Also kauften sie einen Fernsehsender. (»Zwei Dinge, die die Amerikaner immer machen werden«, sagte Jack. »Fressen und fernsehen.«) Natürlich gab sich Jack nicht mit einem kleinen Lokalsender in San Antonio zufrieden. Er baute ihn zum Senderimperium aus. Und weil Jack fand, wenn sie schon Familienrestaurants besaßen, sollten sie auch ein familienfreundlicher Sender sein, riefen sie Family Cable Network ins Leben und produzierten Fernsehen für die ganze Familie.
Sie verkauften den Amerikanern gutes nahrhaftes Essen und gute nahrhafte Unterhaltung. Und dann kam der folgenschwere Tag, an dem sie sich mit einer Weihnachtsparty bei all ihren Mitarbeitern und Zuschauern bedanken wollten und beschlossen, diese live auszustrahlen. Jack und Candice traten höchstpersönlich gemeinsam auf, und die Zuschauer liebten sie.
Wer hätte das gedacht? Sie gaben nur eine kleine Party, wie zu Hause, unterhielten sich mit ihren Gästen, Candy spielte »The Old Family Bible« auf dem Klavier, und alle sangen mit, dann schnitt Jack den Truthahn an, während Candy ihn servierte. Eine Flut an Zuschauerpost brach über sie herein. Am vierten Juli feierten sie dann eine Grillparty und an Thanksgiving ein Fest – und Weihnachten auch wieder, und alles live im Fernsehen. Danach standen die Werbekunden Schlange.
Familienzeit mit Jack und Candy war geboren. Zunächst wurde wöchentlich gesendet, die Frequenz aufgrund des starken Zuschauerinteresses aber schon bald auf einmal täglich erhöht – an fünf Nachmittagen die Woche wurde gesendet, dazu kamen Specials an Feiertagen und ständige Wiederholungen frühmorgens und nachts. Jack war wunderbar vor der Kamera. Ein toller Moderator … Und er sah so gut aus … Das Publikum liebte ihn, Candy aber war die mit dem Köpfchen dahinter, und die Sendung wurde zu ihrem Lebenswerk.
Sie entschied, wer eingeladen wurde. Unter guter Familienunterhaltung verstand sie Menschen mit anregenden Geschichten und Experten, die nützliche Tipps geben konnten. (Am liebsten hatte sie Menschen mit anregenden Geschichten und Expertenwissen; leider waren diese nicht immer leicht zu finden.) Besonders schätzte sie Sänger, die durch Gott von ihrer Alkoholsucht geheilt worden waren, ehemals spielsüchtige Comedians, ebenfalls von Gott geheilt, oder Menschen mit anderen schrecklichen Problemen, denen Gott irgendwie geholfen hatte. Religiös war die Sendung streng genommen nicht, denn beide hielten sich mit Ausführungen darüber, welcher Gott geholfen oder geheilt hatte, zurück – schließlich musste es entweder ein christlicher oder ein jüdischer gewesen sein. Auch ehemalige weibliche Strafgefangene waren gern gesehene Gäste – besonders wenn sie während ihrer Haft Kinder bekommen hatten –, Experten erklärten ihnen dann, wie man einen Haushalt führt, ohne ein bestimmtes Budget zu überschreiten und/oder klauen gehen zu müssen.
Candy plante die Menüfolge für ihre Kochbeiträge, achtete darauf, dass die Gerichte nicht nur schmackhaft, sondern auch kostengünstig waren, wobei sie im Rahmen des einmal jährlich ausgestrahlten Specials »Romantisches Dinner für zwei, wenn die Kinder bei den Großeltern übernachten« auch mal ein bisschen über die Stränge schlug. Ihre Spezialität waren vor allem »Mehrfachmahlzeiten« wie beispielsweise der Sonntagsbraten, der bis Dienstag vorhielt, oder das Chili, das man als Chili verzehren, aber auch als Sauce zu Spaghetti oder einer Ofenkartoffel reichen konnte – wobei man die Gerichte, wie Jack einmal scherzhaft in der Sendung anmerkte, natürlich nicht mehrfach aß, sondern mehrfach aufwärmte.
Candy gab außerdem Schminktipps (ihr war aufgefallen, dass sich viele ehemalige Gefängnisinsassinnen entweder zu stark schminkten, was Männer unattraktiv fanden, oder überhaupt nicht, was Männer ebenfalls unattraktiv fanden – allerdings vermutete sie auch, dass einige der Betreffenden gar kein Interesse an Männern hatten), Diättipps (»Budweiser und ein Donut mit Schokoglasur sind kein Frühstück«), und Beziehungstipps (»ein durchsichtiges Negligé im heimischen Schlafzimmer erhält die Leidenschaft und macht niemanden zur Hure«).
Candy wusste, dass sich ein paar Leute – vielleicht sogar Tausende – über sie lustig machten, wusste aber auch, dass sie vielen anderen half. Da draußen waren Menschen, die durch die Sendung begriffen hatten, was ihnen fehlte, und jetzt eine Therapie machten. Familien ernährten sich eine Woche lang von einem einzigen Thunfischauflauf, und so manche Ehe funktionierte besser, weil die Kinder ab und zu mal bei den Großeltern übernachteten.
»Sie müssen sie finden, Chuck«, sagte Candy. »Finden Sie Polly Paget, und überreden Sie sie, sich den Kameras zu stellen und die Wahrheit zu sagen.«
Chuck Whiting begegnete ihrem Blick und entdeckte den Schmerz darin. Der ehemalige FBI-Agent, engagierte Mormone, hingebungsvolle Ehemann und Vater von neun Kindern war sehr gläubig. Er glaubte an Gott, an Amerika, die Familie und an Jack und Candy – besonders an Candy. Als er Candy in die blauen Augen sah, ihren festen Mund, ihre seidige Haut und ihr goldenes Haar betrachtete, ihrer leuchtenden Reinheit gewahr wurde, hätte Chuck Whiting – hätte er nicht wahrhaftig an Gott, Amerika und die Familie geglaubt – auf die Idee kommen können, er sei verliebt.
»Ich werde sie finden, Mrs Landis«, sagte er. Mit einem Kloß im Hals.