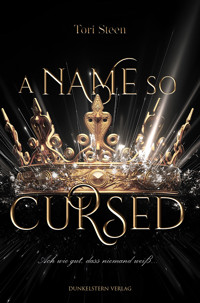
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Dunkelstern Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Ich habe viele Namen. Müllerstochter, Hexe, Königin. Die meisten halten mich für eine Betrügerin, eine junge Frau mit unverschämt viel Glück. Einige wenige beten zur mir als sei ich eine Göttin. Doch sie alle fürchten mich. Mehr als den Tod selbst. Meine Geschichte beginnt nicht mit "Es war einmal", denn sie ist alles, aber kein Märchen …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 564
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Copyright 2025 by
Dunkelstern Verlag GbR
Lindenhof 1
76698 Ubstadt-Weiher
http://www.dunkelstern-verlag.de
E-Mail: [email protected]
Dieses Werk darf weder im Gesamten noch in Auszügen zum Training künstlicher Intelligenzen, Programmen oder Systemen genutzt werden.
Lektorat:Lektorat Mitternachtsfunke
Korrektorat: Michelle G.
Cover: Bleeding Colours Coverdesign
Satz: Bleeding Colours Coverdesign
ISBN: 978-3-98947-085-9
Alle Rechte vorbehalten
Ungekürzte Taschenbuchausgabe
Für meine Eltern.
Mit jedem vorgelesenen Märchen habt ihr mir gezeigt, was Mut, Güte und Gerechtigkeit bedeuten.
Inhalt
Prolog
Aradia
Fabio
Aradia
Fabio
Aradia
Aradia
Aradia
Fabio
Aradia
Aradia
Aradia
Fabio
Aradia
Aradia
Fabio
Aradia
Aradia
Fabio
Aradia
Aradia
Aradia
Fabio
Aradia
Fabio
Aradia
Aradia
Fabio
Aradia
Aradia
Aradia
Fabio
Aradia
Aradia
Aradia
Fabio
Aradia
Aradia
Aradia
Fabio
Aradia
Aradia
Aradia
Aradia
Aradia
Fabio
Aradia
Aradia
Aradia
Aradia
Aradia
Aradia
Aradia
Aradia
Fabio
Aradia
Fabio
Aradia
Fabio
Aradia
Fabio
Aradia
Fabio
Epilog
Die Namen und ihre Bedeutung
Danksagung
Content Notes:
Hinweis Content Notes
Dieses Buch behandelt Themen, die potenziell belastend wirken können. Wenn du glaubst, davon betroffen zu sein, so beachte bitte die ausführliche Liste am Ende des Buches.
Prolog
Ich hatte viele Namen. Müllerstochter, Hexe, Königin. Manche halten mich für eine Betrügerin, eine junge Frau mit unverschämt viel Glück. Manche beten zu mir, als sei ich eine Göttin. Doch die meisten fürchten mich mehr als den Tod. Vielleicht stimmt das eine, vielleicht auch das andere. Ich glaube jedoch, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Es wird Zeit, dass ich meine Sicht der Dinge erzähle. Was wirklich in der Kammer voll Stroh geschah. Hier ist meine Geschichte.
Aradia
In dieser Vollmondnacht läuteten die Turmglocken der Stadt Sturm. Der kühle Bergwind trug den Geruch von brennendem Holz und Stroh über die Stadtmauern. Die drei Scheiterhaufen vor den Toren Verossas brannten lichterloh. Jedoch ohne die Frauen, die zu Unrecht der Hexerei bezichtigt worden waren. Zufrieden mit meinem Werk hockte ich hinter aufgestapelten Holzkisten nahe der Stadttore und beobachtete, wie die aus dem Schlaf gerissene Bürger die Stadt verließen oder sich in ihren Häusern vor Schreck verbarrikadierten. Wenn nun auch die Stadtwachen hinaus zu den brennenden Scheiterhaufen eilten, um das Unheil in Augenschein zu nehmen und den Brand zu löschen, würde mein zweiter Streich beginnen. Ich würde zum Hexenturm der Stadt eilen und die drei verurteilten Frauen befreien. Schnell, leise und ohne großes Aufsehen zu erregen. So wie ich es immer tat. Vorsichtig lugte ich hinter den Holzkisten hervor. Noch immer riss der Strom an Bürgern, die durch die Tore eilten, nicht ab.
»Das ist das Werk der Hexen!«, keifte eine dürre Frau, eilig in einen Mantel gehüllt, über das allgemeine Gemurmel der Masse hinweg.
»Diese Stadt ist verflucht«, bekräftigte ein beleibter Mann mit tiefer Stimme.
»Der König hat Recht, wir müssen die Hexen vernichten!«, schrie ein weiterer Mann.
»Die brennenden Scheiterhaufen, ich sage euch, das ist Aradias Werk«, keifte wieder die Frau und quetschte sich durch die Masse, sodass ich sie nicht mehr sehen konnte.
Mein Herz begann schneller zu schlagen. Seit vielen Monaten befreite ich Mädchen, junge und alte Frauen, die dem Hexenwahn des Königs und der Menschen zu Unrecht zum Opfer gefallen waren. Doch noch nie hatte ich es gewagt, meinen Plan in einer der größeren Städte des Königreichs umzusetzen. Und selbst hier hatte sich das angebliche Treiben Aradias herumgesprochen. Es war das eine, Frauen aus einem kleinen Dorf zu befreien. Mein Auftauchen versetzte viele Dorfbewohner in Schrecken. Der Aberglaube hielt die Menschen in festem Griff. Eine Stadt mit hohen Mauern und bewaffneter Stadtwache war allerdings eine neue Herausforderung. Und es war das Wagnis wert. Wenn mir der Plan gelänge, würde König Gaspare sofort davon erfahren. Eine erfolgreiche Rettungsaktion in einer großen Stadt wäre der nächste Schlag ins Gesicht des Königs. Der Gedanke daran ließ mich lächeln. Der Hexenwahn des Königs musste ein Ende finden. Ein für alle Mal. Denn die Frauen wurden zu Unrecht der Hexerei bezichtigt. Zu viele waren in den letzten Jahren auf den Scheiterhaufen verbrannt. Zu viele, bevor ich mit meinem Feldzug gegen die Hexenverbrennungen begonnen hatte. Zu viele, die ich nicht hatte retten können. Ich fasste an mein Dekolleté und umschloss den silbernen Kettenanhänger meiner Mutter. Auch sie war dem Hexenwahn des Königs zum Opfer gefallen. Vor genau einem Jahr hatte meine Mutter auf dem Scheiterhaufen gebrannt. Nicht weil sie Magie besaß, sondern weil sie schlau gewesen war. Schlauer als die naive Bauersfrau aus dem Nachbarsdorf. Meine Mutter hatte sich mit Kräutern und Heilmitteln ausgekannt. Fast jeden Tag waren Menschen von nah und fern mit ihren Leiden gekommen, von denen sie meine Mutter erlöste. Ebenso jene Bauersfrau. Doch anfängliche Bewunderung war umgeschlagen in Neid. Neid war zu Hass geworden. Und Hass war letztlich in Irrglauben gegipfelt. Eine Rechtfertigung, um sich die eigenen Sünden nicht eingestehen zu müssen. Der Hexenwahn des Königs entschuldigte so vieles. Eine kleine Andeutung und eine Frau saß schneller in der Folterkammer, als sie Hilfe schreien konnte. Nein, es gab auf dieser Welt keine Hexen. Es gab keine Magie oder Zauberei. Es gab nur die Gier, die sich tief in die Herzen der Menschen grub. Und die Gier des Königs war am größten.
Ich schüttelte den Kopf, wie um meine Zweifel von mir zu werfen und lugte nochmals hinter den Holzkisten hervor. Die Luft war endlich rein. Kein schlaftrunkener Stadtbewohner war mehr zu sehen. Die Wachen auf der Stadtmauer hatten mir und Verossa den Rücken gekehrt. Alle blickten auf die brennenden Scheiterhaufen. Ich schlüpfte aus meinem Versteck und schlich eng an die Mauer gedrückt die Außengasse der Stadt entlang. Vollkommen in schwarz gekleidet, die Kapuze tief ins Gesicht und ein Halstuch bis über die Nase gezogen, verschmolz ich in der Nacht mit den Schatten der Stadt. Mein Ziel war das Osttor Verossas mit seinem Hexenturm. Hier wurden die verurteilten Frauen bis zu ihrer Hinrichtung eingesperrt. Auch wenn ein Flüstern über Aradia, die Hexenkönigin und Retterin, mir folgte, noch nie hatte ein Mensch auf meinen Streifzügen mein Gesicht gesehen. Inzwischen hatte König Gaspare ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Fünftausend Talleri für denjenigen, der mich lebendig zu ihm brachte. Doch auf den Aushängen war nicht viel mehr zu sehen als eine völlig in schwarz gehüllte Gestalt. Aradia, den alten Sagen nach Tochter der Göttin Diana und des Gottes Luzifer, Königin der Hexen auf Erden war eine gesichtslose Frau. Und das sollte auch so bleiben.
Fabio
Ich musste das Zittern meiner Hände unterdrücken. Am Rande des Tischs lagen meine letzten zweihundert Talleri neben den anderen Wetteinsätzen. Ich hatte noch eine Karte in der Hand. Einen Herz Cavall, den Reiter, meine Lieblingskarte seit Kindesbeinen an, gewiss weil sie meinen Namen trug: Cavalli. Noch konnte ich gewinnen. Alles lag nun an den Karten meiner drei Gegenspieler. Ich fixierte den Glatzkopf mit den vielen Zahnlücken, der mir gegenüber am Tisch saß und an der Reihe war. War er mir vor Spielbeginn noch mehr als betrunken vorgekommen, spielte er jetzt erstaunlich strategisch. Das war gar nicht gut. Mein zweiter Gegenspieler war etwa in meinem Alter und hatte den ganzen Abend über fast kein Wort gesagt. Seinen Oberarmen nach zu urteilen, war er sicher Zimmermann oder hatte einen anderen harten Beruf. Sein Einsatz war enorm hoch. Und ich fragte mich, wo ein gewöhnlicher Mann wie er so viel Geld aufgetrieben hatte. Vielleicht spielte er einfach oft. Der vierte Mann am Tisch war ein blasser, dünner Kerl, der mit den Fingern nervös auf seine letzte Karte trommelte. Der Glatzkopf jedenfalls ließ sich Zeit mit seinem Zug und musterte mich abschätzend. Ich hatte das dumpfe Gefühl, dass er es aus irgendeinem Grund auf mich abgesehen hatte. Allerdings war das nicht ungewöhnlich. In den meisten Städten, in denen wir königliche Boten auf unseren Reisen durchkamen, waren wir keine gern gesehenen Gäste. Schließlich war König Gaspare und damit gleichzeitig alle, die für ihn arbeiteten, schuld an der Armut des Reichs. Da konnten die Menschen noch so viele Hexen verbrennen. Hinter vorgehaltener Hand war Gaspare das Schlimmste, was Rascara je passiert war. Über den Gesang des Lautenspielers und das allgemeine Stimmengewirr in der Schenke hinweg hörte ich von draußen dumpf die Turmglocken läuten. Ungewöhnlich für diese Uhrzeit. Schließlich legte der Glatzkopf zu meiner Erleichterung einen Herzbuben auf den Tisch. Zwar war ich bemüht, mir keine Regung anmerken zu lassen, doch ein kurzes Lächeln konnte ich mir nicht verkneifen. Ich würde diesen einen Stich, wie zu Rundenbeginn angekündigt, machen und mit einem Sack voll Münzen Heim kehren. Wie zu erwarten, hatte der Muskelprotz links neben mir keine gute Karte mehr in der Hand und legte lediglich eine Treff Sieben. Triumphierend warf ich meinen Herz Reiter auf den Tisch. Meine Lieblingskarte hatte mich noch nie im Stich gelassen. Zu meiner Verwunderung grinste der Glatzkopf so breit, dass es seinen Schädel zu spalten schien. Der dürre Mann zu meiner Rechten legte seine letzte Karte. Einen Herz König.
Ich sprang vom Stuhl auf. »Betrug!« Meine Hand wanderte zu meinem Dolch am Gürtel.
Der Muskelprotz neben mir sprang ebenfalls auf, beugte sich über den Tisch und packte den dürren Mann am Kragen. »Du hast geschummelt!«.
Das hatte er, denn es war bereits ein Herz König ausgespielt worden. Da war ich mir sicher. Während der Muskelprotz den dürren Mann schüttelte, wischte der Glatzkopf seelenruhig mit seinem Arm alle Münzen vom Tisch in einen Sack.
»He!«, schnauzte ich, »was macht Ihr da?«
»Nehmen, was uns gehört«, sagte er mit sonorer Stimme.
»Uns?« Ich sah von ihm zum dürren Mann im Schwitzkasten des Muskelprotzes. Und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen: »Ihr habt gemeinsame Sache gemacht!«
Der Glatzkopf lachte und schnürte den Sack zu.
Dann ging alles ganz schnell. Der Muskelprotz ließ den dürren Mann fallen und rammte seine Faust ins Gesicht des Glatzkopfes. Warum diesem inzwischen so viele Zähne fehlten, war mir nun klar. Allerdings ging der Glatzkopf nicht zu Boden, sondern zum Gegenangriff über. Er rammte den Muskelprotz hart, der daraufhin über den Stuhl fiel. Dieser wiederum griff sich den Stuhl und schleuderte ihn gegen den Glatzkopf. Der schrie vor Wut auf. »Luigi, schnell!«
Der dürre Mann rannte so flink wie ein Wiesel um den Tisch, griff sich den Sack voll Münzen und bahnte sich dann einen Weg durch die Gäste, die bereits einen Kreis um unseren Kampf bildeten. Es ging doch nichts über eine schöne Schlägerei zu später Stunde. Ich sah noch einmal zu den kämpfenden Giganten, dann hatte ich meine Entscheidung getroffen. Diesem Glatzkopf ein blaues Auge oder einen weiteren Zahn auszuschlagen, war zwar verlockend, aber verdammt, die beiden hatten mich um zweihundert Talleri gebracht, die ich dringend gebrauchen konnte. Ich entschied mich, die Verfolgung von dem Wiesel aufzunehmen. Schnell bahnte ich mir meinen Weg durch den Schankraum und hinaus auf die Gasse. Es war schon weit nach Mitternacht, in wenigen Stunden würden bereits die ersten Menschen aufstehen, um ihren täglichen Beschäftigungen nachzugehen. Eine kühle Brise wehte durch die Stadt und der Geruch von Rauch lag in der Luft. Ich sah mich um. Von dem Wiesel war keine Spur zu sehen. Die Gasse lag still da, doch in der Ferne hörte ich Gezeter, als sei Markttag und die halbe Einwohnerschaft auf den Beinen. Was war hier los? Da machte ich im Augenwinkel eine Bewegung am Ende der Passage aus. Das musste der verdammte Dreckskerl sein. Den Dolch fest in der Hand nahm ich die Verfolgung auf. Als ich am Ende der Gasse um die Biegung spähte, blickte ich auf einen größeren Platz, von dem etliche schmale Straßen tiefer in die Stadt hineinführten. Wo war dieser verdammte Dreckskerl mit meinem Geld abgeblieben? Erneut machte ich eine Bewegung aus. Eine Gestalt schlich, eng an die Außenmauer gepresst, in Richtung des Osttors. Ich wollte gerade zum Angriff übergehen, als sie in den Schein einer Fackel trat. Das war nicht der dürre Mann namens Luigi. Diese Person war völlig in schwarz gekleidet, den Kopf hatte sie mit einer großen Kapuze verdeckt. Schnell schob ich mich zurück hinter die Biegung, um weiter unbemerkt zu beobachten. Verdammt, ich hatte Luigi verloren, aber diese Gestalt schlich hier wie ein Räuber in der gespenstisch verlassenen Stadt herum. Irgendetwas ging hier vor sich. Ich sah hinauf zu den Wachtürmen des Osttors und runzelte die Stirn. Es war keine Wache zu sehen. Seltsam. Hatten die Turmglocken deshalb geläutet? War Gefahr in Verzug? Die in schwarz gehüllte Person schob sich weiter an der Außenmauer entlang und hielt geradewegs auf den Hexenturm zu. Plötzlich erregte ein Aufblitzen am Ende des großen Platzes in der gegenüberliegenden Gasse meine Aufmerksamkeit. Meine Augen hatten sich noch nicht vollends an die Dunkelheit der Nacht gewöhnt, doch ich glaubte, etwas zu erkennen. Kauerten dort mehrere Personen? Ich kniff die Augen zusammen. Wieder blitzte etwas auf. Mondschein auf silberne Rüstung. Mein Herz hämmerte wie wild. Da hinten in der gegenüberliegenden Gasse hockte die Stadtwache, die eigentlich oben auf den Wachtürmen hätte postiert sein müssen. Was zur Hölle taten sie da? Ich sah wieder zu der verhüllten Gestalt, die inzwischen das Osttor erreicht hatte. Kurz sah sie über ihre Schulter und schlüpfte dann durch die Tür des Hexenturms. Wie auf Kommando kam Bewegung in die Wachen. Stirnrunzelnd blickte ich auf die Tür, in der die Gestalt verschwunden war. In meinem Kopf begann es zu rattern. War das etwa …? Nein, das konnte nicht sein. In einer so großen Stadt doch nicht. Andererseits, warum sollten sich sonst Wachen in einer Gasse versteckt halten? Für morgen standen drei Hexenverbrennungen bevor. Die Scheiterhaufen hatte ich bei meiner Ankunft gesehen. Es konnte nicht anders sein. Die Gestalt, die gerade im Hexenturm verschwunden war, musste Aradia sein. Aradia, die gerade dabei war, ihre Hexenfreundinnen zu retten und der man eine Falle gestellt hatte. Ich grinste. Zwar hatte ich gerade eben zweihundert Talleri verloren, doch vielleicht hatte mir der Herz Reiter trotzdem Glück gebracht. Wenn ich Aradia zu König Gaspare brachte, würde ich fünftausend Talleri bekommen und vielleicht noch mehr. Es war das Risiko wert. Den Stadtwachen jedenfalls wollte ich diesen Triumph nicht überlassen. Schnell wandte ich mich um und rannte zurück zur Schenke. Es blieb nicht viel Zeit.
Aradia
Vor mir ragte frei vom Rauch und Qualm der brennenden Scheiterhaufen der Hexenturm in den Nachthimmel. In die Schatten der Mauer gepresst schlich ich vor bis zum Stadttor und lugte vorsichtig um die Ecke. Es waren keine Wachen zu sehen. Mein Ablenkungsmanöver war aufgegangen. Schnell rannte ich zur Tür des Hexenturms, die mit unzähligen Amuletten behangen war. Schutzzauber für die Bewohner der Stadt. Sie sollten die Kräfte der vermeintlichen Hexen im Turm bannen. Ich schüttelte darüber nur den Kopf, sah noch einmal über die Schulter und schlüpfte dann durch den Eingang. Eine steile Wendeltreppe führte nach oben. Ich fasste unter meine Kapuze und zog aus meinen zusammengebundenen Haaren eine feine Nadel heraus. Mit ihr würde ich das Schloss der Zelle knacken. Mir blieb nicht viel Zeit. Allzu lang würden auch drei brennende Scheiterhaufen die Stadtbewohner und Stadtwachen nicht fernhalten. Schnell rannte ich die Treppe hinauf. Oben angekommen keuchte ich vor Anstrengung und stützte meine Hände in die Seiten. »Habt keine Angst. Ich bin Aradia, Retterin der Hexen, und ich werde euch befreien.«
Dann sah ich auf und keuchte erneut. Nicht mehr vor Anstrengung, sondern vor Schreck. Die Gittertür der Zelle stand sperrangelweit offen. Von den drei verurteilten Frauen fehlte jede Spur. Verwirrt lief ich in die verwaiste Zelle und drehte mich um die eigene Achse. Es sah so aus, als wenn nie jemand dort gewesen wäre.
»Angriff!«, brüllte auf einmal eine Männerstimme von draußen.
Ich hastete aus der Zelle und wollte schon die Treppe nach unten eilen, als ich dort bereits etliche Schritte hörte. Mein Herz zog sich zusammen. Sie hatten mir eine Falle gestellt. Und ich war hineingetappt. Verzweiflung machte sich in meiner Brust breit. Panisch suchte ich nach einem Ausweg. Mein Blick fiel auf das gelbglasige Fenster des Hexenturms. Ich hatte keine Zeit, lange zu überlegen. Mit einem kräftigen Tritt zerschlug ich die Fensterscheibe. Ich sah hinunter und mein Herz krampfte abermals. Es ging sicher acht Mannslängen in die Tiefe. Die Schritte hinter mir wurden lauter. Ich griff unter meinen Umhang und zog ein Seil heraus. Schnell band ich es um eine Eisenstange der Zellentür und schwang das andere Ende aus dem Fenster. Ich kletterte auf den Sims, bedacht, mich nicht an den Scherben des Glases zu schneiden und umgriff fest das Seil. Ein Blick nach unten ließ mich schaudern, doch ich hatte keine andere Wahl. Mit den Füßen fest an die Steinmauer gestemmt, kletterte ich hinab.
»Die Hexe flieht! Wachen wieder nach unten!«, gab eine Wache von oben den Befehl.
Das Adrenalin schoss mir in den Kopf. Schneller, ich musste schneller klettern. Ich hatte es fast geschafft, als plötzlich die Spannung des Seils verloren ging. Einen kurzen Moment fühlte ich mich schwerelos. Das gehässig lächelnde Gesicht einer Stadtwache blickte zu mir hinab.
»Wir sehen uns unten«, röhrte die Wache und hob das Schwert wie zum Gruß.
Ihr Bastarde, dachte ich. Dann fiel ich. Der Aufprall war schmerzhaft. Jegliche Luft wurde aus meiner Lunge gepresst. Für einige wenige Augenblicke dachte ich, das hier sei das Ende, doch dann sog mein Körper gierig neue Luft ein. Ich hustete und keuchte, drehte mich schließlich auf die Seite und stemmte mich auf alle Viere. Ich durfte nicht aufgeben. Ich durfte den Wachen nicht in die Hände fallen. Fliehen, ich musste fliehen. Es war dieser Gedanke oder der pure Fluchttrieb, der mich zu fast übermenschlichen Fähigkeiten brachte. Ich rappelte mich auf und rannte los. Den Weg zurück, den ich gekommen war. Ich rannte um mein Leben.
»Ergreift sie!«, befahl eine Wache hinter mir.
Ich hörte Schritte und das Klappern von Rüstungen, sah mich aber nicht um. Ich sah stur geradeaus, hoffend, dass das Stadttor bald in Sichtweite kam. Doch war das klug? Wäre ich auf offenem Feld, in der Menge der Menschen bei den brennenden Scheiterhaufen nicht leichte Beute? Sollte ich mich nicht lieber in den Winkeln der Stadt verstecken? Doch nichts dergleichen würde passieren. Das Herz sank mir in die Hose als ich weitere Stadtwachen mir entgegenrennen sah. Nun saß ich endgültig in der Falle.
»Gebt mir Eure Hand!«, rief jemand plötzlich von hinten. Ich hörte schnelles Getrappel von Pferdehufen. Mitten in der beengten Stadt. Ich drehte mich um. Die Wachen waren mir dicht auf den Fersen, als sie auf einmal zur Seite ausbrachen. Ein Reiter ritt scharf an ihnen vorbei und hielt direkt auf mich zu.
»Schnell, gebt mir Eure Hand!«, forderte der Reiter mich erneut auf und zügelte seinen Schimmel. Wild bäumte sich das Pferd neben mir auf. Der Reiter, der seine Kapuze wie ich tief ins Gesicht gezogen hatte, streckte mir seine Hand entgegen. »Schnell!«
Ich sah nochmal nach rechts. Die Wachen hatten uns fast erreicht. Ich ergriff seine Hand und ließ mich hinter ihn auf den Pferderücken ziehen. Der Fremde gab dem Schimmel kräftig die Sporen. Schnell schlang ich meine Arme um ihn. Die herannahenden Wachen warfen sich schützend auf die Seite, als wir mitten durch sie hindurch ritten.
»Die Hexe flieht«, warnte eine der Wachen.
»Schließt die Tore!«
Doch das Glück war uns hold. Gerade als das Stadttor sich knarrend nach unten bewegte, ritten wir hindurch, hinaus aufs offene Feld.
Wir ritten über die Wiese, an den qualmenden und teilweise immer noch lichterloh brennenden Scheiterhaufen vorbei und ließen die überraschte Menschenmenge hinter uns. Der Reiter spornte sein Pferd weiter an. Rechts, hinter der Stadt, erhoben sich die Berge. Das dortige Gelände bei Nacht zu betreten war zu gefährlich. Und so hielten wir in bahnbrechendem Tempo auf die offene Ebene zu. Ich war es nicht gewohnt, zu reiten und schlang daher meine Arme fest um meinen Retter. Plötzlich zischte etwas an meinem rechten Ohr vorbei. Ich wandte den Kopf und sah, wie uns zwei Reiter verfolgten.
»Schneller. Zwei Stadtwachen sind uns dicht auf den Fersen!«, schrie ich gegen den Wind an.
Ein zweiter Pfeil schoss nur knapp an meinem linken Arm vorbei.
»Verdammt!«, fluchte der Mann, an den ich mich klammerte. »Tut etwas!«
»Was soll ich machen?« Ich wandte erneut den Kopf. Die Reiter hatten weiter aufgeholt.
»Woher soll ich das wissen? Lasst einen Blitz auf sie niedergehen oder lasst die Erde sie verschlucken. Ihr seid die Hexe.«
Panisch starrte ich auf den Rücken des Fremden. Natürlich dachte er, ich sei eine Hexe und ich konnte ihm schlecht sagen, dass ich es nicht war. Zumal die Situation nicht gerade Zeit für einen gemütlichen Plausch hergab. Die Reiter waren inzwischen nur noch zwei Pferdelängen hinter uns, die Lichter der brennenden Scheiterhaufen wurden immer kleiner, plötzliche Dunkelheit hüllte uns ein. Der Wind schnitt mir scharf ins Gesicht. Es war nur noch eine Frage der Zeit, bis wir gefangen genommen oder tot sein würden. Ich schloss die Augen. Unfähig vor lauter Panik überhaupt noch einen klaren Gedanken fassen zu können.
Auf einmal wieherte hinter uns eines der Pferde.
»Was passiert hier?«, rief einer der Männer mit bebender Stimme.
Ich öffnete die Augen und sah über die Schulter, dass die Reiter ihr Tempo drosselten, zu meiner Verwunderung tat dies ebenfalls der Fremde.
Ich blinzelte verwirrt. Die Dunkelheit war plötzlich über uns hereingebrochen, heimtückisch und unbemerkt. Erst mit Verzögerung wurde mir klar, dass sie vom Himmel kam. Mein Blick wanderte hinauf, zum Vollmond – oder dem, was von ihm übrig war. Ein Schauer durchlief mich. Der Mond, einst hell und strahlend, wurde fast vollständig verschluckt, als hätte ein gigantisches Ungeheuer den Großteil in seine unsichtbare Kehle gleiten lassen. Einzig ein schmaler Sichelrand blieb übrig, kaum genug, um den Weg zu erleuchten. Keine Wolke bedeckte den Himmel, und dennoch verschwand der Mond in dieser gespenstischen Finsternis.
Angst packte mich, tief und uralt. Meine Hände begannen zu zittern, und ich war nicht allein in meiner Furcht. Unsere Verfolger hielten plötzlich inne. Ich glaubte, ihre Köpfe gen Himmel gewandt zu sehen.
»Der Mond verschwindet!« Die Stimme der Stadtwache hallte in der drückenden Stille der Nacht umso lauter wider.
Auch der Fremde an meiner Seite zügelte sein Pferd. Es scharrte nervös mit den Hufen. Die Dunkelheit lastete auf uns wie eine schwere Decke. Man konnte kaum noch etwas sehen, außer den fahlen Schatten, die über den Boden glitten. Inmitten dieser überwältigenden Angst hatte ich einen plötzlichen Einfall. Ohne nachzudenken, sprang ich vom Pferd und richtete mich mit erhobenen Händen zum fast vollständig verschwundenen Mond auf, als könnte ich seine magische Kraft lenken.
»Maleficium maleficarum!« Meine Stimme bebte nicht, sondern hallte fest und sicher durch die Finsternis. Diese Worte, einst im Flüstern der Hexenprozesse gehört, kamen mir wie ein machtvoller Zauberspruch vor. Ihre genaue Bedeutung war mir unbekannt, doch Latein klang nach dem Omen, das in die Herzen dieser Männer Furcht säen würde. Es spielte keine Rolle, ob es Sinn ergab. In diesem Moment wollte ich die Angst derer, die uns jagten, zu meiner eigenen Waffe machen.
»Aradia lässt den Mond verschwinden!«, schlug eine der Stadtwachen Alarm.
»Verdammt, nichts wie weg hier«, schrie der andere, seine Furcht war deutlich zu hören.
Der donnernde Hufschlag ihrer Pferde durchbrach die Finsternis, als sie in wilder Panik flohen.
Ich stand reglos, die Arme noch immer zum Himmel erhoben, den Atem flach und stoßweise. Mein Blick war zum Himmelszelt gerichtet, wo vor einer Stunde noch der majestätische Vollmond geleuchtet hatte. Nun war er vollständig verschwunden, als wäre er von einem dunklen Schlund verschlungen worden. Alles, was blieb, war ein fahler, fast geisterhafter Schein, ein schwaches Leuchten, das die Stelle markierte, wo er einst gehangen hatte.
Doch dann, ganz allmählich, begann sich der Mond wieder zu zeigen – allerdings nicht wie zuvor. Statt silbernem Licht schimmerte er nun in einem tiefen, unheilvollen Rot. Der Mond schien zu bluten. Es war, als sei der Himmel selbst verflucht.
»Beim Allmächtigen«, flüsterte der Fremde voll ehrfürchtigem Erstaunen. »Ein Blitz hätte auch gereicht. Aber das hier …« Er ließ den Satz unvollendet.
Ich hatte den Mond weder verschwinden noch sich rot färben lassen, das wusste ich – und dennoch schien es, als ob irgendeine uralte Magie auf meinen verzweifelten Ruf geantwortet hatte. Meine Hände, noch immer erhoben, zitterten leicht, als ob sie die Kälte der dunklen Nacht eingefangen hätten.
»Bleibt der Mond jetzt für immer so?«
Ich hörte die Angst in seinen Worten mitschwingen.
Langsam ließ ich meine Arme sinken, mein Herz raste. Der Blutmond, der am Nachthimmel prangte, strahlte eine düstere Macht aus, die mich frösteln ließ. Ich hatte keine Ahnung, was hier vor sich ging und genauso viel Angst wie der Fremde und unsere Verfolger. Aber um meine Rolle weiterzuspielen, durfte ich sie nicht zeigen.
»Das entscheide ich, wenn ich in Sicherheit bin«, antwortete ich schlicht.
»Dann lasst uns weiterreiten«, entschied der Mann, hielt mir seine Hand hin und half mir aufs Pferd. Meine Beine fühlten sich schwer und zittrig an, doch ich schaffte es irgendwie, mich festzuhalten.
Das Pferd setzte seinen schnellen Schritt fort, und die Hufe schlugen dumpf auf den Boden. Der Blutmond hing noch immer bedrohlich über uns, wie ein stummer Wächter über unserem Schicksal. Mein Herz raste vor Angst und Erschöpfung, und ich klammerte mich an den Fremden, ohne wirklich zu wissen, was ich tun sollte.
Jeden Moment erwartete ich, dass unsere Verfolger zurückkehren würden, dass sie uns entdecken und erneut über uns herfallen würden, doch nichts dergleichen geschah. Die Nacht blieb still, abgesehen von dem rhythmischen Stampfen der Hufe und dem gelegentlichen Rascheln der Blätter. Wir ritten mehrere Stunden und allmählich bemerkte ich, wie das Licht sich veränderte. Das unheilvolle rote Glimmen begann zu verblassen. Die Blutmondnacht, die wie ein Fluch über uns gehangen hatte, wich langsam silbernem Licht. Ich hob den Kopf und sah, wie sich der Schatten langsam zurückzog. Erhellt von einem fahlen Schimmer, kehrte der Mond nach und nach zu seiner vollen, weißen Pracht zurück.
Meine Schultern entspannten sich leicht, als ob der Bann, der uns in der Dunkelheit gefangen gehalten hatte, endlich gebrochen war. Das Pferd schnaubte leise, es schien ebenfalls Erleichterung zu spüren, als die Welt wieder in ein sanfteres Licht getaucht wurde.
»Die Finsternis ist vorbei«, flüsterte ich, fast ungläubig.
»Ja«, antwortete der Fremde knapp, während er das Pferd nun langsamer führte. Als die erste Spur des Morgens am Horizont zu erahnen war, ritten wir in den Wald. Der Himmel begann sich in ein blasses Grau zu hüllen, und das bleiche Licht des anbrechenden Tages brach sich zwischen den Bäumen.
Schließlich, als die Dämmerung den Wald ganz erfasst hatte, traten wir aus dem Dickicht auf eine Lichtung. Vor uns breitete sich ein offenes Feld aus, das vom sanften Morgennebel durchzogen war. Das Gras unter den Hufen des Pferdes war feucht vom Tau, und in der Ferne konnte man das Zwitschern der ersten Vögel hören. Es war, als hätten wir einen anderen Ort erreicht, fernab der Bedrohungen der Nacht. Wir hielten an. Der Fremde stieg ab und half mir vom Pferd. Meine Beine waren taub und zitterten vor Erschöpfung. Er führte das Pferd ein paar Schritte weiter, und wir beide standen still, der Wald hinter uns, in dem die Dunkelheit noch leise nachhallte.
»Hier werden sie uns nicht mehr finden«, meinte er leise. Sein Blick war auf den Horizont gerichtet, wo die ersten Sonnenstrahlen zaghaft durch den Morgennebel brachen. Dann klopfte er auf den Widerrist des Pferdes. »Gut gemacht, alte Dame.« Der Fremde drehte sich zu mir um und endlich konnte ich im Morgengrauen mehr vom Gesicht meines Retters erkennen. Auch wenn ihn seine Bartstoppeln ein wenig älter aussehen ließen, so schätzte ich ihn auf Anfang Zwanzig. Seine eisblauen Augen waren wachsam auf mich gerichtet. Er war groß, nicht breit gebaut wie ein Soldat, aber dennoch muskulös. Seine eng anliegende Reiterhose zeigte starke Beine. Er war offenbar viel zu Pferd unterwegs. Zweifellos war mein Gegenüber attraktiv. Um seine Schultern trug er einen dunkelroten Umhang. Keine preiswerte Ausstattung, wie ich feststellen musste.
»Warum habt Ihr mir geholfen?«, fragte ich und zog meine Kapuze tief ins Gesicht. Auch wenn mir dieser Fremde das Leben gerettet hatte, durfte ich ihm nicht blind vertrauen. Niemand kannte mein Gesicht und das sollte so bleiben. Der Schock, beinahe in die Falle der Stadtwache getappt zu sein, saß immer noch tief.
»Keine Dankesworte?« Seine Lippen umspielte ein belustigtes Lächeln. Er musterte mich von oben bis unten.
Lächerlicherweise schoss mir dabei das Blut in den Kopf. »Ihr habt Recht, wo sind nur meine Manieren. Habt Dank, edler Reiter«, sagte ich daher ein wenig unwirsch und machte einen kleinen Knicks. Es gefiel mir nicht, dass der Fremde eine derart anziehende Wirkung auf mich hatte. Ich war Aradia, die Hexenretterin, vor der die meisten Angst hatten. Kein naives Mädchen, das sich von jungen Männern den Kopf verdrehen ließ. Ich hatte ein Ziel und auf meinem Weg dorthin gab es keinen Platz für Spielereien.
»Edler Reiter«, der Fremde lachte, »da liegt Ihr ganz falsch.« Er kam näher, doch als ich zurückwich, blieb er stehen. Sachte hob er seine Hände und zog seine Kapuze nach unten. Er hatte kurz gelocktes, aschblondes Haar. »Ich bin nur ein einfacher junger Mann, der die Hexenverfolgungen genauso hasst wie Ihr.«
Skeptisch blickte ich zu ihm auf. Noch nie hatte ich, außer meinen Vater, jemanden die Hexenverfolgungen verurteilen gehört. Es gab zwar einige, die unserer Meinung waren, die ebenso einen geliebten Menschen zu Unrecht verloren hatten, doch seine Meinung offen kundzutun war in diesen Zeiten gefährlich.
»Wen habt Ihr verloren?«, fragte ich.
Mein Retter wirkte kurz irritiert, schüttelte dann aber den Kopf. »Das ist schon lange her«, er machte eine kurze Pause, »Wie dem auch sei. Ich glaube nicht an eine Hexenverschwörung. Ich glaube, dass viel zu viele zu Unrecht sterben.«
Fasziniert musterte ich den Fremden. Wer war dieser Mann, der mit dem Feuer spielte?
»Es heißt immer, die Zauber finden im Geheimen statt. Die Hexe hat des Nachts die Hühner des Bauern verzaubert. Oder die Hexen treffen sich auf dem Drachenberg und brauen einen Trank, der den Himmel verdüstert und Blitz und Donner bringt. Aber auf frischer Tat ertappt hat sie nie jemand.«
Die Worte meines Vaters. Meine Mutter war wegen genau solcher fadenscheiniger Aussagen der Bauersfrau verurteilt worden. »Ihr seid mutig, solch heikle Meinungen einer Fremden gegenüber zu äußern.«
Der Mann grinste nun breit. »Eine Fremde. Soso. Wenn Ihr mich verratet, sage ich einfach, Ihr hättet meine Sinne verhext. Gesucht werdet Ihr seit langem, niemand würde Euch glauben.«
Ich wich zurück.
»Nein, schon gut«, er hob beschwichtigend die Hände, »so war das nicht gemeint.«
Ich kniff die Augen zusammen.
»Die einzige Hexerei, die ich je gesehen habe, war Eure heute Nacht. Ihr seid es doch? Aradia, Königin und Retterin der Hexen. So werdet Ihr vom Volk genannt, nicht wahr?« Der Fremde sah mich neugierig an und versuchte ungeniert unter meine Kapuze zu schauen.
Ich schluckte. »Ein Name, nichts weiter. Und ketzerisch zugleich.«
Er grinste. »Was habt Ihr nun vor? Was sind Eure nächsten Pläne?«
Ich verschränkte meine Arme vor der Brust. Von hier war es noch eine Tagesreise zurück in mein Heimatdorf. Dort würde ich meine Kleidung ablegen und wieder meinem normalen Dasein als Müllerstochter nachgehen. Keiner wusste von meinem Geheimnis. Noch nicht einmal mein Vater. »Warum sollte ich Euch das sagen?« So langsam irritierte mich die Fragerei des Fremden. Ja, er hatte mir das Leben gerettet. Aber ich war ihm nichts schuldig, oder? Die Bäume hinter mir standen eng beieinander. Ein Pferd würde es schwer haben, mir durch das Dickicht zu folgen. Wenn ich jetzt losrannte, könnte ich …
»Weil ich Euch helfen will, unschuldige Frauen und Mädchen vor dem Scheiterhaufen zu retten.«
Sein Satz traf mich mitten ins Herz. Der Fremde stand vor mir, zeigte keine Unsicherheit. Er meinte es ernst.
»Wer seid Ihr?«, fragte ich. Dass sich unter meiner Kapuze meine Augenbrauen zusammenzogen, konnte er nicht sehen.
»Euer Freund.«
»Nein, sagt mir Euren Namen!«
Der Reiter atmete tief ein und aus. »Fabio.«
»Und weiter?«
»Cavalli. Mein Name ist Fabio Cavalli, und ich war Bote des Königs.«
»Ein Mann des Hofs. Bei Eurer Kleidung habe ich gleich daran gedacht.« Ich lachte. Traue niemals einem Höfling, hatte mir meine Mutter vor vielen Jahren gesagt, als ein hochnäsiger Steuereintreiber des Königs versucht hatte, meinen Vater zu betrügen und mehr als nur den Zehnten zu verlangen. »Ich danke Euch vielmals für Eure Rettung. Seid gewiss, sollte eine Cavalli je der Hexerei bezichtigt werden, helfe ich. Das bin ich Euch schuldig. Aber nun gehe ich wieder meiner eigenen Wege.« Ich wandte mich um und trat zwischen die Bäume. Das Laub unter meinen Schuhen raschelte.
»Ich habe dem Königshaus den Rücken gekehrt. Seither streife ich durch die Lande, um Euch zu finden. Die legendäre Hexenretterin.«
»Dann seid Ihr ein Narr!« Ich lief unbeirrt weiter. Wie naiv konnte dieser Fabio sein? Auch er war heute Nacht nur knapp dem Tod entkommen. Wenn uns die Pfeile getroffen hätten …
Bei dem Gedanken lief es mir kalt den Rücken runter.
»Ich bin nicht der Einzige«, rief er mir hinterher, »Ich habe gut ein Dutzend Leute zusammengebracht, die so denken wie wir beide.«
Jetzt blieb ich stehen. Ein Ast unter meinen Schuhen zerbrach.
»Was glaubt Ihr, wie lange Ihr noch allein Retterin der Hexen spielen könnt? Ihr arbeitet mit der Angst der Menschen. In den abgelegenen Dörfern führt Euer Auftauchen vielleicht noch dazu, dass man von den Frauen ablässt. Hingegen hier in den großen Städten ist das Wagnis zu groß. Das hat Euch die heutige Nacht hoffentlich gelehrt. Und wie lange werdet Ihr mit Euren Rettungsaktionen überhaupt noch erfolgreich sein, wenn die Truppen Eabans in Rascara einmarschieren? Wenn sie die Dörfer plündern? Wem geben die Menschen wieder die Schuld für ihre Misere?«
Es war eine rhetorische Frage. Natürlich würden die vermeintlichen Hexen als Sündenböcke herhalten müssen. Ich zwang mich, bei Fabios Worten, weiter ruhig zu atmen.
»Die Truppen belagern bereits die gesamte westliche Grenze. Wusstet Ihr das?«
Das Herz sank mir in die Hose. Dass sich der Konflikt zwischen Rascara und Eaban bereits so zugespitzt hatte, hatte ich nicht gewusst. Ich drehte mich zu Fabio um. Er war mir bis zu den ersten Sträuchern gefolgt.
»Gemeinsam sind wir stark. Gemeinsam können wir Größeres bewirken«, Fabio kam noch ein paar Schritte auf mich zu, »Schließt Euch uns an. Seid unsere Anführerin im Kampf gegen den Hexenwahn des Königs.«
Der Hexenwahn des Königs. Ich sah die Feuer um die Körper der Frauen züngeln, ich hörte die verzweifelten Schreie in meinem Kopf, ich roch den beißenden Geruch von verbranntem Fleisch. Ich sah, wie sich die Lippen meiner Mutter zu den Worten formten: »Ich werde immer bei dir sein«, ehe die Flammen und der Rauch sie verbargen. Schnell blinzelte ich die Tränen fort. Hoffnungsvoll blickte Fabio mich an. Und seine strahlenden Augen hielten mich gefangen.
»Wo habt Ihr euer Versteck?«, fragte ich nach kurzem Zögern. Dieser unverschämt gut aussehende Mann hatte leider mein Interesse geweckt, auch wenn mein Verstand mir zuschrie, besser zu gehen.
Fabio atmete erleichtert aus. »Kein Versteck, wie Ihr es vielleicht habt«, er wartete kurz, ob ich etwas dazu sagte, doch da ich schwieg, fuhr er fort, »Kennt Ihr die Schenke Zum vollen Krug?«
Ich kniff die Augen zusammen. »Das zwielichtige Gasthaus zwischen Sedura und Triessa?«
Fabio nickte. »Genau das. Der Wirt ist einer von uns. Wir treffen uns dort einmal im Monat. Nächste Woche, am Feria Sexta, ist es wieder so weit. Kommt dazu und lernt uns kennen.«
Ich ging ein paar Schritte auf ihn zu. »Ihr wollt mir erzählen, dass sich mehrere Leute – Leute die sich dem Befehl des Königs widersetzen – einmal im Monat in einer heruntergekommenen Schenke treffen?«
Fabio hob erneut beschwichtigend die Hände und zeigte zugleich ein listiges Lächeln. »Herunterkommen ist genau das richtige Stichwort.«
Ich stutzte. Eine unbeachtete Schankstube war vielleicht tatsächlich gar keine so schlechte Idee. Zumindest konnte selbst der König niemandem ein Dunkelbier in geselliger Runde verbieten. »Wann genau trefft ihr euch?«
»Immer nach Einbruch der Nacht.«
Ich nickte.
»Klopft im Rhythmus unserer Nationalhymne an die Tür. Dann können wir Euch zuordnen.«
Ich grinste. Das gefiel mir.
»Also, was sagt Ihr? Sind wir ab jetzt Gefährten?« Fabio streckte mir seine Hand entgegen.
Ich zögerte einen kurzen Moment. Ich war viele Monate über allein gut zurechtgekommen. Hatte dutzende Frauen vor dem Scheiterhaufen bewahrt. Andererseits, wenn die Truppen Eabans tatsächlich kurz davorstanden, in unser Land einzumarschieren, war es vielleicht an der Zeit, sich Gleichgesinnten anzuschließen. Noch dazu war ich heute nur knapp meiner Gefangennahme entkommen. Allein mit Hilfe dieses Mannes, der sich Fabio Cavalli nannte, steckte mir kein Pfeil im Rücken. Vielleicht war es also Zeit, neue Wege zu beschreiten. Neue Wege, um meine Mutter zu rächen und den Hexenwahn des Königs zu besiegen. Ich trat noch einen Schritt auf Fabio zu und schlug ein. »Ich komme zu Eurem nächsten Treffen und dann sehen wir, ob wir Gefährten werden oder nicht.«
Fabio nickte. »Wir werden Euch nicht enttäuschen.«
»Das hoffe ich.«
Noch immer hielten wir uns an den Händen. Fabio stand nun so dicht vor mir, dass ein leichter Geruch von Heu und Dunkelbier meine Nase umspielte. Nun konnte er auch meine Augen sehen. Und er hielt mich wieder mit diesem intensiven Blick gefangen. Seine Iriden waren so blau wie das Gefieder der Eisvögel, die sich manchmal in den Wasserbecken vor der Mühle meines Vaters tummelten. Ich schluckte, weil ich spürte, wie sich Verlegenheit in mir breit machte. Kurz fiel sein Blick auf mein Dekolleté. Vielleicht machte ich den Fehler, etwas zu schnell den Anhänger meiner Kette zu greifen. Aber die Kette war alles, was mir von meiner Mutter noch geblieben war. Während er meine linke Hand nicht losließ, fasste Fabio schließlich mit seiner rechten sachte nach meiner geschlossenen Hand und öffnete sie. Irgendetwas in seinem Blick, veranlasste mich, ihm zu vertrauen.
»Das ist eine wunderschöne Kette«, murmelte er, während er sich den Anhänger näher besah. Zwei Falten bildeten sich dabei auf seiner Stirn. Ich hielt den Atem an.
Auf der Vorderseite des silbernen, ovalen Anhängers war ein Sternensymbol eingraviert. Acht Linien, die sich in der Mitte trafen. Meine Mutter hatte mir erzählt, das Symbol bedeute Freiheit und Inspiration. Für mich bedeutete es mein Ziel, die Hexenverfolgungen zu bekämpfen, nie aus den Augen zu verlieren. Fabio strich über den Stern und drehte den Anhänger herum.
»Velia«, las er den eingravierten Namen. Er blickte mir in die Augen und lächelte. »Ich dachte, Euer Name wäre Aradia?«
Ich schluckte. Ein Gefühl der Unsicherheit machte sich in mir breit. Dieser Mann wusste nun genug über mich. Ich nahm ihm den Anhänger aus der Hand und versteckte die Kette wieder unter meinem Mantel. »Auf Wiedersehen, Fabio Cavalli. Wir sehen uns schon bald wieder.« Dann trat ich zwischen die Bäume und ließ ihn allein am Waldrand zurück.
Fabio
Aradia verschwand im Dickicht des Waldes. Und ich stand wie betäubt zwischen den Bäumen. Wer war diese geheimnisvolle junge Frau? Sie kam mir nicht wie eine böse, satanische Hexenkönigin vor, wie es König Gaspare und sein Vertrauter Malfois immer propagierten. Den alten Legenden nach, war Aradia Tochter der beiden Gottheiten Diana und Lucifer. Diana schickte sie auf die Erde, um den geknechteten Menschen und unterdrückten Frauen die Hexerei zu lehren. Aradia versprach den unterdrückten Menschen universelle Freiheit. Und so wurde sie zur ersten Königin der Hexen. Nun, da die Hexen mit aller Macht verfolgt wurden, schien sie erneut auf die Erde zurückgekehrt zu sein. Seit vielen Monaten befreite sie bereits Frauen vor ihrer Verurteilung. Dutzende Hexen waren untergetaucht und konnten andernorts ihr Unheil vollbringen. König Gaspare hatte das Kopfgeld auf Aradia immer weiter erhöht, um seine Männer anzuspornen, dennoch war es niemandem gelungen, die Hexenkönigin zu fangen. Bis jetzt. Ich grinste. Fabio Cavalli, dem einfachen Boten des Königs, würde das Unmögliche gelingen. Allerdings schien diese junge Frau, die im Dickicht des Waldes verschwunden war, so gar nicht zu den alten Legenden über die Hexenkönigin zu passen. Ich hatte mir Aradia ganz anders vorgestellt. Älter, unheimlicher, dunkler.
Schlagartig ließ meine Anspannung nach, und Müdigkeit übermannte mich. Ich rieb mir über die Augen und lief zurück zu meinem Pferd. Diese junge Frau ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Ihr Gesicht war die meiste Zeit unter der Kapuze verborgen gewesen. Erst als wir am Ende nahe beieinandergestanden hatten, hatte ich mehr erkennen können. Klare, grüne Augen waren von rot gelockten Haarsträhnen eingerahmt gewesen. Ihre Haut hatte einen warmen Elfenbeinton. Ihre Wangen waren gesprenkelt von Sommersprossen, wie eine bunte Blumenwiese. Sie war wunderschön. War ich der erste Mann auf Erden, der Aradia zu Gesicht bekommen hatte? Bei diesem Gedanken kribbelte es in meinem Bauch. Vielleicht aber auch nur vor Aufregung. Ich war mit meiner Rettungsaktion ein großes Risiko eingegangen. Doch es hatte sich ausgezahlt. Das Lügenmärchen war mir so einfach über die Lippen gekommen. Sie hatte mir den Gleichgesinnten abgekauft. Ich schüttelte den Kopf. Alles an Aradia, angefangen von ihrem Aussehen bis hin zu ihrem Verhalten, stand im Gegensatz zu den Erzählungen des Königs. Aradia, die Knospe des Bösen, satanische Brut der vergangenen Gottheiten Diana und Lucifer. Trotzdem hatte sie mir nichts getan. Sie hatte sich mit mir wie eine ganz gewöhnliche junge Frau unterhalten. Einen Narren hatte sie mich genannt. Unweigerlich stahl sich ein Lächeln auf meine Lippen. Ja, vielleicht war ich ein Narr. Aber die Aussicht auf Gewinn und Aufstieg waren es wert. Der drohende Krieg mit Eaban hatte Aradia sichtlich zu schaffen gemacht. Erst als ich ihr von den eabanischen Truppen an der Westgrenze unseres Königreichs erzählt hatte, war sie auf mein Angebot, sich mir anzuschließen, eingegangen. Ich hatte mich zwingen müssen, meine Erleichterung darüber nicht zu deutlich zu zeigen. Sie hatte eingewilligt, mich wieder zu treffen. Mein Plan war aufgegangen. Ein siegreiches Grinsen trat auf mein Gesicht. Gleichzeitig hatte mich dieses Aufeinandertreffen mehr verwirrt als gedacht. Aradia. Ein Name, nichts weiter, hatte sie gesagt. Was, wenn wir alle mit unseren Vermutungen falsch lagen? Ihre Kette jedenfalls hatte mir einen irdischen Namen offenbart. »Velia.« Tief in Gedanken versunken, bemerkte ich erst jetzt, dass ich ihren Namen laut ausgesprochen hatte. Velia. Ich schüttelte meinen Kopf, um der Betäubung zu entrinnen. Hatte Aradia mich vielleicht verhext? Ich streichelte über die Mähne meiner Schimmelstute, die genüsslich das kalte Bergwasser des Flusslaufs trank. Heute Nacht hatte ich sie bis an ihre Grenzen getrieben. »Lass uns weiterreiten. Zu Hause bekommst du eine extra Portion Hafer«, sagte ich und klopfte auf ihren Widerrist. Ich schwang mich geschickt auf den Sattel. »Außerdem gibt es nun viel zu tun«, murmelte ich und lenkte mein Pferd in gemütlichem Schritttempo den Fluss entlang. In wenigen Stunden würde ich die Schenke Zum vollen Krugerreichen. Ich hatte einiges vorzubereiten.
Aradia
Gegen Mittag trat ich aus dem Wald und erreichte den Fluss Rano, der sich in großen Bögen durch die Ebene schlängelte. Ihm brauchte ich nur noch ein paar Stunden zu folgen, dann würde ich mein Zuhause erreichen. Ich vermied es auf meinem Weg zurück, Straßen zu benutzen. Noch war ich zu weit von Zuhause entfernt. Eine Frau, allein unterwegs und noch dazu ohne Gepäck, würde zu viel Aufsehen erregen. Außerdem kannte man inzwischen mein schwarzes Gewand. Dass ich als Frau Hosen trug, galt ohnehin als anstößig. Also lief ich querfeldein, streifte durch die hohen Gräser am Flussufer und folgte seinem Lauf. Hier war ich noch nie einer Menschenseele begegnet. Warum auch? Es gab hier nichts von Interesse. Die Fischereiplätze lagen nahe unserem Dorf bei der Stadt Cremonone. Genauso wie die Plätze für die Wäscherinnen. Seit ich heute Morgen Fabio Cavalli verlassen hatte, ging mir dieser Mann nicht mehr aus dem Kopf. Die Erinnerung an sein unverschämt gutaussehendes Lächeln und diese strahlend blauen Augen verursachten ein leichtes Ziehen in meiner Magengegend. Was hatten diese Augen Grausames gesehen, dass er freiwillig einer guten Stellung im Königshaus den Rücken gekehrt hatte und eine Rebellion anzettelte? Er hatte gesagt, er habe gut ein Dutzend Gleichgesinnte gefunden und zusammengebracht. Die Vorstellung war für mich unmöglich und faszinierend zugleich. Ich fasste an mein Dekolleté und spürte die Kette unter meiner Kleidung. Vielleicht würde mich dieser Fabio meinem Ziel, den Hexenverfolgungen ein für alle Mal ein Ende zu setzen, näherbringen.
Als die Sonne bereits gen Westen wanderte, sah ich endlich eine halbe Meile vor mir den Hain meiner Heimat. Die hohen Tannen standen dicht an dicht und ließen keinen Blick auf die Behausungen des Dorfes und die dahinter liegende Stadt zu. Als ich den Hain erreicht hatte und die Tanne mit dem Fliegenpilz zu ihren Füßen erblickte, begann ich die Baumreihe flussaufwärts zu zählen. An der siebten Tanne erblickte ich schließlich den großen Stein, der mein Versteck markierte. Ich lief zu dem Stein und rollte ihn zur Seite, sodass mein selbst gegrabenes Loch zum Vorschein kam. Ich griff hinein und zog einen kleinen Leinenbeutel hervor. In ihm ließ ich immer meine gewöhnlichen Kleider zurück, bevor ich mich in Aradia, Hexenretterin oder wie auch immer man mich nennen mochte, verwandelte. Ich zog meinen schwarzen Umhang, die schwarze Hose und das Oberteil sowie mein Halstuch aus. Schnell streifte ich mir wieder das weiße Unterkleid und das braune Kleid aus Leinen über den Kopf. Die schwarzen Kleider stopfte ich zurück in den Beutel. Dann griff ich ein zweites Mal in das Erdloch und holte meine kleine lederne Tasche sowie mein Gebetsbuch heraus. Letzteres band ich mir mit einer Kordel um die Hüfte. Das Gebetsbuch, für alle offen sichtbar, war meine Tarnung. Mein vermeintlicher Grund für mein Verschwinden an den Wochenenden. Töchter von zu Hexen verurteilten Frauen lehrte man in Gebetsschulen den wahren Glauben. Der König und diejenigen, die dem Hexenwahn Glauben schenkten, hofften so, junge Frauen und Mädchen vor Hexerei zu bewahren. Mein Vater war gezwungen gewesen, auch mich in eine solche Gebetsschule zu schicken. Drei Monate lang hatte ich jedes Wochenende die Predigten über mich ergehen lassen. Nun gab ich vor, weiterhin freiwillig dorthin zu gehen. Ich spielte die fromme Müllerstochter, die mit den Taten ihrer Mutter nichts zu tun haben wollte. Bei dem Gedanken traten mir Tränen in die Augen. Die Welt war so ungerecht. Bisher hatten mein Vater und die anderen Dorfbewohner nichts von meinen Lügengeschichten oder meiner Verwandlung in Aradia erfahren. Sollte jedoch irgendwann jemand Nachforschungen anstellen und mein Fehlen in der Gebetsschule bemerken, dann würde ich mit Sicherheit der Hexerei bezichtigt. Man würde behaupten, ich reise zu meinen Hexenfreundinnen beim Drachenberg. Eine wunderbare Ausrede, bekanntlich verließ den Drachenberg mit seinen Klippen und Höllentälern fast niemand wieder lebend, der sich in dieses unwegsame Gebiet begab.
Den Beutel mit meinen ketzerischen Kleidern legte ich wieder zurück ins Loch und rollte den Stein darüber. Ich strich mein Kleid glatt und sah an mir herunter. Jetzt war ich wieder ein einfaches Mädchen. Nichts weiter als eine gewöhnliche Müllerstochter.
Ich ging nicht mehr zurück zum Fluss, sondern lief mitten durch den kleinen Wald. Nach wenigen Schritten erreichte ich die Dorfstraße, der ich um eine Biegung folgte. Der Wald lichtete sich und nun sah ich weiter unten am Fluss Rano, mein Zuhause: die Wassermühle. Ein großes Backsteinhaus, das mit hölzernen Querbalken geschmückt war. Von hier oben konnte ich das große Mühlrad nicht sehen, aber wenn ich mich konzentrierte, konnte ich das Wasser rauschen und das Mühlrad klappern hören. Vor der Tür, die zum Innenraum der Mühle führte, stand ein großes Ochsengespann mit leerer Ladefläche. Ein freudiger Anblick, denn die Kundschaft wurde, je schlechter es unserem Königreich ging, immer weniger. Je weniger Kundschaft umso weniger Abgaben an den König und umso schlechter ging es dem Land, das unter der Misswirtschaft König Gaspares litt und sich durch Hexenverbrennungen Besserung erhoffte. Es war ein Teufelskreis. Ich seufzte und rannte das restliche Stück hinunter zur Mühle, vielleicht brauchte mein Vater Hilfe. Die harte Arbeit über viele Jahre hinweg hatten ihn gezeichnet. Er klagte immer öfter über starke Rücken- und Gelenkschmerzen. Es gab Tage, an denen er nicht das Bett verlassen konnte und die Arbeit vertrauensvoll seinem Gesellen überließ. Giorgio Agricola hatte zwar letztes Jahr seine Gesellenprüfung abgelegt, manchmal stellte er sich aber an, als hätte er die Lehre erst begonnen. Er war zwar kräftig und konnte mehr Mehlsäcke tragen als jeder andere Mann aus dem Dorf, jedoch war er von einfachem Verstand und allein das Kopfrechnen fiel ihm schwer. Würde ich ihm an solchen Tagen nicht helfen, wären wir schon mehrfach von listigen Kunden übers Ohr gehauen worden. Die Tür zum Innenraum stand offen. Meine Augen mussten sich kurz an das Dunkel gewöhnen, da es nur ein kleines Fenster gab, doch nach und nach offenbarte sich mir das mechanische Wunderwerk der Mühle. Unzählige Rädchen drehten sich, das rhythmische Klacken und Quietschen der aneinanderschlagenden und reibenden Balken ertönte wie Musik in meinen Ohren. Und ganz rechts sah ich durch ein Rohr das fein gemahlene, weiße Mehl in eine große Kiste rieseln. Ich sah nach oben. Dort standen mein Vater, Giorgio und, wenn ich mich nicht irrte, dessen Vater. Giorgio war der dritte Sohn einer großen Bauersfamilie hier in der Region. Da er als Drittgeborener niemals die Chance hatte, den Hof zu übernehmen, hatte sein Vater ihn in eine Lehre geschickt. So würde er es mit viel Glück zu einem guten Lebensunterhalt bringen. Meinem Vater, das sah ich an seiner gekrümmten Haltung, ging es seit meinem Aufbruch nicht besser. Aufgrund des Klickens und Klackens der Mühle konnte ich nicht hören, über was die Männer redeten. Mein Vater rieb sich immer wieder über sein Steißbein.
»Vater, ich bin zurück«, rief ich den Männern entgegen.
Die Drei wandten sich erschrocken um. Mein Vater lehnte sich über das Geländer und hob die Hand zum Gruß. »Meine Tochter«, ein breites Lächeln erschien auf seinem Gesicht, »Schön, dass du zurück bist. Hattest du eine gute Zeit in der Gebetsschule?«
»Ja, Vater«, vor den beiden anderen Männern senkte ich fromm meinen Kopf, »Ich habe viel über Gott und den rechten Weg nachgedacht.« Bei den Worten wurde mir ganz schlecht.
»Du bist ein braves Mädchen«, mein Vater räusperte sich, sah kurz zu Giorgio und dessen Vater und sagte dann, »Ich habe hier noch kurz etwas zu bereden. Wir sprechen nachher ausführlich. Geh schon mal ins Haus und kümmere dich ums Abendessen.«
»Brauchst du keine Hilfe?«
»Nein, ich komme zurecht. Geh schon mal vor, ich komme bald nach.«
Ich runzelte die Stirn. Ich hatte bei meiner Rückkehr mit einer anderen Begrüßung gerechnet. Normalerweise ging ich meinem Vater noch zur Hand. Ich zuckte mit den Schultern und verließ die Mühle.
Unser Wohnraum war an die Mühle angebaut. Wir hatten zwei Etagen zur Verfügung. Unten befanden sich die Küche mit einer Feuerstelle, ein großer Holztisch mit Stühlen und ein offener Kamin, der im Winter die ganze Stube zusätzlich wärmte. Die obere Etage bestand aus zwei Zimmern, wovon eines mir gehörte, und einem kleinen Erker, in dem der Abort eingebaut war. Ein Luxus, den nicht alle Dorfbewohner kannten. Nachdem ich meine Tasche und das Gebetsbuch nach oben in mein Zimmer gebracht hatte, sah ich in den Küchenschränken nach, was ich uns zum Abendessen kochen konnte. Ich fand frische Eier, Speck und Käse. Sogleich schürte ich das Feuer auf der Feuerstelle an. Die Glut von heute Morgen war noch warm und so dauerte es nicht lange, bis ein kleines Feuer knisterte. Ich schlug mehrere Eier in die Pfanne, gab kleine Stücke des Specks hinzu und würzte alles mit getrockneten Kräutern. Den Käse stellte ich auf den Tisch und legte ein Messer dazu. Zwei Becher füllte ich mit Dunkelbier. Schon bald durchzog ein köstlicher Geruch die Stube, und das Wasser lief mir im Mund zusammen. Mein Vater ließ nicht lange auf sich warten. Ich wendete gerade die Eier in der Pfanne, als er zu mir trat und mich auf die Stirn küsste. »Schön, dass du wieder zurück bist.«
Ich lächelte. »Das Essen ist gleich fertig. Setz dich ruhig, du hattest sicherlich einen harten Tag.«
Das ließ sich mein Vater nicht zweimal sagen und nahm ächzend auf seinem gewohnten Stuhl Platz. Er zog seinen Hut ab und legte ihn auf den Tisch. »Da hast du Recht.«
Ich holte aus dem Schrank zwei Teller, Messer und Gabel, teilte das Essen gerecht auf die Teller auf und setzte mich zu meinem Vater an den Tisch. Beide hungrig vom anstrengenden Tag aßen wir zunächst schweigend, bevor ich das Wort ergriff. »Ihr saht sehr beschäftigt aus, als ich kam. Was hattet ihr Wichtiges zu bereden?«
Mein Vater schwieg lange, und ich dachte bereits, er hätte meine Frage nicht gehört, schließlich legte er seufzend seine Gabel auf den Tisch. »Ich werde alt. Nein, ich bin alt. Jeder Tag, an dem ich die schweren Kornsäcke der Kundschaft trage, steckt mir mehr in den Knochen. Seit langem trage ich die Sorge um die Weiterführung unserer Mühle mit mir. Wie geht es weiter, wenn ich mal nicht mehr kann?«
»Ich führe die Mühle weiter.«
Mein Vater lachte. »Du weißt, dass das nicht geht. Eine Frau kann kein Handwerk allein führen.«
»Und du weißt, dass ich das sehr wohl kann. Ich habe dich schon oft vertreten. Ich bin es, die Giorgio hilft, weil er kaum zwei plus drei zu rechnen vermag.«
Mein Vater seufzte. »Du bist von schnellem Verstand, das weiß ich. Und dennoch ist es das Schicksal einer jungen Frau zu heiraten und eine Familie zu gründen. Nicht ein Handwerk zu erlernen oder gar selbst zu führen.«
»Du hast mich doch das Handwerk gelehrt, damit ich nicht abhängig bin von anderen, sondern selbst für mich sorgen kann.«
Mein Vater ließ seinen Kopf in die Hände sinken. »Vielleicht war das ein Fehler.«
»Was redest du da?« Ich war fassungslos. So hatte ich ihn noch nie reden gehört. Ihn, der nicht an Hexen glaubte, der immer stolz war, eine Tochter zu haben und keinen Sohn. Der mir immer gesagt hatte, ich könne alles werden, wenn ich es nur wollte.
»Ein Bote des Königs ritt gestern ins Dorf und ließ verlauten, dass die Truppen Eabans die westliche Grenze belagern. Sie haben anscheinend bei Perpiyonne eine größere Anzahl von Soldaten zusammengezogen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis sie einfallen und sich selbst nehmen, was ihnen König Gaspare schuldet.«
Es stimmte also, was dieser Fabio Cavalli mir erzählt hatte.
»König Gaspare kalkuliert mit einem Krieg. Er lässt alle jungen Männer zwischen vierzehn und dreißig Jahren einziehen.«
»Also auch Giorgio. Ist es das, was ihr besprochen habt?«
»Giorgio wird nicht gehen.«
Ich runzelte die Stirn. Ein ungutes Gefühl machte sich in meinem Bauch breit. »Warum?«, fragte ich, obwohl ich die Antwort nicht hören wollte.
Mein Vater sah mir fest in die Augen. »Weil Giorgio die Mühle übernehmen wird.«
Ich schoss vom Stuhl auf. »Nein, nein. Das kannst du nicht machen. Giorgio ist überhaupt nicht fähig, eine Mühle zu führen. Er ist ein Geselle, mehr nicht.«
»Giorgio hat noch viel zu lernen. Aber er hat ein gutes Herz und sein Vater hat mir mehr als genug bezahlt, sodass mein Lebensunterhalt gesichert ist.«
»Dein Lebensunterhalt? Du sprichst allein von dir? Was wird mit mir passieren? Wo sollen wir wohnen?«
»Giorgio hat um deine Hand angehalten.«
Mein Magen krampfte sich zusammen. »Und du hast ja gesagt.« Das Schweigen meines Vaters war Antwort genug. Meine Augen füllten sich mit Tränen. Meine Lippen begannen zu zittern. »Das hätte Mutter nicht gewollt.« Tränen rannen mir heiß über die Wangen. Ich wischte sie zur Seite. »Ich werde Giorgio nicht heiraten.«
Mein Vater sprang nun seinerseits vom Stuhl auf und sah wütend auf mich hinab. »Willst du auf der Straße landen?« Die Strenge, mit der er sprach, hatte ich noch nie bei ihm gehört. »Wenn die Truppen Eabans hier einfallen, wirst du froh sein, ein Dach über dem Kopf und einen starken Mann an deiner Seite zu haben.«
»Ich kann selbst auf mich aufpassen.«
»Was redest du da für Zeug? Du bist eine junge Frau, keine Kriegerin!«
Meine Trauer verwandelte sich in Wut. Waren seine früheren Worte eine Lüge gewesen? Leere Komplimente? Dachte mein Vater wirklich eine schwache Tochter zu haben, die sich nicht verteidigen konnte? »Was will ich mit einem Mann, der einfältiger ist als unsere Ziege!«
»Du bist undankbar!« Mein Vater setzte sich wieder auf seinen Stuhl. Er sah erschöpft aus. »Das Einzige, was ich noch in diesem Leben sehen will, ist meine Tochter versorgt und in guten Händen zu wissen. Das bin ich deiner Mutter schuldig.«
Nein, mein Vater durfte sich nicht setzen und seine Entscheidung mit meiner Mutter begründen. Ich wollte streiten, diskutieren, zeigen, dass ich die Mühle allein weiterführen konnte. Doch seine Begründung ließ mich verstummen. Tote waren immer ein Argument. Sie waren nicht mehr da. Sie konnten nicht mehr ihre Meinung sagen. Man konnte ihre Ansicht nur vermuten. Ich atmete tief ein und aus. »Aber Mutter hätte niemals Giorgio für mich gewollt.« Ich nahm meinen leeren Teller, stellte ihn neben den Herd und ging nach oben in mein Zimmer. Sollte mein Vater über seine Entscheidung grübeln. Für mich stand fest: Keine zehn Ochsen würden mich zum Altar mit Giorgio bringen.
Aradia
Die folgenden Tage waren einsam. Mein Zuhause fühlte sich plötzlich fremd an. Mein Vater und ich vermieden es, über seine Entscheidung zu sprechen und gingen uns mehr oder weniger aus dem Weg. So glaubte er wahrscheinlich, dass ich seine Entscheidung akzeptiert hatte und lediglich noch mit mir haderte. Am Tag nach meiner Rückkehr erschien Giorgio mit einem selbstgepflückten Blumenstrauß zur Arbeit. Während Giorgio stammelte, er habe niemals zu träumen gewagt, je eine so schöne Frau wie mich zur Frau zu bekommen, nahm ich die Blumen wortlos entgegen und steckte sie in irgendeine Vase, die ich im Haus fand. Ich hörte meinen Vater sagen, Giorgio solle sich gedulden, das mit uns würde schon werden. Und Giorgio, mit seinem einfältigen Verstand, glaubte ihm, denn am nächsten Tag bekam ich erneut von ihm Blumen geschenkt. Ich stellte sie in einer zweiten Vase neben die andere. Während die beiden Männer glaubten, ich hätte mich meinem Schicksal ergeben, hatte ich bereits damit begonnen, einen Plan zu schmieden. Ich war mehr als jemals zuvor entschlossen, mich diesem Fabio Cavalli anzuschließen. Er war in jeder Hinsicht das Gegenteil von Giorgio. Kein Muskelprotz, aber mit scharfem Verstand hinter den eisblauen Augen. Und je mehr gefühlsduselige Worte Giorgio murmelte, wenn er mich sah oder mir Blumen brachte, umso hoffnungsvoller dachte ich an das bevorstehende Treffen mit Fabio. Er hatte mich schon einmal gerettet. Würde er es wieder tun?
***
Es war Feria Quinta. Der letzte Tag vor meinem Aufbruch, denn morgen Abend würden sich Fabio und die anderen in der Schenke Zum vollen Krug nahe Sedura treffen. Von meinem Heimatdorf war die Schenke genau eine Tagesreise entfernt. Mein Plan stand fest. Ich würde mich im frühen Morgengrauen aus dem Haus schleichen und nicht wieder zurückkommen.
Mein Vater hatte Giorgio gebeten, an diesem Abend zum Essen zu bleiben. Ich hatte uns allen einen Linseneintopf gekocht.
»Wir sind schon eine richtige Familie«, gluckste Giorgio vor Freude, als er zwischen mir und meinem Vater am Tisch Platz nahm.
Mein Vater nickte zufrieden, während ich mich zusammenreißen musste, nicht meine gespielte Miene der Freundlichkeit zu verziehen. Schnell schaufelte ich mir einen Löffel Linsen und Karottenstückchen in den Mund.
»Und das Beste ist, meine Zukünftige kann kochen wie eine Göttin.«
»Das hat sie von ihrer Mutter«, meinte mein Vater.
Giorgio strahlte mich an. Er schien am heutigen Abend der glücklichste Mensch auf Erden zu sein. So langsam bekam ich Mitleid mit ihm. Wie es ihm wohl ergehen würde, wenn er morgen feststellte, dass seine künftige Frau nicht mehr da war? Und wie würde es meinem Vater ergehen? Würde er meine Entscheidung zu gehen verstehen? Würden die beiden nach mir suchen?
»Ich habe übrigens heute mit Pater Matteo gesprochen. Eure Vermählung wird in zwei Wochen stattfinden.«
In zwei Wochen! Mein Vater wollte mich wirklich schnell unter die Haube bringen.
»Das ist wunderbar«, sagte Giorgio.
Beide Augenpaare wandten sich mir zu. »Ja, ganz wunderbar«, beeilte ich mich zu sagen und schenkte Giorgio ein strahlendes Lächeln. Ein Fehler, wie sich sogleich herausstellte. Giorgio nahm meine Geste als Zuneigung war, ließ sich vom Stuhl gleiten und ging vor mir auf die Knie. »Ich habe noch gar nicht offiziell um deine Hand angehalten«, stammelte er und nestelte in seiner Hosentasche, »Willst du meine angetraute Frau werden?« Er hielt mir einen silbernen Ring vor die Nase. Am liebsten hätte ich gesagt: Nein. Ich schielte zu meinem Vater, der mir aufmunternd zunickte. Eigentlich war es egal, was ich sagte, denn morgen wäre ich sowieso nicht mehr da. »Ja, Giorgio, ich möchte deine Frau werden.« Das Wörtchen »möchte« kam mir nicht ganz so flüssig über die Lippen, aber Giorgio schien es nicht zu bemerken. Er stieß vor Freude oder Erleichterung die Arme in die Luft.
»Na los, nimm dem armen Kerl den Ring ab«, verlangte mein Vater.
»Das ist der Hochzeitsring meiner Großeltern.« Giorgios Stimme überschlug sich geradezu vor Stolz.
Ich nahm den Ring entgegen. Er war hübsch, das musste ich zugeben. Ein filigranes Muster aus feinen Linien, die sich zu Blättern und Blüten wanden, umspannte die gesamte Oberfläche.
»Im Inneren steht unser Familienname«, fügte Giorgio hinzu.





























