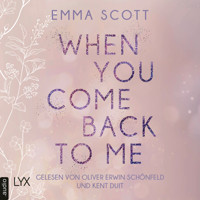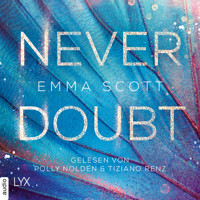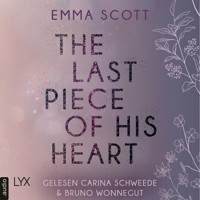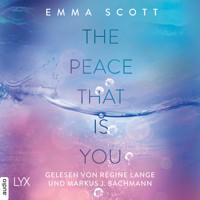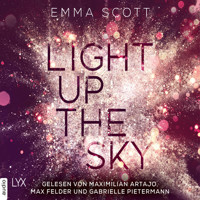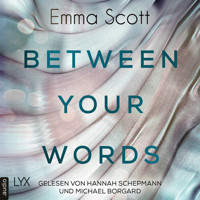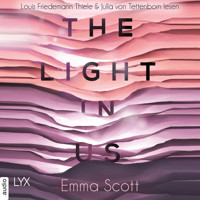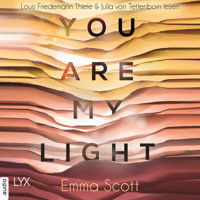9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Das Dreamcatcher-Duett
- Sprache: Deutsch
Eine dramatische Reise voller Träume und Hoffnungen! Um ein Leben zu retten, muss man bereits sein, sich dem Abgrund zu stellen
Seit dem Tod ihrer Mutter zieht Jo mit ihrem Onkel ständig um. Doch diesmal will sie bleiben. Denn da ist Evan, der aussieht wie der Golden Boy der Schule, aber von allen wie ein Ausgestoßener behandelt wird. Jo, die Schlimmes erlebt hat und eigentlich niemanden an sich heranlässt, fühlt sich magisch zu dem schweigsamen jungen Mann hingezogen. Bei nächtlichen Treffen im Schwimmbad der Stadt kommen sie sich näher - zwei verletzte Seelen, die sich einander öffnen. Doch dann werden sie durch ein tragisches Ereignis plötzlich getrennt, und für Jo beginnt erneut eine dunkle Zeit, in der sie sich selbst zu verlieren droht. Als Evan nach langer Zeit völlig unerwartet wieder auftaucht, treten sie gemeinsam eine Reise an, die ihr Verderben, aber auch ihre Rettung sein könnte.
»Eine wunderschöne, erschütternde, herzzerreißende und doch absolut erhebende Liebesgeschichte!« MARYSE‘S BOOK BLOG
Der bewegende Auftakt der DREAMCATCHER-Dilogie
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 444
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
INHALT
Titel
Zu diesem Buch
Vorschlag für einen Soundtrack
Leser:innenhinweis
Widmung
1. Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
2. Teil
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
3. Teil
36. Kapitel
37. Kapitel
Epilog
Danksagung
Die Autorin
Die Romane von Emma Scott bei LYX
Impressum
EMMA SCOTT
A Whisper Around Your Name
Roman
Ins Deutsche übertragen von Inka Marter
ZU DIESEM BUCH
Seit dem Tod ihrer Mutter zieht Jo mit ihrem Onkel ständig um. Aber diesmal will sie bleiben. Denn da ist Evan, der aussieht wie der Golden Boy der Schule, aber von allen gemieden und wie ein Ausgestoßener behandelt wird. Jo, die seit dem Missbrauch durch einen Verwandten eigentlich niemanden an sich heranlässt, fühlt sich magisch zu dem schweigsamen jungen Mann hingezogen. Bei nächtlichen Treffen im Schwimmbad der Stadt kommen sie sich näher – zwei verletzte Seelen, die sich einander öffnen, und zum ersten Mal seit langer Zeit verspürt Jo so etwas wie Glück. Doch dann werden sie durch ein tragisches Ereignis getrennt, und all die Träume und Hoffnungen, die sie mit-einander verbanden, scheinen zunichte gemacht – bis Evan Jahre später wieder in Jos Leben auftaucht. Als hätte er gewusst, dass sie genau jetzt am Abgrund steht und keinen Ausweg mehr weiß. Verfolgt von der Polizei, geleitet von Evans geheimnisvoller Intuition, die Orte zu finden, an denen Jos Seele endlich heilen kann, treten sie eine Reise an, die ihr Verderben, aber auch ihre Rettung sein könnte.
VORSCHLAG FÜR EINEN SOUNDTRACK:
Concrete Blonde: Everybody Knows
Martha and the Vandellas: Heat Wave
Radiohead: Creep
Christina Aguilera: Hurt
The Robins: SmokeyJoe’s Café
The Wallflowers: Josephine
Brandi Carlile: The Story
Tori Amos: Silent all These Years
Fastball: The Way
Adele: All I Ask
Patsy Cline: Crazy
The Fray: How to Save a Life
Liebe Leser:innen,
dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte.
Deshalb findet ihr hier eine Triggerwarnung.
Für Mom,
die wusste, dass ich schreiben will, bevor ich es wusste, und die an mich geglaubt hat, bevor das erste Wort dastand.
Mit all meiner Liebe
J.
1. TEIL
Schlafwandler
Doch gerade in unserer Muße, in unseren Träumen geschieht es zuweilen, dass die untergründige Wahrheit an die Oberfläche dringt.
Virginia Woolf
1. KAPITEL
Jo
Guten Morgen, Karn County! Auch heute wird wieder ein heißer Tag werden mit Temperaturen bis 35 Grad. Die Hitzewelle lässt nicht locker, es wird auch nächste Woche und noch länger so heiß bleiben. Passend dazu jetzt eine kleine »Heat Wave« von Martha and the Vandellas und eurem Oldie-Sender KNOL.
Hitzewelle traf es absolut. Es war höllisch heiß, seit wir gestern von Missouri hier hochgefahren waren, und im Führerhäuschen des Sattelschleppers war es stickig. Gerry ließ die Klimaanlage ungern länger an, weil er Angst hatte, den Motor zu überhitzen. Ich hatte die nackten Füße auf das Armaturenbrett gestützt und ließ wie ein Hund den Kopf aus dem Fenster hängen, um ein bisschen Fahrtwind abzukriegen.
Ich war kein Fan von der Musik, die im Radio lief, aber hier in der Gegend gab es nur Oldies, Gott oder Country. Da waren Oldies eindeutig die beste Wahl, und alles war besser als Stille. Gerry redete nicht viel, wenn er hinterm Steuer saß, antwortete höchstens ab und zu einem anderen Trucker über CB-Funk. Meistens steuerte er den Truck einfach stumm über die fast schnurgerade Straße durch die flache Landschaft von Iowa.
Martha und ihre Vandellas fragten sich, wie Liebe sein sollte. Ich fragte mich, ob das alles war, was Iowa sein sollte: meilenweit nur Mais. Als hätte man aus einem riesigen Ozean das Wasser abgelassen, bis man nur noch wogendes Seegras sah. Wir kamen an ein paar Farmen vorbei – Satelliten, die um Kleinstädte kreisten – und an Telefonmasten, die sich alle zwanzig Meter entlang des Highways in den wolkenlosen Himmel reckten. Ich starrte auf das eintönige Grün unten und nach oben ins Blau auf der Suche nach irgendetwas, was interessant genug war, um meinen Blick zu fesseln. Dann kam auf meiner Seite ein Schild.
Planerville
1341 Ew.
»Das ist es?«, fragte ich.
»Jepp«, erwiderte Gerry, den Blick auf die Straße geheftet. Sein Bauch wölbte sich so, dass er fast unten ans Lenkrad stieß.
Das war mehr, als wir in der ganzen letzten Stunde geredet hatten. Nicht, dass wir uns überhaupt irgendwas zu sagen gehabt hätten. Nichts zu sagen. Nichts zu sehen. Auf dem Weg nach Nirgendwo. Noch eine winzige Stadt, noch eine Highschool – meine dritte allein in diesem Jahr. Und meine letzte, betete ich. Bestimmt würde Gerry vor Juni nicht noch einmal versetzt werden. Es waren nur noch ein paar Wochen bis zum Ende des Schuljahrs, und dann wäre ich endlich nicht mehr ständig »die Neue«.
Gerry Ramirez war der Cousin meiner Mutter. Der einzige Verwandte auf ihrer Seite, den ich kannte. Als meine Mutter sich vor fünf Jahren umgebracht hatte, war er die ganze Strecke aus Florida gekommen, um sich um mich zu kümmern.
Er war Fernfahrer, süchtig nach der Straße und nicht dafür gemacht, Kinder großzuziehen, erst recht keine Teenagerin. Um meiner Mutter willen sorgte er dafür, dass ich ein Dach über dem Kopf hatte, auch wenn er sich selbst nur wenige Tage im Monat darunter aufhielt.
Ich war das ultimative Schlüsselkind. Wenn irgendeine meiner ständig wechselnden Schulen erfahren hätte, wie viel Zeit ich allein verbrachte, hätte Gerry wahrscheinlich wegen Kindesvernachlässigung Probleme gekriegt. Aber ich verriet nichts über meine Situation. Warum sollte ich auch?
Ich konnte entweder bei Gerry wohnen oder bei der Familie meines Dads in Fayetteville, North Carolina. Und die hätte mich ziemlich schnell vor die Tür gesetzt. Als rausgekommen war, was Onkel Jasper mit mir gemacht hatte, als ich dreizehn war, hatte es ihre verlogene scheißglückliche Welt wie eine Bombe explodieren lassen. Meine Mutter hatte ihr Leben beendet, Jasper war in den Knast gekommen, und die Clarks hatten mir beides nie verziehen. Und mein Dad war nicht da und konnte mich nicht verteidigen. Oder von vornherein vor seinem kranken Bruder beschützen.
Mein Dad hieß Vincent, und das war so ziemlich alles, was ich von ihm wusste. Seinen Namen und dass er in Afghanistan in Ausübung seines Dienstes gestorben war, als ich zwei war. Ich wusste nicht, was für eine Art Vater er gewesen wäre, wenn er überlebt hätte. Vielleicht total scheiße. Vielleicht okay. Und vielleicht wäre er auch der beste Vater aller Zeiten gewesen. Wenn nicht so ein mieser Kämpfer meinem Vater auf seiner Patrouille eine Sprengladung vor die Füße geworfen hätte, wäre unsere Familie vielleicht noch ganz, Mama würde noch leben, und ich hätte weder innerliche noch äußerliche Narben.
Egal ob Sprengladungen in entfernten Wüstenkriegsgebieten oder in Kleinstädten in North Carolina explodieren, es ist immer ein Blutbad. Shit Happens. Manchmal ziemlich viel Shit. Manchmal mehr, als ein Mädchen aushalten kann. Die ganze Umzieherei, von Wohnung zu Wohnung, von Stadt zu Stadt. Es fühlte sich an, als würde ich weglaufen, obwohl ich eigentlich irgendwo Wurzeln schlagen und mich erholen wollte. Genesen.
Hinter dem dichten Vorhang aus dunklen Haaren strich ich mir über die linke Wange. Die Beschaffenheit der Haut unter meinen Fingerspitzen veränderte sich.
Planerville, Iowa, Einwohnerzahl vernachlässigbar, tauchte am Horizont auf.
»Sieht gar nicht schlecht aus«, sagte Gerry.
»Sieht super aus«, sagte ich. Wenigstens für ein paar Wochen. Wenn ich im Juni achtzehn wurde, hätte Gerry seine Pflicht meiner Mutter gegenüber erfüllt. Ich würde von da an auf mich allein gestellt sein, und was dann?
Manchmal lachen Leute über etwas, was ihnen passiert, und sagen: »Die Geschichte meines Lebens.« Ich hatte keine Geschichte. Nur eine Frage.
Und was dann?
Wir kamen an einem Samstag in Planerville an, ich hatte also zwei Tage, um mich umzusehen, bevor ich am Montag mit der Schule anfing. Das schmuddelige kleine Dreizimmerhaus, das Gerry gemietet hatte, war wie jedes Haus, in dem wir gewohnt hatten. Man hätte es direkt aus der letzten Stadt einfliegen können: weiße Wände, die nach frischer Farbe rochen, Teppich, der nach Zigaretten roch, und quadratische Zimmer. Keine Persönlichkeit. Gerry hatte nicht die Absicht, sich einzurichten und sich die Wohnung zu eigen zu machen. In einem früheren Leben war er wahrscheinlich ein sadistischer Gärtner gewesen, der einfach alles mit der Wurzel ausriss, damit nichts jemals die Chance bekam zu wachsen. Nach unserer vierten Stadt packte ich nicht mal mehr die Koffer aus.
Sonntagnachmittag, die Sonne im Rücken, radelte ich ins Zentrum von Planerville. Eine Bank. Eine Autowerkstatt. Ein Supermarkt. Eine Pizzeria und ein Sportgeschäft. Das war’s. Ich würde später herausfinden, dass alles andere in Halston stattfand, etwa zehn Minuten Autofahrt Richtung Norden. Ich verstand warum.
Ich schrieb Gedichte, und normalerweise schrieb ich über jede neue Stadt, in die Gerry mich schleifte, ein paar Verse, um meinen ersten Eindruck festzuhalten. Für Planerville hätte ein einfaches weißes Blatt genügt.
Es gab eine einzige Sehenswürdigkeit: Die Stadt hatte letztes Jahr ein neues Erlebnisbad gebaut. Ich fuhr mit dem Fahrrad vorbei, und es reichte eindeutig nicht an Raging Waters heran, die spektakulären Wasserparks in Kalifornien. Es gab nur drei Wasserrutschen – keine besonders groß und furchteinflößend –, einen Lazy River und einen Pool. Und natürlich einen flachen Bereich mit Wassersprengern und Minirutschen, in dem Kleinkinder nach Herzenslust ins Chlorwasser pinkelten. Hohe Zäune sorgten dafür, dass die Leute nach fünf Uhr abends, wenn das Bad seine Tore schloss, draußen blieben, und im Winter war es komplett geschlossen.
Obwohl ich auf keinen Fall die Absicht hatte, jemals dort zu den Öffnungszeiten zu baden, sah es aus, als könnte man da gut nachts abhängen und die Füße ins Wasser halten. Vielleicht ein Gedicht entwerfen. Ich nahm mir vor, schon bald die Sicherheitsvorkehrungen des Funtown Water Park auszutesten.
Als die Sonne allmählich sank und die Insekten mit ihrer Dämmerungssymphonie anfingen, radelte ich zur Wilson Highschool. Es war sofort klar, dass hier Umstände herrschten wie in Friday Night Lights. In Planerville bestand das Leben aus Football. Der Platz war gute zehn Jahre neuer und besser gepflegt als das schäbige Backsteingebäude der Schule selbst. Ich sah Bilder von tobenden Pep Rallys, von Spielmannszügen, die Kampflieder schmetterten, und wie die komplette beschissene Stadt sich auf der perfekt instand gehaltenen Tribüne drängelte. Sportler waren Könige, Cheerleaderinnen Königinnen.
Da die Footballsaison längst vorbei war, warteten die paar Schülerinnen und Schüler sicher verzweifelt auf die nächste große Zerstreuung, und da wir Ende Mai hatten, war das wahrscheinlich die Prom.
Oder vielleicht die Neue in Schwarz, die sich hinter einem Vorhang aus Haaren versteckte und die Tendenz hatte, mit Jungs zu vögeln, die ihr komplett egal waren und denen sie komplett egal war. Seit Onkel Jasper war ich beschädigte Ware. Kein Typ würde mich je als Freundin in Betracht ziehen. Das waren die Karten, die man mir ausgeteilt hatte, und ich spielte sie so, wie ich konnte. Zu meinen Bedingungen.
Ich wappnete mich mental für den ersten Tag an der Wilson Highschool (Schüler*innenzahl: 311), bereit, als Klassenschlampe oder als Freak aufzutreten.
Es stellte sich heraus, dass »Schlampe« noch verfügbar war. Der Titel »Freak« war schon an jemand anderen vergeben.
Ich schaffte es nicht mal bis zum Mittagessen, ohne einen Haufen Dreck über einen armen Trottel namens Evan Salinger zu hören. Ohne direkt mit jemandem zu reden, erfuhr ich, dass Evan ein Pflegekind war. Ein Spinner. Ein Einzelgänger. Es hatte vor drei Jahren hier an der Schule einen Vorfall gegeben. Irgendwie hatte er in Mathe einen Nervenzusammenbruch gehabt. Ich kannte keine Details, aber nach diesem Zusammenbruch wurde Evan Salinger in ein Irrenhaus eingewiesen und dauerhaft »Freak« genannt.
Da mir die Bezeichnung selbst nicht fremd war, erwartete ich halb, dass Evan den Titel so trug, wie ich es tun würde: dunkle Kleidung, lange Haare, hinter denen man sich verstecken und andere beobachten konnte, vielleicht ein Emo-Lidstrich, wenn man richtig Bock hatte.
Und dann stellte sich heraus, dass ich in Politik und Gesellschaft, meinem letzten Kurs an dem Tag, neben Evan saß. Ich merkte es nicht mal, bis der Lehrer ihn aufrief. Er saß links von mir, und die Haare, die die Seite meines Gesichts verdeckten, hatten ihn vor meinem Blick verborgen. Ich wandte mich ihm zu und wäre fast an meinem heimlich gekauten Kaugummi erstickt. Keine schwarzen Klamotten oder Emo-Make-up oder strähniges Haar. Oh nein. Evan Salinger sah, milde ausgedrückt, einfach nur wahnsinnig gut aus.
Er trug sein blondes Haar ein bisschen länger, wie Leo Di Caprio zu seiner Titanic-Zeit, wobei Evan stämmiger war als der junge Leo. Ich sah ihn nur im Profil, aber Evans T-Shirt dehnte sich ziemlich nett um seinen Bizeps, und seine Schultern waren breit und sahen kräftig aus, obwohl sie nichts taten, als seinen Kopf über dem Buch zu halten. Er war groß – seine Knie stießen unten an sein Pult –, und als er aufsah, um auf die Frage des Lehrers zu antworten, erhaschte ich einen Blick auf eindrucksvolle himmelblaue Augen.
Umwerfend.
Dieser Typ, dachte ich, konnte unmöglich der berüchtigte Freak sein, über den die Schule den Mund nicht halten konnte. Ich hätte ihn für den Quarterback der Wilson Wildcats gehalten. Leiter der örtlichen Landjugend. Klassensprecher. Dieser Typ war Prom King, kein Freak.
Geschützt hinter meinem Vorhang aus Haaren, betrachtete ich Evans Kleidung, suchte nach Hinweisen, fand jedoch nichts, was der Gerüchteküche Recht gegeben hätte. Er trug ausgeblichene Jeans, ein schlichtes T-Shirt und Arbeitsstiefel. Auf den Jeans waren Flecken, die aussahen wie ausgewaschenes Motoröl. Wenigstens das ergab Sinn – ich hatte gehört, dass er der Adoptivsohn von Harris Salinger war, dem Besitzer der Autoreparaturwerkstatt der Stadt. Die Salingers wohnten in einem großen weißen Haus in der Peachtree Lane, und Mrs. S fuhr einen Lexus.
Evans Adoptivfamilie hatte Geld – noch ein Plus für ihn. Offensichtlich konnte sein Platz auf der untersten Sprosse der sozialen Leiter nur durch seinen Aufenthalt in der Woodside-Klinik kommen. Ich hoffte, dass das nicht der Fall war, aber was sollte es sonst sein? In einer Schule mit nur dreihundert Kids hätte Evan bei einer derartigen Vergangenheit keine Chance, jemals etwas anderes zu sein als der hauseigene Irre, und Prom King schon mal gar nicht.
Die Wilson High, folgerte ich schnell, war total ab vom Schuss. Die Kids waren so gelangweilt, man konnte nicht mal einen Furz lassen, ohne dass alle darüber tuschelten.
Und über Evan Salinger tuschelten sie so dermaßen.
Als Mr. Albertine Evan aufrief, um eine Frage über das Kolosseum in Rom zu beantworten, schien die ganze Klasse gleichzeitig zusammenzuzucken. Die Luft verdichtete sich, und dann drehten sich alle – und ich meine wirklich alle – auf ihren Stühlen um, um Evans Antwort zu hören.
Ich erwartete, dass er mindestens ’ne Opernarie schmettern würde. Oder vielleicht aufstehen und Mr. Albertine beide Mittelfinger entgegenstrecken und ihm sagen würde, dass er sich sein Kolosseum in den Arsch schieben könne. Ich hoffte irgendwie, er würde das tun. Ich meine, wenn man schon einen beschissenen Ruf hatte, warum nicht alles rausholen, was ging?
Evan, über sein Buch gebeugt, beantwortete die Frage korrekt mit einer total normalen, irgendwie tiefen, irgendwie rauen (okay, irgendwie sexy) Stimme. Die anderen Schüler starrten ihn kurz an, manche kniffen die Augen zusammen, alle argwöhnisch, als wollten sie sagen: »Was hast du vor, Salinger?« Dann kümmerten sie sich, einer nach dem anderen, langsam wieder um ihren eigenen Kram.
Ich nicht. Ich hörte nicht auf zu glotzen. Bei all den harten Kanten und der schroffen Männlichkeit war auch eine irgendwie nicht greifbare Sanftheit an ihm. Ich weiß nicht, wie oder warum ich das auf den ersten Blick dachte, aber für mich sah Evan wie jemand aus, der dem erstbesten Menschen, der ein bisschen nett zu ihm war, die tiefsten Geheimnisse seines Herzens anvertrauen würde.
Er ist irgendwie schön, dachte ich.
Ich wurde aus meinem Tagtraum gerissen, als Albertine mich aufrief, damit ich die nächste Frage beantwortete. Ich schob das Kaugummi in meine Backentasche. »Sorry, ich hab das grad nicht mitgekriegt.«
Wieder drehte sich die ganze Klasse um, diesmal, um sich die Neue in zerrissener schwarzer Strumpfhose, lila Rock, schwarzem T-Shirt und Stiefeln genau anzusehen. Ich hörte Gekicher. Der wirkliche Quarterback der Wildcats, Jared Piltcher, blickte mich aus der Reihe vor mir abschätzend an.
Albertine wiederholte die Frage, und ich schummelte mir eine Antwort zurecht und spürte immer noch Jareds Blick auf mir. Er entsprach ebenfalls den Anforderungen, um als Mann als sexy zu gelten, aber ihm fehlte diese nicht greifbare Qualität, die mir an Evan aufgefallen war. Jared verbarrikadierte sich hinter seiner Beliebtheit und dem guten Aussehen und dem Star-Status. Man konnte wahrscheinlich tagelang mit ihm reden, ohne je durch all das Gepose zu seinem wahren Ich durchzudringen.
Weshalb er für meine Zwecke der perfekte Kandidat war.
Ich fing Jareds Blick mit dem Auge auf, das nicht hinter den Haaren versteckt war, und fuhr mir mit der Zunge über die Unterlippe. Langsam, als würde etwas gut schmecken. Er zog die Augenbrauen hoch, dann lachte er leise bei sich und schüttelte den Kopf. Er warf mir einen letzten, fragenden Blick zu. Ich nickte einmal. Dann hustete er und drehte sich wieder nach vorn um. Hat er seinen Schritt zurechtgerückt, um einen beginnenden Ständer zu unterdrücken, Ladies und Gentlemen? Ich denke schon. Wir würden uns unter der Tribüne oder hinter der Turnhalle oder in irgendeiner verlassenen Ecke der Bibliothek treffen, und ich würde mir einen Ruf erarbeiten.
Ich beugte mich wieder über den Tisch, achtete darauf, dass sich die Wand aus Haaren vor meiner linken Gesichtshälfte nicht bewegt hatte, und die Stunde schleppte sich weiter voran. Dann spürte ich eine Wärme, als würde ein Sonnenstrahl durchs Fenster fallen. Nur saß ich nicht am Fenster.
Ich blickte zu Evan Salinger. Er sah mich nicht an; sein Kopf war gesenkt, sein Blick auf das Buch gerichtet, aber trotzdem. Er war das. Ich spürte ihn, wenn das irgendeinen Sinn ergibt. Was es nicht tut. Ich weiß, dass es das nicht tut, und damals wusste ich es auch. Aber es fühlte sich an, als würde Evan Salinger mich beobachten, ohne hinzugucken.
»Lass das«, flüsterte ich.
»Sorry«, flüsterte er sofort zurück. Meine Bitte hatte ihn nicht verwirrt. Er wusste, was ich meinte, was verdammt komisch war, da nicht mal ich wusste, was ich meinte. Und dann war es, als würde plötzlich etwas abgestellt. Wie ein Lichtstrahl von einer vorbeiziehenden Wolke verdunkelt wird. Ich erschauderte, und das Gefühl, dass Evans Aufmerksamkeit auf mich gerichtet war, verschwand.
Okay, das war echt komisch.
Rührte sein Ruf als Freak teils daher? Da war ohne Zweifel etwas seltsam an ihm. Man konnte es nicht erklären, und es war höchstwahrscheinlich ein Produkt meiner Fantasie. Aber nicht schrecklich. Nicht, wenn ich wirklich darüber nachdachte.
Überhaupt nicht schrecklich.
2. KAPITEL
Jo
Am nächsten Morgen lockte ich Jared Piltcher vor dem zweiten Klingeln zu der Tribüne hinter der Turnhalle und erlaubte ihm, mir unters T-Shirt zu fassen, bis sein offensichtlicher Ständer gegen meinen Oberschenkel drückte. Er küsste, als wollte er meine Mandeln essen, aber ich schaffte es, meine Haare über meiner linken Wange zu behalten. An meinem Gesicht war er sowieso nicht interessiert.
»Ich hab eine Freundin«, sagte er, als es klingelte. »Ich geh mit ihr zur Prom. Nur dass du Bescheid weißt.«
Ich zuckte die Achseln. »Alles cool. Unser kleines Geheimnis.«
»Cool. Also … nach dem Mittagessen?«
Ich zuckte wieder die Achseln. »Gucken wir mal.«
Die erste Regel im Showbiz: Sorg immer dafür, dass sie mehr wollen. Und das hier war alles nur Show. Ich war nur Show. Die naturgetreue Nachbildung eines menschlichen Wesens, das die Rolle eines siebzehnjährigen Schulmädchens spielte. Und da meine Rolle es erforderte, suchte ich an jenem Tag beim Mittagessen meine Leute auf. Ich fand den Tisch, an dem die Jungs und Mädels in Schwarz saßen, mit Emo-Haaren und Make-up, und ich setzte mich dazu, als hätte ich das seit Beginn des Schuljahrs jeden Tag so gemacht.
Ich ließ mich neben Marnie Krauss auf einen Stuhl fallen, die Alpha-Bitch der Außenseiter, schräg gegenüber von ihrem Stellvertreter, Adam Lopez. Adam war der einzige offen schwule Junge an der ganzen Schule, vielleicht in der ganzen Stadt.
Adam stieß ein beleidigtes Schnauben aus und zog die Augenbrauen hoch. »Äh, sorry, kennen wir uns?«
»Nett, dass du dich zu uns setzt«, sagte Marnie gedehnt. Der Blick, den sie und Adam wechselten, war so beredt, dass ich ihre Gedanken praktisch hören konnte.
Meint die das ernst?
Ja, oder?
»Jo Clark«, sagte ich. »Ich bin neu.«
»Offensichtlich.« Marnie sah mich aus schmalen Augen an. »Wie bist du hier gelandet?«
»Ich hab gehört, ihr macht so ’ne Underground-Zeitschrift.«
Marnie wurde sofort munter, ihre Miene erhellte sich kurz, bevor sie sich bemühte, wieder auf blasiert zu machen. Sie war die Chefredakteurin von Mo Vay Goo, einer der monatlichen Publikationen an der Schule. Ich hatte vor etwa zehn Minuten eine Ausgabe aus dem Papierkorb im Flur geborgen.
Mo Vay Goo spielte mit dem französischen »mauvais goût«, was »schlechter Geschmack« bedeutete. Es war ein kleines Heft voll existentialistischer Meinungsartikel und wütender Tiraden gegen die da oben. Ich hatte erwartet, dass es kindisch und irgendwie dumm sei, aber es war in Wirklichkeit ziemlich gut. Außerdem war ich kein Fan davon, in der Mittagspause allein rumzusitzen.
»Ja, ich bin die Herausgeberin«, sagte Marnie. »Warum?«
»Ich würd gern was dazu beitragen«, sagte ich. »Ich schreibe Gedichte.«
Adam Lopez zog die Nase hoch. »Schätzchen, wir sind eine ernstzunehmende Zeitschrift.«
»Ich schreib keinen sentimentalen Scheiß.« Ich wandte mich Marnie zu. »Wenn du erst was lesen willst, gern.«
Adam sah aus, als wollte er protestieren, aber Marnie betrachtete mich und die Haare, die vor meiner linken Gesichtshälfte hingen. Sie klopfte sich mit einem Fingernagel, von dem schwarzer Lack abblätterte, gegen die Zähne. »Neue Inhalte können nie schaden.«
»Woher wollen wir wissen, dass sie sich nicht bei uns einschleichen will, um uns fertigzumachen?«, fragte Adam.
Ich schnaubte. Es war süß, dass die dachten, jemand wäre hinreichend an ihrem Heft interessiert, um ihnen die Party verderben zu wollen. »Seh ich aus, als wär ich undercover für die Cheerleader hier? Ich hab gesagt, ich schreibe Gedichte. Und die sind ziemlich ›schlechter Geschmack‹.«
Marnie verschränkte die Arme. »Das ist cool. Aber wir haben kein Interesse an lila Wolken der Trauer oder dass dein Leben ein dunkles Haus ohne Türen ist.«
»Wir wollen Kunst«, sagte Adam. »Keine nachgemachten Nick-Cave-Texte.«
Das war ermutigend. Vielleicht war Mo Vay Goo tatsächlich was für mich. Ich sah mich am Tisch um. Sechs weitere Kids in Schwarz mit gezackten Haarschnitten und teils bunten Strähnen starrten mich an. Meine Leute. Wären sie jedenfalls, sobald ich mich in ihren Kreis einführte. Tu’s einfach, dachte ich. Als würdest du ein Pflaster abreißen.
Ich setzte mich gerade hin und hob die Haare hoch, die die Hälfte meines Gesichts verdeckten. Ich spürte kühle Luft auf meiner Wange und fühlte mich nackt. Entblößt. Mein linkes Auge blinzelte wegen der plötzlichen Helligkeit. Der ganze Tisch bekam für drei unerträgliche Sekunden einen guten Blick drauf, dann ließ ich den Vorhang wieder runter.
Adam pfiff leise durch die Zähne. »Gott. Was ist passiert?«
»Autounfall«, sagte ich. »Ich war dreizehn. Meine Mutter ist dabei umgekommen, ich hab dieses schöne Souvenir behalten. Ich rede nicht drüber. Ich schreib Gedichte.« Ich sah zu Marnie. »Keinen sentimentalen Scheiß.«
»Klar.« Sie nickte, guckte mit geweiteten Augen zu meiner Gesichtshälfte mit der Narbe, die jetzt nicht mehr zu sehen war. »Kein sentimentaler Scheiß.«
Ich war drin. Pack einfach ’ne Tragödie drauf, und schon hast du Freunde.
An dem Abend aß ich mein Abendessen im Schneidersitz auf einem der alten Liegesessel, die vor dem Fernseher standen. Gerry saß in dem anderen und guckte Baseball mit einem KFC-Bucket auf dem Schoß. Er hatte mir etwas angeboten – und war so seinen Vormundspflichten für den Abend nachgekommen –, aber ich war kein Fan von dem fettigen Kram. Für mich nur die besten Ramen-Nudeln voller Bisphenol A und eine Diet Coke.
»Ich hab demnächst eine längere Tour«, sagte Gerry, ohne den Blick auch nur eine Sekunde von der Glotze zu lösen. »Anderthalb Wochen. Vielleicht zwei.«
»Okay.«
»Du kriegst das hin?«
»Klar.«
Als hätte ich eine Wahl.
An diesem Abend stand ich vor dem Spiegel meines Badezimmers und band mir die Haare zurück. In dem scheußlichen Neonlicht setzte die Narbe sich glänzend ab. Eine gezackte Naht, die unter meinem linken Auge anfing und sich in einer ungeraden Linie bis zu meinem Kiefer hinunterzog. Ein strahlend weißer Blitz.
Ich hatte in der Schule erzählt, dass es ein Autounfall gewesen sei, und sie hatten es mir abgekauft. Und warum auch nicht? Ich hatte ihnen keinen Grund gegeben, daran zu zweifeln. Und »Autounfall« war so viel menschlicher, als ihnen die Wahrheit zu sagen: dass ich eine sieben Zentimeter lange Schraube genommen und mir die Verletzung selbst beigebracht hatte. Damit mein Onkel aufhörte, drei Mal in der Woche nachts zu mir zu kommen.
Jasper hatte gesagt, ich sollte es nicht weitersagen – niemandem –, also hatte ich es stattdessen gezeigt.
Ein schrecklicher Fehler. Es hatte Jasper aufgehalten, aber meine Mutter umgebracht. Ich hatte mir mit dieser Schraube die Wange aufgeschlitzt, aber ich hätte meiner Mom damit auch gleich die Pulsadern aufschneiden können. Sie warf nur einen Blick auf die blutige Wunde auf meiner Wange, hörte, warum ich sie mir zugefügt hatte, und drehte durch. Sie war ohnehin psychisch nicht so stabil gewesen. Drei Tage hielt sie durch, heulte und schrie hinter der geschlossenen Schlafzimmertür, bis mein Onkel Jasper ins Gefängnis verfrachtet wurde. Dann checkte meine Mutter aus.
Ich rieb die Narbe mit Cold Cream ein, so wie früher mit allen möglichen narbenreduzierenden oder Hautfehler abschwächenden Cremes, die in nächtlichen Dauerwerbesendungen verscheuert wurden. Nichts half, und solange ich nicht im Lotto gewann und mir eine Schönheits-OP leisten könnte, würde auch nichts helfen. Ich hatte gründliche Arbeit geleistet, als ich mein Gesicht verschandelt hatte. Meine Mutter kaputt gemacht hatte. Und mein Leben ruiniert. Alles auf einmal.
Hässliche Gedanken und Erinnerungen. Sie kamen immer hoch, wenn ich die Narbe jemandem zeigte. Eine Folgeerscheinung oder PTBS oder so was. Nachdem ich mir das Gesicht gewaschen und die Zähne geputzt hatte, zitterten meine Hände.
Ich legte mich aufs Bett und tat so, als würde ich irgendwo weit weg auf einem See treiben, das Wasser, das friedlich wie Eis war, von schönen, zerklüfteten Bergen umgeben. Es funktionierte; meine schwarzen und blutigen Gedanken trieben auseinander wie Öl auf Wasser und nahmen mich mit in den Schlaf.
Kurz bevor ich weg war, dachte ich an Evan Salinger.
Wir waren wieder in Politik und Gesellschaft, und er machte wieder diese Sache, die sich anfühlte, als würde ein warmer Lichtstrahl auf mich fallen. Ich wollte ihm schon sagen, dass er aufhören sollte, aber er wandte sich mir zu und sah mich direkt mit diesen himmelblauen Augen an. Mir stockte der Atem, und plötzlich wollte ich, dass er mich mit diesem warmherzigen, klaren Blick betrachtete.
Er lächelte mich an, als wäre ich nicht hässlich und aufgeschlitzt und von meinem Arschloch von Onkel benutzt worden.
»Gute Nacht, Jo.«
Ich wollte auch gute Nacht sagen, aber ich war schon in den Schlaf geglitten.
3. KAPITEL
Jo
Es klingelte, und der Englisch-AP-Kurs stand auf, um rauszugehen. Ms. Politano rief mich zurück. Sie war eine junge Lehrerin. Die Haare trug sie immer in einem lockeren Knoten, und ihre Klamotten waren hippiemäßiger, als ich mir bei einer Lehrerin im Mittleren Westen vorgestellt hatte. Sie sah eher aus, als gehörte sie in eine Bücherei in Seattle, immer mit einem Buch unter dem Arm und einer Lesebrille, die ihr die Nase runterrutschte.
»Also, Jo«, sagte sie und lächelte strahlend. »Kurz für Josephine. Wie Jo March in Little Women.«
Ich nickte. »Es war das Lieblingsbuch meiner Mutter.«
»Meins auch«, sagte Ms. P. »Sie könnten keine bessere Namensvetterin haben, meiner bescheidenen Meinung nach.«
Meine Lippen zuckten, als ich höflich zu lächeln versuchte und es nicht gelang. Ms. P ließ sich von meiner fehlenden Antwort nicht aus der Ruhe bringen.
»Da das Schuljahr beinahe um ist, fällt es mir schwer, Ihre Fortschritte zu beurteilen«, sagte sie und lächelte freundlich. »Ich habe Ihre Arbeiten von einer der beiden Schulen, die Sie vor uns besucht haben, erhalten, aber das genügt nicht, um mir wirklich ein Bild zu machen, wo Sie stehen. In schulischer Hinsicht.«
Ich zuckte die Achseln, obwohl mein Magen in Aufruhr geriet. »Okay. Und das heißt?«
Ms. P saß auf der Ecke ihres Schreibtischs. Ich konnte sehen, wie sie mich auf sich wirken ließ: die Haare vor dem Gesicht, die dunklen Klamotten, der herausfordernde Blick. Ihr Lächeln wurde geduldig. »Ohne einen breiteren Einblick in Ihre Arbeit weiß ich wirklich nicht, wie ich Sie benoten soll.«
»Ich muss den Abschluss machen. Unbedingt.«
»Natürlich«, sagte Ms. P. »Aber die Zeit läuft uns davon. Ich kann Sie nicht einfach abfragen. Wir machen Literaturanalyse und sind schon zur Hälfte durch mit Als ich im Sterben lag.«
Als ich im Sterben lag. Das hatte ich gelesen. Ich hatte viel gelesen unterwegs. Das war ein Roman, in dem die Hauptfigur eine tote Mutter ist. Man könnte sagen, dass mir das Thema aufs Engste vertraut war.
»Ich kann aufholen.«
Ms. Ps warmes Lächeln ging mir langsam auf die Nerven. »Daran zweifle ich gar nicht«, sagte sie. »Aber das plus die Hausaufgaben für den Rest des Schuljahrs werden nicht reichen. Es gibt einfach zu viele Lücken in Ihrem Schuljahr.«
»Was wollen Sie mir damit sagen? Dass ich im Sommer zur Schule gehen und die Nachholprüfung machen muss?«
»Ich wüsste nicht, wie wir das vermeiden können.«
Ms. P strich ihren knielangen Strickrock glatt, als wären wir Freundinnen und würden ein bisschen plaudern. Ich hasste es, wenn Lehrer so taten, als stünden wir auf einer Stufe, vor allem, wenn sie meine komplette Zukunft – die ohnehin schon zerbrechlich war – in den Händen hielten.
Ms. Politano schien eigentlich okay zu sein, aber sie könnte mir gründlich das Leben versauen, wenn sie mich den Abschluss nicht machen ließ.
Ich kaute auf meiner Lippe. »Und wenn ich ein besonderes Projekt abgebe? Für Extra-Punkte?«
»Das hatte ich auch schon überlegt. Aber das müsste schon ziemlich spektakulär sein.«
Ich hatte zu Hause eine Sammlung von dreißig Gedichten. Zwanzig waren okay, zehn ziemlich gut. Ich hatte nicht vorgehabt, sie für etwas so Blödes wie Schule zu benutzen, aber wenn es darum ging, den Abschluss machen zu können, würde ich sie eben dafür opfern müssen.
»Wie wäre ein Poesie-Projekt? Ich hab ein paar Gedichte, die ich Ihnen zeigen könnte, und vielleicht können Sie mir ein paar mehr aufgeben?«
Ms. Ps Gesicht erhellte sich. »Sie schreiben Gedichte? Wunderbar. Früher in diesem Schuljahr haben wir eine ganze Unterrichtseinheit über Liebesgedichte und Sonette gemacht. Keats, Shakespeare, Elizabeth Barrett Browning … Vielleicht könnten wir Ihr Projekt darauf konzentrieren.«
Ich bemühte mich, nicht abfällig die Lippe hochzuziehen. »Liebesgedichte sind nicht wirklich mein Ding.«
Ms. P lachte. »Nun, es darf auch nicht zu leicht sein, nicht wahr? Bringen Sie mir morgen, was Sie haben, und wir sehen, was wir daraus machen können. Klingt das gut?«
Es klang besser, als den Abschluss nicht zu machen, aber ich hatte nicht viel Hoffnung, dass das Projekt Ms. P zufriedenstellen würde. Sie war eine verträumte Romantikerin. Bestimmt wäre sie nicht begeistert von meinen Sachen über selbstmörderische Mütter, tote Väter und perverse Onkel. Und dann wäre ich komplett am Arsch.
Was wusste ich über Liebe? Einen Scheißdreck. Das bisschen, das ich gewusst hatte, war mir entrissen worden und hatte nur einen grauen Nebel ferner Erinnerungen hinterlassen, die täglich mehr verblassten. Meine Mutter … war meine ganze Welt gewesen, lebendig und in Farbe, und jetzt konnte ich kaum noch ihr Gesicht vor mir sehen.
Ich rieb mir über das schmerzende Herz, als ich den Klassenraum verließ, und machte mich innerlich schon mal darauf gefasst, auch im Sommer noch Kurse zu machen.
Später am Tag ging ich mit Marnie und Adam einen Flur entlang. Evan Salinger ging vor uns, die Nase in ein Buch gesteckt. Er trug ein blau-schwarz kariertes Flanellhemd über einem abgetragenen T-Shirt, Jeans und seine Arbeitsstiefel. Auf den Jeans waren Streifen von Motorschmiere, aber sein Arsch sah verdammt gut darin aus.
Jared Piltcher, jetzt mein Pausenknutschkumpel, lehnte mit ein paar Freunden aus dem Footballteam an seinem Schließfach – eine Muskelwand in Jeans und Letterman-Jacken. Als Evan näher kam, stießen sie sich gegenseitig in die Rippen und schubsten sich.
»Oh, oh. Warte«, sagte Adam und zog mich beiseite.
Marnie schürzte die Lippen. »In fünf, vier, drei …«
Kaum dass Evan an den Jungs vorbeiging, schlug Jared ihm das Buch aus der Hand.
»Und Boom«, murmelte Marnie.
»Bücher aus der Hand schlagen«, sagte Adam. »Wie originell.«
Weder er noch Marnie machten irgendwelche Anstalten, Evan zu helfen. Sie sahen nur zu. Wie der Rest der Leute im Flur. Wie ich.
Evan bückte sich, um sein Buch aufzuheben. »Verpiss dich, Jared.«
»Es lebt! Es lebt!« Jared lachte, während Matt King, ein Linebacker, die Arme ausstreckte wie ein schlechtes Frankensteinmonster, stöhnte und im Stechschritt vorwärtsging. Ein anderer aus dem Team legte sich die Finger an die Schläfen, machte ein surrendes Geräuschund zuckte dann, als würde er einen Stromschlag kriegen.
Ich beugte mich zu Marnie. »Was soll diese Scheiße?«
»Evan war mal in Woodside«, flüsterte sie, »der Psychoklinik oben in Halston.«
»Ja, hab ich gehört. Und?«
»Siehst du den Fiesling, der mit den Football-Jungs abhängt?«
Ich sah mich um und bemerkte einen dürren Typen mit verkniffenem Gesicht, der den gebogenen Griff eines Gehstocks in den knochigen Händen hielt.
»Seh ich.«
»Das ist Shane Salinger. Er ist wie Evan in der Oberstufe. Er hat überall erzählt, Evan habe in Woodside ’ne Elektrokonvulsionstherapie gekriegt.«
»Elektrokonvulsions… Du meinst Elektroschocks?«
Marnie nickte.
»Stimmt das?«, fragte ich.
Sie zuckte die Achseln und lächelte trocken. »Nun, das ist die schreckliche, erhabene Schönheit eines Gerüchts. Es muss nicht wahr sein, um sich rumzusprechen.«
Evan verließ mit erhobenem Kopf und nach vorn gerichtetem Blick den Flur. Shane Salinger lachte doppelt so laut wie die anderen. »Ha! Der war gut, Jungs!«
Die Footballspieler ignorierten ihn, und Shane – so ausgemergelt, dass es offensichtlich war, dass er an irgendeiner degenerativen Krankheit litt – rückte näher an den großen Jungen neben ihm, als würde er Schutz suchen. Der war genauso strohblond wie Shane, aber zehn Mal so kräftig, hatte Pickel im Gesicht und einen stumpfen Blick.
Ich deutete mit dem Kinn auf ihn. »Und wer ist das?«
»Auch ein Salinger-Bruder. Merle«, sagte Adam. »Ist noch in der Mittelstufe. Shane ist ein Mitläufer, der versucht, sich an die großen Jungs zu halten, und Merle ist einer von den großen Jungs, weil er Football spielen kann.«
Marnie nickte, als wir weitergingen. »Nur wegen Merle gehört Shane nicht wie wir zum unteren Ende der Nahrungskette. Und wegen der Gerüchte, die er über Evan ausspuckt. Bringt die Dumpfbacken zum Lachen.«
Ich runzelte die Stirn. »Warum redet Shane schlecht über Evan? Er ist doch sein Bruder?«
»Adoptiert.« Adam zuckte die Achseln. »Tja. Ist eben kein richtiger Bruder. Shane hasst Evan. Ich meine, er hasst ihn wirklich.«
»Geht anscheinend ziemlich vielen so«, murmelte ich vor mich hin. Ich ging noch einen Schritt und bemerkte, dass Marnie und Adam beide stehengeblieben waren und mich leicht alarmiert anstarrten. Ich sah wütend zurück. »Was?«
»Lass es«, sagte Adam. »Evan Salinger ist sexy, das geb ich zu. Ein starker, ruhiger Typ. Aber wenn man in seine Nähe kommt …« Er schüttelte sich theatralisch.
»Er ist wirklich heiß«, stimmte Marnie zu. »Wenn auch ein bisschen konventionell für meinen Geschmack, aber … irgendwas stimmt nicht mit ihm.«
»Ist das nicht bei uns allen so?«, murmelte ich.
Marnie schien mich nicht gehört zu haben. »Bist du je unter einer Hochspannungsleitung durchgegangen? Wo man es surren hört und sich dir die Härchen auf den Armen aufstellen?«
Ich sah sie beide skeptisch aus einem Auge an. »Ja?«
»Stell dich mal neben Evan«, sagte Adam.
Marnie nickte. »Er ist mir echt nicht geheuer. Und außerdem ist er soziales Gift, um es milde auszudrücken.«
»Warum?«, erwiderte ich scharf. »Weil er mal in einer psychiatrischen Klinik war? Ist diese gesamte Scheißschule so rückständig, dass deswegen alle auf ihm herumhacken? Noch Jahre später?«
Adam legte mir die Hand auf die Schulter und sagte ernst: »Deine Sorge ist süß. Aber unangebracht.«
Ich schüttelte ihn ab.
»Es ist was ziemlich Heftiges passiert, bevor er da gelandet ist«, erklärte Marnie.
»Was denn?«, fragte ich ungeduldig. »Irgendwas mit einem Zusammenbruch im Unterricht?«
Sie tauschten Blicke.
»So in der Richtung«, sagte Marnie.
»Wenn es nur so einfach wäre«, sagte Adam mit einem dramatischen Seufzer.
Ich bemühte mich, nicht ungeduldig die Augen zu verdrehen. Es würde jetzt jede Sekunde klingeln, und sie würden mich mit einem verdammten Cliffhanger stehen lassen. »Jetzt sagt endlich, was passiert ist!«
»Ein paar Monate, nachdem die Salingers Evan offiziell adoptiert hatten – etwa vor drei Jahren –, hat jemand in einer Fabrik bei Jefferson auf Leute geschossen. Sechs Leute waren tot, dreizehn verletzt.«
Ich riss die Augen auf. »Evan war darin verwickelt?« Das würde einen bleibenden schlechten Ruf durchaus erklären und noch einiges mehr.
»Nicht direkt«, sagte Marnie. »Aber an demselben Morgen ist Evan total durchgedreht, er hat um Hilfe geschrien und rumgebrüllt; er hat irgendjemanden angeschrien, dass er aufhören solle mit was auch immer für schrecklichen Dingen. Jemanden, den nur er sehen konnte. Und zwar exakt zur selben Zeit wie das Blutbad in Jefferson.«
Jetzt verdrehte ich wirklich die Augen. »Ernsthaft? Das ist doch nur Zufall …«
»Sollte man denken. Aber Evan schien zu wissen, dass das passierte, bevor irgendjemand anders etwas von dem Vorfall in Jefferson gehört hatte. War ja nicht so, dass die Nachrichten liefen. Keiner hatte ’ne Ahnung. Außer Evan. Er wusste es.«
Ich verschränkte die Arme. Das roch total nach Gerüchteküche, aber ich spielte mit. »Dann ist er ein Medium oder was? Woher wusste er das?«
»Tja, das ist der Punkt«, sagte Marnie. »Die haben Evan hundertmal gefragt, und er hat immer wieder geantwortet, er hätte es in einem Traum gesehen.«
Adam schüttelte den Kopf. »Die Bullen sind gekommen und haben ihn zu einem Arzt gebracht, und dem hat Evan dann offensichtlich noch viel mehr Sachen erzählt, die er ›im Traum‹ gesehen hatte. Sachen, von denen er nichts wissen konnte.«
»Was für Sachen?«
Erstes Klingeln.
»Fortsetzung folgt«, sagte Marnie und legte ihre Hand auf meinen Arm. »Und bis dahin denk dran: soziales Gift. Wenn du mit Evan Salinger Umgang pflegst, sind selbst wir gegen die Konsequenzen machtlos.«
Adam nickte feierlich, und die beiden machten sich auf den Weg zu ihren Kursen und ließen mich mit hundert weiteren Fragen stehen.
Ich seufzte. Ich hasste Cliffhanger.
Ich ging zu meiner nächsten Unterrichtsstunde und dachte daran, wie Marnie das Gefühl beschrieben hatte, neben Evan zu stehen. Wie unter einer Hochspannungsleitung.
Es ist ganz anders, dachte ich. Kein kribbeliges Surren, sondern ein warmer Lichtstrahl … obwohl er dich nicht einmal ansieht.
4. KAPITEL
Jo
Während der kompletten Mathestunde musste ich an Evan denken. Seit ich dreizehn war, war ich richtig gut darin geworden, mich einen Dreck um andere Leute zu scheren. Aber er tat mir irgendwie leid. Nicht weil er in der Klapse gewesen war, sondern weil er es nötig gehabt hatte. Wahrscheinlich war er an eine Art Belastungsgrenze gestoßen. Ich konnte das verstehen. War mir auch schon passiert, und zum Beweis dafür hatte ich eine Narbe.
An dem Nachmittag, während Jared sich hinter der Tribüne unter meinem Rock hocharbeitete, fragte ich ihn nach Evan.
»Was?« Jared hörte auf, sah mich blinzelnd an. »Was soll mit ihm sein?«
»Warum zieht ihr so übel über ihn her?«
»Weil er ’n Freak ist, deshalb.«
»Mir kommt er ziemlich normal vor.«
»Er ist verrückt, und es sollte nicht mal erlaubt sein, dass er in die Schule geht.« Jared wollte seine Belohnung, wie ein kleiner Junge, der in einer Keksdose wühlt. »Er ist ein Lügner und komplett geistesgestört.«
Jared wurde in seinem Eifer langsam grob, und das weckte ein Gefühl von Übelkeit in meinem Bauch.
»Was kümmert dich das überhaupt?«, fragte Jared und packte mich fest.
»Tut es nicht«, sagte ich und biss ihn noch fester in den Hals.
Jared riss sich von mir los. »Aua, was soll der Scheiß?«
Meine Bedingungen. Meine Entscheidung. Nur meine Entscheidung.
Ich wiederholte das Mantra in meinem Kopf, und dann griff ich nach Jared, nicht andersrum.
»Beruhig dich mal«, sagte ich und packte seinen Reißverschluss. Ich. Weil es meine verdammte Entscheidung war.
Jared kam langsam wieder näher. »Ich will nur keinen Knutschfleck. Den würde Laney sehen.«
Ich griff in seine Hose. »Ich versuche, sanfter zu sein.«
»Gut.«
Er versuchte, mich auf die Knie runterzudrücken, aber ich war schon auf dem Weg.
Um Viertel vor vier verließ ich den Footballplatz. Die Sonne wanderte auf den Horizont zu, und die Schule war leer, als ich zum Fahrradständer ging. Mein Fahrrad war das einzige, abgesehen von einer verrosteten Gurke, die wahrscheinlich jemand aufgegeben hatte.
Ich schloss mein Fahrrad auf und wollte mich gerade draufsetzen, als sich mir plötzlich der Magen umdrehte. Fast hätte ich an Ort und Stelle gekotzt.
Mein Gott, beruhig dich.
Das war mir vorher noch nie passiert, und es hatte im Lauf der Jahre viel vorher gegeben. Viele Heimlichkeiten, Tribünen oder Abstellkammern oder Rücksitze von Autos. Warum also protestierte mein Körper plötzlich?
Ich atmete ein paar Mal tief ein und erinnerte mich daran, warum ich diesen Scheiß mit Typen wie Jared Piltcher überhaupt machte: Weil ich kein Opfer war. Ich sagte, wer und wann und wie viel. Genau wie die verdammte Pretty Woman.
Ich radelte zum nächsten kleinen Laden und kaufte mir Gatorade und eine Dose Altoids. Ich trank die halbe Flasche und kaute drei von den Minzbonbons, bevor ich nach Hause weiterfuhr. Inzwischen war ich ruhiger, die Übelkeit hatte sich gelegt.
Gerry war bei der Arbeit; das Haus war still. Ich schlängelte mich zwischen den unausgepackten Kartons mit unseren wenigen Besitztümern durch in mein Zimmer. Ich machte die Tür zu, setzte mich an meinen Schreibtisch, von dem aus ich den eingezäunten Hof des Nachbarn sehen konnte, und holte mein Notizbuch heraus.
Ich hatte eine Idee für ein Gedicht. Ein paar Sätze, aus denen ich etwas machen könnte. Ich musste sie aufschreiben, bevor sie aus meinem Gehirn flohen oder in peinlichen Erinnerungen verbrannten.
Mein Körper gehört nicht mir
Das hat er mir gezeigt
In den heimlichen Nächten
Intimbereich
jetzt
öffentliches Eigentum
Und eine Lektion:
Verschenk ihn, bevor sie ihn
dir nehmen
dann kannst du so tun
als täte es nicht
weh.
5. KAPITEL
Evan
Hätte ich niemals das Geräusch von Löffeln und Gabeln hören müssen, die über Schüsseln und Teller kratzen, würde ich glücklich sterben. Das war die Hintergrundmusik bei fast jedem Frühstück, Mittag- und Abendessen bei den Salingers. Jede Mahlzeit, kratz, kratz, kratz. Der Soundtrack einer Familie, die sich nichts zu sagen hatte. Bis auf den kleinen Garrett. Seine kleine Stimme war wie eine Flöte, die sich zwischen dem Gekratze zu Wort meldete. Heute Abend war es nicht anders.
Norma saß an einem Ende, überblickte mit geschürzten Lippen den Tisch und aß schweigend. Harris saß am anderen Ende, schaufelte Essen in sich rein wie Kohle in einen Ofen: lediglich als Energielieferant. Neben seinem Teller lag eine Zeitung aufgeschlagen. An den Seiten des Tisches saßen auf einer Seite Merle und Shane, ihnen gegenüber Garrett und ich.
»Hey Evan, spielst du morgen nach der Schule mit mir Ball?«, fragte Garrett, das süße runde Gesicht mit unerschrockener Zuneigung zu mir emporgewandt. Mir tat die Brust weh. Mein neunjähriger Bruder war das einzige menschliche Wesen in Planerville, das mich nicht ansah wie einen Aussätzigen.
»Klar, Kumpel. Machen wir.«
»Ich brauch dich in der Werkstatt«, sagte Harris, ohne von seinem Geschnetzelten oder seiner Zeitung aufzusehen. »Sofort nach der Schule.«
Shane saß mir gegenüber und warf mir einen Todesblick zu, dann drehte er sich jammernd zu seinem Dad um. »Ich dachte, ich wär dran, eine Schicht zu arbeiten. Das hast du letzte Woche gesagt.«
Harris’ Blick schoss zwischen mir und Shane hin und her, dann wieder zu seinem Essen. »Diese Woche ist viel los. Ich brauch Evan.«
»Ja, klar«, sagte ich.
Shanes stummer Wutsturm wehte mich an. Ich konnte nichts tun. Harris’ Regeln waren Gesetz, aber das würde Shane nicht davon abhalten, Rache zu üben.
Neben mir ließ Garrett die Schultern hängen. Ich wollte ihm durch das hellblonde Haar wuscheln. »Nächstes Mal, Kumpel, okay?«
Seine Miene erhellte sich sofort. »Okay«, sagte er und fing an, über die Wissenschaftsausstellung an seiner Grundschule zu plappern.
Shane schmollte stumm, die Arme wie ein bockiges Kleinkind vor der schmalen Brust gekreuzt. Er hatte Multiple Sklerose, die Form, bei der man Schübe und dann längere Zeit Ruhe hatte, und jetzt war gerade eine Ruhephase. Es machte ihn dünn und schwach, und er lebte in ständiger Angst vor dem nächsten Schub.
Es war schrecklich anzusehen, wie die Krankheit ihren psychischen und körperlichen Tribut von meinem Adoptivbruder forderte, und es machte mich stinksauer, dass unsere Eltern nur die körperlichen Symptome behandeln ließen. Shane ließ seine unkontrollierte Wut und Angst an mir aus, sah mich als einen Eindringling, der ihm durch seine Kraft und Gesundheit seine Zukunft in der Werkstatt stahl. Und, was schlimmer war, er machte mir das Leben in der Schule zur Hölle. Ich rief mir ins Gedächtnis, welche Angst er haben musste. Er führte einen Kampf, den er nicht gewinnen konnte, und ich fand es schrecklich, dass er das durchmachen musste. Aber nach den Auswirkungen meines kleinen Aufenthalts in der Woodside-Klinik wollten die Salingers wahrscheinlich nicht noch ein zweites Kind, das eine psychiatrische Behandlung brauchte.
Als wäre es seit Woodside nicht schon hart genug für mich, nahm Shane sich Merle als Bodyguard und Kampfhund. Shane übertrug seinen Zorn direkt auf ihn. Merle – ein Jahr jünger als wir, aber vom Kopf her gute fünf Jahre zurück – tat ihm den Gefallen nur allzu gern. Was ihm an Denkvermögen fehlte, machte er durch Muskelkraft wett. Shane hetzte Merle gern kurz vor der Schule auf mich oder kurz danach. Vor der Arbeit in der Werkstatt, sodass ich mit einem blutigen T-Shirt auftauchte oder einem Veilchen, das vor den Kunden keinen guten Eindruck machte. Harris hasste das.
Shane stieß Merle in die Rippen, und der nickte und schaufelte sich den Rest seines Essens in den riesigen Körper. Mir sträubten sich die Nackenhaare.
»Jungs. Geschirr«, sagte Norma.
Auf dieses Zeichen standen wir alle auf. Die Eltern gingen ins Fernsehzimmer und ließen uns Jungs abräumen.
Sobald Norma außer Sicht war, drückte Merle mich gegen die Tür zur Speisekammer. Er rammte mir den dicken Unterarm unters Kinn und presste ihn gegen meine Kehle. Shane sah mich über Merles Schulter an und lachte höhnisch.
»Glaubst du, ich bin blind? Glaubst du, ich seh nicht, was du machst? Die verdammte Werkstatt gehört mir. Und Merle. Wir sind die Söhne auf dem Schild, nicht du.«
Ich schubste Merle weg und wappnete mich, jeder Muskel und jeder Nerv angespannt, bereit, mich zu verteidigen.
»Lass es, Shane«, sagte ich. »Hör endlich auf mit der Scheiße.«
Ich versuchte, mich an ihnen vorbeizudrängeln, um das zu beenden, aber Merle packte mich vorn am T-Shirt und schubste mich zurück. Ich riss ihm das Shirt aus der Hand, und wir starrten uns an. Da war nichts in Merles Schweinsäuglein als der dumpfe Hass, den Shane ihm eingetrichtert hatte. Garrett stand hinter uns, in der Mitte der von gelbem Neonlicht erhellten Küche, trat von einem Fuß auf den anderen und kaute auf seiner Unterlippe.
»Ich will keinen Streit«, sagte ich zu Shane. »Und ich will auch die Werkstatt nicht. Nach dem Schulabschluss bin ich hier weg.«
»Das will ich schwer hoffen«, stieß Shane hervor. »Ich zähle die Sekunden.«
Er drehte sich um und stützte sich schwer auf seinen Stock, als er ging und mich und Garrett die Küche aufräumen ließ. Merle folgte ihm langsam, enttäuscht, dass die Sache unblutig geblieben war.
Sie hatten mich zu leicht davonkommen lassen. Normalerweise musste ich mich mit Merle prügeln. Er war wie ein Hund, der an seiner Leine zerrte. Als würde nur Shanes Wort ihn daran hindern, mich umzubringen.
Das klang lächerlich, aber es fühlte sich nicht lächerlich an. Nicht, wenn Merle und ich miteinander kämpften. Es fühlte sich nicht an wie eine Rauferei unter Brüdern, sondern als ginge es um Leben und Tod.
»Willst du wissen, was ich denke?«, fragte Garrett, der die Teller wegstellte, die ich abgetrocknet hatte. »Shane hat Angst.«
»Wovor?«, fragte ich.
»Vor dir.«
Ich war sofort angespannt und fragte mich, ob er über den Amokschützen in der Fabrik reden würde. Ich sprach es nie aus, wie Voldemorts Namen; ich wagte nicht einmal, zu viel darüber nachzudenken. Aber wie sehr ich auch versuchte, so zu tun, als wäre es nie passiert, oder wie viele Jahre auch vergingen und Abstand schafften zwischen diesen schrecklichen Tagen und jetzt, es war immer noch da. Direkt vor meiner Nase und in den Köpfen und dem Gerede aller anderen in dieser beschissenen Stadt.
»Er hat Angst, dass Dad dir die Werkstatt gibt«, sagte Garrett. »Sie dir überschreibt.«
»Sag so was nicht«, warnte ich ihn und sah mich um. »Wenn Shane das hört, macht er dir das Leben zur Hölle.« Mir wurde schon schlecht, wenn ich nur daran dachte. Das Einzige, was schlimmer war, als dass Shane mir Merle auf den Hals hetzte, war die Vorstellung, er könnte dasselbe mit Garrett tun.
Der kleine Junge nickte. »Mein Lehrer sagt, Raufbolde haben Angst. Wenn sie Angst haben, werden sie gemein.«
»Sie sind sowieso gemein.« Ich wollte die Arme nach Garrett ausstrecken. Ihn in den Arm nehmen. Aber ich hielt mich zurück. Seit Woodside berührte mich niemand, und ich berührte auch niemanden, als wären emotionale Zusammenbrüche ansteckend.
Sobald die Küche sauber und aufgeräumt war, ging Garrett zu Harris und Norma fernsehen. Man hörte das aufgezeichnete Gelächter irgendeiner Sitcom. Merle war in seinem Zimmer und spielte wahrscheinlich Grand Theft Auto. Shane war in seinem Zimmer und machte, was auch immer er vor dem Schlafengehen tat. Wahrscheinlich lag er herum und hasste das Leben. Er war klug, hatte aber aufgehört zu lernen. Wahrscheinlich dachte er, dass es ohnehin sinnlos war – die Krankheit würde immer schlimmer werden. Aber es war schrecklich, wenn man daran dachte, dass er jetzt schon aufgab. Auf dem Weg in mein Zimmer ertappte ich mich dabei, stehen bleiben und mit Shane reden zu wollen. Um wenigstens Waffenstillstand zu schließen. Oder ihm zu sagen, dass er mich nicht hassen musste.
Einen kurzen Moment lang blieb ich wirklich vor seiner Tür stehen, dann ging ich weiter. Vielleicht brauchte er es, mich zu hassen. Auf mich loszugehen war vielleicht besser, als es in sich zu behalten, wo es an ihm fraß wie die Krankheit. Ich ging hoch in mein Zimmer, das zur Straße hin lag. Ich musste mich an hohen Bücherstapeln vorbeischlängeln, um mich auf mein Bett unter dem Fenster zu legen. Mein Zimmer war meine Zuflucht. Bett, Schreibtisch, Stuhl und Kommode. Überall gestapelte Bücher. Bücher waren mein Ausweg, bis Geld und Zeit einen realen Ausweg möglich machten.
Bücher und das Erlebnisbad, das sie letzten Sommer gebaut hatten.
Wir waren zur Eröffnung mit der Familie hingegangen, und ich hatte es gehasst. Der Lärm, die vielen Leute, das aufgewühlte Wasser. Ich war mit fünfzig anderen Leuten in dem eher kleinen Becken geschwommen und hatte gedacht, ich würde ertrinken. Aber nachts, allein, wenn das Wasser still und ruhig war … dann war es perfekt. Ich weiß nicht, was mich zuerst dort hingelockt hatte, aber nachdem ich einmal angefangen hatte, mich nachts rüberzuschleichen, konnte ich nicht mehr aufhören.
Durch das Fenster sah ich, wie der Abend dunkler wurde. Ich wartete.
Gegen neun war das Haus still. Norma und Harris waren Frühaufsteher. Sie sahen nie nach mir. Ich schlich mich nach unten und zur Hintertür hinaus. An der freistehenden Garage vorbei, die Einfahrt hinunter und auf die Straße.
Halb ging, halb joggte ich durch die schwüle, erdrückende Hitze der Nacht zum Funtown Water Park. Ich kletterte problemlos über den Zaun, nachdem ich das in den letzten vier Monaten jede Nacht getan hatte.
Das Bad war leer. Die drei Rutschen – kurz, mittel und lang – waren gesperrt. Der Bereich mit den Wasserkanonen und -sprengern lag ruhig da. All die gelangweilten Teenager, die da arbeiteten, waren weg. Im Winter würden sie permanent schließen und den Zugang vielleicht besser sichern. Bei dem Gedanken verkrampfte sich mein Magen, bis mir wieder einfiel, dass ich im Winter längst weg sein würde.
Ich ging in die nordöstliche Ecke zu dem rechteckigen Becken für Erwachsene, wo manchmal privater Schwimmunterricht stattfand. Es war nur fünfzehn Meter lang und an der tiefsten Stelle drei Meter tief, aber das genügte mir. Ich zog mir Stiefel, Socken und Jeans aus. Dann sprang ich nur in Boxershorts und T-Shirt hinein.
Das kühle Wasser glitt über meine Haut. Ich fühlte mich ruhiger, friedlich. Schwerelos schwamm ich zum tiefen Ende. Ich hielt ganz still und ließ alle Gedanken los, während ich ein paar tiefe Atemzüge tat, die Luft tiefer und tiefer einsog. Als nichts mehr reinging, tauchte ich unter.
Die Unterwasserbeleuchtung glomm schwach, färbte das Wasser grünlich.
Ich hielt den Atem tief in meinen Lungen, wo mein Körper sich nahm, was er brauchte; jeweils nur wenige Moleküle. Ich blieb fast reglos am Grund, bewegte nur die Arme, um unten zu bleiben.
Dann schloss ich die Lider.
Ich weiß nicht, was der Auslöser war, aber eine alte Erinnerung – meine älteste Erinnerung – lief nun vor meinem geistigen Auge ab wie eine Wochenschau oder ein Amateurfilm.
Der Mann war groß, so groß wie der höchste Baum. Der Junge war klein, vielleicht drei Jahre alt, und sah unverwandt zu dem Mann hoch.
Der Mann legte die Hände auf die Knie und beugte sich vor, ein verwirrtes Lächeln im Gesicht. »Wo bist du denn hergekommen, kleiner Mann?«