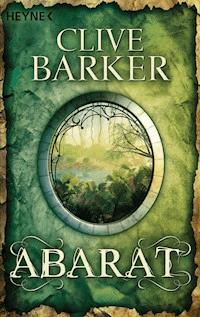
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
In Chickentown, einer ländlichen Kleinstadt in Minnesota, hat Candy sich schon immer fehl am Platz gefühlt. Als sie sich dann auch noch mit ihrer Lehrerin überwirft, beschließt sie, der Schule und allem anderen den Rücken zu kehren. Dass ihr Weg sie allerdings nach Abarat führt, damit hat Candy nicht gerechnet. Trotz der sehr ungewöhlichen Bewohner, der guten Feen, bösen Zauberer und gefährlichen Seeungeheuer, scheint Candy die magische Insellandschaft Abarat merkwürdig vertraut. Doch nicht jeder freut sich über ihre Ankunft dort, und schon bald ist Candy auf der Flucht vor dem finsteren Fürsten der Mitternacht …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1804
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Das Buch
Das geheimnisvolle Abarat übertrifft selbst die wildesten Fantasien, die Candy je hatte: Es besteht aus 25 Inseln, eine Insel für jede Stunde des Tages – und eine außerhalb der Zeit. Doch damit nicht genug: Abarat ist bevölkert von Feen, Zauberern, Seeungeheuern und allerlei anderen zwielichtigen Gestalten, die Candy bestenfalls aus Märchen und Sagen kennt. Nach ihrem langweiligen, absolut vorhersehbaren Alltag in der Kleinstadt Chickentown kommt Candy nun aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Doch viel Zeit zum Nachdenken bleibt ihr nicht, denn schon ist ihr der finstere Christopher Carrion auf den Fersen. Auf der Flucht vor dem Fürsten der Mitternacht gerät die unerschrockene Candy von einem Abenteuer ins nächste. Glücklicherweise gibt es auch ausgesprochen hilfsbereite Inselbewohner – und das Schicksal scheint ihr wohlgesonnen …
»Phantastisch!« Focus
Der Autor
Clive Barker wurde 1952 in Liverpool geboren. Neben seinen zahlreichen Romanen, von denen u. a. »Hellraiser«, »Candyman«, »Cabal« und »Lord of Illusions« verfilmt wurden, hat er Kurzgeschichten und Drehbücher verfasst und als Illustrator, Regisseur, Filmproduzent und Computerspiel-Entwickler gearbeitet. Er gilt neben Stephen King und Dean Koontz als erfolgreichster Autor der fantastischen Literatur. Clive Barker lebt in Beverly Hills.
Lieferbare Titel
Abarat
Abarat – Tage der Wunder – Nächte des Zorns
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel
Abarat / Abarat: Days of Magic, Nights of War /Abarat: Absolute Midnight
bei Joanna Cotler Books, New York
Copyright © 2002, 2004 und 2011 by Clive Barker
Copyright © 2004, 2005 und 2011 der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © 2014 dieser Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Veröffentlicht in Zusammenarbeit mit HarperCollins Children’s Books,
a division of HarperCollins Inc., New York
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München,
unter Verwendung eines Motivs von © Shutterstock
Satz: Schaber Datentechnik, Wels
ISBN: 978-3-641-13427-3
www.heyne.de
INHALT
ABARAT
PROLOG Die Mission
ERSTER TEIL Morgenflut
ZWEITER TEIL Zwielicht und noch weiter
DRITTER TEIL Wo ist wann?
VIERTER TEIL Fremd und tückisch
ABARATTage der Wunder – Nächte des Zorns
PROLOG Hunger
ERSTER TEIL Freaks, Flachpfeifen und Flüchtlinge
ZWEITER TEIL Versäumtes und Vergessenes
DRITTER TEIL Zeit der Ungeheuer
VIERTER TEIL Das Meer kommt nach Chickentown
ABARATIn der Tiefe der Nacht
PROLOG Was der blinde Mann sah
ERSTER TEIL Die dunklen Stunden
ZWEITER TEIL Du oder nicht ich
DRITTER TEIL Viel Zauberei
VIERTER TEIL Heranziehende Dunkelheit
FÜNFTER TEIL Sturmschreiter
SECHSTER TEIL Es gibt kein Morgen
SIEBTER TEIL Ruf des Vergessens
ABARAT
Für Emilian David Armstrong
Ich träumte mir ein grenzenloses Buch,
Ein Buch ohne Beschränkungen,
Dessen Blätter sich in fantastischer Fülle zerstreuten.
Mit jeder Zeile eröffneten sich neue Horizonte,
Erwuchs die Aussicht auf neue Wonnen,
Neue Zustände, neue Seelen.
Eine dieser Seelen träumte,
Einen ganzen imaginären Nachmittag verdösend,
Diese Worte.
Und da sie eine Hand benötigte, sie festzuhalten,
Schuf sie meine.
C. B.
PROLOG
Die Mission
Drei ist die Zahl derer, die heilige Werke tun;
Zwei ist die Zahl derer, die Werke der Liebe tun;
Eins ist die Zahl derer, die vollkommen Böses
oder vollkommen Gutes tun.
Aus den Aufzeichnungen eines Mönches vom Orden des heiligen Oco – sein Name ist nicht bekannt
Der Sturm zog von Südwesten auf wie ein Unhold, der sich auf blitzgezackten Beinen an seine Beute heranpirscht.
Der Wind, den er mitbrachte, war so faulig wie der Atem des Teufels selbst und er wühlte die friedliche Oberfläche des Meeres auf. Als das kleine rote Boot, das die drei Frauen für ihre gefahrvolle Reise gewählt hatten, den Schutz der Inseln verlassen und offenes Gewässer erreicht hatte, waren die Wellen schon steil wie Felsklippen aufgetürmt, acht, neun Meter hoch.
»Diesen Sturm hat jemand geschickt«, sagte Joephi, die das Lyra genannte Boot nach besten Kräften zu steuern versuchte. Das Segel zitterte wie Laub im Orkan, wild hin und her schlagend, kaum noch zu beherrschen. »Ich schwöre dir, Diamanda, das ist kein natürlicher Sturm!«
Diamanda, die älteste der drei Frauen, saß in der Mitte des winzigen Gefährts. Sie hatte ihre dunkelblauen Gewänder zusammengerafft und die kostbare Ladung fest an den Busen gepresst.
»Wir wollen mal nicht hysterisch werden«, sagte sie zu Joephi und Mespa. Sie wischte sich ein langes weißes Haar aus den Augen. »Niemand hat uns aus dem Palast von Bowers herausgehen sehen. Wir sind unbemerkt entwischt, da bin ich mir sicher.«
»Warum dann dieser Sturm?«, sagte Mespa, eine schwarze Frau, die für ihre Unverwüstlichkeit berühmt war, im Augenblick aber Gefahr zu laufen schien, vom Regen, der auf die Häupter der Frauen niederprasselte, hinweggeschwemmt zu werden.
»Warum seid ihr so überrascht, dass der Himmel sich beschwert?«, sagte Diamanda. »Wussten wir denn nicht, dass die Welt von dem, was gerade geschehen ist, auf den Kopf gestellt wird?«
Joephi kämpfte fluchend mit dem Segel. Ihr weißes Gesicht bildete einen schroffen Kontrast zur Schwärze des kurz geschnittenen Haars.
»Ja, mussten wir nicht genau das alles von Anfang an erwarten?«, fuhr Diamanda fort. »Ist es nicht vollkommen richtig, dass der Himmel in Fetzen gerissen wird und das Meer in Raserei gerät? Hätten wir es denn lieber, wenn die Welt gar keine Notiz nehmen würde?«
»Nein, nein, natürlich nicht«, sagte Mespa, die sich am Rand des stampfenden Bootes festklammerte. »Mir wäre es nur lieber, wir würden nicht genau mittendrin stecken.«
»Nun, das tun wir aber«, sagte die alte Frau. »Und daran lässt sich nicht das Geringste ändern. Ich würde also vorschlagen, dass du deinen Magen zu Ende entleerst, Mespa …«
»Er ist leer«, sagte die von Übelkeit Geschlagene. »Nichts mehr da, was noch rauskommen könnte.«
»… und dass du, Joephi, dich um das Segel kümmerst …«
»O Göttin …«, murmelte Joephi. »Seht nur!«
»Was ist denn los?«, sagte Diamanda.
Joephi zeigte hinauf zum Himmel.
Mehrere Sterne waren vom Firmament geschüttelt worden – große weiße Feuerklumpen, die durch die Wolken stießen und aufs Meer herunterfielen. Einer davon steuerte genau auf die Lyra zu.
»Runter!«, schrie Joephi, packte Diamandas Gewänder von hinten und stieß die Alte von ihrem Sitz.
Diamanda ließ sich nicht gern berühren, schon gar nicht herumschubsen,wie sie es nannte. Sie schickte sich an, Joephi einen strengen Verweis zu erteilen, doch wurden ihre Worte von dem Getöse des herabstürzenden Sterns verschluckt, der sich dem Boot mit großer Geschwindigkeit näherte. Er schlug durch das sich bauschende Segel der Lyra,hinterließ dort ein rauchendes Loch und klatschte dann ins Meer, wo er unter mächtigem Zischen erlosch.
»Ich schwöre euch, der war für uns gedacht«, sagte Mespa, nachdem alle wieder den Kopf erhoben hatten. Sie half Diamanda auf die Beine.
»Na gut«, meinte die alte Dame, indem sie den Lärm des aufgewühlten Wassers überschrie, »das war knapper, als ich mir gewünscht hätte.«
»Dann glaubst du also auch, dass wir unter Beschuss stehen?«
»Ich weiß es nicht, und es ist mir auch egal«, sagte Diamanda. »Wir müssen einfach nur auf die Heiligkeit unserer Mission vertrauen.«
Mespa fuhr sich mit der Zunge über die blassen Lippen, bevor sie ihre nächsten Worte riskierte.
»Sind wir uns denn ganz sicher, dass sie wirklich heilig ist?«, sagte sie. »Vielleicht begehen wir ein Sakrileg. Vielleicht wäre es besser, sie …«
»In Frieden ruhen zu lassen?«, sagte Joephi.
»Ja«, antwortete Mespa.
»Sie war praktisch noch ein Mädchen, Mespa«, sagte Joephi. »Sie hatte ein Leben voller Liebe vor sich, und das wurde ihr geraubt.«
»Joephi hat recht«, sagte Diamanda. »Glaubst du, eine Seele wie die ihre würde Ruhe finden, bei all dem ungelebten Leben? Bei all den Träumen, die unerfüllt geblieben sind?«
Mespa nickte. »Das stimmt natürlich«, sagte sie. »Wir müssen dieses Werk vollbringen, koste es, was es wolle.«
Die Gewitterwolke, die ihnen von den Inseln aus gefolgt war, stand nun genau über ihnen. Sie schleuderte einen widerlich schleimartigen, eiskalten Regen nach unten, der wie Trommelschläge auf den Planken der Lyra dröhnte. Blitze zuckten zu allen Seiten des zitternden Gefährts herab, und ihr gespenstisches Licht ließ die sich auftürmenden Wellen wie Schattenrisse erscheinen, bevor sie über dem Boot zusammenschlugen.
»Das Segel ist nicht mehr zu gebrauchen«, sagte Joephi mit Blick auf die zerfetzte Leinwand.
»Dann müssen wir eben andere Mittel finden«, sagte Diamanda. »Mespa. Nimm unsere Fracht mal kurz an dich. Aber sei vorsichtig.«
Voller Ehrfurcht empfing Mespa den kleinen Kasten, dessen Seiten und Deckel mit detailreich gestalteten magischen Bildnissen verziert waren. Von ihrer Last befreit, begab sich Diamanda zum Heck der Lyra, wobei deren heftiges Schwanken sie mehrmals über Bord zu werfen drohte, bis sie schließlich glücklich zu dem kleinen Sitz gelangt war. Hier kniete sie nieder, beugte sich vor und tauchte ihre arthritischen Hände ins eiskalte Wasser.
»Pass lieber auf«, sagte Mespa warnend. »Da ist ein fünfzehn Meter langer Mantizak, der uns seit einer halben Stunde nachschwimmt. Ich hab ihn gesehen, als ich mich übergeben musste.«
»Kein Fisch, der etwas auf sich hält, ist hinter meinen alten Knochen her«, sagte Diamanda.
Sie hatte die Worte kaum ausgesprochen, da kam der gesprenkelte Kopf eines Mantizaks – nicht ganz von der Größe, die Mespa ausgemalt hatte, aber trotzdem riesig – an die Wasseroberfläche geschossen. Sein gewaltiger Rachen klaffte kaum zwei Handbreit von Diamandas ausgestrecktem Arm entfernt.
»Göttin!«, schrie die alte Dame, zog die Hände ein und setzte sich jäh aufrecht.
Der enttäuschte Fisch drängte von hinten gegen das Boot, als hoffte er, auf diese Weise einen der darauf befindlichen menschlichen Leckerbissen in sein Element bugsieren zu können.
»Also …«, sagte Diamanda. »Mir scheint, hier ist ein wenig Mondzauber gefragt.«
»Warte«, sagte Joephi. »Du hast doch selbst gesagt, dass wir nur Aufmerksamkeit erregen, wenn wir Magie anwenden.«
»Ja, hab ich«, erwiderte Diamanda. »Aber wie die Dinge jetzt stehen, riskieren wir, entweder zu ertrinken oder von dem Ding da gefressen zu werden.« Der Mantizak schwamm jetzt längsseits der Lyra, hatte den gewaltigen Kopf erhoben und fixierte die Frauen mit seinem silbrig-scharlachroten Auge.
Mespa presste sich den kleinen Kasten noch enger an die Brust. »Der wird mich nicht kriegen«, sagte sie mit vor Angst zitternder Stimme.
»Stimmt«, sagte Diamanda beruhigend. »Auf keinen Fall.«
Sie hob ihre vom Alter gezeichneten Hände. Dunkle Energiefäden zogen durch ihre Adern und schossen aus den Fingerspitzen, fügten sich in der Luft zu feinen Gebilden und flogen dann himmelwärts.
»Edle Frau Mond«, rief sie. »Du weißt, wir würden dich nicht anrufen, wenn wir nicht auf dein Eingreifen angewiesen wären. Aber das sind wir. Herrin, wir drei sind ohne Bedeutung. Wir erbitten deine Gnade nicht um unsertwillen, sondern für die Seele einer, die vor der Zeit aus unserer Mitte gerissen wurde. Bitte, Herrin, führe uns sicher durch diesen Sturm, auf dass ihr Leben fortdauern kann …«
»Gib unser Ziel an!«, schrie Joephi über das Getöse des Wassers hinweg.
»Sie kennt unsere Gedanken«, sagte Diamanda.
»Trotzdem«, erwiderte Joephi. »Nenne den Ort!«
Diamanda warf ihrer Gefährtin einen etwas ungehaltenen Blick zu. »Wenn du drauf bestehst«, sagte sie und rief, indem sie die Hände wieder zum Himmel ausstreckte: »Bring uns ins Hernach.«
»Gut«, sagte Joephi.
»Herrin, erhöre uns …«, hob Diamanda wieder an.
Aber sie wurde von Mespa unterbrochen.
»Sie hat uns schon erhört, Diamanda.«
»Was?«
»Sie hat uns gehört.«
Die drei Frauen blickten nach oben. Die trüben Sturmwolken rissen auf, als würden sie von Riesenhänden auseinandergeschoben. Durch den sich stetig weitenden Spalt stieß ein Mondstrahl: von reinstem Weiß, aber doch irgendwie warm. Er erleuchtete das Wellental, in dem das Boot der Frauen vergraben war. Er tauchte das Gefährt vollständig in Licht.
»Danke, Herrin …«, murmelte Diamanda.
Das Mondlicht strich über das Boot, erfasste jedes einzelne Teil des winzigen Gefährts bis hin zum schemenhaft unter Wasser liegenden Kiel. Es segnete jeden Nagel und jede Planke vom Bug bis zum Heck, jede Seilschlinge, jedes Ruder, jeden Zapfen, jeden Farbfleck, jeden Zentimeter Tau.
Es legte sich auch auf die Frauen, erweckte neues Leben in ihren müden Knochen und wärmte ihre eiskalte Haut.
Das alles dauerte vielleicht zehn Sekunden.
Dann begannen die Wolken sich wieder zu schließen, das Licht des Mondes schwand. So plötzlich, wie er begonnen hatte, war der weihevolle Moment auch schon wieder vorbei.
Das Meer erschien jetzt, da das Licht verschluckt war, doppelt so düster, der Wind doppelt so scharf. Die Bootsplanken jedoch zeigten noch immer ein zartes Leuchten, und durch die Segnung, die sie erhalten hatten, waren sie stabiler geworden. Das Boot ächzte nicht mehr, wenn es breitseits lag. Stattdessen schien es ohne Anstrengung auf den steilen Wellenkämmen zu schweben.
»So ist es schon besser«, sagte Diamanda.
Sie streckte die Hände aus, um die kostbare Fracht wieder an sich zu nehmen.
»Ich kann schon darauf aufpassen«, sagte Mespa leicht aufgebracht.
»Daran zweifle ich nicht«, sagte Diamanda. »Aber die Verantwortung liegt nun einmal bei mir. Denk dran, ich kenne die Welt, die wir ansteuern. Du nicht.«
»Du weißt, wie sie früher war«, sagte Joephi, wie um es ihr in Erinnerung zu rufen. »Sie wird sich verändert haben.«
»Gut möglich«, meinte Diamanda. »Trotzdem habe ich eine bessere Vorstellung von dem, was uns erwartet, als ihr beiden. Nun gib mir schon den Kasten, Mespa.«
Mespa rückte den Schatz heraus, und das Boot der Frauen furchte durch die lichtlose See, stetig schneller werdend, den Bug leicht übers Wasser erhoben.
Der Regen prasselte nach wie vor auf die Frauen herunter, sammelte sich auf dem Boden des Bootes, bis das Wasser knöchelhoch stand. Die Reisenden nahmen aber keine Notiz von dieser Belästigung. Sie saßen einfach nur in dankbarem Schweigen beisammen, während der Zauber des Mondes sie auf ihr Ziel zueilen ließ.
»Da!«, sagte Joephi auf einmal. Sie deutete auf einen Küstenstreifen in der Ferne. »Ich sehe das Hernach.«
»Ich sehe es auch!«, sagte Mespa. »Oh, der Göttin sei gedankt! Ich sehe es! Ich kann es sehen!«
»Seid still«, sagte Diamanda. »Wir wollen doch keine Aufmerksamkeit erregen.«
»Es sieht ganz leer aus«, sagte Joephi, während sie die vor ihnen liegende Landschaft absuchte. »Du hast doch gesagt, dass es da eine Stadt gibt.«
»Da ist tatsächlich eine Stadt. Nur liegt sie etwas vom Hafen entfernt.«
»Ich sehe auch keinen Hafen.«
»Na ja, ist nicht mehr viel davon übrig«, sagte Diamanda. »Er wurde niedergebrannt, schon lange vor meiner Zeit.«
Der Kiel der Lyra glitt knirschend aufs Gestade des Hernach. Joephi sprang als Erste an Land, befestigte das Schiffstau an einem in den Boden geschlagenen, vom Alter verwitterten Stück Holzbalken. Mespa half Diamanda von Bord, und dann standen alle drei Seite an Seite da, um das nicht sehr viel versprechende Gelände, das sich vor ihnen erstreckte, zu begutachten. Der Sturm war ihnen über die Scheidelinie zwischen den zwei Welten gefolgt, und seine Wucht war ungemildert.
»Also, noch mal zur Erinnerung«, sagte Diamanda. »Wir sind hier, um etwas Bestimmtes zu tun, und sonst nichts. Wir erledigen unsere Aufgabe, und dann verschwinden wir wieder. Denkt dran: Wir dürften eigentlich nicht hier sein.«
»Das wissen wir«, sagte Mespa.
»Wir wollen aber auch nichts überstürzen und dabei irgendwelche Fehler begehen«, sagte Joephi mit einem Blick auf den Kasten, den Diamanda in Händen hielt. »Um ihretwillen müssen wir alles richtig machen. Wir tragen die Hoffnungen des Abarat.«
Diese Bemerkung ließ sogar Diamanda verstummen. Sie schien dem Gesagten einen Augenblick lang nachzusinnen, den Kopf gesenkt, das weiße Haar vom Regen durchspült, sodass es einen Vorhang bildete, der den Kasten in ihren Armen einrahmte. Schließlich sagte sie: »Seid ihr beide bereit?«
Die anderen Frauen murmelten, ja, das seien sie; und mit Diamanda an der Spitze ließen sie den Strand hinter sich und streiften durch das regengepeitschte Gras, um den Ort zu finden, den die Vorsehung für sie bestimmt hatte, auf dass sie dort ihr heiliges Werk verrichteten.
ERSTER TEIL
Morgenflut
Das Leben ist kurz,
Das Vergnügen eher mau,
Leckgeschlagen das Schiff,
Die Mannschaft hängt tot im Tau;
Aber ach! Aber ach!
Das Meer,
Wie ist es doch blau!
Das letzte Gedicht des Rechtschaffenen Bandy, Wanderdichter von Abarat
EINS
Zimmer neunzehn
Die Hausaufgabe, die sich Miss Schwartz für Candys Klasse ausgedacht hatte, war nicht weiter kompliziert. Jeder hatte eine Woche lang Zeit, um zehn interessante Fakten über die Stadt, in der sie alle wohnten, zusammenzutragen, die er dann vorstellen konnte. Es dürfe gern etwas über die Geschichte von Chickentown sein, sagte sie, oder, falls das den Schülern lieber sei, Informationen über die Stadt von heute, was natürlich nichts anderes bedeutete, als das altbekannte Zeug über moderne Hühnerhaltung in Minnesota wiederzukäuen.
Candy hatte ihr Bestes getan. Sie war in die Schulbücherei gegangen und hatte die Regale abgesucht, um vielleicht etwas – irgendetwas – zu finden, was wenigstens halbwegs von Interesse sein könnte. Da war aber nichts. Null, nada, niente. Es gab noch eine Bücherei in der Naughton Street, die zehnmal so groß war wie die Schulbibliothek, also ging sie dorthin. Wieder durchforstete sie die Regale. Es gab ein paar Bücher über Minnesota, in denen die Stadt Erwähnung fand, aber auch dort wurden nur immer wieder die gleichen langweiligen Fakten referiert: Chickentown hatte 36793 Einwohner und war der größte Hühnerfleischproduzent im ganzen Staat. Eines der Bücher charakterisierte die Stadt, nachdem es auf die Hühner hingewiesen hatte, als »ansonsten nicht weiter bemerkenswert«.
Ausgezeichnet, dachte Candy. Ich lebe in einer Stadt, die ansonsten nicht weiter bemerkenswert ist. Na ja, das war also Fakt Nummer eins. Fehlten nur noch neun.
»Wir wohnen in der langweiligsten Stadt im ganzen Land«, beklagte sie sich bei ihrer Mutter Melissa, nachdem sie zurückgekehrt war. »Ich finde einfach nichts für Miss Schwartz, worüber zu schreiben es sich lohnen würde.«
Melissa Quackenbush stand in der Küche und bereitete gerade einen Hackbraten. Die Küchentür war geschlossen, damit Candys Vater Bill nicht gestört wurde. Er saß in bierseligem Schlummer vor dem Fernseher, und Candys Mutter wollte diesen Zustand unbedingt erhalten. Je länger er ohne Bewusstsein blieb, desto angenehmer war das Leben für alle anderen im Haus – Candys Brüder Don und Ricky eingeschlossen. Nicht, dass dieser Wunsch je laut ausgesprochen worden wäre. Es bestand ein stilles Einvernehmen zwischen den Mitgliedern des Haushalts. Sie hatten es alle leichter, solange Bill Quackenbush schlief.
»Warum findest du denn, dass es hier langweilig ist?«, fragte Melissa, während sie den Hackbraten würzte.
»Guck doch nur mal nach draußen«, sagte Candy.
Melissa machte sich gar nicht erst die Mühe, der Aufforderung zu folgen, schließlich kannte sie die Szenerie vor dem Fenster nur allzu gut. Jenseits des schmierigen Fensterglases befand sich der chaotische Garten der Familie: das fast kniehohe, von der unerwartet mitten im Mai ausgebrochenen Hitzewelle braun gebrannte Gras; das aufblasbare Planschbecken, das sie vergangenen Sommer gekauft hatten, ohne aber im Herbst die Luft wieder rauszulassen und es wegzupacken, sodass es jetzt als kreisförmiger Schmutzhaufen aus rot-weißem Plastik in der äußersten Ecke des Gartens lag. Hinter diesem erschlafften Elend schloss sich gleich der kaputte Zaun an. Und hinter dem Zaun? Gab es noch einen Hof, der sich in einem nicht viel besseren Zustand befand, und dahinter noch einen, und noch einen und noch einen, bis die Gärten irgendwann aufhörten, ebenso wie die Straßen, und das leere Grasland begann.
»Ich weiß, was du für deine Hausarbeit suchst«, sagte sie.
»Ach?« Candy ging zum Kühlschrank und holte sich eine Brause heraus. »Was suche ich denn?«
»Etwas Abgedrehtes, Unheimliches«, sagte Melissa, während sie das Fleisch in die Backform stopfte. »Du hast einen gewissen Hang zum Makabren, genau wie deine Großmutter Frances. Die ist früher immer zu Beerdigungen gegangen, auch wenn sie die Leute gar nicht kannte.«
»Ist nicht wahr«, sagte Candy lachend.
»O doch, ich schwör’s dir. Sie hat lauter solche Sachen gemacht. Du hast das von ihr geerbt. Von mir oder deinem Vater hast du es jedenfalls nicht.«
»Oh, danke, da komme ich mir ja gleich wie ein echtes Wunschkind vor.«
»Du weißt schon, wie ich das meine«, sagte Candys Mutter abwehrend.
»Du findest also nicht, dass Chickentown langweilig ist?«, sagte Candy.
»Es gibt schlimmere Orte, glaub mir«, sagte Melissa. »Immerhin hat unserer ein bisschen Geschichte …«
»Nicht, wenn man den Büchern glaubt, die ich mir alle angesehen habe«, sagte Candy.
»Weißt du, mit wem du wirklich mal sprechen solltest?«, sagte Melissa.
»Nein, mit wem denn?«
»Norma Lipnik. Erinnerst du dich an Norma? Ich hab früher mit ihr zusammen im Hotel Comfort Tree gearbeitet.«
»Schemenhaft«, sagte Candy.
»In einem Hotel geschehen alle möglichen merkwürdigen Sachen. Und das Comfort Tree gibt es schon seit … ach, ich weiß nicht. Frag Norma, sie wird es dir erzählen.«
»Ist das die mit dem weißblonden Haar, die immer viel zu viel Lippenstift aufgetragen hat?«
Melissa bedachte ihre Tochter mit einem kurzen Lächeln. »Wehe, du sagst irgendwas Unhöfliches zu ihr.«
»Würde ich nie tun.«
»Ich weiß doch, wie dir solche Sachen herausrutschen.«
»Mama. Ich werde echt total höflich sein.«
»Gut. Ja, dann mach das ruhig. Sie ist inzwischen stellvertretende Geschäftsführerin; wenn du also richtig nett zu ihr bist und die richtigen Fragen stellst, dann liefert sie dir garantiert etwas für deine Hausarbeit, was kein anderer aus deiner Klasse wird bieten können.«
»Was denn zum Beispiel?«
»Geh hin und frag sie. Sie erinnert sich bestimmt an dich. Bitte sie, dass sie dir von Henry Murkitt erzählt.«
»Wer ist denn Henry Murkitt schon wieder?«
»Geh und frag sie. Es ist deine Hausarbeit, nicht meine. Mach dich auf die Socken, und führe ein paar Ermittlungen. Wie ein Detektiv.«
»Gibt es da denn was zu ermitteln?«
»Du wirst überrascht sein.«
Das war sie tatsächlich. Als erste Überraschung erwies sich Norma Lipnik selbst, die keineswegs mehr jene geschmacklose Frau war, als welche Candy sie kennengelernt hatte: mit hoch aufgetürmten Haaren und zu kurzem Rock. In den etwa acht Jahren, die seit ihrer letzten Begegnung vergangen waren, hatte Normas Haar offenbar zu seiner natürlichen Graufärbung gefunden. Und der knallrote Lippenstift gehörte ebenso der Vergangenheit an wie die kurzen Röcke. Sobald Candy sich jedoch vorgestellt hatte, war Normas neue berufsbedingte Seriosität verflogen, und die herzliche, dem Schwatz nicht abgeneigte Frau, die Candy in Erinnerung hatte, kam wieder zum Vorschein.
»Mein Gott, was bist du groß geworden, Candy«, sagte sie. »Ich habe dich so lange nicht gesehen; und deine Mutter auch nicht. Geht’s ihr so weit gut?«
»Ja, glaub schon.«
»Hab gehört, dass dein Papa seine Arbeit in der Hühnerfabrik verloren hat. Hatte Probleme mit dem Bier, hab ich mir sagen lassen, oder?« Candy hatte gar keine Zeit, dazu Stellung zu nehmen. »Weißt du was? Ich finde, dass man den Leuten eine zweite Chance geben sollte. Wenn man ihnen diese Chance nämlich verweigert, wie sollen sie dann ihr Leben ändern?«
»Ich weiß nicht.« Candy fühlte sich ziemlich unbehaglich.
»Männer«, sagte Norma. »Halt dich von denen fern, Schatz. Sie sind den Ärger, den sie einem bereiten, einfach nicht wert. Ich bin inzwischen zum dritten Mal verheiratet, aber ich gebe dieser Ehe höchstens noch zwei Monate.«
»Oh …«
»Na egal, du bist bestimmt nicht gekommen, um meinem Geplapper zu lauschen. Was kann ich für dich tun?«
»Ich habe eine Hausarbeit aufbekommen, über Chickentown«, erläuterte Candy. »Miss Schwartz hat sich das ausgedacht. Die stellt uns immer solche Aufgaben, die eigentlich eher für Fünftklässler geeignet sind. Außerdem mag sie mich nicht besonders …«
»Ach, lass dich nicht unterkriegen, Liebes. Es gibt immer jemanden, der einem das Leben sauer macht. Du kommst früh genug aus der Schule raus. Was willst du dann eigentlich machen? Drüben in der Fabrik arbeiten?«
Candy fühlte sich von einer großen Last niedergedrückt, als sie sich diese schreckliche Perspektive vor Augen führte.
»Hoffentlich nicht«, sagte sie. »Ich würde gern etwas mehr mit meinem Leben anfangen.«
»Du weißt aber nicht, was?«
Candy schüttelte den Kopf.
»Keine Sorge, da wird sich schon was ergeben«, sagte Norma. »Wir wollen’s doch jedenfalls hoffen, schließlich möchtest du nicht auf ewig hier hängen bleiben.«
»Nein, das möchte ich wirklich nicht.«
»Du sollst also etwas über Chickentown machen …«
»Ja. Und Mama sagt, da wären irgendwelche Sachen im Hotel passiert, nach denen ich mich erkundigen soll. Sie sagt, Sie wüssten schon, was sie meint.«
»Ach, das hat sie gesagt?«, fragte Norma mit neckischem Lächeln.
»Ich soll Sie bitten, mir was über Henry …«
»… Murkitt.«
»Ja, über Henry Murkitt zu erzählen.«
»Armer alter Henry. Was hat sie noch gesagt? Hat sie dir von Zimmer neunzehn erzählt?«
»Nein. Von einem bestimmten Zimmer hat sie nichts gesagt. Sie hat nur diesen Namen erwähnt.«
»Tja, ich kann dir die Geschichte erzählen«, sagte Norma. »Ich weiß nur nicht, ob die Sache mit Murkitt unbedingt das ist, was deine Miss Schwartz sich so vorstellt.«
»Warum?«
»Na ja, weil das Ganze ziemlich düster ist«, sagte Norma. »Richtig tragisch sogar.«
Candy lächelte. »Also, Mama sagt, ich habe einen Hang zum Makabren, also wird es mir wahrscheinlich gefallen.«
»Makaber, hm? Na gut«, sagte Norma. »Dann sollte ich dir die ganze verflixte Geschichte wohl mal erzählen. Also, Chickentown hieß ja früher Murkitt.«
»Im Ernst? Davon habe ich aber in den Büchern über Minnesota nichts gelesen.«
»Du weißt doch, wie es ist. Es gibt die Geschichte, die ihren Weg in die Bücher findet, und es gibt die, die das nicht tut.«
»Und Henry Murkitt …?«
»… ist Teil der Geschichte, die nicht aufgeschrieben wurde.«
»Aha.«
Candy war fasziniert. Sich an das erinnernd, was ihre Mutter über das Führen von Ermittlungen gesagt hatte, zückte sie ihr Notizbuch und begann zu schreiben. Murkitt. Geschichte, die wir nicht kennen.
»Die Stadt wurde also nach Henry Murkitt benannt?«
»Nein«, sagte Norma. »Sie hatte den Namen von seinem Großvater, Wallace Murkitt.«
»Warum hat man ihn geändert?«
»Na, Chickentown ist doch ein passender Name, oder? Dieser Ort beherbergt mehr beschissene Hühner als Menschen. Und manchmal hab ich auch das Gefühl, dass die Leute sich mehr für die Hühner interessieren als für ihre Mitmenschen. Mein Mann arbeitet in der Fabrik, also höre ich nichts anderes von ihm und seinen Freunden als …«
»Hühnergeschichten?«
»Hühner, Hühner und noch mal Hühner.« Norma warf einen Blick auf ihre Armbanduhr. »Pass auf, ich hab jetzt nicht so viel Zeit, um dir das Zimmer neunzehn heute zu zeigen. Ich erwarte noch eine größere Gesellschaft. Können wir das nicht auf einen anderen Tag verschieben?«
»Ich muss die Arbeit morgen früh abgeben.«
»Ach, ihr jungen Leute. Immer alles erst auf den letzten Drücker erledigen«, sagte Norma. »Na ja, gut. Dann beeilen wir uns eben. Sieh aber zu, dass du alles ordentlich mitschreibst, ich hab wirklich keine Zeit, irgendetwas zweimal zu sagen.«
»Ich bin bereit«, sagte Candy.
Norma zog ihren Hauptschlüssel aus der Tasche. »Linda?«, sagte sie zu der Frau, die am Empfang beschäftigt war. »Ich geh mal eben rauf zum Zimmer neunzehn.«
Die Frau runzelte die Stirn. »Im Ernst? Wozu?«
Die Frage blieb unbeantwortet.
»Dauert nicht länger als zehn Minuten«, sagte Norma.
Sie führte Candy aus dem Empfangsbereich, ohne die Unterhaltung einzustellen. »Wir befinden uns hier im neuen Teil des Hotels«, erläuterte sie. »Er wurde 1964 gebaut. Aber sowie wir hier« – sie führte Candy durch zwei Doppeltüren – »durch sind, befinden wir uns im alten Hotel. Früher hieß es ›Das Hochseehotel‹. Frag mich nicht, warum.«
Auch ohne Normas Hinweis hätte Candy sofort gesehen, dass sich der Teil des Hotels, in dem sie sich jetzt befanden, sehr von dem unterschied, in dem sie sich bisher aufgehalten hatten. Die Flure waren hier schmaler und weniger gut beleuchtet. Ein saurer Geruch nach Alter hing in der Luft, so als hätte jemand das Gas angelassen.
»Im alten Teil des Hotels bringen wir nur dann Gäste unter, wenn alle anderen Zimmer belegt sind. Und das kommt nur vor, wenn eine Konferenz der Hühnerhändler stattfindet. Aber selbst dann bemühen wir uns, niemanden in Zimmer neunzehn zu stecken.«
»Und warum?«
»Tja, nicht, dass es dort geradezu spuken würde. Obwohl, es wird da so einiges gemunkelt. Ich persönlich glaube ja, dass all diese Geschichten über ein Leben nach dem Tod Unfug sind. Man hat nur ein Leben, und ich würde jedem nur empfehlen, das Beste daraus zu machen. Meine Schwester ist letztes Jahr schwer religiös geworden, und jetzt strebt sie den Stand der Heiligkeit an, aber ehrlich.«
Norma hatte Candy bis zum Ende eines Flurs geführt, wo sich ein schmaler Treppenaufgang befand, der von einer einzigen Lampe beleuchtet wurde. Diese warf ein gelbliches Licht, das weder den reizlosen Tapeten noch dem abblätternden Farbanstrich schmeichelte.
Candy wollte schon anmerken, es sei kein Wunder, dass die Geschäftsführung den Gästen den Anblick dieses Hotelabschnitts ersparen wolle, aber sie biss sich auf die Zunge, weil ihr die Ermahnung ihrer Mutter wieder einfiel, weniger höfliche Gedanken doch bitte für sich zu behalten.
Sie bestiegen die knarrende Treppe. Sie war ziemlich steil.
»Ich sollte mit dem Rauchen aufhören«, sagte Norma ächzend. »Es bringt mich noch um.«
Im Obergeschoss gab es zwei Türen. Eine gehörte zu Zimmer 17. Die andere zu Zimmer 19.
Norma reichte Candy den Hauptschlüssel.
»Willst du aufschließen?«, sagte Norma.
»Klar.«
Candy nahm den Schlüssel und steckte ihn ins Türschloss.
»Du musst ein bisschen rumrütteln.«
Candy rüttelte. Und nach einiger Fummelei ließ sich der Schlüssel tatsächlich drehen, sodass Candy die schlecht geölte Tür von Zimmer 19 öffnen konnte.
ZWEI
Was Henry Murkitt hinterließ
Es war dunkel im Zimmer; die muffige Luft stand. »Geh doch mal und mach die Vorhänge auf, Liebes«, sagte Norma und nahm Candy den Schlüssel wieder ab.
Candy wartete einen Augenblick, bis ihre Augen sich etwas an das düstere Licht gewöhnt hatten, dann tastete sie sich durchs Zimmer zum Fenster. Der dicke Vorhangstoff fühlte sich schmierig an, so als wäre er ewig nicht mehr gereinigt worden. Sie zog daran. Die Vorhänge bewegten sich nur widerstrebend an ihren mit Staub und Schmutz bedeckten Schienen entlang. Das Fensterglas, durch das Candy unversehens blickte, war ebenso dreckig wie der Gardinenstoff.
»Wie lang ist es her, seit dieses Zimmer zuletzt von einem Gast benutzt wurde?«, fragte Candy.
»Ich kann mich eigentlich nicht erinnern, dass irgendjemand drin gewesen wäre, seit ich hier angefangen habe«, sagte Norma.
Candy schaute aus dem Fenster. Der Ausblick war auch nicht anregender für die Sinne oder das Gemüt als jener aus dem Küchenfenster in der Followell Street 34, ihrem Zuhause. Unmittelbar unter dem Fenster, auf der Rückseite des Hotels, befand sich ein kleiner Hof, der fünf oder sechs nahezu überquellenden Mülltonnen Platz bot und auch die dürren Überreste des letztjährigen Weihnachtsbaums beherbergte, einschließlich der schäbigen Deko aus Lametta und Kunstschnee. Jenseits des Hofs verlief die Lincoln Street (so jedenfalls Candys Vermutung; bei der Wanderung durch das Hotel hatte sie völlig die Orientierung verloren). Sie konnte Autodächer hinter der Hofmauer erkennen und auf der gegenüberliegenden Straßenseite einen Billig-Drugstore, dessen Türen mit Vorhängeschlössern verriegelt und dessen Regale leer waren.
»Tja«, sagte Norma, um Candys Aufmerksamkeit wieder auf das Zimmer 19 zu lenken, »hier also hat Henry Murkitt logiert.«
»Ist er oft ins Hotel gekommen?«
»Meines Wissens«, sagte Norma, »war er nur einmal hier. Aber ganz sicher bin ich mir da nicht, berufe dich also lieber nicht auf mich.«
Candy konnte nachvollziehen, warum Henry offenbar kein Stammgast gewesen war. Das Zimmer war sehr klein. An die hintere Wand zwängte sich ein schmales Bett, und in der Ecke befand sich ein Stuhl, auf dem ein kleiner schwarzer Fernseher stand. Davor gab es noch einen zweiten Stuhl, und auf dem stand ein überquellender Aschenbecher.
»Einige unserer Angestellten kommen, wenn sie mal eine halbe Stunde freimachen können, hier rauf, um in Sachen Seifenopern auf dem Laufenden zu bleiben«, sagte Norma wie zur Erklärung.
»Dann glauben die also nicht, dass es im Zimmer spukt?«
»Sagen wir mal so, Liebes«, sagte Norma. »Egal, was sie glauben, es hält sie jedenfalls nicht davon ab, hier raufzukommen.«
»Was ist hinter der da?«, fragte Candy und deutete auf eine Tür.
»Schau selber nach«, sagte Norma.
Candy öffnete die Tür und trat in ein winziges Badezimmer, das schon lange nicht mehr gereinigt worden war. Über dem dreckigen Waschbecken begegnete sie ihrem Spiegelbild. Ihre Augen wirkten in der Düsternis dieser kleinen Zelle fast schwarz, und ihr dunkles Haar musste mal geschnitten werden, aber dennoch mochte sie ihr Gesicht, selbst in solch unvorteilhaftem Licht. Sie hatte das Lächeln ihrer Mutter, offen und entspannt, und das Stirnrunzeln ihres Vaters – die tiefen, aufgewühlten Falten, die Bill Quackenbush trug, wenn er in seinen Bierträumen lag. Und dann waren da natürlich noch ihre unegalen Augen: das linke dunkelbraun, das rechte blau; im Spiegel jetzt allerdings seitenverkehrt.
»Wenn du dich irgendwann genug bewundert hast …«, sagte Norma.
Candy machte die Badezimmertür zu und schlug, um ihre Verlegenheit zu verbergen, das Notizbuch wieder auf. Keine Tapeten an den Wänden von Zimmer 19, schrieb sie, einfach Putz, mit schmutzigem Weiß übermalt. Eine der vier Wände wies ein merkwürdiges abstraktes Muster in blassem Rosa auf. Alles in allem hätte man sich kaum einen trostloseren, unwirtlicheren Ort ausmalen können.
»Also, was können Sie mir über diesen Henry Murkitt erzählen?«, fragte sie Norma.
»Nicht so furchtbar viel«, antwortete die Frau. »Sein Großvater war wie gesagt der Gründer der Stadt. Im Grunde sind wir alle hier, weil Wallace Murkitt irgendwann beschloss, dass er vom ewigen Umherziehen genug hatte. Angeblich ist ihm plötzlich mitten in der Nacht sein Pferd unter dem Hintern weggestorben, sodass er gar keine andere Wahl hatte, als sich gleich hier, weitab von allem, niederzulassen.«
Candy lächelte. Sie fand, dass diese Einzelheit sehr gut zu allem anderen passte, was sie über ihre Heimatstadt wusste. »Chickentown existiert also, weil das Pferd von Wallace Murkitt gestorben ist?«, sagte sie.
Norma schien den Sarkasmus der Bemerkung zu verstehen. »Ja«, sagte sie. »So könnte man die Geschichte wohl zusammenfassen, nicht wahr? Henry Murkitt aber war offenbar sehr stolz darauf, dass die Stadt nach seiner Familie hieß. Jedenfalls hat er gern damit geprahlt.«
»Und dann ist der Name geändert worden …«
»Ja, gut, darauf komme ich gleich. Eigentlich war das Leben des armen Henry gegen Ende hin eine einzige Kette von Katastrophen. Zuerst hat ihn seine Frau Diamanda verlassen. Kein Mensch weiß, wo sie geblieben ist. Und dann, irgendwann im Dezember 1947, beschloss der Stadtrat, den Namen der Stadt zu ändern. Henry hat das sehr übel aufgenommen. An Heiligabend hat er sich hier im Hotel ein Zimmer geben lassen, allerdings ist der Ärmste nie dazu gekommen, wieder auszuchecken.«
Candy hatte geahnt, dass so etwas kommen würde, aber trotzdem fing es unter den kleinen Härchen im Nacken zu prickeln an, als sie die Worte aus Normas Mund hörte.
»Er ist in diesem Zimmer gestorben?«, sagte Candy leise.
»Ja.«
»Wie? Ein Herzinfarkt?«
Norma schüttelte den Kopf.
»O nein …«, sagte Candy, der sich die Bruchstücke allmählich zusammenfügten. »Er hat sich umgebracht?«
»Ja. Leider.«
Das Zimmer kam ihr plötzlich noch kleiner vor, falls das überhaupt möglich war, die Ecken – trotz der Sonne, die jetzt einen Weg durch das schmutzige Fenster gefunden hatte – noch dunkler.
»Das ist ja furchtbar«, sagte Candy.
»Eines wirst du noch lernen, Liebes«, sagte Norma. »Liebe kann das Beste im Leben sein. Aber auch das Schlimmste. Das Allerschlimmste.«
Candy schwieg. Zum ersten Mal nahm sie wahr, welch traurigen Ausdruck Normas Züge angenommen hatten, seit sie einander zuletzt gesehen hatten. Wie die Mundwinkel sich nach unten neigten und die Stirn von tiefen Falten durchzogen war.
»Aber es war nicht nur die Liebe, die Henry Murkitt das Herz gebrochen hat«, sagte Norma. »Es war …«
»… die Tatsache, dass man den Namen der Stadt geändert hat?«, sagte Candy.
»Ja. Genau. Immerhin war es der Name seiner Familie. Sein Name. Sein Anspruch auf ein bisschen Unsterblichkeit, wenn du so willst. Als ihm das genommen war, hat er wohl keinen Sinn mehr im Leben gesehen.«
»Der Ärmste«, sagte Candy und bekräftigte damit Normas zuvor formulierte Empfindung. »Hat er irgendwas hinterlassen? Ich meine, einen Abschiedsbrief oder so was?«
»Ja. So eine Art. Soweit ich weiß, steht darin, er wolle warten, dass sein Schiff einlaufe, oder so ähnlich.«
»Was soll das heißen?«, fragte Candy, während sie sich den Satz notierte.
»Na ja, er war wahrscheinlich betrunken, und auch ein bisschen wirr im Kopf. Aber so eine gewisse Neigung zu Schiffen und dem Meer hat er wohl gehabt.«
»Ist ja merkwürdig«, sagte Candy.
»Es wird noch merkwürdiger«, sagte Norma.
Sie ging zu dem kleinen Nachttisch neben dem Bett und zog die Schublade auf. Darin lag eine Ausgabe der Gideonbibel und ein seltsamer Gegenstand aus einem Material, das wie Messing aussah. Sie nahm das Ding heraus.
»Wie man sich erzählt«, sagte sie, »war das hier der einzige Wertgegenstand, den er bei sich hatte.«
»Und was ist das?«
»Das ist ein Sextant«, sagte Norma.
Candy machte ein verständnisloses Gesicht. »Was ist denn ein Sextant?«
»Den benutzen Seeleute auf hoher See, um herauszufinden, wo sie sind. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber irgendwie richtet man es an den Sternen aus und …« Sie zuckte die Achseln. »Jedenfalls stellt man auf diese Weise fest, wo man sich genau befindet.«
»Und so was hatte er bei sich?«
»Wie gesagt: Man erzählt es sich. Aber genau der hier war es.«
»Würde nicht normalerweise die Polizei so was beschlagnahmen?«, sagte Candy.
»Sollte man denken. Aber so lange ich hier im Hotel arbeite, liegt das Ding auch schon hier in der Schublade neben der Gideonbibel. Henry Murkitts Sextant.«
»Hm«, meinte Candy, die sich gar nicht mehr so sicher war, was sie mit alldem anfangen sollte. Sie gab Norma den Gegenstand zurück, worauf diese ihn vorsichtig – sogar ein wenig ehrfürchtig – an seinen Platz zurücklegte und die Schublade wieder schloss. »Also das und die Abschiedsmitteilung waren alles, was er hinterlassen hat?«, fragte Candy.
»Nein«, sagte Norma. »Er hat noch mehr hinterlassen.«
»Was denn?«
»Sieh dich um«, entgegnete Norma.
Candy sah sich um. Was war da noch, was Henry Murkitt gehört haben könnte? Die Möbel? Wohl kaum, oder? Der verschlissene Teppichläufer am Boden? Möglich, aber nicht sehr wahrscheinlich. Die Lampe? Nein. Was blieb da übrig? Es gab keine Bilder an der Wand, also …
»Oh, Moment mal.« Sie musterte die Flecken an der Wand. »Doch nicht etwa das?«
Norma zog eine der tadellos gezupften Augenbrauen hoch und sah Candy nur an.
»Das da?«, sagte Candy.
»Egal, wie viele Schichten Farbe die Maler auf dieser Wand auftragen, die Flecken schimmern trotzdem immer wieder durch.«
Candy näherte sich der Wand, um die Spuren zu untersuchen. Ein Teil von ihr – der Teil, für den ihre morbide Großmutter verantwortlich zeichnete – wollte Norma die naheliegenden Fragen stellen: Wie waren die Flecken da hingekommen? Hatte er sich erschossen? Ein Rasiermesser benutzt? Der andere Teil von ihr aber zog es vor, nichts Näheres darüber zu erfahren.
»Schrecklich«, sagte sie.
»Solche Sachen können passieren, wenn die Leute merken, dass ihr Leben nicht das ist, was sie sich erträumt haben«, sagte Norma. Sie warf einen Blick auf ihre Armbanduhr. »O Gott, so spät schon. Ich muss Schluss machen. Das ist also die Geschichte von Henry Murkitt.«
»Was für ein bedauernswerter Mensch«, sagte Candy.
»Tja, ich vermute mal, auf die eine oder andere Weise warten wir alle darauf, dass unser Schiff einläuft.« Norma ging zur Tür und ließ Candy hinaus auf den düsteren Treppenabsatz treten. »Und einige von uns lassen die Hoffnung nicht sinken«, sagte sie mit halbherzigem Lächeln. »Was sollen wir auch sonst tun?«
Und mit diesen Worten schloss sie die Tür des Zimmers, in dem Henry Murkitt seinen letzten Atemzug getan hatte.
DREI
Kritzelei
Miss Schwartz, Candys Geschichtslehrerin, war schon unter normalen Umständen nicht gerade die bestgelaunte Person der Welt, aber heute war sie in noch üblerer Stimmung als sonst. Während sie im Klassenzimmer umherging, um die durchgesehenen Hausarbeiten über Chickentown zurückzugeben, ernteten nur ihre wenigen Lieblingsschüler (in der Regel Jungen) so etwas wie Anerkennung. Alle anderen mussten sich Tadel gefallen lassen.
Was aber noch gar nichts im Vergleich zu der Abfertigung war, die Candys Arbeit zuteilwurde.
»Fakten, Candy Quackenbush«, sagte Miss Schwartz und warf Candy die Ausführungen über Henry Murkitts Ableben auf den Tisch. »Ich hatte um Fakten gebeten. Und was gibst du mir?«
»Das sind Fakten, Miss …«
»Keine Widerworte«, fauchte Miss Schwartz. »Das hier sind keine Fakten. Das ist krankhafter Klatsch, nichts weiter. Diese Arbeit taugt überhaupt nichts, aber das sind wir ja von dir gewöhnt.«
»Aber ich war selber in dem Zimmer im Hotel Comfort Tree«, sagte Candy. »Ich habe Henry Murkitts Sextanten mit eigenen Augen gesehen.«
»Bist du etwa hoffnungslos leichtgläubig?«, sagte Miss Schwartz. »Oder einfach nur dumm? In jedem Hotel gibt es irgendwelche albernen Gespenstergeschichten. Kannst du nicht zwischen Dichtung und Wahrheit unterscheiden?«
»Aber Miss Schwartz, ich schwöre, dass das alles die Wahrheit ist.«
»Du bekommst eine Sechs, Candy.«
»Das ist ungerecht«, sagte Candy aufgebracht.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























