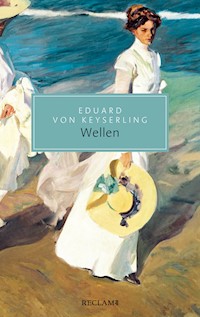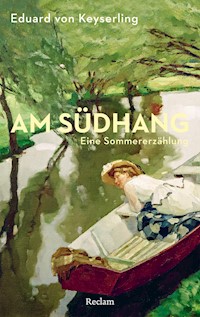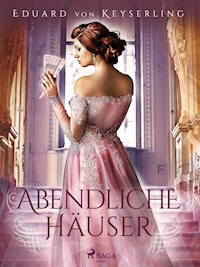0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Keyserling bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Keyserlings Beschreibung eines zunehmend verarmten Landadels – eine ihm gut bekannte Lebenssituation. Eine "alte Tante" schildert die Situation folgendermaßen: »Wir haben nichts anderes zu tun, als zu sitzen und zu warten, bis eines nach dem anderen abbröckelt.« Im Roman geht es um Generationen. Die jüngere Adels-Generation hängt noch an den Schößen der Alten und hat sich noch nicht emanzipiert. Aber das Abschneiden "alter Zöpfe" scheint unausweichlich. Reihum in allen Häusern gibt es Söhne und Töchter, die in die große Stadt ziehen, um der öden Bedrängnis und der Not zu entfliehen. Aber die, die zurückkommen, sei es aus Einsamkeit oder Pflichtbewusstsein, sind nicht selten gebrochene Individuen ohne Zukunft. So kommt es, dass eine mit letzten Mitteln finanzierte Abendgesellschaft der Auslöser für einen weiteren Aderlass wird, als ein russischer Gast die Männer beim Kartenspiel ausnimmt. Null Papier Verlag
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 235
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Eduard von Keyserling
Abendliche Häuser
Eduard von Keyserling
Abendliche Häuser
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] EV: S. Fischer, Berlin, 1914 (260 S.) 2. Auflage, ISBN 978-3-962814-52-6
null-papier.de/katalog
Inhaltsverzeichnis
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Keyserling bei Null Papier
Fräulein Rosa Herz
Wellen
Beate und Mareile
Seine Liebeserfahrung
Dumala
Abendliche Häuser
Schwüle Tage
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Erstes Kapitel
Auf Schloss Paduren war es recht still geworden, seit so viel Unglück dort eingekehrt war. Das große braune Haus mit seinem schweren, wunderlich geschweiften Dache stand schweigsam und ein wenig missmutig zwischen den entlaubten Kastanienbäumen. Wie dicke Falten ein altes Gesicht durchschnitten die großen Halbsäulen die braune Fassade. Auf der Freitreppe lag ein schwarzer Setter, streckte alle vier von sich und versuchte sich in der matten Novembersonne zu wärmen. Zuweilen ging eine Magd oder ein Stallbursche über den Hof langsam und lässig. Hier schien es, hatte niemand Eile. In der offenen Stalltüre lehnte Mahling, der alte Kutscher mit dem weißen Bart, und gähnte. In der offenen Gartenpforte stand Garbe, der Gärtner, und verzog sein glattrasiertes Sektierergesicht und blinzelte in die Sonne. Dann begannen die beiden Männer aufeinander zuzugehen, mitten zwischen Stall und Garten blieben sie stehen, sprachen einige Worte zueinander, schwiegen, spuckten aus, ließen wieder einige Worte fallen.
Auf der anderen Seite des Hauses wurde eine Glastür geöffnet, die geradewegs in den Garten führte, und der Schlossherr, der Baron von der Warthe, wurde in seinem Rollstuhl von seinem Diener Christoph hinausgefahren. Dicht in seinen Pelz gehüllt, eine Pelzmütze auf dem Kopfe, schwankte die in sich zusammengebogene Gestalt im Stuhle sachte hin und her. Das Gesicht war sehr bleich und in seiner strengen Regelmäßigkeit von einer müden Ausdruckslosigkeit, nur die hervortretenden Augen waren noch wunderlich klar und blau. Neben dem Rollstuhl schritt die Schwester des Barons, die Baronesse Arabella, hin, groß und hager in ihrem schwarzen Mantel und dem wehenden Trauerschleier, das Gesicht schmal und messerscharf zwischen den gebauschten weißen Scheiteln. So ging es die feuchten Herbstwege des Parks entlang, auf denen die Herbstblätter raschelten. Von den Bäumen fielen Tropfen, und die Wipfel waren voll lärmender Nebelkrähen. Christoph steckte das Kinn tiefer in den aufgeschlagenen Kragen des Livreemantels und schnaufte ein wenig in der Anstrengung des Stoßens. Dann hielt er plötzlich still, sein Herr hatte ein Zeichen mit der Hand gemacht, der Baron sah zu seiner Schwester auf und sagte mit einer Stimme, die ärgerlich und gequält klang: »Sag’ mal, Arabella, was ist die Dachhausen für eine Geborene?« – »Birkmeier, die Fabrikantentochter«, erwiderte die Baronesse ruhig und wie mechanisch. Befriedigt ließ der Baron den Kopf sinken, und Christoph schob den Stuhl weiter.
Und doch vor wenigen Wochen noch war Paduren die Hochburg des adeligen Lebens in dieser Gegend gewesen, und der Baron Siegwart von der Warthe hatte hier eine stille, aber unbestrittene Herrschaft über seine Standesgenossen ausgeübt. Der kleine rundliche Herr mit dem strengen, feierlichen Gesicht, das von dem weißen Haar und weißen Backenbart wie von einem silbernen Heiligenschein umrahmt wurde, war das Gewissen dieses Adelswinkels gewesen. Öffentliche Ämter mochte er nicht bekleiden, in Versammlungen schwieg er. »Ich bin kein Tribünenläufer«, pflegte er zu sagen, aber seine Ansicht war dennoch stets die ausschlaggebende, und in jeder wichtigen Sache war es die Hauptfrage: »Was sagt von der Warthe?« In Sachen der Politik und der Landwirtschaft, in Familienangelegenheiten und Ehrenhändeln, überall sprach er das wichtigste Wort mit. Er lieh Geld denen, die es nötig hatten und die er dessen würdig hielt, und wachte streng darüber, dass gute alt-edelmännische Sitte hier nicht in Verfall geriet. Wenn der Baron von der Warthe die greisen Augenbrauen in die Höhe zog, mit der flachen Hand durch die Luft von oben nach unten fuhr, als machte er einen Sargdeckel zu, und leise sagte: »Hm – ja, schade, aber der Mann ist erledigt«, dann war der Mann für diese Gegend wirklich erledigt. Der Baron war sich seiner Stellung wohl bewusst, und er genoss sie, und sie war vielleicht die einzige wirkliche Freude seines Lebens. Immer wohlwollend würdig zu sein, geachtet und ein wenig gefürchtet zu werden, mag ein großes Gut sein, es macht jedoch einsam und ist nicht gerade heiter. Das gab dem Baron wohl auch den feierlichen, ein wenig ungemütlichen Ausdruck; er sah aus, als dürfe er sich nie gehen lassen und als sei ihm dieses selbst zuweilen unbequem. Dietz von Egloff, der es liebte, von älteren Herren respektlos zu sprechen, meinte: »Dem Gesicht des alten Warthe würde ich es gönnen, sich einmal eine Stunde lang nach Herzenslust verziehen zu dürfen, um sich von der ewigen Würde gänzlich erholen zu können.« Der Baron liebte es, wenn es heiter um ihn her war, seine Jagden und sein Rotwein waren berühmt, aber er konnte sich nicht verhehlen, dass die Leute sich gerade dann am besten unterhielten, wenn er zufällig nicht zugegen war. Das mochte ihn zuweilen ein wenig melancholisch machen, aber er gestand sich das selbst nicht ein und war überzeugt, dass er das bessere Teil erwählt habe, die Weisheit, die Würde und die Macht. Die jungen Leute liebten ihn nicht, lachten über ihn, wenn sie unter sich waren, und nannten ihn den »Baron Missbilligung«. Allein sie fürchteten ihn, und wenn sie in Schwierigkeit gerieten, wandten sie sich stets an ihn. Die alten Herren bewunderten ihn und lauschten seinen Worten wie einem Evangelium.
Am Kamin bei der Nachmittagszigarre liebte es der Baron, zu seinem alten Freunde, dem Baron Port auf Witzow, von seinen Grundsätzen zu sprechen: »Ansichten, die jungen Leute wollen jetzt allerhand Ansichten haben. Nun ja, ich bestreite ja nicht, es mag allerhand Ansichten und Grundsätze geben, die ganz gut und richtig sind für andere. Man braucht ja schließlich kein Edelmann zu sein, aber für uns gibt es gewisse Ansichten und Grundsätze, die richtig und wahr sind, nicht weil jemand sie uns bewiesen hat, sondern weil wir wollen, dass sie richtig und wahr sind. Mir braucht man nichts zu beweisen und zu erklären. Ich will, dass das und das wahr und richtig ist, weil, wenn das falsch ist, ich nicht mehr der von der Warthe bin, der ich bin, und du nicht von Port bist, der du bist, weil wir sonst beide alte Narren wären. Siehst du, das sage ich.«
Als sein Freund zu sprechen anfing, hatte der Baron Port sich aus der leichten Nachmittagsschläfrigkeit aufgerüttelt. Er beugte den schweren Oberkörper nach vorn, legte die Hand an das Ohr und hörte aufmerksam zu. Als die Rede zu Ende war, schlug er dem Baron von der Warthe mit der flachen Hand auf das Knie und meinte: »Da hast du wieder recht, Bruder.« Dann lehnten die beiden Herren sich in ihre Sessel zurück und sogen befriedigt an ihren Zigarren.
Vorbildlich wie die Ansichten und die Landwirtschaft des Baron von der Warthe für seine Nachbarn waren, so war es auch sein Haus, die hohen Zimmer voll weitläufiger, schwerer Mahagonimöbel, großer Kachelöfen, voller Ahnenbilder und alten Silbers, in denen sich ein Leben geregelter Wohlhabenheit behaglich abspann. »Unsere Vornehmheit ist schlicht«, pflegte der Baron zu sagen. Er liebte das Wort »schlicht« und fuhr gern, wenn er es aussprach, mit der flachen Hand waagerecht durch die Luft. Dass die beiden Kinder des Barons in Paduren, Fastrade und Bolko, Vorbilder für alle Kinder der Nachbarschaft waren, das wusste jedes Kind der Gegend. Die Baronin von der Warthe war bei der Geburt ihres zweiten Kindes gestorben, die Baronesse Arabella stand dem Haushalt ihres Bruders vor und erzog die Kinder, und auch diese Erziehung wurde allgemein bewundert. Da war der Hauslehrer, Herr Arno Holst, der Bolko auf die höheren Gymnasialklassen vorbereiten sollte und die eben erwachsene Fastrade noch in Literatur und Kunstgeschichte einführte. Ein schmalschulteriger junger Mann mit kurzsichtigen braunen Augen, blonden Locken und einem hübschen Mädchengesicht. Er war sehr musikalisch, sang mit einer schönen Baritonstimme, las Schillersche Dramen vor und war von einer fast knabenhaft schwärmerischen Begeisterung für alles Schöne. Der Padurensche Hauslehrer war in der ganzen Nachbarschaft berühmt. »Es ist toll«, sagte Baron Port zu seiner Frau, »wenn der Warthe sich was anschafft, so ist es unfehlbar erster Güte. Wie er das nur macht? Hat er einen Hühnerhund, so ist der hasenreiner als alle unsere Hunde, nimmt er sich einen Hauslehrer, so ist das gleich ein ungewöhnlich scharmanter Kerl.«
»Kränklich scheint er mir«, sagte die Baronin, die es nicht liebte, die Schattenseiten an Menschen und Sachen zu übersehen. Umso größeres Erstaunen erregte die Nachricht, Herr Holst habe das Schloss plötzlich verlassen. In Paduren tat man so, als sei nichts Besonderes geschehen, es sei eben an der Zeit, Bolko auf das Gymnasium zu schicken. Allein ein Gerücht, niemand wusste, woher es kam, wollte nicht verstummen, es erzählte von wunderlichen Dingen, welche sich in Paduren ereignet haben sollten. Hatte sich Herr Holst in Fastrade verliebt? Hatte Fastrade sich in den hübschen Hauslehrer verliebt? Hatten sie sich verlobt, und hatte es einen bösen Familienauftritt gegeben? Niemand glaubte so recht daran, dennoch wurde auf den benachbarten Gütern eifrig darüber geflüstert, und es war, als sei den meisten der Gedanke nicht unangenehm, dass es auf Paduren auch nicht immer so einwandfrei hergebe, wie es scheinen wollte. Von Warthes war natürlich nichts zu erfahren. Bolko kam auf das Gymnasium, der Baron war würdig und voll Autorität wie immer, die Baronesse Arabella schwieg, und Fastrade sah man wie sonst auf ihrem kleinen Schimmel die Waldwege entlang jagen im blauen Reitkleid. Unter der weißen Knabenmütze flatterte blondes Haar um das runde, über und über rosa Gesicht, auf den Lippen ein stetiges Lächeln, als lächelte sie dem scharfen Luftzuge der tollen Bewegung zu. Auch in Gesellschaft war sie wie sonst das unbefangene heitere Mädchen mit dem hinreißenden Lachen. Sie bog dann den Kopf zurück, öffnete die Lippen ein wenig weit, und die Augen wurden glitzernd und feucht. »Die Augen der kleinen Warthe machen mich durstig«, hatte Dietz von Egloff gesagt, »auf der ganzen Welt habe ich nach einem Getränk gesucht, so stark blau und ganz durchsichtig, aber das gibt es nicht.«
Zwei Jahre vergingen, Bolko bezog die Universität, Fastrade feierte ihren einundzwanzigsten Geburtstag, als wiederum eine Nachricht die Gegend in Aufregung versetzte. Fastrade, hieß es, verlasse ihr väterliches Haus, um fern irgendwo, in Hamburg sagte man, im Krankenhause die Krankenpflege zu erlernen. Die Nachricht bestätigte sich und war doch so unglaublich. Wie oft hatten nicht alle es von dem Baron von der Warthe gehört: »Unsere Töchter gehören in unser Haus, bis sie ihr eigenes beziehen. Tochter eines adeligen Hauses zu sein ist ein Beruf, der ebenso wichtig ist wie jeder andre Beruf.« Und noch letzthin, als die zweite Tochter der Ports nach Dresden ging, um ihre Stimme auszubilden, hatte der Baron das eine Desertion genannt. Und nun desertierte seine einzige Tochter, ließ die beiden alten Leute allein. Was war geschehen? In Paduren schwieg man darüber wie immer. Man glaubte zu bemerken, dass der Baron nach der Abreise seiner Tochter strenger und unnachsichtiger in seinen Urteilen war, dass er ungeduldig wurde, wenn man ihm widersprach, aber sonst war keine Veränderung bemerkbar. Große Jagden wurden in Paduren abgehalten, bei denen er nervös die Jugend zur Heiterkeit aufmunterte. Ja, er selbst bemühte sich, heiter zu sein, sprach viel von Bolko, von dem Studentenleben, erzählte aus der eigenen Studentenzeit verschollene Studentenstreiche, über die nur er und der Baron Port lachen konnten.
An einem Novemberabend trat die Baronesse Arabella in das Arbeitszimmer ihres Bruders, sie fand ihn in seinem Sessel sitzend, den Kopf zurückgelehnt, das Gesicht grau und wie zerfallen, die Augen geschlossen, in der Hand hielt er ein Telegramm. »Mein Gott! Siegwart!« rief die Baronesse. Matt reichte er ihr mit der einen Hand das Telegramm, mit der anderen winkte er. Er wollte allein sein. Das Telegramm meldete, Bolko sei im Duell gefallen. Die Baronesse ging, um sich in ihr Zimmer zu verschließen und zu weinen. Im Schlosse wurde es eine Weile ganz still, als die Nacht aber hereingebrochen war, begannen Schritte unablässig durch die lange Zimmerflucht zu irren, und wenn sie an der Tür der Baronesse vorüberkamen, glaubte diese etwas wie ein leises Wimmern zu hören. Den nächsten Morgen war der Baron bleich und gefasst, traf die Vorbereitungen für die Bestattung seines Sohnes und empfing die Trauerbesuche. Er war feierlich und würdevoll wie immer, nur schien es zuweilen, als gerieten diese Feierlichkeit und diese Würde ins Schwanken, als müsste er sie gewaltsam festhalten wie einen schweren Mantel, der von den Schultern herabzugleiten droht.
Nach dem harten Schlage, der sie getroffen, zeigten die Einwohner von Paduren sich nicht in der Nachbarschaft. Sie blieben zu Hause und gingen recht schweigsam in den großen Räumen nebeneinander her. Einmal sagte die Baronesse Arabella zu ihrem Bruder: »Unsere Fastrade, soll unsere Fastrade nicht kommen?« Er aber winkte ärgerlich ab. Die Nachbarn trauten sich nicht recht in das so still gewordene Schloss, nur der Baron Port besuchte seinen Freund. Dann saßen sie beide wie sonst am Kamin bei der Nachmittagszigarre, und der Baron von der Warthe sprach von seinen Grundsätzen und den falschen Ansichten der jungen Leute, er wollte sich wieder an den eigenen schönen und vernünftigen Worten erfreuen, aber es war, als schmeckten sie ihm nicht mehr, die Stimme begann zu zittern, wurde kleinlaut und mutlos und versiegte endlich ganz. Dann beugte sich der Baron Port vor und klopfte seinem alten Freunde sanft auf das Knie.
»Der Warthe ist nicht mehr der alte«, berichtete Baron Port seiner Frau, »er hält sich, er hält sich, aber das mit dem Sohn ist für ihn doch zu stark gewesen.«
Ja, es war für ihn zu stark gewesen. Als Christoph eines Nachmittags in das Arbeitszimmer seines Herrn trat, wo dieser auf einem großen Sessel seine Nachmittagsruhe zu halten pflegte, fand er ihn auf dem Fußboden liegend. Der kleine Herr lag da, Hände und Füße hilflos von sich gestreckt, das Gesicht grau und wie von einer Qual verzerrt inmitten des silbernen Heiligenscheines der Haare und des Backenbartes. Ein Schlaganfall hatte ihn getroffen, hatte den armen Baron »Missbilligung« in einem Augenblick all seiner Feierlichkeit und seiner schönen Haltung entkleidet und ihn zu einem hilflosen alten Manne gemacht.
Zweites Kapitel
Die Baronesse Arabella hatte sich entschlossen, am Nachmittage einen Besuch bei der Baronin Port zu machen. Die Krankenstubenstille des Schlosses quälte sie wie eine Krankheit. Sie wollte Menschen sehen und sprechen, vor allem sprechen. So fuhr Mahling sie in der großen Kalesche nach Witzow hinüber. Die Herbstwege waren schlecht, das Wetter feucht und kalt unter einem niedrigen grauen Himmel, der Wind wühlte im feinen Gezweige der Hängebirken wie in feuchtem roten Haar. Zwischen den Schollen der aufgepflügten Äcker lag hier und da schon ein wenig Schnee. Alles sah unreinlich aus und als ob es friere. Aber die alte Dame blickte mit einem liebenswürdigen und angeregten Lächeln auf die Landschaft hinaus. Sie machte schon jetzt ihr Besuchsgesicht, denn sie freute sich wirklich herzlich auf ihren Nachmittag. Das weiße Witzowlandhaus mit der niedrigen Treppe, vor dem sie jetzt hielten, erschien ihr heute besonders anheimelnd, auch der große Flur, der stets nach feuchtem Kalk roch und in dem die Baronesse jedes Mal dachte: Die gute Karoline kann sagen, was sie will, das Haus ist doch feucht.
Sylvia, die älteste Tochter des Hauses, ein schlankes, ältliches Mädchen mit einem bleichen Gesicht und einem gefühlvollen, ein wenig mitleidigen Lächeln, empfing die Baronesse. Sylvia hatte eine Art, die Leute zu begrüßen, als seien sie krank und bedurften der Teilnahme und der Schonung. Und das tat der alten Dame heute wohl. Im Wohnzimmer auf dem großen Sofa mit der zu steifen Rückenlehne saß die Baronin Port, eine sehr starke Dame, das Gesicht stets rot und erhitzt unter der weißen Blondenhaube. »Nun, meine gute Arabella«, sagte sie mit einer lauten, tiefen Stimme, »da sind Sie, ich habe an Sie schon wie an eine Verstorbene gedacht.« Die Baronesse lächelte wehmütig: »Ach ja, zuweilen möchte man wirklich schon gestorben sein.«
»Na, na, es kommen wieder bessere Zeiten«, beschwichtigte die Baronin, »setzen Sie sich und erzählen Sie, wie geht es bei Ihnen?«
»Immer das gleiche«, erwiderte die Baronesse, »doch nein, eine gute Nachricht habe ich, unsere Fastrade kommt, ich habe an sie geschrieben, und sie kommt.«
»So.« Die kleinen Augen der Baronin wurden blank vor Neugierde, und sie lüftete die Blondenhaube ein wenig an den Ohren, um besser hören zu können. »So, die kommt also, jetzt erst.«
Die Baronesse zog traurig die greisen Augenbrauen empor und meinte: »Bisher hatte es der Vater nicht gewollt, aber jetzt …«
»Und immer wegen des jungen Menschen?« fragte die Baronin gespannt. Die Baronesse nickte, sie schwieg einen Augenblick, lehnte den Kopf zurück. Sie wusste, jetzt würde sie über alle diese Dinge sprechen, über die sie so lange hatte schweigen müssen. Aber sie konnte nicht anders. Sylvia ging leise ab und zu und servierte den Tee. Die Baronin nahm eine Strickarbeit mit klappernden elfenbeinernen Nadeln, wie beruhigt darüber, dass sie ihren Besuch jetzt dort hatte, wo sie ihn haben wollte.
»Ach ja! Was man nicht erlebt«, begann die Baronesse, »und denken Sie sich, ich hatte doch von allem nichts gemerkt, ich merke so etwas nie. Erst als eines Tages die beiden sich an der Hand fassten und in das Schreibzimmer meines Bruders gingen, da packte mich der Schrecken, die Knie zitterten mir so sehr, dass ich mich setzen musste.«
»Also einfach eine Verlobung«, bemerkte die Baronin sachlich.
»Ja«, erwiderte die Baronesse, »die armen Kinder dachten sich wohl so etwas, aber mein Bruder machte dem allen schnell ein Ende.«
»Wie ertrug es Fastrade?« inquirierte die Baronin weiter.
Die Baronesse seufzte, diese langverschwiegenen Dinge herauszusagen, ergriff sie so stark: »Fastrade, Sie kennen sie ja, ist ein so starkes und mutiges Mädchen, wenn sie gelitten, hat sie es uns nie gezeigt. Und wie die Zeit verging, glaubte ich, sie hätte ihn vergessen. Da kommt nun dieser Geburtstag, an dem sie dem Vater erklärt, sie muss fort in ein Krankenhaus, sie ist volljährig, sie hat Geld von ihrer Mutter; was gesprochen wurde, weiß ich ja nicht, Sie kennen meine Feigheit; wenn so etwas in der Luft liegt, verkrieche ich mich in mein Zimmer. Da kommt nun das Kind, weiß wie ein Tuch und sagt: ›Ich reise.‹ – ›Liebes Kind‹, sage ich, ›nur eins möchte ich wissen, ist es seinetwegen?‹ Sie sieht mich ruhig an und sagt klar und fest: ›Er ist krank und in Not, da muss ich bei ihm sein.‹ Was konnte ich da sagen, ich habe ja nie recht was zu ihr sagen können. Als sie noch ein kleines Mädchen war, fühlte ich, dass sie von uns beiden immer die Klügere und Stärkere war. So reiste sie denn. Es war gute Schlittenbahn, ich stand im großen Saal am Fenster und hörte noch den Schellen ihres Schlittens zu, die man bei uns ja so weit von der Landstraße hört, da kam mein Bruder aus seinem Zimmer, setzte sich an den Kamin, stocherte mit der Zange in den Kohlen herum und murmelte so vor sich hin: ›Auf dem Posten bleiben will keine. Das ist wohl auch schwerer, ein Fräulein von der Warthe zu sein, als so etwas anderes.‹«
»Also sie fuhr direkt zu dem jungen Menschen«, sagte die Baronin scharf.
»Nun ja«, erwiderte die Baronesse zögernd, »er war krank, lag im Krankenhaus, da hat sie ihn wohl gepflegt, und dann, dann starb er.«
Die Baronin ließ die Arbeit sinken und blickte überrascht auf: »Er starb? Gott sei Dank!«
»Wollen wir uns nicht versündigen, liebe Karoline«, meinte die Baronesse wehmütig, »der arme junge Mensch! Vielleicht war es so besser.«
»Viel besser«, bestätigte die Baronin, »überhaupt, die Sache ist dann nicht so schlimm, aber das kommt von der Geheimtuerei, da denkt man gleich wer weiß was.«
»Und dann, liebe Karoline«, versetzte die Baronesse und lächelte gerührt, »unserer Fastrade kann man dies alles nicht anrechnen, sie hat ein zu heißes Herz. Als unser kleiner Hund umkam, sie war noch ein kleines Kind, da hat sie doch die ganze Nacht geweint und geradezu gefiebert. Und später, als die alte Wärterin Knaut starb – mein Bruder hatte gewünscht, dass die Kinder bei der Beerdigung mit auf den Friedhof genommen werden, sie sollten sich früh an solche Pflichten gewöhnen, sagte er –, nun gut, am Abend, es war im Juni, ist Fastrade fort. Man sucht sie und wo findet man sie? Sie sitzt auf dem Friedhofe in der Abenddämmerung am Grabe der Knaut, sie will die Knaut nicht allein lassen. So war sie immer.«
Von ihrem Sitz aus konnte die Baronesse die dämmerige Zimmerflucht entlang sehen, an deren Ende jetzt die breite Gestalt des Baron Port erschien und langsam herankam. Er war von seinem Nachmittagschlafe aufgestanden und schien verstimmt, er begrüßte die Baronesse kurz und setzte sich an den Tisch. »Wir sprechen von der Fastrade«, sagte die Baronin, »sie kommt endlich nach Hause.«
Der Baron machte eine abwehrende Handbewegung und beugte sich über die Teetasse, welche seine Tochter vor ihm hingestellt hatte.
»Und Ihre Gertrud kehrt ja auch wieder zu Ihnen zurück«, versetzte die Baronesse.
Da begann der Baron zu sprechen, heiser und undeutlich, als läge ihm nichts daran, dass er verstanden werde: »Ja, zurück kommen sie alle, aber wie? Die Nerven kaputt, zerzaust wie die Hühner nach dem Regen, der arme Warthe hatte ganz recht, keine will auf dem Posten bleiben. Früher hatten die adeligen Fräulein nie solche Talente, die ausgebildet werden mussten, das ist auch so die neue Zeit.« Dieses knarrende Schelten schien ihm wohlzutun, er fuhr daher fort, verbiss sich in seinen Ärger: »So bin ich gestern bei Dachhausens zu Mittag. Na, dass es dort nach Finanz riecht, dafür können sie nichts, sie ist ja eine Fabrikantentochter, aber er ist ein braver Junge, und einer der Unseren. Gut, es wird also ein Rehbraten serviert, einer unserer ehrlichen, heimatlichen Böcke, aber ringsum auf derselben Schüssel liegen so halbe Orangeschalen voll Orangegefrorenem, so das süße Zeug, das man beim Konditor kriegt.«
»Ist das gut?« fragte die Baronesse teilnehmend.
Der Baron zuckte mit den Schultern: »Gut! In Berlin und Paris versucht man mal so abenteuerliches Zeug, aber hier bei uns – ich kann mir nicht helfen, mir kommt so was pervers vor. Na und unser anderer Nachbar, der Egloff in Sirow, dass er sein Haar gescheitelt trägt wie ein Mennonitenprediger, ist seine Sache, das soll amerikanisch sein. Also vorigen Tag war ich Geschäfte wegen bei ihm, da stellte er mir so einen kleinen Kerl vor, schwarz wie ein Tintenfass, der ist ein portugiesischer Marquis, und einen langen Grauhaarigen mit einer blauen Brille, der ist wieder ein polnischer Graf. Und die Großmutter, die alte Baronin, sieht diese unheimlichen Leute strahlend an und freut sich, dass ihr Dietz so vornehme Bekannte hat. Und wenn sie abends in ihrem Zimmer sitzt und sich von dem Fräulein von Dussa die frommen Bücher vorlesen lässt, dann horcht sie hinaus auf das Toben der Herren im Spielzimmer und ist glücklich, dass ihr Dietz sich so gut unterhält dort am grünen Tisch, wo er das Familienvermögen riskiert.«
Der Baron schüttelte sich wie von Widerwillen übermannt und schloss düster: »Eins weiß ich, ich werde diese Komödie nicht mehr lange anzusehen haben, mein Parkettsitz wird bald leer sein.«
Alle schwiegen; die Dämmerung war vollends hereingebrochen. Als ihr Vater zu sprechen begonnen, hatte Sylvia sich erhoben und ging lautlos die Zimmerflucht auf und ab, zuweilen blieb sie an einem Fenster stehen und schaute hinaus auf den schwefelgelben Streifen, der am Abendhimmel über dem schwarzen Walde hing; eine, die bleich und nachdenklich auf ihrem Posten geblieben war.
Da die Dunkelheit kam, machte die Baronesse sich auf den Heimweg. Als sie im Wagen saß, sagte sie sich, dass es dort bei Ports nicht eben heiter gewesen war, aber sie hatte sprechen können, und das empfand sie wie eine Erleichterung nach allem Schweigen.
Drittes Kapitel
Es war reichlich Schnee gefallen, die Abenddämmerung lag blau über der weißen Decke. Die Baronesse Arabella hatte zwei Lampen im großen Saal anzünden lassen und ging nun unablässig dort auf und ab, die eingefallenen Wangen leicht gerötet. Oft blieb sie stehen und lauschte hinaus auf ein Schellengeläute, das fern von der Landstraße herübertönte. Solchem Schellengeläute zuzuhören, wie es von der Straße herklang, an den Biegungen schwächer wurde, wie es sich entfernte oder näher kam, war ihr stets eine gewohnte Beschäftigung an stillen Winterabenden gewesen, und wie bedeutungsvoll war dieses Geläute zuweilen, an dem Abend, da Fastrade von ihnen fuhr, und wiederum an jenem Abend, da die Glocke der Estafette immer näher kam, welche die Nachricht von des armen Bolko Tode brachte. Seitdem schien es der Baronesse, als könnte sie aus den Stimmen der Schellen etwas von dem heraushören, was dort auf der Landstraße zu ihr herankam. Heute, glaubte sie, heute klängen die Schellen besonders hell und erregend, es war Fastrade, die da kam. Die alte Dame freute sich, aber in dieser Freude lag eine Aufregung, die sie fast schmerzte.
Jetzt war das Geklingel ganz nahe, es machte einen großen Bogen im Hofe und hielt vor der Freitreppe. Geräuschvoll öffnete Christoph die Haustüre. Die alte Dame stand regungslos da und horchte auf die Schritte im Flur. Fastrades Stimme mit ihrem metalligen Schwingen sagte. »Guten Abend, Christoph, wie unverändert Sie sind, nur grau sind Sie geworden.« – »Wir sind hier alle grau geworden, gnädiges Fräulein«, erwiderte Christoph. Jetzt öffnete sich die Tür, und Fastrade stand da in ihrer hübschen, aufrechten Haltung. Über dem schwarzen Trauerkleide nahm sich der blonde Kopf, das runde, von der Fahrt leicht gerötete Gesicht wunderbar hell und farbig aus. Sie lächelte ihr Lächeln, das ihr so leicht auf die Lippen stieg, und die Augen, von der Dämmerung verwöhnt, blinzelten in das Licht. Die Baronesse stand noch immer wie hilflos da und weinte. Erst als Fastrade sie in ihrer bekannten schützenden Art in die Arme nahm, den alten zerbrechlichen Körper hielt und leitete, da fühlte die Baronesse wieder die ganze Wärme dieser Gegenwart, nach der ihr alle Jahre hindurch gefroren hatte.
Fastrade führte die Baronesse zum Sofa, ließ sie dort niedersitzen, setzte sich neben sie und hielt die beiden alten Hände in den ihren. Die Baronesse weinte still vor sich hin, Fastrade saß ruhig da und ließ ihre Blicke im Zimmer umherschweifen, suchte die Sachen an ihren gewohnten Plätzen auf. Es stand alles dort, wo es einst gestanden, alles war unverändert, und dennoch schien es ihr, als sei es verblasster, farbloser als das Bild, welches sie die ganze Zeit über in ihrer Erinnerung herumgetragen, das Getäfel schien dunkler, die Seide der Möbel verschossener, die Kristalle des Kronleuchters undurchsichtiger. All das erschien Fastrade wie eine Sache, die wir sorgsam verschließen, und wenn wir sie endlich wieder hervorholen, wundern wir uns, dass sie in ihrer Verborgenheit alt und blass geworden ist. Und auch die Töne des Hauses waren die altbekannten. Aus dem Zimmer ihres Vaters hörte man die fette, knarrende Stimme des Inspektors Ruhke dringen, aus dem Esszimmer klang das Klirren von Gläsern, das Klappern von Tellern herüber, und endlich im kleinen Kabinett neben dem Saale sang eine ganz dünne, zitternde Stimme eine hüpfende Melodie leise vor sich hin. Das war die uralte Französin Couchon, die schon die Lehrerin der Baronesse gewesen war. Sie saß an der grün verhangenen Lampe in sich zusammengebogen, das Gesicht ganz klein unter der enganliegenden grauen Sammethaube, legte ihre Patience und trällerte leise ihre verschollene französische Melodie. Das ergriff Fastrade so stark, dass sie laut sagen musste: »Ah, Ruhke ist bei Papa, und Christoph deckt im Esszimmer den Tisch, und Couchon sitzt noch bei ihrer Patience und singt.«
»Ja, Kind«, sagte die Baronesse, »wir haben nichts anderes zu tun, als zu sitzen und zu warten, bis eines nach dem anderen abbröckelt.«
Fastrade erhob sich schnell von ihrem Sitz, als wollte sie etwas abschütteln: »Ich will Couchon begrüßen«, sagte sie und ging in das Kabinett hinüber. Die alte Französin hob ihr kleines Gesicht zu Fastrade auf, lächelte mit dem lippenlosen Munde und sagte: »Te voilà, ma fillette, à la bonne heure.«1