
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Der vierzehnjährige Heinrich Wendt lebt als Waise ungeliebt bei seinem Onkel August und dessen bösartiger Haushälterin Kathrin in einem kleinen Hafenstädtchen an der Ostsee. Seine Eltern sind vor einiger Zeit bei einer Epidemie verstorben und sein älterer Bruder Karl ist auf See verschollen. Heinrichs einziger Freund ist der geheimnisvolle Herr Seiffert, der einsam auf einer kleinen Insel am Hafen lebt. Als Heinrich fälschlich des Diebstahls beschuldigt wird, nimmt Seiffert ihn zu sich und weiht ihn nach und nach in sein Geheimnis ein. Was hat der heimliche Kriminalist aber mit dem undurchsichtigen Onkel zu tun, was weiß er über den verschwundenen Karl Wendt, und ist dieser doch noch am Leben? Und dann beginnt ein unglaubliches Abenteuer, das sie bis zum anderen Ende der Welt führt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Abenteuer Kerguelenland 1 - Das Tagebuch des Steuermanns
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenText
Schmökerkiste – Band 3
W. Belkav- Das Tagebuch Des Sreuermanns
Abenteuer Kerguelenland, Teil 1
1. eBook-Auflage – September2013
© vss-verlag Hermann Schladt
Titelbild: Armin Bappert unter Verwendung des Originalcovers der Vorkriegsserie
Lektorat: Hermann Schladt
Das Tagebuch des Steuermanns.
Von
W. Belka.
1. Kapitel.
Fälschlich angeschuldigt.
Herr Ernst Mulack, Inhaber des größten Kolonialwarengeschäftes des Hafenstädtchens, hatte soeben den jüngsten Stift, der erst vor drei Wochen eingetreten war, in sein Privatkontor gerufen.
Heinrich Wend, ein überschlanker, blasser Knabe von etwa fünfzehn Jahren, stand nun vor seinem Chef mit demselben halb ängstlichen, halb verstockten Gesichtsausdruck, der ihm zumeist eigen war und der vielen Menschen von dem Charakter des angehenden Kaufmanns ein ganz falsches Bild gab.
Der dicke Herr Mulack hatte seine Stirn in drohende Falten gelegt und begann jetzt mit erhobener Stimme, deren Klang den angeblichen Missetäter von vornherein einschüchtern sollte:
„Du bist vor vier Wochen eingesegnet worden, Heinrich,“ sagte er und blickte seinen jüngsten Stift durchbohrend an. „Die Bibelsprüche werden Dir also wohl noch geläufig sein. Nenne mir einen, der von der Ehrlichkeit handelt.“
Heinrich Wends große, blaue Germanenaugen, die er von der Mutter geerbt hatte, spiegelten deutlich das Erstaunen über diese Aufforderung wider. Dann entgegnete er nach einer Weile offenbar angestrengten Nachdenkens: „Mir fällt keiner ein.“ Das klang genau so zögernd und unsicher wie alles, was der verschüchterte Junge sagte. Viel sprach er ja überhaupt nicht. Im Hause seines Onkels, wo er nach dem Tode seiner Eltern Aufnahme gefunden hatte, durfte er nur reden, wenn das Wort an ihn gerichtet wurde.
Herr Mulack räusperte sich. „So, so, – nichts über die Ehrlichkeit, – so – so!! Sehr, sehr bezeichnend! – Junge, wenn ich nicht auf Deinen wackeren Oheim, den Herrn Steuermann August Wend, Rücksicht nehmen würde, stände jetzt hier einer unserer Stadtpolizisten, um Dich gleich nach der Wache zu führen.“ Kurze Pause. Dann: „Heinrich, Du hast den Weg betreten, der zur Verdammnis hinabgeht – in den Abgrund des Lasters und Verbrechens! Du hast aus der Kasse gestern sechs Fünfzigmarkscheine entwendet. Du glaubtest allein im Laden zu sein. Aber Willi Polk hat Dich beobachtet, hat auch gesehen, wo Du einen der Scheine verbargst – unter dem einen Sack Salz im Keller! Dort habe ich die Banknote gefunden. Wo – wo sind die anderen? Heraus damit, Junge! Dir soll nichts geschehen, wenn –“
Heinrich war so bleich geworden, dass sein Chef jetzt plötzlich innehielt, da er fürchtete, der Knabe würde ohnmächtig werden. Er täuschte sich jedoch. Heinrich hatte den ersten furchtbaren Schreck schnell überwunden, rief jetzt mit völlig verändertem Gesichtsausdruck und vor Empörung flammenden Augen: „Ich – ich soll gestohlen haben! Und – Willi Polk will gesehen haben, dass – Oh – der – der schlechte, heimtückische Bursche! Alles ist gelogen, Herr Mulack, das schwöre ich beim Andenken meiner geliebten Eltern! Gestern früh bemerkte ich – so verhält sich die Sache! – wie Willi heimlich zwei Tafeln Schokolade zu sich steckte. Ich hielt ihm dies vor, verlangte, er solle sie wieder zurücklegen und erklärte dazu, ich müsste Ihnen, Herr Mulack, davon Meldung erstatten, da zu leicht der Verdacht des Diebstahls auf mich fallen könnte. Willi zog darauf Geld aus der Tasche, bezahlte damit die beiden Tafeln, indem er es in die Kasse tat und fuhr mich grob an, weil ich ihn grundlos verdächtigt hätte. Er hat mich nie leiden mögen, der Willi und jetzt wird er aus Hass und Rachsucht –“
Da hob Herr Ernst Mulack wie beschwörend die Hand und fiel seinem Lehrling ins Wort: „Missratener Junge, wie darfst Du es wagen, in so raffinierter Weise Deinen Kameraden anzuschwärzen! Ich sehe jetzt, wie verderbt Du bist. Keine Minute länger dulde ich Dich hier in meinem Hause. – Hinaus mit Dir! Das weitere wird sich finden! Ich werde sofort zu Deinem Onkel kommen und ihm mitteilen, weshalb –“
Die Klingel des Tischtelephons rasselte. Herr Mulack schwieg, griff nach dem Hörer, sagte gleich darauf in kühl-höflichem Tone: „Guten Morgen, Herr Seiffert. – Ah – nach dem Knaben wollen Sie sich erkundigen? Wie er sich hier als Lehrling macht? – Ich weiß, Sie haben eine Vorliebe für ihn, ja, ja. Nun, leider muss ich Ihnen erklären, dass –“ Es folgte genau das, was Herr Mulack seinem jüngsten Stift soeben vorgehalten hatte. Dann schien Herr Seiffert am anderen Ende der Leitung allerlei Zweifel an der Wahrheit dieser für Henrich so beschämenden Anklage zu äußern, denn der Chef der Firma rief nun in den Hörer hinein:
„Es ist so – daran lässt sich nichts ändern! Übrigens habe ich gerade viel zu tun. Daher Schluss.“
Als Ernst Mulack jetzt aufschaute, war Heinrich verschwunden. Er hatte lautlos das Gemach verlassen, war auch im Geschäft nicht mehr aufzufinden, also wohl getrieben vom schlechten Gewissen, irgendwohin geeilt, vielleicht nach dem Hafenviertel, das er in jeder freien Stunde aufsuchte, um am Bollwerk zu sitzen und den lebhaften Schiffsverkehr zu beobachten, dieser verstockte Träumer, dieser wortkarge, unfreundliche Nichtsnutz. So dachte Herr Mulack. Und nahm Hut und Stock und machte sich auf den Weg zum Herrn Steuermann August Wend, der draußen in der Vorstadt dicht am Hafenkanal ein kleines Häuschen zusammen mit einer mürrischen, halbtauben, alten Wirtschafterin bewohnte und nur eine Leidenschaft außer seiner Tabakpfeife kannte: seine Rosenzucht.
Der Steuermann war nicht gerade beliebt in der Stadt, obwohl er hier aufgewachsen und auch viele Bekannte von früher her hatte, denen er aber stets aus dem Wege ging. Er wollte offenbar einsam bleiben. Das hatte jeder gemerkt, als August Wend vor fünf Jahren seinen Seemannsberuf aufgab und den kleinen Rentner zu spielen begann. Damals hatten Heinrichs Eltern noch gelebt, waren jedoch bereits ein halbes Jahr später einer schweren Epidemie zum Opfer gefallen, ohne ihrem zweiten Sohne – der um sechs Jahre ältere war als Schiffsjunge verschollen – so viel zu hinterlassen, dass er das Gymnasium weiterbesuchen konnte. So war Heinrich denn in das Haus seines einzigen Oheims väterlicherseits gekommen. Und von da an begann jene Leidenszeit für den früher so heiteren und sorglosen Knaben, die in ihrer ganzen Schwere den meisten Bürgern der Stadt verborgen blieb, weil August Wend es nur zu gut verstand, stets den fürsorglichen, liebenden Onkel herauszukehren, wobei ihn die alte Kathrin, seine Haushälterin, recht geschickt trotz ihrer Schwerhörigkeit zu unterstützen wusste.
Nein – der Steuermann erfreute sich keiner großen Beliebtheit bei den Heilmündern. – Wir wollen die kleine, lebhafte Hafenstadt hier Heilmünde nennen und an die Ostsee verlegen. – Man munkelte im Städtchen sogar allerlei über August Wend, hütete sich aber, diese Gerüchte an sein Ohr gelangen zu lassen, da er schon seinem Äußeren nach ein Mann war, dem man besser aus dem Wege ging: groß, breitschultrig, Hände wie Bärenpranken, Augen, die unter dicken Brauen tief im Kopfe lagen und stets einen halb forschenden, halb katzenfreundlichen Blick hatten, während die Mund- und Kinnpartie dieses Menschen wieder von brutaler Selbstsucht, Grausamkeit und eisernem Willen sprachen.
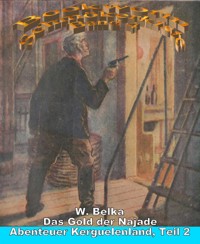












![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)















