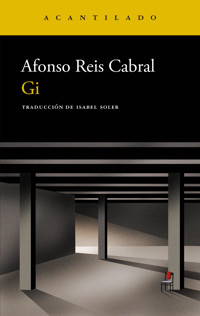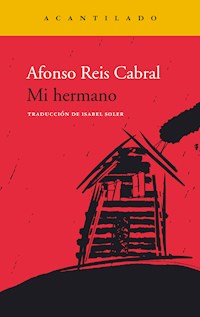Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Geschichte vom Rand der Gesellschaft: Afonso Reis Cabrals erschütterndes Porträt der obdachlosen trans Frau Gisberta – ausgezeichnet mit dem Premio Saramago Ein wahrer Fall, der ein ganzes Land erschütterte. „Wir lieben dich Gisberta“ – rufen ihr die Freier und die Zuschauer der Show zu, bei der die trans Frau als Marylin Monroe posiert. Als sie später in einer Bauruine in Porto haust, kümmert das niemanden mehr. Rafa, der sie als Erster dort entdeckt, ist stolz auf sein ungewöhnliches Geheimnis. Es ist die Begegnung zweier Menschen am Rande der Gesellschaft. Doch dann wird ihm klar, dass die hübsche Frau ein „Mann mit Brüsten“ ist. Zerrissen zwischen Attraktion und Verachtung, Gruppenzwang und Geltungsdrang, gleitet Rafa in eine Spirale des Bösen. Wer ist schließlich schuldig – die Jungen, die Gesellschaft? Alfonso Reis Cabrals Roman entfaltet einen Sog, dem man sich nicht entziehen kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 349
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Eine Geschichte vom Rand der Gesellschaft: Afonso Reis Cabrals erschütterndes Porträt der obdachlosen trans Frau Gisberta — ausgezeichnet mit dem Premio SaramagoEin wahrer Fall, der ein ganzes Land erschütterte. »Wir lieben dich Gisberta« — rufen ihr die Freier und die Zuschauer der Show zu, bei der die trans Frau als Marylin Monroe posiert. Als sie später in einer Bauruine in Porto haust, kümmert das niemanden mehr. Rafa, der sie als Erster dort entdeckt, ist stolz auf sein ungewöhnliches Geheimnis. Es ist die Begegnung zweier Menschen am Rande der Gesellschaft. Doch dann wird ihm klar, dass die hübsche Frau ein »Mann mit Brüsten« ist. Zerrissen zwischen Attraktion und Verachtung, Gruppenzwang und Geltungsdrang, gleitet Rafa in eine Spirale des Bösen. Wer ist schließlich schuldig — die Jungen, die Gesellschaft? Alfonso Reis Cabrals Roman entfaltet einen Sog, dem man sich nicht entziehen kann.
Afonso Reis Cabral
Aber wir lieben dich
Roman
Aus dem Portugiesischen von Michael Kegler
Carl Hanser Verlag
18. Also unterhielten sie sich mit ihr und besuchten sie von diesem Zeitpunkt an regelmäßig, meist in der Mittagspause.
Jugendstrafprozess Nr. 637/06.2TMPRT
Vorbemerkung
Rafael Tiago, kaum jünger als ich, wechselt Reifen, schraubt an Motoren und beult Autokarosserien aus. Bremsflüssigkeit, Schmieröl, Hydrauliköl haben sich ihm in die Haut seiner linken Hand eingefressen wie eine Tätowierung, eine Art Mehndi. Es scheint ihm unangenehm zu sein, denn er juckt ständig daran, als wolle er es von der Haut kratzen. Er ist es leid, Einspritzdüsen einzustellen und nur den Anweisungen seines Chefs zu folgen, zieh die Schraube hier an, mach das ordentlich, und will umschulen auf Tischler. Er sagt, Jesus sei schließlich Zimmermann gewesen und Jesus sei ihm ein Vorbild. Mir drängt sich der Eindruck auf, dass Jesus für ihn eine Art Winston Churchill ist.
Er wirkt älter als neunundzwanzig. Als hätte ihn die Pubertät gleich nach der Geburt voll erwischt, und danach sei es nur noch abwärts gegangen. Inwiefern das nur körperlich ist, sei dahingestellt. Ich kenne einen, der hat schon mit zwölf heimlich geraucht, um mit dem Stress klarzukommen, und suchte nach einer Haushälterin, die ihm die Wäsche macht — da war es kein Wunder, dass er auch aussah wie ein alter Mann. Rafael wirkt auch wie ein alter Mann, aber mit der Kraft eines Jungen, was angesichts all der Umstände nicht weiter verwunderlich ist.
Ich begegnete ihm an einem Tag, als Granit, Asphalt und Beton auf der Stadt lasteten, wie frisch gefallener Schnee. Nur in Porto können so viel Hässlichkeit und Beton so schön aussehen — was man nicht überbewerten sollte, denn der Zauber verfliegt sofort wieder, wenn die Sonne scheint. Immerhin scheint die Sonne nicht allzu oft.
Ich hatte eine Lesung in der Bücherei von São Lázaro und war nicht begeistert von dem Gedanken, gleich wieder durch den dichten Nebel gehen zu müssen, der zwischen Ribeira und Cais de Gaia vom Douro aufsteigt. Da stand er plötzlich mit einem Umschlag in der Hand vor mir.
Er war nicht der Erste. Es kommen immer mal E-Mails von Leuten mit Lebensgeschichten, auch welche von Leuten ganz ohne Geschichte, mit Titeln wie »Aufzeichnungen eines Spermatozoons« oder »Erst Putzfrau, jetzt Doktorin«. Ab und zu in meinem Leben als reisender Schriftsteller steht auch jemand wie dieser Rafael da mit einem Umschlag und der Bitte, man möge es lesen.
Im Betreff steht »Ein Buch« und darunter die Erklärung, »Mein Lebensweg seit der ersten Liebe bis dahin, was nun aus mir geworden ist und noch mehr, denn am soundsovielten werde ich soundso alt und denke, das wäre ein Anlass, mir meinen schon lange gehegten Wunsch zu erfüllen.« Am Ende noch etwas wie »Herzlichen Dank im Voraus«, was eher wie eine Drohung klingt und schon gar nicht mehr wie eine Bitte, ein Strick um den Hals: Für was hältst du dich eigentlich, dass du dich für mein Leid und Freud nicht interessierst?
Jedenfalls landete Rafaels Schreiben erst einmal vergessen in der Schreibtischschublade. Als ich es irgendwann wegschmeißen wollte, fiel mir über dem Absender ein schmutziger Fingerabdruck auf. Der Brief fing an mit »Manchmal ist das Leben so schön, dass ich weinen muss, und es ist mir egal, was die anderen sagen«, gefolgt von sehr vielen Leerzeilen und dann einer Liste von schönen Dingen.
Ich paraphrasiere, denn er selbst hätte es so nie geschrieben:
Das Lied, das Senhor António frühmorgens pfeift, wenn Rafael seinen Kaffee trinkt.
Júlia, die dort bedient, deren Augen er ihr aus Liebe schier ausreißen möchte. Sie sind beide noch jung und würden bestimmt gut zueinander passen.
Der Wind, der sich durch die Straßen zwängt und auf den Balkons Traumfänger in Bewegung setzt.
Geliebte, die sich streiten und dann nicht mehr streiten oder sich daraufhin küssen.
Kinder, die um Aufmerksamkeit betteln.
Das Geräusch von Autoreifen auf der Straße.
Hundebesitzer, die warme Hundescheiße mit Plastiktütchen einsammeln, die kaum ihre Hände bedecken.
Sogar wenn ein Motor, den er gerade in Ordnung gebracht hat, anspringt.
Die erste Seite endete mit »Und das ist nur das, was ich heute gesehen habe. Es macht mir Spaß, so etwas aufzuschreiben, denn was es im Leben an Schönem gibt, vergisst man zu schnell.«
Die Liste ließ mich an Eva Aurora Santos denken, eine Frau von mindestens einhundert Jahren, die einmal zu mir ins Auto stieg und mich mit Stockschlägen dazu zwingen wollte, sie zum Büro der Sozialversicherung zu fahren. »Fahr schon los, ich habe es eilig.«
Unterwegs erzählte sie mir, dass sie gern Marmeladebrot aß und wie bitter und süß die Orangen draußen auf dem Land seien. Die Finger seien dann immer so süß und klebrig. Schön, aber nur wie zur Vorbereitung dessen, was dann kommen sollte, dem Geständnis hinter der ganzen Geschichte.
Erst auf dem Rückweg erzählte sie, wie klein ihre Tochter gewesen sei, sowieso eine Frau, und wie groß der Mann. Es sei unabwendbar gewesen: Kaum in der Wohnung, hatte er sie im Bad eingeschlossen und längst gewusst, was er tun wollte. Die Tochter war stark gewesen wie eine Flamme, aber er hatte sie ausgelöscht mit einem Schnitt durch die Kehle.
Sie war kaum eingestiegen, da wusste ich schon, dass sie eine Geschichte dabei hatte. Bei Rafael hatte ich dieses Gefühl erst, als ich den öligen Fingerabdruck auf dem Umschlag sah.
Wir trafen uns in einem Café in Carvalhido, das ich eher aus Trotz besuchte, denn es stank dort regelmäßig nach Toilette. Ein solcher Ort würde ihn vielleicht weniger befangen machen, dachte ich.
Ich war mir auch sicher, dass er zu spät kommen würde, und ich könnte dann immer noch vorher weggehen. »Also Samstagnachmittag dann wegen der Werkstatt.« Weder er noch ich wussten, was sich daraus ergeben könnte. Ich hoffte, hinter der Auflistung der schönen Dinge verberge sich etwas Entsetzliches; er hoffte, ich könne beim Schreiben die Schönheit betonen, dieses Weinen aus Rührung und sich nicht darum scheren, was andere sagen.
Doch er war pünktlich. Er hatte eine Mappe dabei, aus der wahllos Papiere zum Vorschein kamen, ein Wirrwarr aus Notizen, Zeitungsausschnitten, Prozessakten und Zitaten, wild durcheinander. »Hier, das ist alles. Alles, an was ich mich erinnere, und dazu noch die Zeitungsausschnitte, die ich alle gesammelt habe.«
Wir tranken Kaffee. Er behielt die Kapuze auf, aber jedes Mal, wenn er die Tasse zum Mund führte, sah ich kurz einen billigen Ohrring aufblitzen. Wir redeten fast nichts.
Dann schenkte ich ihm mein erstes Buch, das für mich immer mehr von einem Roman zur Tauschwährung wird. Er sagte, er lese eigentlich immer nur den Sportteil, aber die Wichtigkeit von Literatur sei ihm bewusst.
In den Tagen darauf versuchte ich, den Papieren irgendeine Art von Bedeutung zu entlocken, fast so, wie wenn man sich mit einem Ehepaar unterhält, das auf den Treppenstufen zur Generalstaatsanwaltschaft Gerechtigkeit verlangt.
Mit Erstaunen bekam ich schließlich heraus, worauf Rafael hinauswollte, und dann wusste ich, dass in dem, was er mir überreicht hatte, alles drin war, wonach ich suchte: der Zusammenstoß zweier prekärer Welten, der Konflikt aller Beteiligten, und im Mittelpunkt immer er selbst, eine Auseinandersetzung mit dem Körper, die Folgen der Armut, dieses Wort, das man nicht mehr benutzen will, aber weiterhin verwendet, die Balance zwischen Verzweiflung und Hoffnung. Nichts Besonderes also.
Davon ausgehend, machte ich mich an die Recherche.
Ich las die Prozessakten und konnte nicht mehr aufhören, als ginge es darin um jemand Nahestehendes. Die Beweisaufnahme, Abschnitt 10 und folgende über den »feuchten, unwirtlichen Ort, an dem sich Menschen nur selten aufhalten«; Abschnitte 23 bis 94, die Zusammenfassung der Woche des 15. bis 22. Februar; Ausdrücke wie »Zustand fortgeschrittener Erkrankung« oder intime Aussagen wie »wollte nur eine Zigarette und in Ruhe gelassen werden« beziehungsweise »auch Mahlzeiten wurden ihr vor Ort von dem Betreffenden zubereitet«.
Ich las mich durch damals schier ausufernden Presseberichte. Nach inzwischen zwölf Jahren gibt es immer noch manchmal den ein oder anderen Artikel darüber. Und Sätze wie: Für die dortige Sicherheit sorgt ein Parkplatz / Sie waren dort häufig nachts anzutreffen / ginge es nach den Anwälten, ließe sich alles endlos in die Länge ziehen / soll nun ein Gewerbepark entstehen sowie eine Klinik mit Reha-Zentrum.
Vor allem begab ich mich auf Spurensuche, ohne die ein Buch wie dieses nicht auskäme, verschaffte mir Zugang zum wichtigsten Schauplatz der Handlung, interviewte Freunde und Bekannte der Beteiligten, besorgte mir den offiziellen Wetterbericht für den betreffenden Monat, ging in die Bars und sprach morgens um sieben Leute in Cafés an.
Das alles vermengte ich mit Fiktion, wie man es eben so macht im Roman.
Immer, wenn ich in Porto war, trafen wir uns. In dringenden Fällen telefonierten wir übers Handy. Er gab immer recht knapp und nur mit wenigen Worten Auskunft, die aber so gut gewählt waren, dass sie immer genau dahin passten, wo ich sie haben wollte.
Vergangenes Jahr sahen wir uns zum letzten Mal in Carvalhido. »Es ist fertig«, sagte ich. »Es ist deine Geschichte, so wie du sie erzählen würdest, aber ich sie für dich geschrieben hätte.« Er senkte den Kopf wie beschämt, weit davon entfernt, sich geschmeichelt zu fühlen, völlig uneitel. Er hätte nur gewollt, dass ich alles, so wie es geschehen sei, wiedergebe — alles andere sei ihm egal. Vielleicht hoffte er, sobald die Geschichte zu Papier gebracht sei, würde er sie aus dem Kopf bekommen, wo sie natürlich niemals verschwindet. Aber das sagte ich ihm nicht.
Als wir uns verabschiedeten, sagte er noch einmal, dass er bei der Autowerkstatt aufhören wolle, und juckte sich noch einmal heftiger. Ich versicherte ihm, ganz bestimmt werde er einmal Tischler werden, natürlich. Natürlich wird er da nie rauskommen, und das Motoröl, das er eintätowiert hat, wird er erst mit dem Tod wieder loswerden. Was mehr ist, als man ihm zubilligen will.
1
Wir suchten in der Stadt nach den Dreckslöchern. So nannten wir sie. Nélson sagte Verbotene Orte, Samuel mochte das nicht, denn es waren ja eigentlich keine Orte und nicht einmal verboten. Nélson und ich waren gut im Kaputtmachen, Samuel dagegen konnte zerstören und Dinge erschaffen.
Wir waren fast gleich alt, aber etwas lag zwischen uns: Nélson und ich auf der einen Seite, Samuel auf der anderen, ein paar Monate älter als wir und im Besitz eines Zeichenstifts und vor allem der Gabe, damit umzugehen. Den abgegriffenen Stift hatte er immer dabei, auch den Zeichenblock, den er der Frau im Schreibwarenladen abgeschwatzt hatte (irgendwann hatte sie nachgegeben und gesagt, »Gut, aber mach keinen Blödsinn«, als könne man mit Canson 120 g irgendwas anstellen).
Ich tat so, als sei mir das alles egal, es sei mehr was für Schwuchteln, sagte ich, bessere Leute, Versager, und war immer wieder beeindruckt, wie Samuel darauf mit der Verbissenheit eines in den Seilen hängenden Boxkämpfers erwiderte, »Für dich vielleicht, Arschloch.« Es lagen nur ein paar Monate zwischen uns, aber vor allem die Kunst und seine besondere Wahrnehmung des Alltäglichen, als seien die Dreckslöcher in der Stadt für ihn allenfalls als Motiv seiner Zeichnungen gut.
Eine davon habe ich noch:
Das Drecksloch, das man darauf sieht, habe ich ihm allerdings erst viel später gezeigt.
Vorher trieben wir uns ganz woanders herum, in Prelada zum Beispiel. Die Bauarbeiten an dem neuen Stadtviertel waren ins Stocken geraten, und nun gehörten die Straßen uns. Von den Geschossen aus rohem Zement, den verlassenen Wegen, all dem, was von den Baustellen liegen geblieben war und nun Typen wie uns überlassen, ging etwas Aufregendes und Verlockendes aus.
Wir gingen früh aus dem Wohnheim in der Jugendhilfewerkstatt São José und nahmen den Bus an der Ponte do Infante. Ich drückte mich durch die Hintertür, die anderen drängelten vorn zwischen den anderen rein. Der Busfahrer erwischte uns so gut wie nie.
Der Bus schwitzte, der Atem der Leute brannte auf der Haut, in den Augen und weiter hinten im Hals. Aber ich mochte die Fahrt, weil ich für ein paar Augenblicke allein sein konnte. Allein mit den anderen weiter vorn. Eingequetscht zwischen den Leuten konnte ich mich unauffällig ganz dicht an die Mädchen schmiegen und den Jungs vorne Zeichen geben, was für ein geiles Mädel das sei und ich so cool. Nach dem Aussteigen in Prelada war dieses fast kranke Gefühl wieder weg, und ich war wieder nur einer, der keinen Plan hatte, woher er kam, wohin es gehen sollte, und kurz darauf stöberten wir schon durch das verlassene Viertel, die Dreckslöcher, und die nervöse Anspannung legte sich für ein paar Stunden.
Mit etwas Mühe erkannte ich, was Samuel daran so toll fand: fünf unterschiedlich zerklüftete Rohbauten und ringsum die Hinterlassenschaften der Baustellen, Stapel von PVC-Rohren, ein Areal nur für uns, Tiefgaragen, in denen Typen herumhingen, die sich an Feuerstellen und in Pappkartons wärmten.
Großartige Motive für Zeichnungen.
Die Gebäude, nur notdürftig gesichert mit Sperrholzplatten und Absperrgittern, wirkten wie Kranke auf Krücken. Ringsherum, auf den umgebenden Grundstücken kläfften Pitbulls herum, ganze Rudel von Schweinen wühlten sich durch das Gestrüpp und die Erde, und die Zigeuner hatten hier ihre Hütten. Es gab damals noch überall in den Randbezirken von Porto welche, und niemand störte sich daran.
Wenn es geregnet hatte, sickerte noch tagelang Wasser über den Beton. Bis ganz nach oben zu gehen, war eine Herausforderung. Mehr noch als die Herausforderung suchten wir Frieden, den wir nur an besonderen, nur schwer zugänglichen Orten fanden. Am Anfang lockte uns noch das Abenteuer, aber jetzt, mit zwölf Jahren, stiegen wir hoch auf das höchste Podest und schauten von oben weit über die Stadt, eine Welle, die uns nicht mitnahm, von der wir aber auch nicht mitgenommen werden wollten.
Die Ruhe dort auf dem obersten Stockwerk, wie zwischen dieser und einer anderen Welt, ließ uns die Straße vergessen, die Schule, die Werkstatt. Die Zeit stand still, wenn die beiden wie ich ihren Atem anhielten und einfach nur da standen und uns das Blut in den Füßen pochte, tief unten die Stadt und das ganze Leben noch vor uns. Und wir es einfach mal sein ließen, ohne wirklich zu wissen, was. Einfach nur sein lassen.
Nélson steckte sich eine Zigarette an und sagte, was wir alle dachten, »Was für ein verdammter Scheiß«, und ich entgegnete ängstlich, ganz so sei es ja auch nicht. Immerhin konnten wir uns aufeinander verlassen. Wenn ich darüber nachdenke, bin ich mir inzwischen nicht mehr so sicher, ob ich den Mut gehabt hätte, so zu widersprechen, wahrscheinlich habe ich eher zugestimmt und gesagt »Scheiße, verdammte« und dabei auf die Straße gerotzt, acht Stockwerke runter im freien Fall, um zu beweisen, dass ich das Leben in all seinen Ausmaßen kannte und dass man nur darauf scheißen konnte.
Samuel sagte nichts, hockte nur auf einem Backsteinhaufen und zeichnete. Er zeichnete Sachen — nie Leute, außer in dem einen Bild oben (wo das aber kaum zu erkennen ist, weil die Person ziemlich klein zwischen den Pfeilern ganz links versteckt ist), und das ist schade. Denn heute würde ich mich gern auf so einer Zeichnung sehen. Manchmal versuchte er, Flüchtiges, wenig Greifbares, also uns, auf Papier festzuhalten, aber Nélson sagte, hör auf, und was soll der Scheiß, ich mit Rafa auf einer Zeichnung; Samuel schaute dann hilfesuchend zu mir, und ich antwortete, was soll der Scheiß, ich mit Nélson auf einem Bild. Er solle sich mit der Aussicht beschäftigen, mit Porto, dem ganzen anderen Dreck. Wenn es sie überhaupt noch irgendwo gibt, sind die Zeichnungen wahrscheinlich leblos wie Bühnenbilder, auf denen die Darsteller fehlen, und ich bin schuld, und Nélson auch. Aber wahrscheinlich ist sowieso alles verbrannt.
Auf einer dieser Expeditionen drangen wir in das nördliche Gebäude gleich gegenüber den Wohnhäusern ein. Da hatten wir uns vorher nie reingetraut, weil wir Angst hatten, dass jemand die Polizei rufen könne.
Die Gitter vorm Eingang der Tiefgarage hielten dem ersten Fußtritt nicht stand. Nélson ging vor und versuchte, mit der Taschenlampe seines Handys etwas zu erkennen. Wir blieben ganz nah beieinander, denn trotz unseres Wagemuts war es immer noch ein fremdes Untergeschoss, das wir erkundeten. Es konnte uns jederzeit jemand begegnen, oder man trat in eine Scherbe oder stürzte in ein Loch und brach sich dabei den Arm.
Ich stellte mir vor, wie ich unten am Grund eines tiefen Lochs enden würde.
Ein falscher Tritt, und ich landete völlig verkrümmt unten im Schlamm und im faulen Wasser. Ich konnte gerade noch Samuels und Nélsons Umrisse erkennen und hören, »Rafa, was ist passiert? Alles in Ordnung?«, längst aber nicht mehr antworten, weil ich zu sehr damit beschäftigt war, zu sterben. Und dann wäre ich weg, aber was weiß ich, trotzdem konnte ich noch meine Umgebung und meinen Körper wahrnehmen, das mickerige bisschen, mit dem ich das alles beobachtete. Erst den Tod, gnadenlos, dann die Verwesung, die Maden und später die Larven. Mit offenen Augen und trotzdem blind spürte ich, wie sich alles in mir bewegte, konnte Nélson und Samuel sehen, wie sie kamen, um den Leichnam zu betrauern, den man nie finden würde, weil sie es niemandem sagen würden, um keinen Ärger zu kriegen. Als letzter Beweis meiner Freundschaft würde ich mich über diese Feigheit nicht einmal aufregen und meinen Leib der allmählichen Auflösung überlassen.
Das war natürlich nur Spinnerei. Keinen halben Schritt wich ich von ihrer Seite aus Angst, irgendwo reinzufallen oder mich zwischen verrosteten Stahlträgern, kaputten Betonmischmaschinen, Zementsäcken und Haufen von Ziegelsteinen zu verlaufen.
Dann waren wir oben, über allen Gebäuden um uns herum und es war eine ganz neue Aussicht: das Meer an der Flussmündung. Ich sagte, »traumhaft«, und Nélson seufzte sogar.
Samuel gab sich ungerührt, das Meer interessierte ihn nicht, besser gesagt, sagte er, was wir sähen, sei gar nicht das Meer. Wir sahen tatsächlich nur einen blauen Fleck, eine reglose Landschaft wie jede andere, und er meinte, das Meer jedenfalls sei ganz was Anderes.
Ich hätte ihm gern eine reingehauen, denn ich hatte ja dieses »traumhaft« nur ihm zuliebe gesagt, also mit anderen Worten versucht zu erklären, dass ich ihn bewunderte. Sonst hatte ja keiner von uns, was ich heute Talent nennen würde oder Kunst, die mehr ist als Garagenkunst. Damals entzog sich uns das jeder Begrifflichkeit, deshalb war dieses »traumhaft« mein Versuch gewesen, eine Wirklichkeit auszudrücken, so präzise wie möglich, ein Bild von irgendwo anderswohin zu übertragen.
Außerdem ärgerte es mich, dass ich ihm zugestand, größer zu sein, rauszukommen aus diesem beschissenen Leben, mehr zu sein als nur einer von uns aus der Werkstatt, dem Jugendheim, und er das nicht einmal mitbekam und sogar verächtlich machte.
Ich schaute noch einmal aufs Meer und fand es nun auch langweilig, ein blaues Etwas, bis auf die Farbe ein ebenso dunkler Fleck wie die Stadt ohne Bäume im Nebel. Seine Meinung schlug meine, sie war, was das Künstlerische anging, die gültigere.
Ich machte eine verächtliche Handbewegung zu Nélson rüber, zuckte mit den Schultern und sagte, »Wenn du meinst, Samuel.«
Erst als die Schule schon aus war, gingen wir zurück in die Werkstatt. Normalerweise gingen wir früher, um keinen Stress zu bekommen. An einer Ecke der Duque de Loulé trafen wir Fábio, der mit einer Angestellten vom Billardsalon Triunfo redete. Er winkte uns zu und brüllte, »Nächstes Mal komme ich mit!«, und wir taten so, als hätten wir es nicht gehört, weil wir einen älteren Typen, der völlig ungeniert auf den hinteren Sitzen im Bus die Mädchen befingerte, nicht bei uns haben wollten. Die Frauen kreischten dann immer, und dann gab es nur Stress mit dem Busfahrer.
2
Ich achtete auf die Geräusche und jede Bewegung im Schlafsaal, unterschwellige Kriege in jedem Stockbett. Nach dem Gong zur Nachtruhe inspizierte einer der Erzieher die Betten, das heißt, er ging zwischen den Reihen durch und sagte sinnlose Sachen wie »Rafa, willst du nicht endlich Schäfchen zählen?«, und teilte Kopfnüsse aus, wenn irgendwo noch Klamotten herumlagen. Die Fenster wurden nie aufgemacht, aus Gesundheitsgründen, also lag über allem ein Hauch von abgestandenem Wasser.
Samuel und Nélson schliefen am anderen Ende des Korridors, bei den Pissern, ich war schon bei den Älteren, was es für mich nachts theoretisch einfacher machte. Hauptsache, man hängte sich nicht in die Konflikte von Fábio rein, der rumbrüllte, »Ihr seid alles Fotzen!«, und wahllos mit Beleidigungen um sich schmiss. Er musste die Wut loswerden, die sich den Tag über in ihm aufgestaut hatte. Anders als die immer stickiger werdende Luft, von der man nur Kopfschmerzen bekam, war so viel Wut nicht gesund.
Fábio war zwar schon sechzehn, aber noch in meiner Klasse und hatte immer noch nicht kapiert, dass man sich, um nicht sitzenzubleiben, nicht einmal anstrengen musste. Der kleinste Anlass hätte den Lehrern genügt.
Denn das Letzte, was sie wollten, war, etwas mit Fábio zu tun zu haben, und hätten sie nur irgendwo eine winzige Möglichkeit gesehen, ihn per Anweisung des Sekretariats zu versetzen, hätten sie es getan. Wenn sie sich auf dem Flur unterhielten mit diesem überheblichen Zug im Gesicht und dem Irrglauben, nur weil sie irgendwann was studiert hatten, hätten sie schon das Recht auf eigene Meinung, nannten sie Fábio den schmierigen Trottel, den Klotz am Bein, der es wohl immer noch nicht kapiert hatte, dass so oft sitzenzubleiben mehr Mühe macht, als nur minimal etwas zu tun.
In Wirklichkeit hatten sie Angst. Ohne es zuzugeben, ließen sie durchblicken, wie sehr sie bedauerten, dass die Sozialpädagogen dermaßen darauf beharrten, solche Delinquenten auf jeden Fall bis zur Neunten auf der Schule zu lassen. Eine Drogenabhängige, die nicht aufgepasst hat, und wir müssen es ausbaden. So nannten sie seine Mutter: drogenabhängig und nicht Junkie.
Im Klartext hieß das, dass in ihren Augen nicht Fábio der eigentlich Leidtragende daran war, dass seine Mutter nicht aufgepasst hatte. Er war es auch eigentlich nicht, denn dafür hätte er sich dessen wenigstens irgendwie bewusst sein müssen. Sich irgendwie in der Welt positionieren.
Aber nein, denn er lebte die Freude und auch den Schmerz jeden Augenblicks und meist weiter nichts. Wenn er gut geschlafen hatte, rief er, »Guten Morgen, ihr Fotzen!«, als seien wir alle seine kleinen Schwestern und es gäbe nichts Schöneres, als aufzuwachen und uns Fotzen und Muschis zu nennen. Und er schenkte uns Zigaretten.
Aber wenn Ana Luísa, Cátia oder eine andere es ihm nicht unter der Brücke besorgt hatte, benahm er sich, als seien wir es gewesen, die ihm diese Abfuhr verpasst hatten und müssten nun dafür bezahlen. Er rief seine Komplizen, normalerweise Grilo und Leandro, und knallte einen von uns gegen den Pfosten mit der Wut dessen, dem man widersprochen hatte, und fast sexuell, warum nicht mit feuchtem Ausgang.
Gegen den Pfosten knallen bedeutete, jemanden mit der Leiste gegen einen Torpfosten zu prügeln und dann kräftig an beiden Beinen zu ziehen, bis ihm die Eier gequetscht wurden. Sabbernd sagte Fábio dann, »Fester, noch fester!«, war aber dann irgendwann schon zufrieden, wenn den anderen die Lust am Eierquetschen vergangen war.
Im Schlafsaal war es dann nachts immer so: Irgendwo wimmerte ständig jemand, Träume endeten in einem Schrei oder Lachen (Zé, der ein bisschen behindert war, lachte im Schlaf); Laken raschelten, und die Erzieher, die Aufsicht hatten, gingen von Tür zu Tür und beleidigten uns in dem Versuch, irgendwie Ordnung zu schaffen oder was auch immer.
Vor dem Einschlafen fasste ich gern, anstatt Schäfchen zu zählen, die Ereignisse des Tages noch einmal zusammen, fast wie ein Gebet, aber ohne jede Auswirkung auf die Ewigkeit.
Ich ließ alles noch einmal an mir vorbeiziehen, wie Fotografien aus unterschiedlichen Blickwinkeln und Lichtverhältnissen, um nichts zu vergessen. Auch die Hauptfiguren in meinem Leben, meine Mutter, Norberto — allerdings nicht mehr so oft, seit sie mich im Heim abgegeben hatten.
Als sie noch ledig war, machte sich meine Mutter, das weiß ich von Fotos, die ich gesehen habe, wie ein Fotomodell zurecht: blondes Haar, kurze Hosen, Nylonstrumpfhosen, Klimperketten, Flitterkram und wog bestimmt zwanzig Kilo weniger als heute. Dreißig.
Sie ging mit Freundinnen bei Santa Catarina anschaffen. Sie wirkte damals noch wie ein Kind, weil sie zu Boden sah, wenn ein Mann sie ansprach. Sogar geschminkt wirkte sie noch wie ein kleines Mädchen, das sich als Frau auftakelt.
Auf einem dieser Ausflüge lernte sie meinen Vater kennen. Wenn es Essen gab, kratzte sie immer im Topf herum, ohne besondere Lust, selbst zu essen. Mein Vater sagte zu ihr, »Ich besorge es dir«, wenn er sie ins Zimmer schleifte. Dann hörte ich Schnaufen und Schlagen, wie wenn Schubladen zuknallen (aber es gab in dem Zimmer gar keine Schubladen), dann kam mein Vater zurück und ließ sich in den Sessel fallen. »Ich hab es ihr besorgt, das hat sie gebraucht.«
Ich sagte, »Ja, Papa«, und huschte auf seinen Schoß. Ich umarmte ihn und tätschelte seine Wange. Sein Bart stachelte. Im Zimmer brachte sich meine Mutter in Ordnung.
Wenn sie mich in der Anstalt besuchte, weinte sie am Ende immer, denn nach dem Tod meines Vaters hatte sie niemanden mehr, nicht einmal mehr Norberto — und drei oder vier waren schon weg, wie war so etwas möglich? Warum war das erlaubt? Einer bedürftigen Mutter auch noch drei oder vier Kinder wegnehmen. Mutterschaft war für sie ein steter Quell ungenießbaren Dreckwassers.
Ich dachte viel über Nélson und Samuel nach, darüber, wie viel ich ihnen zu sagen hätte, vor allem Samuel, wenn ich bei genauer Betrachtung auch nicht ganz genau wusste, was. Auch über die Schule, die ich in letzter Zeit fast nicht mehr besucht hatte, weil es Wichtigeres zu tun gab und man in den Dreckslöchern in der Stadt mindestens doppelt so viel lernen konnte.
In den ersten Tagen des Jahres 2006 kreisten meine Gedanken um zwei Räder, die mich in den Schlaf wiegten und zugleich hellwach bleiben ließen. Ich versuchte, sie zu fassen, aber sie rollten weiter (wie immer, wenn sich etwas in der Vorstellungskraft dreht) und nahmen die unterschiedlichsten Farben an, Farben, die ich ihnen gab. Daran war ein metallener Rahmen mit Sattel.
Dann schlief ich ein, aber radelte und radelte durch die Straßen der Stadt.
3
Beim ersten Sonnenlicht aufstehen und vor allen anderen nach draußen zu kommen, hieß, wieder zu leben. Auf dem Kopf des heiligen Josef mit Kind auf dem Dach der Werkstatt landete eine Möwe und rief schnatternd die anderen. In wenigen Sekunden umkreiste ein ganzer Schwarm die Statue, ihre säbelartigen Schnäbel klapperten. An der Tür stand auf einem Emailleschild »Jugendheim, Werkstatt für Buchdruck und Buchbinderei«. Glänzend verlieh dieses Schild dem gesamten Gebäude ein sauberes Äußeres. Gegenüber blinkte die Neonreklame von LiderNor: Klimaanlagen, Heizung, Klimaanlagen, Heizung.
Ich glaube, es war Januar, auch weil alles am 22. Februar um halb neun Uhr morgens geendet hat, obwohl es einem inzwischen vorkommt wie Monate, waren es gerade einmal sieben Wochen, bis alles vorbei war.
Ich nahm den kürzesten Weg zur Grundschule Pires de Lima links an der António Carreiro entlang hinter den Grabsteinen des Friedhofs Bonfim. Die klotzig aufragende Schule erinnerte an einen fleischverarbeitenden Betrieb, und das ist kein Zitat von Pink Floyd — wo der Hammerkopflehrer die Schüler durch einen Fleischwolf in Form einer Schule drückt —, sondern die Fassade erinnerte wirklich an eine Großschlachterei, in der Schweine zerlegt werden.
Dona Palmira, die ich ausschließlich in ihren Kittel gezwängt kannte (unmöglich, sich vorzustellen, wie es darunter aussah), öffnete die Eingangstür. »Schau an, der Rafa, zu so früher Stunde«, grüßte sie mich, ihre Hand in die Hüfte gestemmt, und ich pfiff, wie man hübschen Frauen hinterherpfeift.
Die erste Stunde war Sportunterricht. Nicht, dass ich eine Ausrede gebraucht hätte, um mich davor zu drücken, aber mit Fußball hatte ich aufgehört wegen Grilo. Der gehörte nicht nur zu Fábios Leuten, sondern war auch schon einen Meter siebzig groß zur Welt gekommen. Man kann sich vorstellen, wie groß er inzwischen in der sechsten Klasse war.
Alle auf dem Flur waren sich einig, dass Grilo zu groß war, um ordentlich Fußball zu spielen, und viel zu breite Schultern hatte. Natürlich wollten wir vor allem so groß sein wie er, so gut Fußball spielen und ebenso breite Schultern haben.
Ich wurde immer ins Tor gestellt, weil ich den Ball mit den Füßen nicht traf. Grilo war in der anderen Mannschaft, und wenn er auf dem Platz war, hatte niemand sonst etwas zu melden. Er tanzte allein. Und ich wollte abhauen, ohne als schwach dazustehen. Keine Tussi sein, wie wir sagten.
Er, ich, das Spielfeld und der Ball. Wen interessierte es da noch, ob die Pille im Netz landete, wenn es vor allem schon klar war, dass sie mich zerfetzen würde? Und da kam er schon, dribbelte, schmiss sich ungerührt zwischen den anderen durch, die er wie Kinder eiskalt stehen ließ. Ich streckte die Arme zur Latte hoch, um möglichst viel Raum einzunehmen, und — verfickte Scheiße — da kam der Ball, wie ein Donnerschlag.
Alle Spieler umringten mich mit weit aufgerissenen Augen. Jetzt endlich hatte ich einen Grund, um vom Platz zu gehen: meine im rechten Winkel nach hinten gebogene Faust und blau angelaufene Finger. Grilo sagte, »Da ist nichts gebrochen«, und alle anderen stimmten ihm zu. Aber ausgerenkt war etwas, da waren sich auch alle einig. Dass sich ein Knochen schon fast durch die Haut bohrte, kümmerte Grilo nicht weiter.
Meine Hand pochte, und der Schmerz wurde immer heftiger. Erst Stunden später renkte der Arzt sie eiskalt wieder ein, klemmte meinen Arm zwischen Bettpfosten und zog daran — das war schlimmer, als gegen den Torpfosten geknallt zu werden. Einen Monat lang blieb die Hand in Gips.
Heute bin ich der Überzeugung, dass Grilo sich deswegen nie dazu bekannt und auch nie dafür entschuldigt hat, meine Hand zertrümmert zu haben, weil er danebengeschossen hatte. Und ich hatte das Fußballspielen erhobenen Hauptes aufgeben können, lädiert zwar, aber als derjenige, der einen unhaltbaren Schuss abgewehrt hat.
Dona Palmira war überzeugt davon, dass sie diesen Pfiff verdiente, strich sich den Kittel glatt und ließ mich vorbei. Ein paar Schritte weiter schaute ich mich noch mal um und sah, wie sie ihren eigenen Umriss betastete wie einen Klumpen Lehm, den man in Form bringen möchte.
Gegen neun Uhr kamen immer die Rentner auf die kleine Grünfläche mit ein paar Bäumen und einigen Vögeln namens Campo 24 de Agosto, um Karten zu spielen und sich über ihre Frauen zu beklagen. Was sie tröstete, war, dass sie sie eines Tages als Witwen zurücklassen würden. Auch die, die sie eigentlich liebten, denn ich konnte immer wieder mal sehen, wie sie zärtlich über das Foto in ihren Brieftaschen strichen, während sie über mangelnde Zuneigung maulten oder darüber, dass ihre Hemden nicht gebügelt worden waren.
Das Kartenspiel war eine ernste Sache. Die Rentner knallten die Karten nur so auf den Tisch, räusperten sich dabei geräuschvoll, gestikulierten und stritten sich laut über die Punktzahlen. Der, der sie aufschreiben sollte, irrte sich regelmäßig, und sie verbrachten den halben Vormittag über sein Heft gebeugt.
Die große Neuigkeit damals war ein Satz Karten, die laut Verpackung Kem, America’s Most Desired Playing Cards zu sein vorgaben und nach einigem Streit brennend in einer Mülltonne landeten. »Da siehst du, was du davon hast, Junge.«
Ich überquerte den Platz und betrat das Café, wo ich immer hinging, eigentlich eine enge Spelunke, in der ich mich zu Hause fühlte. Es gibt im Leben so manches Geheimnis, und eins davon war der Name des Cafés. Einmal fragte ich Herrn Xavier, warum er es Piccolo genannt hatte, und er antwortete, dass er Pinocchio mochte, »Piccolo wie du«, und ich war so schlau wie vorher. Dann war das Thema erledigt.
Ich setzte mich direkt an die Scheibe nach draußen und nahm ein Glas Milchcafé, dazu einen Berliner mit Vanillecremefüllung, die mir übers Kinn tropfte.
Von dort aus konnte man den Rohbau des Pão de Açúcar gut sehen.
1989 wohnten in dem engen Quartier zwischen der Avenida Fernão de Magalhães, Rua Abraços und Rua da Póvoa noch eine Menge Leute, die sich in Häusern aus dem 19. Jahrhundert verbarrikadiert hatten. Sie überlebten in ihren Küchen, Zimmern, Wohnzimmern, wo auch immer es in diesen Häusern noch warm wurde. Ich stelle mir vor, wie sie in Decken gehüllt neben dem warmen Ofen sitzen, falls darin noch ein Feuer brannte.
Dann kamen im Winter die Bulldozer, um den Räumungsbefehl zu vollstrecken. Wer noch da war, wurde vom Brüllen der Maschinenführer geweckt, »Haut ab, die Maschinen sind blind!« Dann wurden die Wände eingerissen, ihre Betten zertrümmert, Bilderrahmen zersplitterten, sie fügten sich und verschwanden die Straßen entlang, manche noch im Morgenmantel, andere hatte sich noch schnell etwas überziehen können. Nach drei Tagen erinnerte sich niemand mehr an sie.
Der Bauunternehmer wollte in Rekordzeit dort bauen, aus Angst, dass die Stadtverwaltung sich neue bürokratische Hürden ausdachte. Wochenlang hämmerten Bulldozer Steine klein, falteten Stahlträger zusammen und ließen Holz splittern. Dann kamen die Bagger und packten die Trümmer schaufelweise auf Lastwagengespanne, Fundamente wurden fünfzehn Meter tief in die Erde gegraben, gesichert von Baugittern, auf denen Schilder vor dem Offensichtlichen warnten: Gefahr! Vorsicht!
Der Abriss ging schnell, dann musste gebaut werden.
Im Piccolo hieß es, in dem ganzen Projekt sei wie immer von Anfang an schon der Wurm drin gewesen. Natürlich. In eine Gegend wie Fernão de Magalhães passte kein Einkaufszentrum wie dieses, das man dort geplant hatte mit diesem glanzvollen Namen: »Pão de Acúcar« — Zuckerhut. Man braucht sich doch nur die Gebäude ringsum ansehen. Alle hässlich, bis auf die alten Wandfliesen und das Grandhotel Vila Galé, das höchste Hochhaus der Stadt. Und dann spuckten sie auf den Boden und sagten, »Ist doch so, unsere Stadt lernt es nie«, und tranken ihren Espresso aus in der wohligen Sicherheit, dass sich sowieso nie was ändern würde.
Die Baukräne zogen dann hinter der Fassade zur Straße hin noch einen fünfstöckigen Klotz hoch. Und das war’s. 1992 mussten die Arbeiten wegen juristischer Auseinandersetzungen eingestellt werden, Bürokratie, Korruption oder weil kein Geld mehr da war, eins der üblichen Szenarien.
Die Investoren hatten noch vor, irgendwann weiterzubauen, aber die Jahre vergingen. Ein Einkaufszentrum jedenfalls wurde aus dem Skelett nie. Wieder hatte die Fernão de Magalhães nichts Ansehnliches vorzuweisen.
Als Erstes kamen die Ratten. Sie zogen ein, als dort längst noch gebaut wurde. Dann kamen die Tauben, die Eidechsen, Geckos und Schlangen. Auch ein Rotkehlchenpaar schaffte es bis ganz nach oben und blieb. Brütete.
Die Holzabsperrungen brachen ein, Leute zwängten sich durch sie hindurch. Erst kamen die alten Bewohner zurück und bedauerten, was aus der Baustelle geworden war, in der sie ihr eigenes Schicksal wiedererkannten. Die Decken, die Wände und Pfeiler überzogen sich mit Graffiti, ein Schriftzug flehte, BAUT WEITER und ein anderer sagte TUT MIR LEID. Müll aller Art lag überall über den Boden im Keller verteilt. Und in der Mitte des Rohbaus drückte ein Atrium Licht in die einzelnen Stockwerke. Dort sonnten sich Prostituierte, in den Kellern lungerten Junkies herum, und die Obdachlosen versuchten, irgendwie Ordnung hineinzubringen, es war ja Platz für alle.
Ganz unten im untersten Keller war ein Wasserloch, eher ein dreieckiger Schacht, bestimmt mehr als zehn Meter tief. Manchmal pinkelte einer von den Bewohnern hinein.
Neues Leben zog in das Gebäude, es wurde zum Übergangswohnheim, Schlafplatz, immer mal wieder kam Polizei. Bei ein oder zwei Razzien waren auch Schüsse zu hören, aber die trafen wohl nur den Beton, und es ist nichts passiert.
Nachts schliefen die Bewohner in zusammengezimmerten Hütten aus Pappdeckeln, Holz, Kartons, Plastikplanen, Matratzen. Besser gesagt, übernachteten sie in Behausungen, aus denen manchmal etwas Licht über den Beton flackerte. Die Ruine überlebte die Schmach und fand sich damit ab: Es waren ja nur Leute, die einen Schlafplatz brauchten.
Die neuen Bewohner kamen miteinander klar. Sonntags wurden Sardinen gegrillt, und der Rauch zog bis hinauf auf die Dachterrasse des Vila Galé, wo das Feiern bis tief in die Nacht störte.
Nach ein paar Jahren beschloss dann die Stadtverwaltung, dass es einen Plan geben müsse für den Verfall dort im Herzen der Stadt. Um zu irgendwas nütze zu sein, durften dort nicht nur Bettler, Geheimnisse, Schlägereien sein, benutzte Spritzen, Orgasmen und freundliche Gesten. Nein, um für irgendwas gut zu sein, musste ein Parkplatz her.
Mehr als die Polizei scheuchten nun Autos diejenigen auf, die dort nur ihre Ruhe haben wollten. Es war die letzte Vertreibung. Sie gingen, allein oder in Gruppen, und ließen die Überreste ihrer Behausungen einfach zurück.
2006 hatte sich lange schon niemand mehr um die Ruine gekümmert, die einmal ein Wohnviertel aus dem 19. Jahrhundert gewesen war und ein Einkaufszentrum namens Pão de Açúcar hatte werden sollen.
»Willst du noch was, piccolino?«, fragte Herr Xavier. Ich gab keine Antwort und ging über die Straße.
Der Parkplatz war längst vollgestellt, und der Wachmann vertiefte sich in seinem Häuschen in das Kreuzworträtsel im Jornal de Notícias, was wohl seine gesamte Aufmerksamkeit beanspruchte. Alles andere ging an ihm vorbei.
Es regt mich auf, dass er mich nicht einmal gesehen hat und auch nichts davon mitbekam, was dort in den Wochen darauf geschah. Es hat etwas Kleinliches, beinahe Tantiges, wenn ein fast zwei Meter großer Gorilla Buchstaben in winzige Kästchen malt.
Ich sprang über das Gitter, das den Zugang zum Treppenhaus versperren sollte. Meine Augen gewöhnten sich an die Dunkelheit, nur den Geruch nach Schimmel und Feuchtigkeit bekam ich nie mehr aus der Nase. Die Treppe mündete in einen Winkel, der wohl mal ein Abstellraum hatte werden sollen, aber nun nichts weiter war als ein Loch.
Das einzige Licht, ein schwacher Schimmer, fiel direkt auf mein neues Versteck, das Versteck für mein Fahrrad.
4
Ich schleppte das Rad ein Stück die Treppe hoch, wo mehr Licht war, irgendwo auf halber Treppe, und roch nun die frische Farbe am Rahmen, wie Erdbeergeruch, irgendwie viel zu süß für das synthetische Zeug. Ein trauriger Anblick und gleichzeitig wunderschön: Der Lenker, in der Mitte gebrochen, war durch ein Stück Besenstiel und ein paar Schlauchschellen zusammengehalten. Die Reifen waren platt. Und der Rahmen war natürlich mattgrün geworden, dabei hatte ich ihn glänzend haben wollen, damit er auf der Straße etwas hermachte.
Ein paar Wochen zuvor war ich mal einen anderen Weg zurück zum Wohnheim gegangen. Eigentlich sollten wir nach der Schule immer erst auf die Betreuer warten, aber die kamen sowieso nur, wenn sie wollten und um kein schlechtes Gewissen zu haben, und darauf hatte ich keine Lust, also dass sie auf meine Kosten kein schlechtes Gewissen bekamen. Also ging ich, wann ich wollte, und dort entlang, wo ich wollte, egal, ob sie kamen oder auch nicht, die Idioten.
Als ich den kleinen Weg zwischen Praça da Alegria und Brücke runterging, stand es da gegen einen Container gelehnt, gegenüber dem alten Kinderheim, an das nur noch der Schriftzug in altmodisch länglichen Lettern erinnerte. Und für mich stand da sowieso Fahrrad geschrieben.
Wahrscheinlich hatte ich es mehr aus Mitleid gerettet. Der Lenker war durchgebrochen, das Vorderrad platt, die Speichen am Hinterrad völlig verbogen, der Ledersattel aufgeplatzt und der Rahmen komplett verrostet.
Nachdem ich es im Gebüsch ganz am Ende der Straße versteckt hatte, wollte ich Samuel und Nélson davon erzählen. Das Fahrrad war ja noch gar nicht Wirklichkeit, bevor ich es vorgeführt hatte. Es ist so mit schrecklichen Dingen und auch mit Glück: Um ein Gefühl zu ermessen, muss man es teilen. Dann aber dachte ich, scheiß auf Glück oder Traurigkeit, es war sowieso nur Schrott, weggeschmissen mit anderem Dreck. Also hielt ich den Mund, weil es mir lächerlich vorkam, irgendwie auch beängstigend, dass der Abfall des einen bei jemand anderem solche Begeisterung auslösen kann.
Aus dem Gebüsch schleppte ich es dann in den Zwischenraum hinter dem Busbahnhof und von dort zu den leeren Flohmarktständen. Immer woandershin, damit es mir niemand wegnehmen konnte.
Erst als ich das Pão de Açúcar aufgetan hatte und mir sicher sein konnte, dass keine Drogensüchtigen oder sonst wer sich im Treppenhaus rumtrieben, war mir wohler. Ich ging jede Mittagspause nachschauen, bis ich ganz sicher wusste, dass es dort in Sicherheit war.
Nélson fragte, »Wohin haust du eigentlich immer ab?«, und ich sagte, »Das geht dich einen Scheiß an.« Samuel fragte nie.
Ich fing an, es für mich in Ordnung zu bringen. Der Besenstiel passte ganz gut an den Lenker, ich musste ihn nur mit den Schlauchschellen festmachen, die ich in einem Eisenwarengeschäft eingesteckt hatte. Nur die Kette war, obwohl ich sie mit Speiseöl eingeschmiert hatte, immer noch rostig und hakte. Ich ließ eine Dose mit grüner Farbe bei CIN in der Rua de Santos Pousada mitgehen und pinselte damit den Rahmen an, der sie aufsaugte wie trockenes Holz. Ich malte langsam über den Rost, es tat mir leid, dieses Fahrrad, das Farbe anscheinend so nötig hatte wie Zuwendung.
All das tat ich im Dunkeln, getrieben allein von der Kraft, etwas wieder in Ordnung zu bringen. Wenn irgendetwas wieder in seinen Originalzustand versetzt, im besten Sinne des Wortes wieder zum Leben erweckt werden konnte, dann dieses Fahrrad. Und ich mit ihm.
So wie Nélson einmal in der fünften Klasse einen jungen Spatzen gefunden hatte, der gegen die Wand geflogen war. Wir hörten das Tier piepsen, Nélson schleppte es überallhin in der Innentasche seiner Jacke, aber er sagte, »Ich habe nur was am Magen.« Wir hatten es glauben müssen, aber dann war der Vogel mitten im Unterricht aus seiner Tasche geflattert, hatte ein paar Runden durch den Raum gedreht und war durchs Fenster verschwunden. Samuel sagte, da gehen sie hin, deine Bauchschmerzen.
Das Fahrrad brauchte noch reichlich Arbeit: Noch einen Anstrich, Lack drüber, die Speichen mussten gerichtet werden, die Reifen geflickt, und ein Überzug für den rissigen Sattel musste ich auch noch finden.