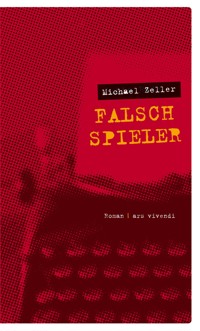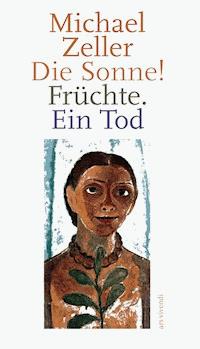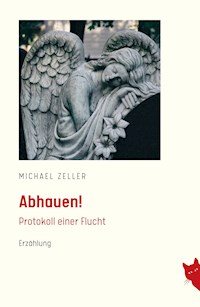
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rote Katze Verlag
- Sprache: Deutsch
In "Abhauen!" erzählt er die letzten zwei Jahre im Leben eines alten Menschen, eines ihm sehr nahen Menschen: der Mutter. Bei diesem bewußten Abschied spürt er den ganz eigenen Verbindungen zwischen allen Eltern und ihren Kindern nach. Dank Zellers differenzierter Sprache macht die Lektüre von Abhauen! durchaus nicht trübsinnig. In ihrer Ehrlichkeit liest sich die Erzählung überraschend leicht und humorvoll.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 146
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
1.
Oft hatte ich Mutter so nicht erlebt. Nur in selten glücklichen Augenblicken ihres Lebens. Länger nie.
Etwas hatte sich gelöst im Gesicht, auch im Sprechen des Körpers, dieses eingeschrumpften, verbogenen Rumpfes. Die Spannung schien gewichen, die sich so oft in ihren allseits gefürchteten Hassausbrüchen entladen hatte, wenn sie wieder einmal Gott und die Welt verfluchte, Lebende wie Tote, wegen ihres fehlgegangenen Lebens. Ich schob es auf die regelmäßige Kost des Krankenhauses, dass Pölsterchen ihr Gesicht rundeten und die Falten um den Mund, unter den Augen dabei eingeebnet hatten. Aus diesen Augen drang jetzt, jenseits der Trübheit des Grauen Stars, eine Ruhe, von innen. So hätte ich Mutter mir immer gewünscht. Selbst das Knibbeln an den Fingernägeln, an der Nagelhaut, war vorbei.
Der zweite Schlaganfall vor wenigen Tagen, kurz vor ihrem achtzigsten Geburtstag, hatte offenbar auch das Unruhezentrum in Mutters Gehirn berührt. Der Altersschwachsinn, der fröhlich aus ihr herausleuchtete, wie sie dalag in den hohen weißen Klinikkissen, war jetzt offenbar geworden. Als ich ihr beim Erzählen zuhörte, begriff ich, dass sie nicht mehr beim Wort zu nehmen war. Merkwürdig – Mutter kam mir dadurch näher. Ich durfte sie jetzt gelten lassen als einen Menschen, dessen Gedanken nicht mehr gehorchen. Dafür gab es jetzt andere Regeln als bisher. Sie waren mir vollkommen unbekannt. Sollte der Krieg der Worte zwischen uns ausgestanden sein? Eine eisige Spur von Trauer zog durch mich. Dass auch Erleichterung dabei war, konnte ich mir kaum eingestehen. Und dann gab es auch wieder helle Momente bei Mutter zwischendurch, in denen sie ansprechbar schien wie immer.
Ich versuchte mich der neuen Lage anzupassen. Beim Sprechen achtete ich ab jetzt viel stärker auf meine Stimme, modulierte sonor und weich und einschmeichelnd. Das, was ich sagte, sollte als beruhigender Klang bei ihr ankommen. Wer konnte sagen, was sie vom Inhalt noch verstand? In diesem Ton, vermutete ich, hätte ich ihr auch einen Leitartikel über den Krieg im Irak vorlesen können, der vor Tagen ausgebrochen war, oder über andere Reizthemen. (Politik war immer das erste Minenfeld unseres Streitens gewesen.) Oder wäre es nicht noch viel passender, ihr »La Le Lu« ins Ohr zu summen, »nur der Mann im Mond schaut zu …«, die Lieder, die wir gemeinsam gesungen hatten, als ich weder lesen noch schreiben konnte, und die sich mir gerade deshalb so untilgbar ins Gedächtnis gegraben haben?
Die Zeitungen, die Freunde und Bekannte Mutter ins Krankenhaus mitbrachten, fand ich jeden Morgen unbenutzt vor. Selbst ihr so geliebtes »Goldenes Blatt« oder »Frau mit Herz« und wie die Postillen alle hießen, mit denen sie in den letzten Jahren ihre Weltneugier gestillt hatte, rührte sie nicht mehr an. Sie schaute das bunte Heft an, wenn ich es ihr hinschob, aber sie schüttelte den Kopf dabei, leicht, doch entschieden genug, dass kein zweiter Versuch mehr infrage kam.
Was sie dagegen las, voller Eifer, wenn sie in ihren Stuhl saß, im Morgenmantel aus Frottee, war das Telefonbuch. Diese Lektüre allerdings geriet so heftig, dass die Krankenschwestern ihr nach wenigen Tagen den Lieblingstext wegnehmen mussten. Denn jedes Mal, wenn Mutter auf einen ihr bekannten Namen stieß, riss sie die ganze Seite raus und umrandete den Namen dick mit dem Kugelschreiber. Diese fünf oder sechs Blätter trug sie im Morgenrock mit sich herum, faltete sie immer wieder auf und studierte sie aufs Neue. Bis sie auf die wenigen Namen stieß, die ihr etwas bedeuteten. Ständig brachte sie sie durcheinander oder vergaß sie, musste nachschauen.
Dann leuchtete ihr die Freude aus den Augen, sobald sie die Namen gefunden hatte. Als wären es die Menschen selbst. Sie steckte die Telefonbuchblätter klein gefaltet zurück in die Taschen, um sich nie mehr davon trennen zu müssen. Nach ein paar Augenblicken geriet sie in Panik, als sie die Blätter auf dem Nachttisch nicht vorfand, griff in den Mantel, erlöst, legte sie jetzt dort ab, die zerzausten Seiten, strich sie glatt mit ihrer gichtkrummen Hand. Dann war sie wieder für eine Weile zufrieden. Im Suchen nach den Namen saßen Reste der Unruhe, die sie bedrängten. Geschrumpft auf die wenigen Meter zwischen Stuhl und Kopfende des Bettes.
Mit den Krankenschwestern kam Mutter überraschend gut aus. Je jünger sie waren, desto besser. Ausländische Schwestern erregten ihre besondere Neugier, ja eine Art Zärtlichkeit, wie gegenüber Kindern. Die junge Frau von den Philippinen fragte sie immer wieder, ob sie tatsächlich aus Italien komme. Auch Italien kannte Mutter nicht, aber es war ihr doch eine Spur vertrauter. Und sie war beliebt beim Personal. Ihr clowneskes Talent, die burschikose Art, Menschen direkt anzusprechen, mit ihnen zu scherzen, ihr rheinischer Mutterwitz kamen ihr dabei zugute. Es war viel Lachen um sie herum.
Mit diesem theaterreifen Mutterwitz hatte sie vor einem halben Leben sogar eine deutsche Beamtenseele weichgeschmolzen. Es war ihr damals, in den frühen fünfziger Jahren, gelungen, sich in ihrem Personalausweis um vier Jahre jünger zu machen, sodass sie auch jetzt hier im Krankenhaus mit dem gefälschten Geburtsjahr 1915 aufgenommen worden war.
So gut Mutters Verhältnis zu dem Personal war: Mit dem Arzt gab es Schwierigkeiten. Als ich sie nach ihrer Einlieferung zum ersten Mal besuchte, beschwerte sie sich bei mir sofort, dass sich bisher noch kein Arzt bei ihr habe blicken lassen. Einfach liegen gelassen werde sie hier, keiner kümmere sich um sie, außer diesen netten, jungen Dingern. Eine komme sogar extra aus Italien.
Natürlich glaubte ich ihr kein Wort. Als ich dann im Stationszimmer vor dem Arzt stand, verstand ich, warum er von Mutter nicht wahrgenommen worden war. Der Arzt war eine Frau. Eine ziemlich junge Frau, groß, kräftig, mit deutlich ausgeprägten weiblichen Formen. Dergleichen hatte Mutter nie gemocht (gelinde gesagt), und Frauen kamen als Ärzte für sie ebenso wenig in Betracht wie als Politiker. (Ihre Hassausbrüche gegenüber Politikerinnen jeder Couleur waren von einer derart kreatürlichen Wucht gewesen, wie sie der verbohrteste Mann im Stammtischrausch kaum überbieten könnte.)
Deshalb also gab es in Mutters Logik keinen Arzt auf der Abteilung, der nach ihr schaute. Dafür fragte sie mich jedes Mal, wenn der Krankenpfleger auftauchte, in seinen Turnschuhen, ein schlecht rasierter Jüngling, das schüttere Haar zu einem langen Zopf gebunden, ob das der Herr Professor oder gar der Klinikdirektor sei. Nachdem ich einige Mal verneint hatte, gab ich einfach nach.
»Ja, das ist der Herr Professor.« Alle hatten wir unseren Spaß dabei. Mutter freute sich über den hohen Besuch, und der Zivi grinste. Wieso sollte ich da nicht mitlachen? Wenn auch jeder sein eigenes Lachen lachte, so taten wir’s doch gemeinsam.
Beim Essen hatte Mutter alle Mäkeleien, die ich erwartet hatte, abgelegt. Sie waren herabgesunken in ihr wie so vieles andere auch. Obwohl sie sich als Vegetarierin verstand, aß sie die Fleischportionen mit großer Gier in sich hinein, knetete die Nudeln oder Kartoffeln in die dicken braunen Soßen und schaffte Mahlzeiten, an denen auch ich genug gehabt hätte.
Sie schien vollkommen ausgehungert zu sein. Ab zehn Uhr schon wurde sie unruhig, nahm die Wanderungen auf zwischen Nachttisch und dem Stuhl am Fenster, suchte hektisch nach den Telefonbuchblättern und fragte mich alle drei Minuten, wann endlich das Essen komme. Man habe sie schon wieder vergessen. Es sei doch längst über zwölf hinaus. Als ich ihr die Uhrzeit sagte, glaubte sie mir nicht. Sie lief hinaus auf den Gang, rief »Hallo, Hallo!«, bis jemand der dahineilenden Pfleger bei ihr stehen blieb, und fragte mit unleidlich fordernder Stimme, wann denn heute endlich das Essen komme.
Als die Mahlzeit endlich vor ihr stand, schob sie das Tablett mit den grau bedeckten Tellern weg von sich und nörgelte, sie habe sowieso keinen Hunger. Ich solle das essen.
Das erste Mal war ich noch ungeduldig gewesen mit ihr und hatte schroff abgelehnt (umso schroffer, als ich tatsächlich hungrig war und gern etwas gegessen hätte). Ich deckte die Teller ab, richtete ihr das Tablett, den Sitz und forderte sie auf, jetzt solle sie doch bitte essen. Ich hörte selbst, dass meine Stimme dabei überhaupt nicht weich und lieblich tönte. Mutter jammerte weiter. Das sei doch für mich bestimmt, sie habe sowieso keinen Hunger. Damit sie sich nicht länger drücken konnte, verließ ich das Zimmer und kam nach zehn Minuten zurück. Unberührt standen die Teller auf dem Tablett. Mutter weinte. Sie weinte mit vollem Mund. Neben ihr lag eine aufgerissene Packung Plätzchen.
Jetzt hatte ich begriffen.
Am nächsten Mittag schlug ich ihr vor, dass wir heute gemeinsam äßen. Sie solle nur erst einmal alleine anfangen. Ich schnitt ihr das Putenschnitzel vor, die eine Hälfte, und bat sie aufzustehen, damit ich ihren Stuhl ordentlich an den Tisch heranrücken konnte. Noch im Stehen aß sie schon. Sie aß nicht, sie schlang. Noch ehe der Mund leer war, schob sie die nächste Gabel nach. Im Nu war der Teller blank. Mutter legte die Gabel hin, nahm sie sofort wieder auf, kratzte die Soße zusammen. Also schnitt ich ihr den Rest klein. Im Nu war auch der verschwunden, gleich noch der Nachtisch.
Ausgehungert. Wie eine Ausgehungerte hatte sie das Essen in sich hineingeschlungen. Nur einmal bot sie mir an mitzuessen, halbherzig, flüchtig, vergaß es schnell, gabelte gierig weiter, bis alle Teller blank waren. So viel aß sie zu Hause nie, seit Jahren schon nicht mehr. Die nächsten Tage ging es ebenso. Einmal nur schob sie den Hackbraten weg. Ich hatte vergessen, ihn mundgerecht vorzuschneiden. Ihr Gesicht verzog sich in Ekel vor dem Batzen Fleisch. Ich machte ihr Häppchen, lockte sie, sie müsse auch nur drei Gabeln davon nehmen, den Rest äße dann ich. Sie aß und aß, bis kein Krümel übrig geblieben war.
Zum ersten Mal nahm ich bei diesen gemeinsamen Mittagessen so etwas wie Dankbarkeit an Mutter wahr. Obwohl sie jetzt regelmäßig ihre Teller leerte, jedenfalls immer dann, wenn ich dabei war und sie bediente und auch etwas anspornte, erwartete ich doch, dass sie sich anschließend über das Essen beklagen werde, das wirklich nicht vom Feinsten war, sondern der Grobküche eines Krankenhauses entsprach.
Doch kein Wort des Tadels kam je über ihre Lippen.
Nein, das Essen hier sei in Ordnung, das müsse sie sagen. Überhaupt werde sie gut versorgt. Die jungen Mädchen seien reizend, sogar die aus Italien. Alles picobello sauber. Jeden Tag werde das Bett frisch bezogen. Dass »der Arzt« sich nicht um sie kümmere, hatte sie längst verschmerzt.
»Ich fühle mich ganz wohl bei denen. Am liebsten blieb ich hier, ehrlich gesagt.« Nein, sie wolle nicht mehr in ihre Wohnung zurück. Und dem Gesicht, mit dem sie das sagte, glaubte ich viel mehr als ihren Worten, die von einer Sekunde zur nächsten ins genaue Gegenteil umkippen konnten, mit Heftigkeit verfochten. Ich musste es mir immer wieder selber sagen: Das ist nicht mehr deine launische Mutter. Das war eine leicht schwachsinnige alte Frau nach einem Schlaganfall. Ich war selbst ruhiger geworden und konnte deshalb weicher zu ihr sein.
Ja, in diesen Krankenhaustagen verhielt ich mich Mutter gegenüber entspannter denn je. Als wäre ich befreit, seit ihre Worte nicht mehr galten. Andere Angehörige der Familie und Freunde schreckten dagegen vor Mutters Verwirrtheit noch zurück und wollten sie nicht wahrhaben. Wenn ich gar von Altersschwachsinn sprach, wurde ich von der Seite angeschaut, besonders wenn ein Außenstehender dabei war: Als wäre ich für den Zustand verantwortlich, weil ich das Wort in den Mund nahm.
Magie der Sprache! Zum ersten Mal begriff ich es, nein, es drang mir durch den ganzen Körper, dass in menschlicher Frühzeit die Überbringer schlimmer Nachrichten erschlagen wurden. In den Familien haben sich Reste dieser historischen Entwicklungsstufe über die Jahrtausende erhalten. Familie ist die Vorzeit selbst, immer wieder.
Langeweile? Nein, Langeweile habe sie keine, antwortete mir Mutter. Der »Klinikdirektor« mit Zopf und in Turnschuhen hatte das Tablett abgeräumt, und wir saßen vor dem Fenster und schauten hinaus. Sie sitze gerne so da und schaue in die Natur hinaus. Tatsächlich: Sie sagte »Natur«. Meinte sie damit den verschneiten Fliederbusch zwischen Betonplatten, am Rand des Klinikparkplatzes? Obwohl ich sie stets mit dem Rücken zum Fenster sitzend vorfand, wenn ich morgens kam, wiederholte sie mehrfach die Nähe zur »schönen Natur« hier. Manchmal stellte ich die Sträuße vom Nachttisch an ihren Fensterplatz (wer sie ihr mitgebracht hatte, konnte sie mir nicht mehr sagen) und drehte die Blüten zu ihr. Sie schaute flüchtig hin, sagte: »Ach, Blumen.« Dann hatte sie genug.
»Wie viel Uhr ist es jetzt? Wann kommt das Essen? Waaas? Erst elf Uhr? Das kann nicht sein!« Und sprang hoch, tappelte auf den Flur, schaute nach der großen Uhr.
»Tatsächlich. Heute ist es aber spät!«
An einem Vormittag fand ich sie in hellster Aufregung vor. Da stand ihr wieder die alte Spannung ins Gesicht geschrieben. Sie nahm mich kaum wahr, tigerte zwischen Nachttisch und Stuhl auf und ab, immer auf der Suche nach den Telefonbuchblättern, die, zerfleddert wie sie waren, neu geordnet und immer wieder studiert werden mussten. Sie wolle raus hier, aber sofort! Noch heute Abend gehe sie nach Hause, das könne sie mir sagen. Jetzt habe sie doch wirklich genug.
Was ihr denn heute über die Leber gelaufen sei, wollte ich wissen.
»Nichts. Gar nichts. Wieso denn?« Gereizte Stimme, böser Blick.
Da sie nach ihrem Schlaganfall lediglich in Morgenmantel und Hausschuhen ins Krankenhaus eingeliefert worden war, nahm ich ihre Drohung nicht ernst. Das war wohl nur wieder eine ihrer Anwandlungen von früher, ein Stimmungstief, eine Laune des Tages.
Das Telefon. Mutter sprang auf, alarmiert. Ich nahm den Hörer ab. Eine Bekannte. Vorhin habe Mutter bei ihr angerufen. Vier Männer seien zu ihr ins Zimmer gestürmt, hätten sich um ihr Bett aufgebaut und ihr gedroht, sie müsse in ein Altersheim. Was daran denn stimme?
Gleich suchte ich die Ärztin auf. Ja, es habe am Morgen eine Visite gegeben bei Mutter, zwei Ärzte, sie, eine andere Kollegin. Und man habe ihr geraten, von hier aus doch besser in ein Altersheim zu gehen anstatt zurück in ihre Wohnung.
»Was redest du eigentlich immer mit diesem Weib?«, giftete mich Mutter an, als ich zurückkam. »Hat sie dich wieder aufgehetzt gegen mich, das Weib?«
Meine Wut, diese uralte, schluckte ich runter, wartete ein paar Sekunden, bis sie hinabgesunken wäre, achtete auf meine Stimme, mit der ich sie fragte, ob heute Morgen Ärzte bei ihr gewesen seien.
»Nein. Wieso? Was für Ärzte? Hier gibt es keine Ärzte! Seit ich hier bin, hat sich noch keiner bei mir blicken lassen.«
Sie war aufgelöst, gehetzt, böse, getrieben von Angst. Ja, das war Angst! Ihre Augen flackerten hin und her. Dann starrten sie mir ins Gesicht, wollten etwas lesen dort. Mutter spähte mich aus. Sie hatte einen schlimmen Verdacht. Ich musste meine Erinnerungen an diese Art von Blick niederhalten, um klarsehen zu können. Es war die schiere Angst, die ihr die Augen aus den Höhlen drehte. Vergiss nicht: Sie ist eine debile alte Frau, sonst nichts, ein Bündel Hilflosigkeit. Vergiss die Mutter! Ich sprach ihr beruhigend zu. Sie fing an zu weinen.
Wie es denn dem Hundchen gehe, ach Gott? Das arme Hundchen, so ganz ohne sie.
»Es geht ihm gut, du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Wirklich nicht.« Er fresse ordentlich, sei lebhaft, springe herum. Der Bruder führe ihn zweimal am Tag auf die Straße. »Ums Hundchen musst du dir keine Sorgen machen.«
»Wirklich? Belügst du mich auch nicht?«
Ich legte meine Hand auf ihre, streichelte sie.
»Ach, du bist doch ein guter Junge!« Sie trocknete die Tränen mit dem verkrumpelten Papiertaschentuch, das sie ständig in Händen hielt und mit dem sie alles, was sie anfasste, vorher und nachher abputzte. Und sie lachte wieder.
Mutter lag in einem Zweibett-Zimmer, an der Fensterwand. Ich wusste ja, wie heikel sie war, wenn Menschen ihr körperlich nahe kamen, gerade auch Frauen. Sie konnte sich im Angesicht von Fremden, die mit ihr eine Klinke benutzten oder in der Straßenbahn neben ihr saßen, regelrecht vor Ekel schütteln. Ihr Mund zog sich dann in Hass zusammen, dass es außer ihr noch andere Menschen gab auf dieser Erde. Ihr Hygienebedürfnis trug immer schon wahnhafte Züge, galt aber nur für andere. Sich selbst gönnte sie stets die größten Freiheiten, in der Überzeugung, es finde sich weit und breit kein reinlicherer Mensch als sie.
»Bei mir kann man von der Toilettenbrille essen!« war ein geflügeltes Wort von ihr gewesen, obwohl keiner je davon Gebrauch gemacht hat, soweit ich weiß. Das »Blinken und Blitzen« in der Wohnung war früher ihr ganzer Stolz gewesen. Meine Freunde in der Schulzeit, die mich zu Hause besuchen kamen (es waren nicht viele, die sich ein zweites Mal trauten), wurden von ihr mitleidlos in Schafe und Böcke geschieden, je nachdem in welchem Zustand sie unsere Toilette zurückgelassen hatten. Ein Tropfen Wasser von der Spülung, der auf der blank polierten Brille hängen geblieben war, genügte Mutter, um den Mitschüler als »Schwein« zu titulieren und sich über sein Elternhaus auszulassen. Fremde Menschen, dies war mein Eindruck aus der Kindheit, nahm sie immer nur als Schmutzfinken und Störenfriede ihrer perfekten häuslichen Ordnung wahr.
Jetzt, hier im Krankenhaus, war davon wenig mehr geblieben. Obwohl die Bettnachbarin einen hässlichen Hautausschlag hatte, der sie Tag und Nacht in den Kissen sich herumwälzen und jammern und stöhnen und winseln ließ, ging Mutter darüber hinweg, als summte allenfalls eine Fliege im Raum. Manchmal winkte sie sogar zu der Frau rüber oder nickte aufmunternd mit dem Kopf und sagte mit gesenkter Stimme: »Ach Gott, die Arme. Da muss man ja noch froh sein ...«