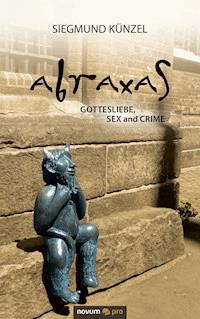
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: novum pro Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
"Sehen Sie sich manchmal auch so hin- und hergerissen? Dann haben Sie erkannt: Auch ICH bin ABRAXAS." Zwei Männer, Zwillinge, wachsen getrennt voneinander in unterschiedlichen Gesellschaftsschichten auf; der eine führt ein Leben als zupackender, weltgewandter Unternehmer, der andere als engagierter Theologe. Obwohl sie sich nicht kennen, spüren sie, dass sie im Geist zusammengehören. Im UNI-Disput will der eine klarmachen, dass der Mensch nur ein vom Schöpfer polar angelegter Mensch, ein "ABRAXAS", ist und auch "schlecht" handeln muss. Der andere aber meint, sich dem Mitmenschen gegenüber vor allem helfend und unterstützend einbringen zu müssen. Hier herrschen - dort dienen. Die eingestreuten Geschichten der beiden geben die unterschiedlich erlebten, ganz persönlichen Lebenseinstellungen der beiden wieder. Praktisch als "Mittelsmann" fungiert der Mediziner und Zwillingsforscher Dr. Wenger, der die Geschichte als (fast) ganzheitlich denkende und handelnde Person vorwärtstreibt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 577
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Inhalt
Impressum
Dazu erzählt man sich folgende Sage:
Als Grundlage zum vorliegenden Roman: ABRAXAS
1 Mein Heim ist mein Leuchtturm
2 Zu spät …
3 Warum ich …? Ich gelobe …!
4 Ein wohlbehütetes Elternhaus
5 Ein zielgerichtetes Elternhaus
6 In Gottes freier Natur
7 Im Internat ist gut leben
8 Das „Wahrheitsgefühl …“
9 Männlichkeitsprüfung
10 Was geht mich das an?
11 Kirchliche Jugendjahre
12 Auf dem Paukboden
13 Wir wollen helfen …
14 Wir werden wieder EINS
15 Mormonen und Christus
16 Handel treiben in der Welt
17 Diskussion über Gott und die Welt
18 Der Ferne Osten ruft
19 Patienten-Geschichten
20 Kranksein ist anders
21 Anzeigen sind auch Nachrichten
22 Anzeigen fordern zur Wahrheit
23 Vergeben – vergessen – erlöst …
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.
Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.
© 2014 novum publishing gmbh
ISBN Printausgabe: 978-3-99026-934-3
ISBN e-book: 978-3-99026-935-0
Lektorat: Dr. Annette Debold
Umschlagfoto: Siegmund Künzel
Umschlaggestaltung, Layout & Satz: novum publishing gmbh
Innenabbildungen: Siegmund Künzel (1)
www.novumverlag.com
Dazu erzählt man sich folgende Sage:
„Als die Lübecker dabei waren, die Marienkirche zu bauen, kam der Teufel des Weges und fragte, was sie da bauten.
„Ein großes Wirtshaus“, logen sie, um ihn nicht zu verärgern.
Ein Wirtshaus? Ein Ort von Laster und Trunk?
Das gefiel dem Teufel und er half kräftig mit, sodass der Bau schnell voranging.
Erst als die Kirche fertig war, merkte der Teufel, dass die Lübecker ihn reingelegt hatten. Wütend nahm er einen riesigen Stein, um den Bau wieder zu zerstören. Da sagten sie ihm, sie wollten gleich nebenan wirklich ein großes Wirtshaus bauen, den Ratskeller.
Der Teufel ließ daraufhin den Stein fallen, sodass er dicht neben der Kirche zu liegen kam. Dort befindet er sich noch heute, und auf ihm sitzt ein Teufel aus Bronze, den der Bildhauer Rolf Goerler 1999 schuf.“
Als Grundlage zum vorliegenden Roman: ABRAXAS
„Da hörte ich seine Stimme wieder.
Laut sagte sie das Wort: ‚ABRAXAS‘.
In einer Erklärung, deren Anfang mir entgangen war, fuhr Doktor Follen fort: ‚Wir müssen uns die Anschauungen jener Sekten und mystischen Vereinigungen des Altertums nicht so naiv vorstellen, wie sie vom Standpunkt einer rationalistischen Betrachtung aus erscheinen. Eine Wissenschaft in unserem Sinne kannte das Altertum überhaupt nicht. Dafür gab es eine Beschäftigung mit philosophisch-mystischen Wahrheiten, die sehr hoch entwickelt war.Zum Teil entstanden daraus Magie und Spielerei, die wohl oft auch zu Betrug und Verbrechen führte.
Aber auch die Magie hatte eine edle Herkunft und tiefe Gedanken. So die Lehre von Abraxas, die ich vorhin als Beispiel anführte. Man nennt diesen Namen in Verbindung mit griechischen Zauberformeln und hält ihn vielfach für den Namen irgendeines Zauberteufels, wie ihn etwa wilde Völker heute noch haben.
Es scheint aber, dass Abraxas viel mehr bedeutet.Wir können uns den Namen etwa denken als den einer Gottheit, welche die symbolische Aufgabe hatte, das Göttliche und das Teuflische zu vereinigen.‘
Der kleine gelehrte Mann sprach fein und eifrig weiter, niemand war sehr aufmerksam, und da der Name nicht mehr vorkam, sank auch meine Aufmerksamkeit bald wieder in mich zurück.
‚Das Göttliche und das Teuflische vereinigen‘, klang es in mir nach.“
(aus DEMIAN, von Hermann Hesse)
Das Göttliche und das Teuflische vereinigen?
Aber – stellt dieses kosmische Surrogat nicht denMENSCHENdar?
Ist der MenschABRAXAS?
HONI SOIT QUI MAL Y PENSE
(Beschämt sei, wer schlecht darüber denkt)
Devise des englischen Hosenbandordens
1 Mein Heim ist mein Leuchtturm
Es schneit noch immer.
Schon den ganzen Tag über hat es geschneit – große, dicke, weiche Flocken. Alles ist mit einer leichten weißen Decke überzogen.
Dazu ist es eisig kalt und das ganze Land scheint steinhart gefroren zu sein.
Aber trotz der Kälte vermittelt der schneeweiße Überzug irgendwie ein Gefühl der Wärme. Denn alles ist so eingehüllt und leicht bedeckt, wie wenn eine Mutter ihr Kind mit einem flauschigen Schaffell vor den kalten, Leben raubenden Mächten der Natur beschützen würde.
Doch das sehe ich nicht so.
Ich stehe auf dem knöchelhoch beschneiten Treppenabsatz vor meinem Haus und schaue dem Taxi nach, das mich gerade hierhergefahren hat und nun die abschüssige Straße, dick mit Eis und Schnee überzogen, langsam und vorsichtig hinunterschlittert.
Ein leichter Ostwind treibt mir dicke, aufgeplusterte Schneesterne ins Gesicht.
Ich fühle, wie diese fast im gleichen Augenblick ihres Auftreffens auf meiner leicht erröteten Haut vergehen; zerfließen in Wasser, verdampfen und sich in nichts auflösen.
Ich drehe mich um, gehe vorsichtig die weiß belegten Stufen weiter hinauf, ziehe im Gehen den Schlüssel hervor, öffne die einladende Eingangstür, durcheile die geheizte Halle und gelange nach wenigen Sekunden mit dem Lift in den 13. Stock, in dem sich meine Wohnung, ein nach meinen Plänen gestalteter Attikabau, befindet.
Ich hänge meinen Mantel an den hölzernen Garderobenständer im geräumigen Vorplatz und stelle den schmalen ledernen Aktenkoffer in mein Studio.
Da mich leicht fröstelt, drehe ich den Thermostat auf Maximaltemperatur und begebe mich ins Badezimmer.
Für einige Augenblicke überlege ich, ob ich nicht ein paar mich aufwärmende Züge im beheizten und überdachten Swimmingpool machen sollte, entscheide mich dann aber für die Dusche.
Langsam entkleide ich mich und stelle mich unter den dampfenden Wasserstrahl.
Leicht läuft mir das Wasser über Bauch und Rücken. Wohlig kriecht mir die Wärme in alle Glieder. Wie eine Katze, die nach Streicheleinheiten verlangt, strecke ich mein Becken und die Oberschenkel in die feinen, warmen Strahlen.
Meine abgestumpften Lebensgeister regen sich wieder.
Ich greife nach dem Handtuch neben mir, trockne mich sorgfältig ab und betrachte mich dabei im gegenüberliegenden Spiegel, der die ganze Wand einnimmt.
Mit sichtlicher Genugtuung kann ich erkennen: Mit meinen gut vierzig Jahren stelle ich einen recht respektablen Mann dar!
Breite Schultern, eine stämmige Brust, volles schwarzes Haar, grau-grüne Augen, ein gefälliger Kopf. Dazu schlanke, muskulöse Beine und kräftige Hüften. Und im Übrigen … ja, auch das stimmte!
Brauchte ein Mann mehr?
Ja, ich habe einen wohlgeformten Körper, und – ich bin stolz darauf.
Die Chancen bei den Frauen jeglichen Alters bestätigen es mir!
Ich habe es zu etwas gebracht.
Meine Firma, ein gut gehendes Handelshaus, ein Unternehmen mit weltweiten Geschäftsverbindungen und erstklassigen Beziehungen bis in die höchsten Staatsämter der wichtigsten Industrieländer, habe ich allein aufgebaut. Bis hierher war es ein gutes Stück Arbeit gewesen und nicht ohne Neid verfolgen meine Freunde und Bekannten meinen unaufhaltsamen Aufstieg.
Es ging und geht noch immer steil nach oben.
Dass mich mein Stiefvater mit seinem Geld und seinem Einfluss – er hat einen vollstufigen Textilbetrieb mit eigenen Zulieferfirmen im Fernen Osten – sehr gefördert hat und dass er es praktisch war, welcher meine Firma ins Leben gerufen und, wenigstens in den Anfängen, finanziell und mit seinen geschäftlichen Verbindungen nach dem Motto „Eine Hand wäscht die andere – dort, wo Wasser ist!“ sehr unterstützt hat, sage ich nie. Wichtig ist nicht, wie man etwas erreicht hat im Leben, sondern nur, was. Und nur das zählt!
Eine wichtige Frage meines Vaters enthielt daher nur ein einziges, immer fragendes Wort: „Resultat …?“
Nur die Dummen schlagen sich mit moralischen oder ethischen Gedanken herum, sagte er immer. Sie sollten sich viel mehr um ihre beruflichen Aufgaben, ihre eigenen Geschäfte kümmern. Auf jeder Ebene.
Da sie dies aber nicht oder nur inkonsequent tun, „dümmeln“ diese geistigen Leichtgewichte daher auch meist auf den untersten Stufen der Gesellschaftspyramide dahin. Nur sie gehen den ausgelatschten Trampelpfad des Lebens und meinen ein besonders schönes Leben damit zu führen. Dabei haben sie nur Angst und wollen kein Wagnis eingehen. Sie leben immer in der törichten Annahme, ganz besonders belohnt zu werden, je fleißiger sie sind und je mehr sie sich bemühen. Es ist genau die Variante, welche die Psychologen und Theologen als die Theorie von der „gerechten Welt“ bezeichnen – dass nämlich die Menschen bekommen, was sie sich selbst verdienen.
Wie gehorsame Dickhäuter schlagen sie sich durch das so fruchtbare Dickicht des Alltags, sich selbst aber immer wieder drohend: Nur nicht nach rechts und links schauen, geschweige denn etwas „naschen“; nur nicht vom Weg abweichen!
Diese Typen sind nicht flexibel, nicht anpassungsfähig genug. Sie sind daher selbst schuld, wenn sie ihre Chancen nicht nutzen und somit arme Schlucker bleiben.
Diese geistigen Kleingärtner sind einem fast magischen Denken verfallen, das ihnen einredet, dass die verschiedenen Institutionen, denen sie dienen, ihre Verdienste auch fair belohnen werden. Selbst intelligente Frauen und Männer wollen nicht einsehen, dass sich die übergroße Mehrheit der Menschen nicht an der Spitze der Macht-Pyramide wiederfindet.
Sie wollen nicht realisieren, dass sie durch ihr dummes Verhalten nur zu Schachfiguren genügen, die man herumschieben, ja sogar, wenn es sein muss, ersetzen kann. Zugreifen ist bei diesen Leuten nicht gefragt, da es Eigeninitiative verlangt, und diese ist immer mit einem gewissen Risiko verbunden.
Ich – ich hatte es jedoch getan, hatte zugegriffen, hatte meine Chancen genutzt, mich dem Risiko ausgesetzt, in jeder Beziehung.
Ich – ich hatte jede mir bietende Gelegenheit ausgekostet.
Und ich – ich habe es geschafft!
Ich gehöre zu den Menschen, die etwas zu sagen haben. Auf mich hört man, mich respektiert man. Ich bin Teilnehmer der Macht-Pyramide; ich bin angekommen.
Ich bin oben!
Ganz oben!
Und wie lauten hier die Gesetze der Marktwirtschaft? Der eine will etwas und der andere hat etwas. Geben und Nehmen.
Stolz und mich anerkennend genießend, schaue ich im Spiegel an mir herunter. Ich bin wer – die kleinen rötlichen Äderchen, die sich seit einiger Zeit, hie und da, auf der einmal reinen, makellosen weißen Haut zeigen, übersehe ich. Sie interessieren mich nicht. Wenigstens im Moment nicht!
Dann wende ich mich ab, werfe mir den bunt bedruckten Bademantel über, bereite mir im Salon einen Drink und gehe hinüber ins Schlafzimmer, um mich anzukleiden.
Das Schlafzimmer mit den angrenzenden Gebäudeteilen ist mein ganzer Stolz. Es ist zwar nicht zu groß, aber doch geräumig genug, um ein überdimensionales rundes französisches Bett darin aufzunehmen.
Diese eher einer Wohnlandschaft gleichende, aus Mahagoniholz fein gearbeitete Liegestätte befindet sich direkt in der Mitte des Raumes und stellt nicht nur im architektonischen Sinne das Zentrum dar. Es verkörpert praktisch das Zentrum meines Lebens!
Wie viele schöne Stunden hatte ich nicht schon in dieser wohl „friedlichsten“ Kampfstätte der Welt verbracht. Denn auch hier werden Siege, oft mit sehr spitzer Lanze, erfochten; doch immer war das zu erringende Glück, der Preis jeder Schlacht, auf beiden Seiten der Kämpfenden. Win-Win …
Alle, die dieses Marketenderlager verließen, verließen es zwar müde und matt, abgekämpft, aber doch zufrieden und glücklich. Und so sollte es auch noch lange bleiben. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass es je anders hätte sein können.
Zu dem Bett hinauf führen zwei Stufen. Sie sind rings um die runde Lagerstätte angeordnet.
Vom Fußboden her zieht sich ein dicker, bräunlicher Wollhaarteppich bis auf die erste Stufe des Bettes hinauf. Die zweite Stufe ist mit grünem Wollplüsch belegt. Das Bett, die Auflagefläche selbst, ist in einem hellen Rot gehalten. Wie ein alttestamentlicher Altar, auf dem die Opfergaben auf ihre Darbringung warten, so kam es mir immer vor, wenn der nackte Frauenkörper, lang hingestreckt, reglos, auf dieser Ebene lag und der kommenden geistigen und körperlichen Glückseligkeiten harrte.
Die wirkliche geistige Übereinstimmung ergäbe sich immer nur dann, wenn auch die körperliche stimme – und umgekehrt, sagten mir meine Gespielinnen stets. Mir war das egal.
Auf dem Bett liegt ein großes, gelb eingefärbtes Eisbärfell, welches fast die ganze Liegefläche bedeckt. Das Kopfende der Bettstatt ist erhöht, mit rosa Seide drapiert und enthält zu beiden Seiten Lautsprecherboxen. Links, eingelassen in die oberste Stufe, ist ein Musikschrank. Hier können Platten, Bänder ab- und auch Radio gespielt werden. Rechts, ebenfalls in der zweiten Stufe, befindet sich eine kleine, aber wohl eingerichtete Bar mit den feinsten flüssigen Kostbarkeiten aus aller Herren Länder.
An der gegenüberliegenden Wand ist eine Fernsehmattscheibe eingelassen, auf der, vom Videosteuerpult aus, links in der Stufe, die heißesten Streifen und pikantesten Filme gezeigt werden können. Die Mattscheibe wird eingerahmt von sechs kleinen, dickbackigen Puttenengeln, welche in stiller Anteilnahme dem munteren Treiben mit Freude zuschauen.
Direkt über dem Bett befindet sich eine sich drehende Glaskugel, die aus vielen Dreiecken zusammengesetzt ist. Eine auf sie gerichtete Spotlampe zaubert durch verschiedenfarbige Scheiben weiße, rote, orange, gelbe, grüne, blaue und violette Reflexe auf die Kugel, welche wiederum den Raum in ein bunt schillerndes Regenbogen-Paradies verwandelt. Freunde, die diese Wunderwelt kennen, nennen daher diesen Raum auch den Raum der Harmonielehre; Harmonie der Farben und Körper!
Eigentlich besteht dieses ganze Schlafzimmer nur aus zwei Wänden, nach oben offen, und zwei seitlichen Säulenhallen. Denn frei vom Schlafzimmer aus zugänglich, ist das Schwimmbad in der linken Halle eingebaut. Besonders am Morgen bereitet es ein unbeschreibliches Vergnügen, nach „getaner Arbeit“ und erquickendem Schlaf, nackt, in den bewegten Wellen, den Körper wieder langsam an die kommenden Dinge des Alltags zu gewöhnen; durch die Fenster schimmert die aufgehende Sonne.
Auf der rechten Seite ist eine Art Wintergarten-Gewächshaus angelegt. Es ist ebenfalls durch einen kurzen Säulengang vom Bett direkt zu erreichen. Im Glashaus wurden die mannigfaltigsten Tropengewächse, Bäume, Sträucher und Büsche gepflanzt. Orchideen und seltene ostasiatische Blumen zieren den gepflegten Rasen. Ein kleiner See, in welchem sich im Sommer (bei offenem Dach) der blaue Himmel spiegelt, unterbricht das Grün des Rasens. Im See wurden Lotusblumen und andere Wasserpflanzen aus dem Fernen Osten angesiedelt. Liegebetten unter bräunenden Höhensonnen laden zum Verweilen.
In diesem Garten-Schwimmbad-Abteil herrscht, durch eine automatische Klimaanlage bedingt, immer eine Temperatur von siebenundzwanzig Grad Celsius; fast subtropisch.
Ich bin stolz auf diese Südseelandschaft und ich weiß, man muss weit laufen, um so etwas zu sehen. Ich bin fast sicher, dass ich der Einzige bin, der dieses Stückchen Imitat-Erde der Südsee in einer Attikawohnung in Europa sein Eigen nennen kann. Ein Paradies für mich und einige wenige, aber wichtige Freunde.
Unschlüssig stehe ich vor dem in der Wand eingebauten Kleiderschrank. Ich überlege mir, was ich anziehen könnte. Lässig abwägend fahre ich mit der offenen Hand an den vor mir hängenden Hemden, Hosen, Jacken und Anzügen vorbei.
Ach ja, Ulrike wird ja heute kommen, erinnere ich mich. Mit ihr hatte ich nun schon längere Zeit ein recht enges Verhältnis. Ihr Vater ist ein angesehener Politiker und viel unterwegs. Er hat sehr gute persönliche Verbindungen, weltweit. Ulrike, die einzige Tochter, ist nicht gerade sehr attraktiv – aber sie passt in die Klasse der Eliten. Eigentlich ist sie auch nicht mein großer Schwarm – da gibt es andere interessante junge Frauen, aber sie ist standesgemäß.
Nun, heute kommt sie wieder einmal vorbei. Aber bis dahin ist noch Zeit. So wähle ich eine graugrüne Hose, ein dazu passendes wollenes Sporthemd, Socken und Schuhe. Ich ziehe mich an und gehe zurück ins Wohnzimmer. Dort nehme ich das Glas Whisky, welches ich mir eingeschenkt hatte, zur Hand, und während ich langsam den goldgelben Getreidesaft hinunterschlucke, schaue ich mich im Zimmer um.
Ich sollte wieder einmal umstellen, vielleicht neue Möbel kaufen … etwas anderes, wieder mal was Neues sollte kommen!
Ich werde Ulrike fragen, was sie dazu meint! Ihr Geschmack ist nicht schlecht und ich sollte sie auch etwas mehr mit in mein Leben einbeziehen, immerhin beabsichtige ich sie einmal zu heiraten, denke ich gelangweilt.
Nochmals schenke ich mir ein Glas ein und schlendere dann hinüber zum großen Schiebefenster, welches auf den jetzt schneebedeckten Balkon geht.
Ich schaue hinunter. Unter mir liegt die Stadt.
Das Schneetreiben ist jetzt so stark geworden, dass ich die gegenüberliegenden Häuser kaum mehr erkennen kann. Der Stadtteil, in dem ich wohne, liegt etwas erhöht und das Zentrum bildet mein Haus, der LEUCHTTURM, wie man es nennt. Von hier aus hat man einen wunderbaren weiten Blick über die ganze Stadt bis hinunter zum jetzt zugefrorenen See. Bei schönem Wetter geht der Blick sogar zu den immer schneebedeckten Berggipfeln in der Ferne. Ein erhabenes Gefühl stellt sich ein durch diese Weite und scheinbare Unbegrenztheit, die da vor einem liegt. Eine Freiheit und Herausgehobenheit, die nur ich so richtig zu genießen weiß.
Ich bin in jeder Beziehung ein freier Mensch. Ein Mensch, über alle anderen Menschen erhaben, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ich kann tun und lassen, was mir beliebt.
Ich brauche keine Rücksicht zu nehmen, auf niemanden. Auf keinen Menschen!
Nach den Maßstäben weniger Erfolgreicher hatte ich den Gipfel bereits erreicht. Nun war es meines Erachtens sogar Zeit, meine Vorstellungen von Erfolg voll und ganz zu verwirklichen. Ich hatte nur noch nicht beschlossen, wie.
Gewiss, ich hatte die letzten Jahre hart, sogar sehr hart gearbeitet.
Das Ergebnis war sichtbar.
Aber nun fragte ich mich mehr und mehr, warum ich mich nicht einfach zurückzog, um so wenig wie möglich zu tun; denn ich hatte ja alles. Und meine Leute in der Firma waren gut eingearbeitet und spurten …
Der Hauptunterschied zwischen mir und meinem Vater liegt darin, dass das, was er immer noch tut, von ihm als unerhört wichtig, wertvoll und sogar sinnvoll angesehen wird. Ich konnte ihn verstehen, denn nach dem Krieg hieß es aufzubauen, Neues zu schaffen. Deshalb wollte er auch immer Resultate sehen. An diesen konnte er sich messen! Doch mir kam es immer mehr so vor, als ob wir, unsere Generation, uns eigentlich etwas vormachten. Denn war unser, mein Tun nicht in letzter Konsequenz doch beschränkt und – ich mochte es kaum denken – vielleicht sogar in manchem sinnlos?
Vergebliche Mühe …
Was sind das eigentlich für negative Gedanken?, durchfährt es mich plötzlich und ich realisiere – leicht erschrocken – zum ersten Mal, dass solche Gedanken in der letzten Zeit vermehrt in meinem Kopf herumgeisterten.
„Ich bin ich“, sage ich daher fast stur zu mir selbst, gehe ins Zimmer zurück und stürze einen weiteren Drink hinunter.
Hinter mir schlägt die Uhr.
Ich zähle in Gedanken mit und wende mich dann um, so, als wollte ich nachprüfen, ob die Uhrzeit auch wirklich stimmte. Ja, ich habe mich nicht geirrt. Es ist fünf. Durch die durchlöcherten, breiten Zeiger hindurch kann ich es sehen.
Eine Mattigkeit überfällt mich.
Ich nehme mir noch einen Whisky.
Dann setze ich mich in den Sessel und weiß eigentlich im Moment gar nicht, was ich mit dem angefangenen Spätnachmittag machen soll.
Gedankenverloren starre ich in mein Whiskyglas.
Trinke …
Mit jedem Schluck wird es nicht nur leerer, sondern gibt auch mehr und mehr den Boden frei, welcher bald als Spiegel wirkt, und mit dem letzten Schluck werde ich mir plötzlich meines Konterfeis gewahr, das mich verzerrt anblickt. Mein Gesicht glänzt mich klein an. Die Nase ist durch die Wölbung des Glasbodens so dick, dass sie fast die gesamte Bodenfläche bedeckt. Wie eine Fratze – so scheint es – grinst mir, fast bedrohlich, wie eine kalte Totenmaske, aber dann wieder irgendwie fröhlich triumphierend, mein Gesicht entgegen. So habe ich es noch nie gesehen.
Leicht erschrocken schwenke ich ruckartig das leere Glas weg und gieße gedankenverloren nochmals nach. Es ist mir nicht bewusst, dass ich eigentlich damit mein Gesicht, diese Totenmaske, im Whisky ertränken will – auslöschen.
Mechanisch greife ich nach dem Schaltgerät vor mir auf dem kleinen Glastischchen. Ich drücke auf die untere linke Taste und in Sekundenschnelle erscheint ein Bild auf dem Fernsehschirm.
„Guten Abend, meine Damen und Herren.
Hier ist die Tagesschau! …“
Nur mit halbem Ohr höre ich hin.
„… Washington: Der amerikanische Präsident … bei den in Tokyo diskutierten UN-Resolutionen schärfere … wurde mit neuen Vollmachten ausgestattet … Er erklärte in einer Feierstunde zu Ehren der umgekommenen …“
Ich schalte innerlich ab, höre nicht mehr zu, sehe nur die wechselnden Bilder, ohne recht aufzunehmen, was sich dort, vor mir, auf der Mattscheibe abspielt.
Was gehen mich die Erklärungen, die Konferenzen, Reisen und internationalen Tagungen an, denke ich. Ich weiß, dass diese Menschen alle in eines anderem Auftrag handeln müssen und sowieso nicht das sagen, was für die Allgemeinheit, für das Volk, von Interesse ist und für den Einzelnen eine Hilfe wäre, sondern dass nur das ausgesprochen wird, was die eigene Person ins rechte Licht rückt.
Nur keine Ehrlichkeit der eigenen Person und den Zuhörern gegenüber aufkommen lassen. Es könnte einem den Kopf kosten.
Nur was zur eigenen Imagepflege notwendig ist, das zählt.
Nicht was, wie es gesagt wird, ist entscheidend.
Polemik, nicht sachliche Information ist Trumpf.
Ich kenne diese Leute und ihre Taktik.
Mit einem gütigen Lächeln, mit einem treuherzigen Augenaufschlag konnten die größten Lügen, die abgefeimdesten Unwahrheiten verbreitet werden. Denn was sagte schon US-Präsident Roosevelt: „In der Politik geschieht nichts zufällig! Alles ist vorgeplant.“ Und der ach so ahnungslose Bürger erfährt nur das, was jene hinter den grauen Kulissen der Politik beraten, beschlossen und in die Wege geleitet haben. Das Warum, zu welchem Zweck und auf welches Ziel hin das alles betrieben wird, erfährt er nicht.
Sie alle, die sie da vor mir auf der Mattscheibe Revue passieren, sie beherrschen dieses Metier ausgezeichnet, und wenn noch nicht, sind Medienbeauftragte zur Stelle. Die im Hintergrund, die das Kapital und die Massenmedien beherrschen, sind es, welche die sichtbaren, bunt bemalten Kulissen bewegen lassen; je nach Gebrauch werden diese hin- und hergeschoben und zeigen so dem staunenden Bürger die gesellschaftspolitische Landschaft.
Nur nie die ganze Wahrheit sagen, das weiß man in diesen Kreisen.
Nur immer so viel bewusst preisgeben, wie der Massenmensch vertragen kann; und – nie mehr und nichts anderes als das, was dem Sprecher selbst zugutekommt.
Wer trotzdem einmal die Wahrheit antippt, der wird bald selbst sehen, wohin er damit gelangt. Meist wird er sogar von seiner eigenen Kaste diffamiert, als Außenseiter abgestempelt und von der Masse, die ja Außenseiter nicht versteht und daher auch nicht leiden kann, zerstückelt. Wenn nicht anders möglich, hilft sogar gern die Presse nach. So passt er sich besser an, heuchelt mit und stößt ins gleiche dreckige Horn, aus welchem nur noch Staub, Ruß und Asche kommen.
Doch dann ist er anerkannt, weil voll dabei.
Aber, wie gesagt: Nur nicht die Wahrheit bzw. das Quäntchen mehr aussprechen, welches zur Wahrheit führt oder führen könnte. Das ist die größte Dummheit; für den Sprecher selbst und sogar für die ganze Menschheit.
Deshalb denken diese Leute auch, sie täten noch etwas Gutes, wenn sie nicht die Wahrheit sagen. Denn würde man dem Volk, den Völkermassen, dem Pöpel, wie sie gern sagen, reinen Wein einschenken, so könnten diese ja plötzlich begreifen, die Sachlage sogar verstehen und – mitdenken, und dann würden sie womöglich plötzlich Fragen stellen. Fragen, welche die aufgebaute unsichtbare Mauer zwischen den politisch Mächtigen und der jetzt fordernden Masse niederreißen würden. Nichts würde dann mehr gehen. Ein politischer Zweifronten-Krieg wäre das Resultat.
Eine Macht- und somit eine Gewinneinbuße auf der ganzen Linie für die Beweger der Gesellschaft wäre die Folge. Dieses jedoch muss auf alle Fälle verhindert werden.
„Das Volk muss dumm gehalten werden“, sagte mein Vater immer.
Nur keine eigenen Gedanken aufkommen lassen in der Masse. Und wenn doch? Dann würde dieser gedankliche Schneeball wachsen und es könnte sich leicht eine verhängnisvolle Lawine daraus bilden, welche donnernd ins Tal gehen und alles von uns Aufgebaute vernichten würde, meinte er.
Die größte Revolution könnte vom Zaune gebrochen werden.
Also: Wehret den Anfängen!
Gebt ihnen, den vermassten Typen, Brot!
Gebt ihnen, den vermassten Typen, Spiele!
Lasst sie mit gefüllten, fetten Bäuchen, aber leeren Köpfen aufeinander los.
Auf der anderen Seite wollen die Volksmassen allerdings auch nicht mitdenken. Ich weiß das. Sie wollen am liebsten in Ruhe gelassen werden.
Ich habe Leute unter mir in meinem Betrieb. Sie denken nicht mit!
Gut, nicht alle; aber stehe ich nicht hinter ihnen, gebe ich nicht klare Befehle, nichts oder nur Unnützes und Oberflächliches würde getan werden. Ja, sie würden die Situation sogar für sich ausnutzen.
Deshalb: Treiben wir sie an. Machen wir sie abhängig, gierig … erst dann spuren sie.
Warum diese Leute also für voll nehmen, aufklären, sie darauf hinweisen, dass auch sie denken könnten, wenn sie nur wollten. Nein, stören wir sie nicht in ihrer Lethargie. Der Mensch ist faul, träge, schlampig.
Dieses Dahinvegetieren, was sie Leben nennen, aber nur einen traurigen Abklatsch des wirklichen Lebens darstellt, sollten wir lieber für uns ausnutzen. Die seicht dahinplätschernden Wassermassen der Volkskräfte umleiten, auf die eigene Mühle, das muss von uns getan werden. Und ich tat es.
Dem Volk aufs Maul schauen, gezielt uns genehme Psychologen einsetzen, die ihm in seine Steinseele schauen und ihm schließlich das geben, wonach es in seiner Borniertheit verlangt: Arbeit, Geld – aber gerade so viel, wie es braucht, um zu überleben. Schulden machen – selbst schuld! Und wenn, dann wird man halt durch hoch verzinste Abzahlungsgeschäfte dieses Geld wieder zurückholen. Das Volk abhängig machen, das musste man. Nur so konnte unsereiner verdienen.
Schulden führen ins Paradies – Sparen in die Hölle.
Und wie konnte man am meisten verdienen?
Ganz einfach: Mit Stiftungen sparte man Steuern. Oder zum Beispiel durch landesweit verbreitete Kartellpraktiken. Durch diese und inoffizielle Absprachen mit der Konkurrenz sowie durch Subventionen vom Staat scheffelte man jährlich einige Milliarden ein – und dieses „sauer“ verdiente Geld ging weiter in globale Steuerparadiese ins Ausland. Aber Letzteres erwähnte man nicht.
Umgerechnet machte das zwar ein paar Tausende pro Kopf der Bevölkerung mehr aus, die wir ihnen durch „zu viele“ Steuern jetzt abluchsten, denn wir zahlten ja nicht nach unseren wahren Einnahmen, aber wir brauchten Sicherheit; mein Unternehmerrisiko musste abgedeckt werden.
Ich sah das nicht als Betrug oder Diebstahl am eigenen Volk an. Nein, das war eher Vorsorge für schlechte Zeiten. Und zum anderen wurde das Geld ja wieder re-investiert! Es floss ja wieder in Immobilien, zum Beispiel. Dass – vielleicht – dadurch die Mieten erhöht wurden und die Erträge wiederum uns, den Zusammengeschlossenen, zugutekamen, musste man dem Volk nicht „aufs Brot schmieren“. Weniger reden, mehr tun, das ist die Devise.
Diese menschlichen Zombies haben meist keine Ahnung von Geschichte, Wirtschaft, Gesundheit, Freiheit oder davon, wie politische Prozesse eigentlich ablaufen. Es interessiert sie auch nicht.
Leichte Unterhaltung, Krimi, Sex und natürlich Alkohol, Tabak, Drogen, das waren schon immer, und sind es mehr denn je, die Stimulanzien des „kleinen Mannes“ und seiner „kleinen Frau“. Und sollten sie doch einmal etwas anderes verlangen, was gegen unser Profitdenken gerichtet wäre, dann setzen wir gezielt unsere Machtmittel ein: Werbung und verängstigende Religion.
Wir sitzen immer am längeren Hebelarm.
Manipulation heißt daher die Parole!
Und nochmals das Wichtigste: niemals die Wahrheit.
Das Volk kann sie nicht vertragen, es wird nur noch gestörter und kann sowieso nichts damit anfangen. Nutzlos …
„Wahrheit auszusprechen nützt also nichts, meine Herren, weder dem Volk, das euch zujubelt, noch weniger euch!“, sage ich laut vor mich hin und blicke auf die Bilder im TV! „Gut so!“
Ich weiß, wahrlich nicht die Wahrheit verhalf diesen Männern und Frauen da zur Macht; nur die Verbreitung von eindeutigen Halbwahrheiten war der beste Garant für ein Verbleiben an der Macht.
Undurchsichtig muss man bleiben. Und diese Undurchsichtigkeit lässt sich am besten herstellen durch vieles und langes, möglichst unklares, verworrenes Reden. Das Volk hat nur eine begrenzte Auffassungsgabe und Aufnahmefähigkeit und kann daher nicht lange folgen. Kurze, prägnante Sätze sind immer gefährlich, weil zu verständlich und zu aussagekräftig. In diesen Fehler der Präzision durfte man nie verfallen. Gemeinplätze, Plattitüden, Ungereimtheiten, Schlagworte waren immer das Beste.
Ich weiß das.
Ich hatte es gelernt und praktizierte selbst dieses Verfahren – und mit was für einem Erfolg. Auch ich versteckte, sogar manchmal sehr bewusst, mein wahres Gesicht hinter dieser Maske, ertränkte es sogar in Whisky, gab ich ehrlich genug zu.
„… in dem islamischen Viertel der französischen Stadt eine Explosion. Ein Wohnhaus, in welches mehrere Zeitbomben eingeschmuggelt worden waren, wurde bis auf die Grundmauern zerstört. Acht Menschen kamen dabei ums Leben. Man nimmt an, dass Zugehörige zu der Polizei bekannten Untergrundorganisation der katholischen …“
Katholisch, protestantisch, islamisch, evangelisch – all diese religiösen Schlagworte. Alles Menschenwerk. Da ist nichts Geistiges, vielleicht sogar Religiöses, ja Göttliches … – nein.
Immer sind es Angehörige verschiedener Glaubensrichtungen, die aneinandergeraten. Experten versichern, in solchen Fällen gehe es in Wirklichkeit nicht um religiöse Auseinandersetzungen, sondern um ethnische, politische oder sogar wirtschaftliche. Aber warum wird dann im Namen der Religion getötet?
Ich hatte mich in meiner Studentenzeit zwar nur sporadisch mit diesen sogenannten religiösen Dingen befasst. Man muß ja mitreden können. Aber ich hatte sofort herausgefunden: Da ist gar nichts dahinter. Alles nur von Menschen ausgedacht, um es wiederum gezielt gegen des Menschen Angst anzuwenden. Wer Angst und Terror schürt – gewinnt.
Richtig verstanden gehört Religion eigentlich nicht mehr in unsere Zeit; passt nicht mehr ins 20. Jahrhundert, geht es mir durch den Kopf.
Ich bin nur froh, dass sich diese kleinhirnigen Fanatiker selbst dezimierten, dass sie sich selbst wie heißhungrige Wölfe aufeinanderstürzten und zerfleischten. Den Hass, den sie gebären, muss man am Leben erhalten, unterstützen, schüren und ihm zur weltweiten Ausbreitung verhelfen. Denn dieser Hass ist mein Profit! Globaler Terror heißt die Parole …
Natürlich würde ich dies nie offen zugeben und meinen Freunden gegenüber vertrete ich immer eine soziale, ja humane Richtung, aber im Innersten freute ich mich über jeden Toten, auf welcher Seite und wo auch immer auf der Welt. Denn jeder Schuss, getroffen oder nicht, half mir indirekt meinen Reichtum zu vermehren; und anderen Mittätern auch. „Friedens“-Globalisierung lässt grüßen …
Dutzende von Schiffsladungen, deklariert als Maschinenteile, habe ich schon im Auftrag von Mittelsmännern der Regierung in die sogenannten Krisenherde geliefert. Offiziell wusste ich persönlich natürlich nichts davon. Die entsprechenden Rechnungen wurden auf „Maschinenteile“ oder „technische Röhren“ ausgestellt. Was in den Kisten war, wusste ich oft selbst nicht.
Interessierte mich auch nicht. Meine Aufgabe war die Transaktion „in between“. Und das klappte.
Also was soll’s.
Und „vermittelte“ nicht ich, dann täte es bestimmt – und das mit Handkuss – ein anderer. Diese Geschäfte sind immer global.
Warum aber dem anderen ein Geschäft und noch dazu ein sehr einträgliches überlassen, wenn ich es doch auch tun konnte?
Hauptsache ist für mich: Ich bekomme Geld.
Von irgendetwas muss ich ja schließlich leben!
Und da ich nicht schlecht lebe, muss ich gestehen: Das Geld fließt!
Es kommt prompt.
Der offizielle Rechnungsbetrag für die ausgewiesenen „Maschinenteile“ wird an mich bezahlt und nur dieser, ein geringer Betrag im Verhältnis zur Gesamtsumme, erscheint auch auf der Rechnung.
Mein wirklicher Profit für mein Handling geht lautlos auf meine verschiedenen, legal eingerichteten Nummernkonti in den wichtigsten Steueroasen der Welt, vor jedem Zugriff staatlicher Behörden sicher.
Das heißt nun aber nicht, und keiner sollte das glauben, ich sei ein unredlicher Geschäftsmann, der nur mit undurchsichtigen Dingen handelt – nein.
Ich habe ja ein seriöses Handelsunternehmen, das muss immer wieder betont werden. Und wie gesagt, eine Stiftung für soziale Aufgaben habe ich auch.
Und glaube nur keiner, ich sei inhuman. Bestimmt nicht. Ganz im Gegenteil.
Ich gebe auch für das Rote Kreuz, spendiere bei jeder Sammlung, stehe bei jeder öffentlichen, gemeinnützigen Spendenaktion immer ganz oben auf der Liste. Nicht nur, damit es gesehen und vom Volk entsprechend honoriert wird, sondern auch im Interesse der Sammler und meinem eigenen natürlich. Denn gebe ich viel, so reizt das auch das Fußvolk, eben die mit dem sogenannten „weichen Herzen“, tiefer in ihre Geldbörse zu langen und mehr zu geben. Durch solche Spielereien kann man ja so viel mehr aus den Leuten herausholen.
Und da das notwendige Spendenmaterial (manchmal Fertighäuser, manchmal Decken, Zelte, Rohre für zu erstellende Wasserleitungen oder ganz einfach Nägel, Hammer und Zangen …) auch beschafft werden muss, kann ich durch mein Handelshaus, durch welches diese Einkäufe oft getätigt werden, bei einem größeren Betrag auch wieder mehr Profit machen.
Merkt man jetzt, um was es schließlich geht?
Deswegen sage ich: Sollen sich diese Schwachköpfe doch zerfleischen, sollen sie sich doch wie die Aasgeier benehmen und nur das Verwerfliche und Verweste, den Abfall fressen. Die süßen Früchte werden Menschen meines Schlages schon ernten.
Und um wirklich ehrlich zu sein: Auch vor Rauschgiftdeals würde ich – des Geldes wegen – nicht zurückschrecken. Sogar die „hohe Politik“ in westlichen Ländern mischt ja angeblich hier mit, wie man hört!
Moralische Skrupel …? Nein.
„Nur weiter so, meine Herren …!“, sage ich laut und lächle vor mich hin.
Zufrieden mit mir und der Welt trinke ich erneut mein Glas leer und schenke noch einmal nach. In einem Zug leere ich es wieder.
Ich spüre, wie mein Puls schneller geht und mir das Blut in den Kopf treibt.
Mir schwindelt leicht.
In letzter Zeit war das in kürzeren Abständen immer öfter vorgekommen. Auch musste ich mich öfter übergeben und aus meinem Mund kam manchmal sogar Blut. Mein Privatarzt, Chefarzt in der Universitätsklinik und ein guter Freund unserer Familie, bei dem ich kürzlich deswegen zu einer einfachen Untersuchung war, hatte mich zwar beruhigt und gesagt: „Im Moment sehe ich nichts Schlimmes, nur eine Schwächephase.“ Er wolle mich aber doch einmal gründlicher untersuchen, schlug er vor – aber ich bin nicht bereit. Wozu auch …?
Im Hinausgehen riet er mir aber etwas kürzerzutreten, mehr Arbeit zu delegieren und genug zu essen, da ich etwas Gewicht verloren habe.
Die körperliche Mattigkeit machte mir jedoch immer mehr zu schaffen. Und manchmal bekam ich fast Angstzustände, es könnte doch etwas Krankhaftes dahinterstecken.
Um nicht weiter in eine Depression zu verfallen, riss ich mich von diesen Gedanken los und verfolgte weiter die Nachrichten im Fernsehen.
Der Sprecher sagte gerade:
„… wünsche ich Ihnen einen geruhsamen Heiligen Abend.
Und recht schöne Weihnachtsfeiertage!
Bitte denken Sie daran, dass Sie vorsichtig fahren, sollten Sie noch heute oder in den kommenden Weihnachtstagen mit Ihrem Auto verreisen. Die Straßen sind stark vereist …“
Ich drücke auf den AUS-Knopf des Steuerkästchens und das Bild des Sprechers vor mir verlöscht.
„Heiliger Abend“, brumme ich, das Wortheiligspöttisch in die Länge ziehend.
Warum nennt man diesen Abend eigentlich „Heiliger Abend“?
Was war denn so heilig an diesem 24. Dezember?
Für mich war das fast ein Abend wie jeder andere auch!
Ein Festtag …
Der einzige Unterschied zu den anderen Tagen der Woche, oder sogar des Jahres, war doch nur, dass ich früher nach Hause ging. Nichts weiter. Alle taten das. Aber daran ist doch wirklich nichts Heiliges. Na ja, und dann gibt es an diesem Tag doch auch Geschenke, erinnerte ich mich.
Und noch eins: Ich hatte heute Geburtstag – hurra – und alles war organisiert … keine Aufregung! Und zudem freute ich mich trotz allem auf Ulrike …
Ich grüble jedoch weiter, komme aber zu keinem logischen Ergebnis. Noch nie, so scheint es, habe ich mich mit solchen Nichtigkeiten herumgeschlagen.
Warum eigentlich heute?
Endlich raffe ich mich auf, da mich die Frage nicht lockerlässt, gehe hinüber ins Studio und nehme den zweiten Band des Universallexikons aus dem Bücherregal. Ich suche, schlage dann die Seite 774 auf und lese: „HEILIGER ABEND, der Abend vor Weihnachten.“
Überrascht über diese einfache und kurze, fast nichtssagende Aussage stehe ich da und halte unschlüssig das Buch in den Händen.
In gewissem Sinne bin ich enttäuscht.
Eigentlich hatte ich mehr erwartet.
Aber was … ?
Was eigentlich …?
Ich weiß es nicht!
Doch eines weiß ich nun ganz genau, hier steht es schwarz auf weiß im Lexikon: Es ist ein ganz gewöhnlicher Abend, es ist einfach der Abend vor Weihnachten! Weiter nichts!
Und es ist mein Geburtstag – ich werde wieder ein Jahr älter …
Ich gehe zurück ins Wohnzimmer und genehmige mir nochmals einen Drink.
Als ich es mir im Sessel gerade wieder bequem mache, eine Zeitschrift aufschlage und anfange den Wirtschaftsteil zu lesen, klingelt das Telefon. Ohne von dem Bericht wegzuschauen, angele ich nach dem Hörer in meiner Nähe. Es wird Ulrike sein, denke ich.
„Hallo…“, sage ich mechanisch.
Am anderen Ende der Leitung meldet sich eine mir unbekannte Stimme. Oder nein – irgendwo hatte ich diese Stimme schon gehört; weich, melodisch, nicht fordernd, aber bestimmt.
Ich lasse das Magazin sinken und überlege.
Irgendwo war ich diesem Menschen schon begegnet.
Ohne noch weiter Zeit zu haben, abzuwägen, wer dieser männliche Anrufer sei, hat dieser sich vorgestellt und ich höre mich erwidern: „Oh ja, natürlich. Ich entsinne mich.“
Rhetorisch nichtssagend frage ich: „Wie geht es Ihnen?“
Der Anrufer erwidert mit höflicher, ruhiger Stimme.
Man spürt förmlich seine wohltuende Ausgeglichenheit, die sich in seiner Ausdrucksweise und im artikulierten, ausgewogenen Sprechen widerspiegelt.
Er trägt mir sein Anliegen vor.
Ich höre gespannt zu.
Nach einer Weile sage ich: „Nein, es tut mir leid, aber …“
Höflich, aber bestimmt unterbricht er mich.
„Nein, wirklich, ich würde recht gern, aber ich habe für heute Abend schon etwas vor – eine Einladung. Sehen Sie, ich kann leider nicht“, versuche ich mich seinem Drängen zu entziehen.
Wieder – und diesmal fast leidenschaftlich – unternimmt er alles, mich umzustimmen.
Er redet – ich höre – bin uninteressiert.
Eine ganze Weile erwidere ich nichts; höre ihm nur zu.
Dann braut sich in mir ein leichter Groll zusammen.
Zu gern hätte ich jetzt den Hörer einfach auf die Gabel zurückgelegt und so das etwas einseitige Gedränge beendet. Aber ich kann nicht, irgendetwas – vielleicht irgendwer – hält mich davon ab, ihm so vor den Kopf zu stoßen. Denn er spricht höflich, gewandt, selbstsicher, mit – wie ich meine – einem inneren Engagement. Er redet so, wie er es meint: offen, bestimmt, ehrlich, das fühle ich.
Wieder spricht er auf mich ein.
„Doch, doch … Ich würde Sie natürlich gern besuchen, sehr gern sogar“, erwidere ich jetzt heuchlerisch.
Wieder steigt dieses leichte Schwindelgefühl von vorhin in mir auf.
Ich greife nach dem Whiskyglas und stürze den Rest Alkohol in mich hinein.
Ich will das Gespräch nun einfach so schnell wie möglich beenden und sage daher barsch: „…aber ich sagte Ihnen ja schon: Ich bin verabredet und habe heute wirklich keine Zeit. Vielleicht später, zu einem anderen Zeitpunkt einmal. Heute nicht!“
Aber noch einmal versucht es mein Gegenüber.
Er lässt nicht locker.
Noch einmal setzt er seine Überredungskunst ein.
Schroff falle ich ihm nun ins Wort und erkläre: „Bitte, es geht nicht. Verstehen Sie mich doch!“
Fast zornig setze ich nach: „… und überhaupt, wer gibt Ihnen eigentlich das Recht, sich in mein Privatleben einzumischen?
Und wer gibt Ihnen das Recht, mich so zu drängen?
Ich sage Ihnen: Wenn ich will, dann will ich; wenn ich nicht will, dann will ich nicht!“
Er erwidert bestimmt – und ich erschrecke leicht. Warum?
Fahre aber dann trotzdem fort: „Haben Sie vielen Dank für Ihren Anruf.
Auf Wiedersehen!“
Ärgerlich über diese – wie ich meine – unverschämte Aufdringlichkeit, schmeiße ich den Hörer zurück auf den Apparat, ohne auf eine weitere Erwiderung seinerseits zu warten. Mochte er von mir denken, was er wollte.
Ich nehme, innerlich stark erregt, meine Fachzeitschrift wieder auf und versuche den angefangenen Artikel zu Ende zu lesen. Aber ich muss mich sehr konzentrieren, denn immer wieder denke ich an das soeben geführte Telefongespräch. Als ich fertig bin, frage ich mich, was ich denn nun gelesen habe, und muss feststellen, dass nichts geblieben ist. Alles ist wie verflogen. Ich weiß nichts mehr, denn ich hatte während des Lesens mehr an diesen seltsamen Menschen und an seine Worte gedacht als an die Aussagen dieses Fachartikels.
Was hatte er gewollt?
Nun, höflich-bestimmt hatte er mich gebeten – das musste ich ihm nachsagen –, gebeten, … eingeladen, … den Heiligen Abend – nur für eine kurze Zeit – bei ihm zu verbringen. Mit anderen zusammen, hatte er gesagt und mir sogar seine Adresse gegeben. Und er wolle mir etwas sagen. Vertraulich. Was wohl? –
Ich kannte diese Gegend; ein Industrie- und Arbeiterviertel.
Eigentlich kein Aufenthaltsort für mich.
Und doch, schließlich war ja nichts dabei. Er hatte es halt versucht und ich habe ihm – klipp und klar – abgesagt.
Aber warum hatte er mich nur angerufen – warum gerade mich?
Und was hatte er mir da angedeutet?
Ein leichter Schauer glitt mir den Rücken hinunter.
Ich verdrängte seine, mir noch immer in den Ohren nachklingende, Antwort und überlegte weiter.
Schön, er hatte mir zwar erklärt, warum, … doch was steckte wirklich dahinter?
Was wollte er wirklich von mir?
Je mehr ich mir darüber Gedanken machte, desto neugieriger wurde ich aber auch.
Was war er eigentlich für ein Mensch?
Ich hatte ihn ein paar Mal gesehen.
Wo war das überhaupt gewesen?
Hatten wir uns damals überhaupt unterhalten?
Ich wusste es nicht mehr.
Sicherlich hatten wir kurz ein paar Worte miteinander gewechselt.
Ich entsann mich jetzt: Er war nicht der Typ, der sofort auf mich ansprach. Er war eher ein unscheinbarer Mensch. Herzlich vielleicht?
Aber nicht der Kumpel, mit dem man Pferde stehlen konnte.
Er war eher reserviert, fast kalt – vielleicht aber war das fromm.
Schließlich wollte er ja Pfarrer werden. Und war es nun wahrscheinlich auch geworden.
Ja, … jetzt entsann ich mich.
Den ersten Kontakt hatten wir von der Universität her.
Natürlich, erinnerte ich mich jetzt, der „strebsame Pfaff“, wie ich ihn damals nannte.
Wir wohnten sogar ein paar Wochen im gleichen Haus, aber begegneten uns kaum. Er in einem Zimmer im renovierten Keller und ich damals in der Studentenbude unter dem Dach.
Ach ja, und dann der Disput im Auditorium der Uni.
Ich hatte mich sehr gut vorbereitet …
Er hatte sich damals ganz schön wehren müssen …
Ich musste lachen.
Ein überspitzter Frömmler – genau!
Ich zog dann bald aus – und ich hatte ihn ganz aus den Augen verloren.
Keinen Kontakt mehr. Wozu auch.
Meine Freunde waren aus anderem Holz geschnitzt.
Aber dann – nach einigen Jahren war er plötzlich wieder da.
Ja, ich entsann mich jetzt genau. Es war vor einigen Wochen gewesen. Er hatte mich einfach auf der Straße angehalten, sich mir in den Weg gestellt und mich angeredet. Nein, auch damals nicht frech, aufdringlich oder überheblich – ganz bestimmt nicht. Er war einfach nett, zuvorkommend – aber bestimmt. Schon damals war mir seine direkte, fast gebietende Art aufgefallen.
Schon damals, ich erinnere mich gar nicht mehr, was er wollte, hatte ich ihm eine Absage erteilt. Ich hatte ihm auf der Straße auch meine Meinung gesagt und ihn dann stehen gelassen.
Beim Weggehen jedoch hatte ich bemerkt, dass er fast traurig seinen Blick gesenkt und auf die Erde geblickt hatte. Das Gesicht kam mir irgendwie wieder sehr bekannt vor. Dabei strahlte er aber in seiner Niedergeschlagenheit noch eine seltsame Fröhlichkeit –, nein, besser – Harmonie aus, eine Gewissheit, die ich mir damals schon nicht erklären konnte.
Ich weiß noch …, ja, natürlich …
Ich muss plötzlich lachen, als mir der Gedanke wieder in Erinnerung kommt: Ja, ich hatte ihm noch, mehr aus Spaß, vielleicht auch ein wenig aus Überheblichkeit, aus einem Distanzbewusstsein heraus, meine Visitenkarte gegeben.
„Vielleicht sehen wir uns bei einer anderen Gelegenheit wieder“, hatte ich floskelhaft bemerkt.
Er hatte sich bedankt und gesagt: „Ich kenne Sie …!“
Mir war das egal – mich kannten viele.
Hatte er sich das nun wirklich gemerkt und wollte er nun eine „Gelegenheit“ konstruieren, also bewusst herbeiführen, um mich wieder zu treffen?
Aber warum?
Warum ließ er mich nicht in Ruhe?
Warum verfolgte er mich regelrecht?
Ich fand keine plausible Antwort!
Oder wusste er etwas, und wenn ja, was?
Was wusste er?
Suchte er deswegen meinen Kontakt?
Ich schaue auf die Uhr.
Wo, sagte er, wohnt er?
Und was wollte er?
Irgendwie werde ich unruhig. Wieder fängt es an, sich in meinem Kopf zu drehen. Nochmals nehme ich einen kräftigen Schluck. Jetzt aus der fast geleerten Flasche.
Das einseitige Gespräch hatte mich getroffen, sogar sehr stark berührt.
Äußerlich betrachtet hätte man mir meine Zerfahrenheit und Aufgewühltheit nicht angesehen; aber innerlich machte sich immer mehr eine Zerrissenheit bemerkbar. Ich war komplett aus dem Lot geraten.
Denn ich konnte es nun einmal nicht leiden, wenn andere Menschen Macht auf mich ausübten, nicht den geringsten Druck konnte ich vertragen.
Ich war frei und ich brauchte niemanden zu fürchten.
Und doch: Angst überschattete jetzt meine gespielte Selbstsicherheit.
Im Grunde genommen aber bewunderte ich diesen Menschen. Warum?
Ich konnte es mir nicht erklären, warum, aber ich war irgendwie eingenommen von seiner Art. Unbewusst spürte ich, dass er etwas besaß, was ich nicht hatte.
Aber was war es?
Was unterschied uns; mich von ihm, ihn von mir?
Oder waren wir gar nicht so verschieden, denn auch ich konnte hart, ja engstirnig, stur sein, um mich durchzusetzen. Auch musste man seinen Untergebenen immer Druck aufsetzen, so wie man sich selbst unter Druck setzte, damit man erfolgreich war und blieb.
Was wusste er aber mehr als ich und was wollte er mir vertraulich mitteilen?
Ich schenke noch einen Whisky nach und sinne vor mich hin.
Dann, fast mechanisch, geführt wie von unsichtbarer Hand, gehe ich hinüber ins Schlafzimmer, hole meine Jacke aus dem Schrank, ziehe auch den Mantel in der Garderobe wieder über, verlasse die Wohnung und fahre hinunter in die Tiefgarage.
Die Box, in der mein Sportwagen steht, ist nur ein paar Schritte vom Lift entfernt. Ich öffne die Wagentür und steige ein, lasse den Motor an und fahre in das dichte Schneetreiben und auf die eisige und schneebedeckte Straße hinaus.
Dunkel ist es mittlerweile geworden. Schwer fallen noch immer die dicken Schneeflocken aus der Nacht. Sie sind so groß und fallen so dicht, dass der Scheibenwischer Mühe hat, die Sicht durch die Frontscheiben freizulegen. Im Nu ist der Wagen mit einer dicken Schneeschicht bedeckt, das Innere kalt. Mich fröstelt.
Mehr als fußhoch liegen die weißen Flocken auf der Straße und decken die unsichtbar darunterliegende Eisschicht ab.
Nur mit großer Mühe kann ich den leichten Wagen in einer ausgefahrenen Spur halten.
Wie benommen fahre ich die abschüssige Straße hinunter.
Ich überlege nicht, was ich zu tun habe; alles zum Autofahren Notwendige, tue ich automatisch, mechanisch, ohne nachzudenken – wie in Trance.
Ich weiß jetzt, wo ich hinwill.
Ja, ich weiß jetzt, wo ich hinmuss: zu ihm!
Ich will wissen, was er von mir weiß – ich will jetzt wissen, warum er mich angesprochen und heute angerufen hat.
Ich will wissen …
Ich spüre nicht, wie schnell ich fahre.
Erst als der Wagen in einer Kurve schlittert, nehme ich ein wenig den Fuß vom Gaspedal. Ich steuere automatisch dagegen.
Als ich ihn wieder aufgefangen habe und in die Fahrrinne zurückrutsche, gebe ich schnell wieder Gas.
Ich fahre wie narkotisiert. Unbewusst.
Bin in Gedanken nur bei ihm.
Immer wieder geht mir das Telefongespräch im Kopf herum.
Was weiß und was will dieser Mann von mir?
Das sind die beiden Fragen, die mich bewegen.
Die Tachonadel steigt wieder auf sechzig, dann fünfundsechzig.
Ich werde ihn fragen, werde ihn zur Rede stellen!
Die dicken, wasserschweren Schneeflocken klatschen gegen die Windschutzscheibe.
Die Sicht wird immer schlechter.
Ich werde ihn bitten, mir zu sagen, was er weiß und …
Bitten … – bitten?
Bin ich verrückt, durchfährt es mich plötzlich, warum bitten?
Doch …
Ich werde ihn bitten, mich in Ruhe zu lassen … in Ruhe lassen …
Aber er hat mir ja gar nichts getan …
Die Tachonadel steigt weiter auf 70 km/h.
Nein, ich werde ihn nicht bitten – befehlen werde ich ihm!
Befehlen …
Solche frommen Typen wie er laufen genug in der Gegend umher.
Die sollen sich alle zuerst um sich selbst kümmern, ehe sie andere Leute belästigen.
Die wenigen, mir behutsam entgegenkommenden Autos sehe ich nicht.
Schneller und immer schneller durchquere ich die Stadt. Mein Auto spurt sich mit Mühe einen Weg.
Was fällt ihm überhaupt ein?
Ich werde ihm schon zeigen, wer ich bin!
Ich werde diesem Pfäffchen schon Respekt beibringen.
Wie von Geisterhand gepeitscht, jage ich zielsicher durch die verschneiten Straßen der Stadt, dem Arbeiterquartier zu, am anderen Ende.
Ich sehe nichts mehr, höre nichts mehr.
Eine unbändige Wut hat sich nun meiner bemächtigt und ist dem zarten Anflug von Nachgiebigkeit und Verstehen gewichen.
Ich rase, ich koche innerlich.
Wieder steigt dieser Schwindelanfall in mir auf.
Wie ein aufgestochenes Krebsgeschwür, das Metastasen in jeder noch so entlegenen Nische bildet, so durchflutet nun Zorn meinen Körper.
Hass auf diesen Menschen flammt in mir auf.
Umbringen werde ich ihn …
PLÖTZLICH leuchtet eine Ampel vor mir auf.
ROT …
Ich versuche zu bremsen.
Die Räder blockieren und rutschen unkontrolliert über das Eis.
Etwas SCHWARZES taucht vor mir auf.
Wie wild reiße ich das Steuerrad herum.
UMSONST …
Der Wagen dreht sich, kippt.
In Sekundenschnelle tritt mir der kalte Angstschweiß auf die Stirn.
„NEIN,… MEIN GOTT …“, höre ich mich aufschreien …
2 Zu spät …
Müde geht Chefarzt Dr. Wenger den Abteilungsgang entlang. Er hat einen anstrengenden, arbeitsreichen Tag hinter sich gebracht. Lange waren er und sein Team im Institut zusammengesessen. Sie hatten in der Zwillingsforschung einen interessanten Fall durchdiskutiert, aber leider kein Ergebnis erreicht, das sie in ihren wissenschaftlichen Studien weitergebracht hätte.
Man wusste z. B. heute, und das konnte man überall auch in den populärwissenschaftlichen Veröffentlichungen nachlesen, dass die häufigste Form von Zwillingen aus den dizygoten besteht. Das war die erste Art. Und man rechnete heute, dass auf tausend Geburten etwa sieben bis elf Zwillinge kommen; man nennt diese auch „Geschwisterzwillinge“ oder „falsche Zwillinge“. Denn diese Zwillinge stammen von zwei verschiedenen Oozyten, daher auch Di-Zygoten, also von zwei weiblichen Eiern, welche während des gleichen Menstruationszyklus gereift sind. Sie werden auch durch zwei verschiedene Spermien befruchtet. Mit anderen Worten sind die beiden mit der Befruchtung entstandenen Zygoten genetisch so verschieden, wie es auch zwei normale Geschwister sind. Die dizygoten Zwillinge können daher gleich- oder auch gegengeschlechtlich sein.
Die zweite Art von Zwillingen jedoch, die aus einer einzigen Oozyte (Ei) stammen, nennt man monozygote Zwillinge oder „echte Zwillinge“. Die Häufigkeit solcher Zwillinge beträgt drei bis vier auf tausend Geburten und sie resultieren aus der Teilung der Blastomere in verschiedenen Stadien der fetalen Entwicklung.
Schließlich, in seltenen Fällen, kann die Aufteilung auch im Stadium des zweischichtigen Embryos stattfinden. Diese Art der Trennung führt für die beiden Zwillinge zu einer gemeinsamen Plazenta (Mutter- oder Fruchtkuchen), einem einzigen Chorion (die äußere Schicht der Fruchthülle) und einer gemeinsamen Amnionhöhle, welche die innerste dünne, gefäßlose Eihaut darstellt. Beide Zwillinge sind von einer Fruchtblase umgeben und „schwimmen“ im gleichen Fruchtwasser.
Obwohl nur eine Plazenta vorhanden ist, ist die Blutversorgung der beiden Zwillinge in der Regel gut ausgeglichen. Trotzdem wird manchmal wegen großer Anastomosen, d. h. der ungleichen Verbindung zwischen den zwei anatomischen Körpern, einer der Feten bevorzugt durchblutet, wodurch z. T. Größenunterschiede oder sogar körperliche Beeinträchtigungen erklärt werden können.
Dabei bilden ausschließlich Blutgefäße mit Blutgefäßen, ebenso Lymphgefäße mit Lymphgefäßen und Nerven mit Nerven untereinander Anastomosen. Ungleiche Verbindungen zwischen Arterien sorgen bei einem Ausfall eines Gefäßes für einen Umgehungskreislauf, sodass es nicht zur Abtötung von Gewebe kommt. Arteriovenöse Verbindungen sind für die Regulation der Durchblutung von embryonalen Körpern von großer Bedeutung. Denn Blut ist Leben …
Diesem wichtigen Problem wollte man wissenschaftlich weiter auf die Spur kommen, um das Leben der Schwangeren und der Embryos nicht zu gefährden.
Dr. Wenger kann sich kaum von dieser Angelegenheit trennen. Immer wieder versetzt er sich in die Situation der beiden heranwachsenden Embryos und sieht sie quasi vor sich, vor seinem inneren Auge wachsen. Einer auf Kosten des anderen – und umgekehrt!
Etwas enttäuscht, dass man nicht so recht weitergekommen ist, schickt er sich aber nun doch an, den Heiligen Abend mit seiner Familie zusammen feiern zu können. Seine beiden verheirateten Kinder werden kommen, mit ihren Kindern, und so dem Fest einen feierlichen Anstrich verleihen.
Kinder hat er schon immer gerne gemocht; und gerade der Heilige Abend kann seiner Meinung nach nur im Beisein von Kindern festlich gestaltet werden.
Geht es nicht um das Kind in der Grippe?
Er freut sich jetzt auf diesen Abend und beschwingt biegt er in den Ärztetrakt ein, wo die Büros liegen.
Im Gehen knöpft er seinen Kittel auf, und als er vor der Tür seines Büros angelangt ist, hat er ihn schon ausgezogen. Er hat genug für heute und beeilt sich so schnell wie möglich aus dem Krankenhaus zu kommen.
Er betritt das Zimmer, geht zu seinem Schreibtisch, notiert ein paar Erkenntnisse, macht eine knappe Eintragung in einer Krankengeschichte, blättert ein paar andere durch und schiebt sie dann entschlossen zur Seite. Nein, heute will er keine einzige mit nach Hause nehmen.
Morgen ist auch wieder ein Tag. Er reißt sich von allem los.
Schnell geht er daher zum Schrank, hängt seinen Arztkittel hinein, zieht seine Jacke und seinen Mantel über und schickt sich an das Büro zu verlassen.
Als er die Tür schließen will, klingelt das Telefon auf seinem Schreibtisch.
Er zögert …
Aber obwohl er abgearbeitet ist und am liebsten gehen würde, siegt sein Pflichtbewusstsein. Er geht zurück und nimmt den Hörer auf.
„Ja?“, sagt er fragend, dann fügt er bei: „Dr. Wenger.“
Er wartet und horcht.
„Wo …?“
„Wie ist es passiert?“
„Was …?
„Unterbesetzt. – Ja, ich habe Zeit … – Es interessiert mich …“
Wieder hellwach und konzentriert nimmt er die Nachricht entgegen und bestätigt:
„Ich gehe in die Notaufnahme …“
„Ich komme … – OP 2, gut!“
Er seufzt tief, dann entledigt er sich seines Mantels und seiner Jacke. Beides wirft er über die Stuhllehne. Dann eilt er hinüber zu seinem Schrank, holt wieder seinen weißen Arztkittel hervor und zieht diesen im Hinausgehen über.
In langen Schritten durchquert er die endlos scheinenden Gänge und gelangt zur Notaufnahmehalle. Schwester Erika ist auch schon anwesend. Er begrüßt sie mit leichtem Kopfnicken.
„Sie sind noch nicht da …“, sagt Schwester Erika und Dr. Wenger ergänzt: „…bei dem Schneetreiben und den Straßenverhältnissen erklärlich …“
Dann fasst er in die Tasche und zieht eine Zigarette heraus, die er anzündet.
Er raucht nervös und verhalten.
Flüchtig streifen seine Augen Schwester Erika, die ihm gegenüber an der Wand steht. Sie warten.
Er schaut hinaus auf den weißen Hof. Dicke tanzende Schneeflocken vor dem Fenster verleiten ihn zum Grübeln.
Warum gerade heute?, denkt er sich.
Warum konnten gerade am Heiligen Abend solche Unfälle nicht unterbleiben?
Nun, das ist eben des Menschen Lauf!
Schicksal …
Er war schon mit vielen sogenannten Menschenschicksalen zusammengekommen während seines langen, nun bald zu Ende gehenden Berufslebens.
Mit wie viel Leid, Not und Tränen war er nicht schon konfrontiert worden.
Aber er liebte seinen Beruf, vielleicht gerade deshalb.
Denn nicht das Negative, die unzähligen Überstunden, die harte medizinische Arbeit, der Kampf um Leben und Tod, sondern das Helfende, Aufbauende, eben das Positive sah er in seiner Berufung als Arzt.
Ob es wohl einen Zufall gibt – oder steckt dahinter sogar doch eine Art Vorsehung?
Vorhersehung …
Er hatte sich diese Frage schon oft gestellt, war aber bisher noch zu keinem – für ihn – befriedigenden Ergebnis gekommen.
Vielleicht hängt das mit dem Glauben zusammen?
Aber was heißt denn schon glauben?
Was und vor allem wem sollte man denn glauben?
Und konnte man als aufgeklärter Mensch und ausgebildeter Akademiker eigentlich heute noch glauben? Noch dazu als Mediziner?
War das noch zeitgemäß, an einen Schöpfergott zu glauben?
Und dann gab es ja so viele Glaubensrichtungen!
Da waren einmal die sogenannten offiziellen: der Katholizismus, der Protestantismus oder die Evangelischen. Schon hier gab es Unterscheidungen: nach Lutheranern, Zwinglianern, Calvinisten; aber auch bei den Katholiken gab es Orthodoxe und andere Gruppen in den verschiedensten Ländern.
Das waren die größten Institutionen in unserer westlichen Hemisphäre.
Dann waren da noch die Inoffiziellen, die, welche sich von den Staatskirchen abgespalten hatten: Heilsarmee, Pfingstler, Neuapostolische, Brüdervereine, Zeugen Jehovas, Urchristen usw., usw.
Das waren Vereine, von denen wirklich eine große moralische Tragkraft ausging. In diesen Gruppen waren kaum reine Mitläufer zu finden, wie bei den Staatlichen, den Offiziellen, sondern hier gab es überzeugte, manchmal sogar recht engstirnige, zum Teil sogar weltabgewandte Mitmenschen, welche sich päpstlicher gaben oder sein wollten als der Papst bzw. christlicher, als Christus selbst je gewesen war.
Doch sie waren gehorsam, still, respektierten als Glaubensgrundlage nur die Bibel und waren wirkliche Beter.
Und die sollten jetzt die Wahrheit besitzen?
Aber wie sah es dann mit den anderen Weltreligionen aus?
Dem Buddhismus, dem Taoismus, dem Shintoismus u. v. a. m., welche immer stärker und stärker hervortraten.
Und welchen Stellenwert hatte heute das Judentum?
Und der Islam?
Fragen über Fragen …
Und wo war die richtige Antwort?
UnddieWahrheit, welche jede Religion für sich als allein selig machende beanspruchte?
Was Dr. Wenger betraf, so hatte er sein ganzes Leben den Menschen an sich, das Individuum, immer sehr genau beobachtet. Und er hatte, gerade wegen der ansehnlichen Zahl von religiösen Gruppen, Vereinen und staatlichen Institutionen, in denen sich der einzelne Mensch jeweils bewegte, nach wirklich markanten, sofort ins Auge fallenden Unterschieden und Merkmalen gesucht.
Durch seine beruflichen Kontakte zu Fachkollegen in anderen Ländern, seinen medizinischen Erfahrungen auf anderen Erdteilen, in anderen Kulturkreisen, hatte er auch die Gelegenheit bekommen, sogar in verschiedene menschliche Arten und Rassen hineinzuschauen.
Festgestellt hatte er nur das eine: Es gibt keine menschlichen Unterschiede, sondern im Gegenteil, es gibt eine menschliche Urübereinstimmung, wie er es nannte.
Er besaß in diesem Punkt eine volle Gewissheit: Ein für uns unsichtbares seelisches Band umschließt die gesamte Menschheit!
Jäh wird er aus seinen Gedanken aufgeschreckt.
Aus der Ferne hört man das TATÜTATA, welches sich schnell nähert.
„Bitte, Schwester, öffnen Sie die Türen!“, sagt er, tritt hinzu und hilft selbst mit, die beiden Flügeltüren auseinanderzuschieben.
Nach ein paar Sekunden biegt der Krankenwagen, nur noch das Blaulicht in Betrieb, das ein gespenstisches, aber rhythmisches Blinken verstreut, in den Hof und hält mit quietschenden Bremsen in der Vorhalle der Notaufnahmestation.
Ein Haufen verfestigten Schnees löst sich vom Inneren des vorderen Kotflügels und fällt pflatschend auf die blanken Steinfliesen.
Der Notarzt, der sich während der Fahrt um den Verunglückten gekümmert hatte, öffnet jetzt die hinteren Wagentüren und schiebt die Bahre, auf welcher ein Mann, tief in Decken gehüllt, liegt, hinaus.
Dr. Wenger, der sofort hinzutritt, blickt in ein aschgraues, blutleeres, fahles, zwar wohlgenährtes, aber eingefallenes Gesicht. Die Augen sind geschlossen. Ein Alkoholduft schwebt ihm entgegen.
Er schreckt zurück.
Dr. Wenger kennt diesen Mann. Zwar nicht sehr gut.
Aber sein Herz schlägt schneller.
Werde nicht sentimental, sagt er sich.
Jetzt ist nur eines gefragt: Hilfe.
Schnell hat er sich wieder in der Gewalt.
Aus einer kleinen Platzwunde über dem linken Auge dringt, jetzt wieder stark pulsierend, dunkles Blut, welches der Notarzt wegtupft.
Mechanisch greift Dr. Wenger mit der rechten Hand nach dem Puls des vor ihm Liegenden und mit dem Daumen der linken Hand schiebt er den rechten Augendeckel hinauf.
Kalt, matt und starr, ohne jeglichen Reflex, sieht ihm das Auge entgegen.
Der Puls selbst ist nur noch sehr schwach und kaum zu fassen.
„Machen Sie bitte den Mann zur Untersuchung fertig. Dann in den OP 2 – dort wartet Dr. Hell“, befielt Dr. Wenger.
„… und bereiten Sie eine Herzspritze vor. … entnehmen Sie auch gleich Blut und stellen Sie die entsprechenden Blutkonserven und Kochsalzlösungen zurecht.“
Im Laufen, zwischen sich die rollende Bahre mit dem bewusstlosen Körper, sieht Schwester Erika den Arzt an und nickt.
Sie wusste genau, was in solch einer Situation zu tun war. Ein halbes Leben hatte sie schon in Krankenhäusern verbracht.
Ihr Pflegeberuf machte ihr Spaß und gerade die Zusammenarbeit, wenn es sich ergab, mit Dr. Wenger war ihr ein Vergnügen.
Er war nie ausfallend, sehr beherrscht und in seiner Arbeit korrekt.
Seine Anweisungen kamen präzis.
Er wusste, was er wollte.
Und auch er wusste, was er an Schwester Erika hatte, wenn es sich ergab und sie zusammenarbeiten mussten. Denn im Grunde genommen hätte er gar nichts zu sagen brauchen. Schwester Erika kannte jeden Handgriff genau.
Sie waren beide auf ihrem Gebiet seit einigen Jahren ein eingespieltes Team im Kampf gegen Schmerzen, Leid und Tod.
Der „Verkehrsunfall“ liegt nun auf dem Operationstisch.
Man hatte ihn entkleidet. Schlank und wohlgestaltet liegt der Körper auf dem Tisch in der Mitte des Raumes, von einer überdimensionalen Lampe über ihm schattenfrei angestrahlt.
Durch eine Sauerstoffmaske, die ihm auf die Nase gedrückt wird, versucht Dr. Hell, dem Leblosen in kräftigen Stößen das lebensspendende „Nichts“ zu vermitteln.
Dessen linker Arm ist gebrochen und liegt eng an seinem Körper an.
Knochenteile drängen nach außen.
Sein rechtes Bein zeigt äußerlich Quetschungen.
Auch Rippen scheinen in Mitleidenschaft gezogen worden zu sein.
Innere Verletzungen also gut möglich.
Dr. Wenger beugt sich über den braun gebrannten Körper und gibt ihm nun die von der Schwester vorbereitete, kreislaufanregende Spritze direkt ins Herz. Der Defibrillator ist in Griffnähe, einsatzbereit.
Systematisch beginnt er darauf die Diagnostizierung des reglosen, zum Sterben verurteilten Menschen.
Dr. Wenger spürt es instinktiv, aber er gibt nicht auf.
Schwester Erika wird hinausgerufen und kommt nach einigen Sekunden wieder in den OP zurück.
Die beiden Ärzte bemühen sich noch immer um den Verunfallten. Man hat ihm jetzt auch eine Bluttransfusion gesteckt, da man noch nicht weiß, ob ein innerer Blutverlust vorliegt.
„Dr. Wenger, der zweite in den Unfall verwickelte Autofahrer ist an der Unfallstelle verstorben …“, flüstert, fast scheu, Schwester Erika Dr. Wenger zu, ohne ihn von seiner Arbeit abzuhalten.
Er nickt nur.
Ruhig arbeitet er weiter. Was in seiner Macht und seinem Können steht, will er tun! Alles musste versucht werden, um gerade diesen Menschen zu retten.





























