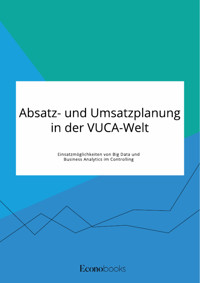
Absatz- und Umsatzplanung in der VUCA-Welt. Einsatzmöglichkeiten von Big Data und Business Analytics im Controlling E-Book
36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EconoBooks
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Im Zeitalter der Digitalisierung sind Unternehmen mit immer komplexer werdenden Entscheidungssituationen, intensiviertem Wettbewerb und wachsender Unsicherheit konfrontiert. In diesem Zusammenhang spricht man von einer VUCA-Welt. Besonders das Controlling steht vor erheblichen neuen Herausforderungen. Welche Vor- und Nachteile bringen Big Data und Business Analytics bei der Planung? Welche Einsatzmöglichkeiten gibt es und was sind die Voraussetzungen für diesen Einsatz? Der Autor untersucht die Potentiale von Big Data und Business Analytics für den Bereich der Absatz- und Umsatzplanung in Unternehmen. Er beschreibt, welche Anpassungen das Controlling vornehmen muss, um die neuen Methoden erfolgreich umzusetzen, warnt aber auch vor den Risiken. Aus dem Inhalt: - Volatilität; - Absatzprognosen; - Unternehmensperformance; - Forecasts; - Planungsaufwand
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 114
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Ausgangspunkt und Problemstellung
1.2 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit
2 Planung
2.1 Die besondere Rolle der Absatzplanung
2.2 Absatz-/Umsatzplanung
2.3 Kritik an der traditionellen Planung
3 Bedeutung der VUCA-Welt
4 Big Data
5 Business Analytics
5.1 Entwicklungsstufen von Business Analytics
5.2 Abgrenzung Business Analytics von Business Intelligence
5.3 Relevante Analysemethoden
5.3.1 Strukturprüfende Analysemethoden
5.3.2 Strukturentdeckende Analysemethoden
6 Einsatzmöglichkeiten und Praxisbeispiele des Einsatzes von Business Analytics in der Absatz-/Umsatzplanung
7 Voraussetzungen und mögliche Barrieren für den Einsatz von Business Analytics
8 Bewertung des Einsatzes von Business Analytics in der Absatz-/Umsatzplanung
9 Fazit
9.1 Zusammenfassung
9.2 Ausblick
Literaturverzeichnis
Einzelwerke
Sammelwerke
Zeitschriften und Magazine
Elektronische Quellen
Abkürzungsverzeichnis
BARC Business Application Research Center
bzw. beziehungsweise
ca. circa
CE Center of Excellence
CFO Chief Financial Officer
d.h. das heißt
DSGVO Datenschutzgrundverordnung
ebd. ebenda
etc. et cetera
EU Europäische Union
sog. sogenannte
STAR Statistical Tracking and Assessment of Revenue
VUCA Volatilität Unsicherheit Komplexität Ambiguität
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Big Data Eigenschaften & Nutzen
Abbildung 2: Business Analytics Entwicklungsstufen mit Beispiel
Abbildung 3: Einsatzgebiete Business Intelligence vs. Business Analytics
Abbildung 4: Übersicht strukturprüfende Analysemethoden
Abbildung 5: Übersicht strukturentdeckende Analysemethoden
Abbildung 6: Traditioneller Forecast vs. Predictive Forecast
Abbildung 7: Vergleich Absatzprognose und tatsächliche Verkäufe
Abbildung 8: Verhältnis zwischen Controller, Data Scientist und Manager
Abbildung 9: Zentrale Organisationsformen von Business Analytics
Abbildung 10: Darstellung Center of Excellence
Abbildung 11: Kriterien zur Bewertung
1 Einleitung
1.1 Ausgangspunkt und Problemstellung
Die Digitalisierung ist von einem Megatrend zu einer Realität geworden, die Unternehmen heute vor große Herausforderungen stellt. Die digitale Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft ist in vollem Gange. Disruptive Technologien führen zu innovativen Geschäftsmodellen. Daten wird der Status des „wichtigsten Rohstoffs“ zugesprochen und alle Informationen werden miteinander vernetzt. Hierdurch ergeben sich in allen Bereichen eines Unternehmens sowohl Chancen als auch Risiken.[1] Die Tendenz der digitalen Transformation ist dabei klar: Weniger Mensch, dafür mehr Maschine. Auch der Controlling-Bereich wird dadurch einen Wandel erleben.[2] Das Zeitalter der vierten industriellen Revolution ist angebrochen.[3] Die Welt, in der wir heute leben, wird immer volatiler und vieles verändert sich mit einer rasanten Geschwindigkeit. Unternehmen sind konfrontiert mit immer komplexer werdenden Entscheidungssituationen, wettbewerbsintensiveren Marktsituationen und einer wachsenden Unsicherheit.[4] In diesem Zusammenhang wird von einer VUCA-Welt gesprochen. [5] Dieses Akronym steht hierbei für Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität. Es bezieht sich dabei auf die Umwelt, in der Unternehmen heute agieren.[6] Dies stellt vor allem das Management und das Controlling, im Rahmen ihrer Planung, vor erhebliche Herausforderungen. Durch die Veränderungen der unternehmerischen Umwelt ist auch im Controlling ein Umdenken gefragt. Die im Planungsprozess häufig etablierten und festgefahrenen Strukturen und Prozesse müssen aufgebrochen werden, um mit dem rasenden Tempo und der Dynamik der Umwelt mithalten zu können.[7] Die Digitalisierung ist einer der wesentlichen Treiber weshalb Unternehmen heute dieser erhöhten Dynamik, Komplexität und Unsicherheit ausgesetzt sind. Allerdings liefert sie zugleich auch neue Instrumente, mit der die Planungs- und Steuerungsaufgaben wahrgenommen werden können. Da Informationen die Basis für die Steuerung darstellen, ist hier vor allem Big Data zu nennen. Big Data liefert den Grundbaustein von Informationen, nämlich Daten, in einer beinahe unerschöpflichen Menge.[8] Mithilfe von neuen Technologien und Methoden, die derzeit unter dem Begriff Business Analytics diskutiert werden, sollen diese Datenmengen nutzbar gemacht werden, um Managemententscheidungen zu unterstützten.[9] Das Spektrum der Neuerungen, die diese Technologien mit sich bringen, ist dabei weitgefasst. Angefangen bei Real-Time-verfügbaren Informationen bis hin zur Automatisierung von Entscheidungen auf Grundlage von quantitativen Modellen.[10] Diese Entwicklungen haben das Potenzial die Planung und Unternehmenssteuerung tiefgreifend zu verändern.[11]
1.2 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit
2 Planung
Das Management von Unternehmen muss täglich eine Vielzahl von Entscheidungen treffen. Betriebswirtschaftlich richtig wäre eine solche Entscheidung, wenn sie streng rational getroffen wird unter der Berücksichtigung, dass die zur Zielerreichung eingesetzten Mittel effektiv und effizient eingesetzt werden. Eine Hauptrolle bei der Einhaltung dieser Zweck-Mittel-Rationalität spielt die Planung.[12] Pläne sind ein bedeutsames Instrument zur aktiven Gestaltung der Zukunft, in dem Sie darstellen was erreicht werden soll[13] und sie sich mit den Handlungen befassen, die nötig sind um den gewünschten zukünftigen Zustand zu erreichen[14]. Damit sind sie ein wesentlicher Bestandteil der Steuerungsfunktion des Controllings.[15] Anhand der Pläne, kann die „Fahrtrichtung“ des Unternehmens abgestimmt und vorgegeben werden.[16] Der vorliegenden Arbeit liegt deshalb, für den Begriff der Planung, folgende Definition zugrunde, die Planung als „ein systematisches, zukunftsbezogenes Durchdenken und Festlegen von Zielen, Maßnahmen, Mitteln und Wegen zur künftigen Zielerreichung“[17] beschreibt.
Im Bezug auf die Planung wird nach verschiedene Planungsebenen unterschieden. Die strategische Planung ist eine langfristige Planung, bei der Ziele gesetzt und das Unternehmen strategisch positioniert wird.[18] Die strategische Planung dient somit als ein Orientierungsrahmen für die essentiellen Unternehmensentscheidungen.[19] Die taktische Planung ist eine Mittelfristplanung, die sich auf einen Planungshorizont von zwei bis fünf Jahren bezieht.[20] Hier werden die Vorgaben, die sich aus der strategischen Planung ergeben, verfeinert und den jeweiligen Unternehmensbereichen zugeteilt.[21] Die operative Planung bezieht sich auf einen Planungshorizont von einem Jahr, sie wird somit jährlich neu erstellt.[22] Sie soll dem Management dabei helfen, die aus den strategischen Zielen abgeleiteten kurz- bzw. mittelfristigen Ziele zu erreichen und die, auf Ertrag und Liquidität ausgerichtete, Steuerung des Unternehmens zu unterstützen.[23] Die operative Planung besteht aus unterschiedlichen Teilaspekten von Sachzielplanungen, die eng mit Formalzielplanungen verbunden sind. In der Sachzielplanung wird festgelegt, wie die einzelnen betrieblichen Funktionen innerhalb des Unternehmens, im kommenden Jahr, handeln sollen. Hierzu zählen z.B. die Absatzplanung, Produktionsplanung und Beschaffungsplanung. Formalzielplanungen sind auf den betrieblichen Erfolg des Unternehmens ausgerichtet und umfassen Größen, die auf Erfolgs- und Liquiditätsaspekte der Sachzielplanungen ausgerichtet sind. Beispielsweise wird der Erlösplan aus dem Absatzplan hergeleitet.[24] Generell liegt die sachliche und fachliche Ausgestaltung der Pläne in der Hand des Managements. Das Controlling befasst sich hingegen mit den Aufgaben der Planungsunterstützung und dem Planungsmanagement.[25]
2.1 Die besondere Rolle der Absatzplanung
Im Rahmen des Planungsmanagements durch das Controlling werden, um die Komplexität im Planungsprozess zu reduzieren, einzelne Teilpläne gebildet. Diese müssen anschließend miteinander koordiniert werden. Die weitere Untergliederung des Gesamtplans, in die einzelnen Teilpläne, kann beispielweise nach Divisionen oder Funktionen vorgenommen werden. Im Rahmen dieser Untergliederung werden generell zwei Koordinationsarten unterschieden. Zum einen die simultane Koordination und zum anderen die sukzessive Koordination.[26]
Bei der simultanen Koordination werden alle Planungsgegenstände gleichzeitig betrachtet und alle interdependenten Abhängigkeiten der Einflussgrößen simultan berücksichtigt. Diese Vorgehensweise führt in der Praxis allerdings häufig zu unüberwindbaren Problemen bei der Berechnung, weshalb sich dort die sukzessive Koordination etabliert hat.[27] Bei der sukzessiven Koordination werden die einzelnen Teilpläne für sich allein optimiert und die Ergebnisse geben die Rahmenbedingungen für die folgenden Teilpläne vor. Von entscheidender Bedeutung ist hier folglich die Anordnung der Teilpläne. Laut dem „Ausgleichgesetz der Planung“ von Gutenberg ist bei der Koordination von Teilplänen stets mit dem Bereich zu beginnen, welcher den größten Engpass darstellt. Der größte Engpassbereich findet sich in der Praxis, unter Annahme gesättigter Märkte, im Absatzbereich wieder. Deshalb spielt die Absatzplanung eine besondere Rolle, da sie in der Praxis häufig der zentrale Startpunkt der Planung ist. [28]
2.2 Absatz-/Umsatzplanung
Die Basis der operativen Absatzplanung bilden die Untersuchung der Marktverhältnisse, die Analyse des eigenen Absatzes und das Erstellen von Absatzprognosen. Durch die Untersuchung der Marktverhältnisse sollen Informationen über die Nachfrage, Konkurrenz und Absatzwege gesammelt werden. Bei der Analyse des eigenen Absatzes werden Kennzahlen auf Basis von mengen- und wertmäßigen Umsatzstatistiken erstellt und Abhängigkeiten wie z.B. zwischen Abnehmer und Produkt ermittelt. Auf Basis dieses Wissens werden Absatzprognosen erzeugt. Diese antizipieren die zukünftige Marktlage und berechnen den eigenen, voraussichtlichen Absatz.[29] Unter Absatzplanung wird folglich die Entwicklung von Absatzplänen verstanden, die auf der Basis von Prognosen über die in zukünftigen Planperioden möglichen Absätze, erstellt werden. Verlässliche Prognosen über die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung, die Entwicklung der Branche sowie des Absatzmarktes, in dem das Unternehmen tätig ist, sind zentrale Vorrausetzungen für die Absatzplanung.[30] Die Prognosen müssen schnell und präzise sein. Dies stellt eine große Herausforderung für das Controlling dar, da die Absatz- bzw. Umsatzentwicklung von vielen dynamischen und sich verändernden internen sowie externen Faktoren abhängt.[31]
Die Planung der Verkäufe selbst erfolgt klassischerweise durch Mitarbeiter in den Vertriebsabteilungen. Für die wichtigen Produkte bzw. Kunden erfolgt dies produkt-bzw. kundengenau. Für die weniger wichtigen Produkte bzw. Kunden wird eine Teilplanung in Produkt- und Kundengruppen zugelassen, um den Planungsaufwand im Rahmen zu halten. Aus den einzelnen Plänen der Vertriebsmitarbeiter wird der Absatzplan für die jeweiligen Vertriebsbereiche zusammengefügt. Hieraus ergeben sich die für die kommende Periode benötigten Stückzahlen der Produkte.[32] Die Absatzplanung ist demnach auch die Basis für die Umsatzplanung, da hier die prognostizierte Absatzmenge mit den jeweiligen Preisen multipliziert wird.[33] Das Controlling koordiniert alle, von den jeweiligen Fachabteilungen angefertigten, Teilpläne[34], gibt geeignete Planungshilfen[35] und fügt die Teilpläne zu einem Gesamtplan zusammen[36]. Anschließend wird durch Kontrollen sichergestellt, dass keine Kunden- oder Produktbereiche vergessen wurden. Durch dieses Zusammenspiel der Vertriebsabteilung und dem Controlling, bei der Absatz – bzw. Umsatzplanung, soll eine möglichst gute Entscheidungsgrundlage geschaffen werden.[37]
Ein wesentliches Steuerungsinstrument des Controllings, welches auch im Rahmen der Absatz- bzw. Umsatzplanung seine Anwendung findet, ist der Forecast. Die wesentliche Zielsetzung des Forecasts ist die frühzeitige Lieferung von Informationen über zu erwartenden Planabweichungen. Damit soll sichergestellt werden, dass rechtzeitig Maßnahmen zur Schließung der Ziellücke entwickelt und Anpassungen vorgenommen werden können.[38] Durch einen effektiven Absatz- bzw. Umsatzforecast kann die Unternehmensperformance gesteigert werden, da direkt Optimierungen hinsichtlich der Lagerverwaltung, Warenbeschaffung und des Vertriebsmanagement angestoßen werden können.[39] Eine hohe Prognosegüte dieser Forecasts ist vor allem in Märkten mit volatilem Nachfrageverhalten wie z.B. der Milchindustrie[40] oder auch der IT-Industrie, die durch ständige Innovation und kurze Produktlebenszyklen geprägt ist, von entscheidender Bedeutung[41].
2.3 Kritik an der traditionellen Planung
Die Umwelt, in der Unternehmen heute agieren ist bedeutend dynamischer und komplexer als sie es noch vor einigen Jahren war.[42] Dies ist der Fall aufgrund einiger, häufig auch interdependent verbundener Faktoren, wie z.B. die fortschreitende Globalisierung, Digitalisierung, disruptive Technologien und Geschäftsmodelle, Innovationen und Marktstörungen. In diesem Zusammenhang wird von einer VUCA-Welt gesprochen.[43] Auf diesen Begriff wird im folgenden Kapitel detaillierter eingegangen. Trotz dieser Veränderung der Umwelt verläuft die Planung in den meisten Unternehmen, wie in einem sich jährlich wiederholenden rituellen Zyklus ab. Beginnend mit der strategischen Planung, geht es in die darauf aufbauende operative Planung und Budgetierung und schließlich zum Forecasting, mit monatlicher bzw. quartalweiser Frequenz.[44] Gerade deshalb steht die traditionelle Planung trotz ihrer generell unbestrittenen Bedeutung derzeit unter starker Kritik. Die Hauptkritikpunkte an dem klassischen Planungsprozess sind unter anderem ein zu hoher Detaillierungsgrad und der enorme Aufwand für die Erstellung, begrenzte Aktualität und mangelnde Flexibilität, unnötige Wiederholungsschleifen und Verhandlungsspiele, Scheingenauigkeit, mangelnder Bezug zur Strategie sowie Maßnahmen und eine nicht ausreichende Integration in die IT.[45] In Bezug auf die Absatz- bzw. Umsatzplanung treffen einige dieser Kritikpunkte in besonderem Maße zu. Da die Absatzplanung Schnittstellencharakter aufweist und Vertrieb, Controlling, die Geschäftsführung und auch teilweise das Marketing involviert sind, ist der Prozess durch eine Vielzahl von Abstimmungsrunden geprägt. Dies führt dazu, dass die Absatzplanung ein langwieriger und enorm zeitintensiver Prozess ist, der in vielen Unternehmen politisch geprägt ist. Informationen werden nicht weitergegeben und Ziele werden bewusst niedrig vereinbart. Diese Planwerte sind dann für Prognosen, Leistungsbeurteilungen und Leistungsvergütungen nicht zu gebrauchen. Ein weiteres Problem im Rahmen der Absatzplanung stellt die unterschiedliche Relevanz dieser Planung für den Vertrieb bzw. für das Controlling dar. Während das Controlling der Absatzplanung eine hohe Bedeutung beimisst, da sie den Ausgangspunkt für die restlichen Teilplanungen darstellt, ist die Absatzplanung für den Vertrieb häufig kaum relevant. Aus Sicht des Vertriebs werden durch den Planungsprozess zu viel Zeit und Ressourcen in Anspruch genommen, die dann für die eigentliche Vertriebstätigkeit fehlen. Diese Problematik kann dazu führen, dass die Planung in der Vertriebsabteilung nicht mit dem nötigen Engagement vorgenommen wird und die Planungsqualität darunter leidet.[46]
Die aktuellen Ansätze zur Planung sind in vielen Unternehmen nicht mehr zeitgemäß. Es ist nötig die Planung an die veränderten Rahmenbedingungen der VUCA-Welt anzupassen.[47] Unternehmen benötigen in einem Geschäftsumfeld, dass hohe Volatilität und Unsicherheit aufweist, eine flexiblere und in die Zukunft gerichtete Unternehmenssteuerung.[48]





























