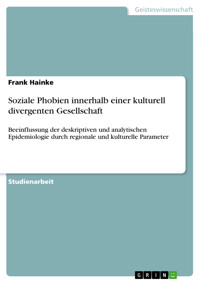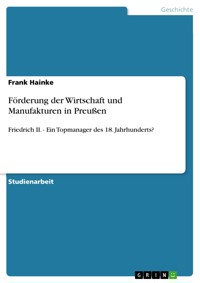Abseits (existieren) und Widerstand (denken). Versagen von Bildungs- und Erziehungsgrundsätzen im Nationalsozialismus E-Book
Frank Hainke
0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2014 im Fachbereich Pädagogik - Pädagogische Soziologie, Note: 1,0, Universität Koblenz-Landau (Pädagogik), Veranstaltung: Kindheit und Jugend im biographischen Kontext - Kindheit und Jugend im Nationalsozialismus, Sprache: Deutsch, Abstract: „Hier ist das jüngste Deutschland der Reinen und Reifenden, hier ist unsere Zukunft und unser Schicksal“, schrieb 1934 der Reichsjugendführer Baldur von Schirach in einem Geleitwort zu Heinrich Hoffmans Bildband „Jugend um Hitler“. In dessen Zuge beschwor er die völlige Ergebung einer nationalsozialistischen Jugend zu Adolf Hitler. So folgerte von Schirach weiter, dass „[...] hier noch ein anderes [ist], das kein Gesetz befehlen, kein Staatsmann kommandieren kann: die Liebe der Jugend. Kein Deutscher hat in solchem Ausmaß die Jugend wirklich besessen wie der Führer.“ Der umfassende Besitzanspruch der in diesen Worten zum Ausdruck kommt, gehört zu den greifbarsten Charakteristika des Nationalsozialismus, dem sich die deutsche Jugendgeneration der Zwanziger und Dreißiger Jahre ausgesetzt sah. Einer dieser Jugendlichen war Peter Brückner. Dessen Autobiographie ‚Das Abseits als sicherer Ort. Kindheit und Jugend zwischen 1933 und 1945‘ schildert den zunehmenden Zugriff des Regimes in die Bildung und in weite Lebensbereiche der Jugendlichen, sowie die vereinzelten Versuche sich diesem Zugriff zu entziehen. „Wie bildet sich ein Antifaschist im Wildwuchs [...]“ fragte Brückner rückblickend, und „[…] wie wird aus ihm später eine politische Existenz?“ Diese spezielle politische Existenz ist im Bezug zu Peter Brückner eine Kernfrage, die den Hintergrund, die Intention und den Zweck seiner Autobiographie erhellt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2013 GRIN Verlag GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhalt
1. Einleitung
2. Die Autobiographie als Quelle für den Nationalsozialismus
3. Peter Brückner zwischen Nationalsozialismus und Deutschem Herbst
3.1. Der Staats- und Systemkritiker
3.2. Aufbau und Struktur der Autobiographie Brückners
4. Das Abseits als sicherer Ort
5. Ergebnisse und Fazit der Untersuchung
6. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
„Hier ist das jüngste Deutschland der Reinen und Reifenden, hier ist unsere Zukunft und unser Schicksal“, schrieb 1934 der Reichsjugendführer Baldur von Schirach in einem Geleitwort zu Heinrich Hoffmans Bildband „Jugend um Hitler“. In dessen Zuge beschwor er die völlige Ergebung einer nationalsozialistischen Jugend zu Adolf Hitler. So folgerte von Schirach weiter, dass „[...] hier noch ein anderes [ist], das kein Gesetz befehlen, kein Staatsmann kommandieren kann: die Liebe der Jugend. Kein Deutscher hat in solchem Ausmaß die Jugend wirklich besessen wie der Führer.“[1]
Der umfassende Besitzanspruch der in diesen Worten zum Ausdruck kommt, gehört zu den greifbarsten Charakteristika des Nationalsozialismus, dem sich die deutsche Jugendgeneration der Zwanziger und Dreißiger Jahre ausgesetzt sah. Einer dieser Jugendlichen war Peter Brückner. Dessen Autobiographie ‚Das Abseits als sicherer Ort. Kindheit und Jugend zwischen 1933 und 1945‘ schildert den zunehmenden Zugriff des Regimes in die Bildung und in weite Lebensbereiche der Jugendlichen, sowie die vereinzelten Versuche sich diesem Zugriff zu entziehen.
Die Vereinnahmung der Jugend, z.B. durch Jugendorganisationen, war und ist kein neues Phänomen, geschweige denn war sie mit der Hitlerjugend eine Erfindung des Nationalsozialismus. Erste Konzeptionen und Institutionen entstanden in Deutschland schon Ende des 19. Jahrhunderts zur Zeit des Kaiserreichs.[2] Nach dem Ersten Weltkrieg begann erneut das Ringen um eine vorerst ‚überflüssig‘ gewordene Jugendgeneration. Im Zeitgeist der Weimarer Republik wurde von verschiedenen politischen und gesellschaftlichen Strömungen das ‚Jugendproblem‘ als Kontrollproblem empfunden, dem mit geeigneter staatlich initiierter Militarisierung, Programmatik oder Organisation entgegenwirkt werden sollte.[3] Mit dem Verbot der katholischen Jugend 1938 blieb am Ende dieser Entwicklung nur noch eine politisch-ideologische Ausrichtung, die der Hitlerjugend, übrig.
Der Nationalsozialismus, speziell die Jugend unter Hitler, ist ein weitreichend erforschtes Feld mit einer Vielzahl von Quellen und Publikationen.[4]
Jedoch lag und liegt der wissenschaftliche Fokus in all seinen Facetten vornehmlich auf quellenbasierten Interpretationen und bloßen Darstellungen des Nationalsozialismus oder auf Entwicklungslinien, die zu den unfassbaren Folgen des NS-Regimes geführt haben.
Bereits unmittelbar nach dem Krieg nahmen Autobiographien in der gesamten Bandbreite der Forschung stets eine Sonderstellung ein. Unabhängig davon ob es nun die Schwierigkeit ist, Einzelschicksale in einen größeren Kontext einzuordnen oder die unsichere Aussagekraft von Autobiographien zu bewerten, der Forschungsansatz bleibt entscheidend für die wissenschaftliche Arbeitsweise. Aus diesem Grund wird im ersten Abschnitt dieser Arbeit zunächst die Autobiographie als Quelle im Spannungsfeld zwischen Geschichts-, Literatur- und Erziehungswissenschaft untersucht um diese Sonderstellung für die Autobiographie Peter Brückners aufzulösen.
„Wie bildet sich ein Antifaschist im Wildwuchs [...]“ fragte Brückner rückblickend, und „[…] wie wird aus ihm später eine politische Existenz?“[5] Diese spezielle politische Existenz ist im Bezug zu Peter Brückner eine Kernfrage, die den Hintergrund, die Intention und den Zweck seiner Autobiographie erhellt. Der Entstehungszeitraum des Werkes und der Zeitpunkt der Veröffentlichung schlagen eine Brücke zur Gegenwart des Autors und stellen einen weiteren Schwerpunkt dieser Arbeit dar. Abschließend werden am Beispiel der Autobiographie, zum einen der Aufbau und zum anderen spezielle Aussagen analysiert, um wesentliche Hinweise für den Bildungs- und Politisierungsprozess Brückners herauszustellen.
Die nachfolgende Untersuchung verfolgt nicht den Anspruch einer vollständigen Darstellung der Autobiographie Brückners oder neue Sachverhalte über Jugend im Nationalsozialismus zu formulieren. Vielmehr soll sie anhand der Kernaussagen das persönliche Bildungsschicksal Brückners darstellen und wesentliche Merkmale seiner Jugend im Nationalsozialismus vermitteln.
2. Die Autobiographie als Quelle für den Nationalsozialismus
Autobiographische Schriften wie z.B. ‚Abrechnung mit Hitler‘ von Dr. Hjalmar Schacht oder Albert Speers ‚Erinnerungen‘ fanden in der Geschichtswissenschaft aufgrund der Nähe zu Hitler große Beachtung. Dabei hat die Erforschung des Widerstands der Bevölkerung, vornehmlich der bildungsintendierte ‚aktive‘ Widerstand wie u.a. die Weiße Rose oder Einzelschicksale der Sozial- und Alltagsgeschichte erst zeitversetzt begonnen und anfangs nur eine untergeordnete Rolle gespielt. Das besondere Problem der Erforschung dieses speziellen Widerstandes kann man mit zwei vornehmlichen Problemstellungen erklären. Spätestens nach Kriegsende bestand ein großes Interesse daran, „sich als ‚Widerständler‘ auszuweisen, um den Sühnebestimmungen des Gesetzes zu entgehen. Die Zahl der ‚Widerständler‘ wuchs von Tag zu Tag lawinenartig an. Namentlich am 20. Juli 1944, dem Tag des Attentats, wollte jeder beteiligt gewesen sein.“[6] Die aus einem Rechtfertigungsbestreben heraus resultierende Unübersichtlichkeit führte zur zweiten Problemstellung: dem definitorischen Problem des Widerstandes bzw. der Bewertung des Widerstandes.