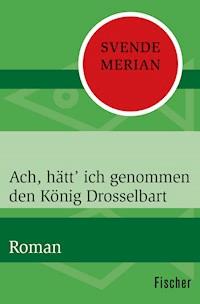
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Marei Asbrook ist Buchhändlerin und alleinerziehende Mutter. Sie kämpft jeden Tag um ihre Existenz. Manchmal flüchtet sie in die Erinnerung an glückliche Momente ihrer Kindheit, als Lesen und Vorgelesen-Bekommen, das Erlebnis der Natur einen wichtigen Platz eingenommen haben. Bei ihrer Gedankenreise in die Vergangenheit wird die Erinnerung an einen Deutschlehrer wach, der sich ihr mit einer spannenden Geschichte über Wölfe unauslöschlich eingeprägt hat. Marei versucht, diesen Lehrer ausfindig zu machen. Ihre kindliche Schwärmerei von damals spornt sie zu einer leidenschaftlichen Suche nach diesem »Wolfsmann« an … (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 390
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Svende Merian
Ach, hätt’ ich genommen den König Drosselbart
Roman
FISCHER Digital
Inhalt
Diese Arbeit widme ich meinen Eltern
»Den Wärwolf kannten sie alle. Das war ein Mensch, der nur eine gewisse verzauberte Schnalle an seinem Gürtel zu lösen brauchte, und er nahm die Gestalt eines Wolfes an …«
Karl Gutzkow19. Jahrhundert
Teil 1
Nebelelstern
Die Elstern am Hauptbahnhof erinnern fast an Nebelkrähen, so schmutzig sind ihre weißen Federn. Vier dieser grauschwarzen, hüpfbeinigen Tanzgenossen beleben die Rasenfläche vor dem Brückenpfeiler. Kaiserwalzer ertönt aus dem Autoradio, und die Elster rechtsaußen kann gar nicht wissen, daß sie im Takt der Musik über die bauchhohen, grünen Halme springt.
Aber Marei hat beides. Die Musik im Ohr und die Elstern vor Augen. Sie hüpfen immer abwechselnd, eine von links und eine von rechts ins Bild. Elsternballett.
Marei kommt vom Flughafen.
Sie ist jetzt allein.
Es ist ja nur für ein Jahr.
Sie sollte sich darauf konzentrieren, ihren Buchladen aus den roten Zahlen herauszuwirtschaften.
Sie sollte sich Gedanken machen, was nun wird.
Sie sollte Ideen entwickeln, was sie beruflich sonst unternehmen könnte, wenn der Buchladen sich auf Dauer nicht mehr trägt, den Lebensunterhalt nicht mehr abwirft.
Sie sollte.
Sie sollte.
Neulich hat ihr jemand vorgeschlagen, Reisen oder Kaffee in ihrem Laden mitzuverkaufen. Kombi-Läden seien auf dem Vormarsch.
Marei ist nicht auf dem Vormarsch. Sie weiß, daß sie irgend etwas ändern muß.
Sie hat zu viel Federn gelassen in letzter Zeit.
Sie sollte …
Heute abend wird sie sich erst einmal richtig etwas gönnen. Die alten Winnetou-Filme werden wiederholt. Heute abend der erste. Die sieht sie sich jedes Mal an. Seit dreißig Jahren.
Claudio hat sie immer damit aufgezogen. Er stellte sich neben den Fernseher, verbreitete Unruhe und kommentierte: »So ein Kitsch! Kriegen die sich am Schluß?«
»Wer denn?« fragte Marei entnervt zurück, »Winnetou heiratet nicht. Winnetou reitet über die Prärie und durch die Berge, über den Fluß und in die Wälder.«
Später dann hatte sie das Argument, daß Jasper die Filme auch sehen wollte. Da ritt Winnetou wieder, und Claudio konnte sich seine Kommentare abschminken. Jasper lag mit einem bunten Stirnband auf der blauen Wolldecke vor dem Fernseher, und Marei setzte sich dazu und meinte: »Ich kann das Kind doch nicht allein fernsehen lassen! Da raten alle Pädagogen von ab. Alle!«
Wölfe
Die Geschichte mit den Wölfen. Wie er sie vorlas, dort vorn am Pult. Nichts hat sie vergessen. In all den dreißig Jahren nicht. Nichts. Nicht die Wölfe, nicht das Gesicht der alten Frau, nicht den Edelmut des handelnden Mannes.
Vor allem aber hatte Marei ihn nie vergessen. Ihn, der diese Geschichte vorlas. Sie war damals neun oder zehn Jahre alt.
Öfter schon hatte sie ihn im Treppenhaus gesehen, auf dem Schulhof. Immer hatte sie sich gewünscht, diesen Lehrer einmal im Unterricht zu bekommen.
Nie bekam sie ihn.
Sie sah ihn nur im Treppenhaus. Er hatte schwarze Haare. Irgend etwas Außergewöhnliches an sich.
Nie hatten sie ihn im Unterricht. Doch dann kam diese Vertretungsstunde. Er betrat die Klasse und schlug dort vorn am Pult ein Buch auf. Er las vor: Die Geschichte mit den Wölfen. Im Anfang war das Wort.
Die Kragenecken von seinem Hemd verschwanden unter seinem Pullover. Auch das hat sie nie vergessen. Ob das so sein sollte? Ob das so Mode war damals? Sie weiß es nicht. Sie weiß nur noch, daß es so war. Und, daß sie eine Stunde lang seine Stimme hören durfte, sein Gesicht anstarren durfte, ohne aufzufallen. Man guckt nach vorn, wenn der Lehrer redet. Vorn ist die Musik.
Im Anfang war das Wort. Er las vor, er sprach zur Klasse, er meisterte seine Vertretungsstunde. Ewig wird Marei dem Lehrer dankbar sein, der überraschend krank geworden war damals, für den er nun einspringen mußte. Sonst hätte sie die Geschichte mit den Wölfen nie kennengelernt.
Ein Mann auf einem Wagen, ein Pferd. Winter, Kälte, weitab vom Dorf und plötzlich Wolfsgeheul. Todesangst. Ein Mann treibt sein Pferd an. Hat er eine Chance, das Dorf zu erreichen? Vielleicht ja. Wenn er sich beeilt. Ein Mann treibt sein Pferd an. Plötzlich, am Waldrand, eine alte Frau, zu Fuß. Ein Mann treibt sein Pferd an, in Todesangst, ist ohne zu überlegen schon an ihr vorbei, sieht ihr Gesicht. Sekundenbruchteile nur sieht er ihre Angst im Gesicht. Ihr Wissen um ihre Todgeweihtheit. Er kehrt um. Er nimmt die Frau auf den Wagen. Verliert den Vorsprung vor dem Wolfsrudel. Findet in letzter Sekunde den rettenden Ausweg, die Idee: Er wirft einen großen Bottich von seinem Wagen, springt hinterher und kriecht darunter. Der alten Frau hat er vorher zugerufen, sie solle im nächsten Dorf Hilfe holen. Er wartet unter dem schweren Holzbottich auf Rettung. Hier endet die Geschichte.
Was sollte er tun, als die Wolfsgeschichte zu Ende war? Die Vertretungsstunde war noch nicht zu Ende. Was also sollte er tun? Er begann zu erzählen. Von Dingen, die er für wichtig hielt. Plötzlich stand das Wort »Krieg« an der Tafel. Er hatte es angeschrieben. Er sagte, sie sollten sich gut merken, wie es geschrieben wird. Sie sollten sich dieses Wort merken.
»Und ich hoffe für euch, daß ihr es nie schreiben müßt«, sagte er, nahm sein weißes Stofftaschentuch aus der Hosentasche und wischte das Wort »Krieg« damit von der Tafel.
Der Schwamm lag an seinem Platz. Er hätte den Schwamm nehmen können. Er aber nahm sein weißes Taschentuch dafür.
Er kam nie wieder in die Klasse. Es war nur eine Vertretungsstunde.
Nie hätte Marei die Geschichte mit den Wölfen kennengelernt, wenn nicht der andere Lehrer krank geworden wäre. War es Herr Schmid, der Klassenlehrer? War es Herr Schwarz, der Musiklehrer? Sie weiß es nicht mehr. Und sie weiß seinen Namen nicht mehr, den Namen von diesem Vertretungslehrer. Bei jedem Klassentreffen fragt Marei die anderen: »Erinnert ihr euch an diesen schwarzhaarigen Lehrer mit der Wolfsgeschichte? Er sah ein bißchen aus wie Pierre Brice.« Doch niemand erinnert sich an ihn. Niemand außer ihr. Sie aber erinnert sich genau. Und sie weiß, daß die Wölfe nur Hunger hatten. Irgendeiner muß dran glauben. Irgendeiner wird immer gefressen.
Pleitegeier
Jetzt, wo sie die Bücher umräumen muß, kommt die Erinnerung an diese Schulstunde immer wieder. Dreißig Jahre muß das her sein. Ja, genau, dreißig Jahre. Sie war in der dritten oder vierten Klasse. Damals dachte sie noch, daß Bücher und Geschichten immer nur Spaß bringen. Im Anfang war das Wort. Und nun muß sie ihren Buchladen aufräumen, muß ihn vielleicht bald schließen. Sie hat die letzten Monate mehr Ausgaben als Einnahmen gehabt, weiß nicht, ob diese Tendenz sich fortsetzen wird. Sie weiß gar nicht, ob sie ihren Buchladen eigentlich aufräumt oder umräumt. Oder ausräumt. Wenn sie dem Lehrer mit der Wolfsgeschichte noch sagen könnte, daß er ein bißchen schuld daran ist, daß sie unbedingt einen Buchladen aufmachen wollte. Herr Schmid hat ihr Lesen und Schreiben beigebracht, der Wolfslehrer lehrte sie, wie man vorliest. Er konnte schön vorlesen. So, daß man es nie wieder vergißt.
Wenn sie sich bloß an seinen Namen erinnern würde! Warum weiß niemand mehr, wie der Wolfslehrer hieß? Warum weiß niemand mehr, wie spannend die Geschichte mit den Wölfen war? Marei beugt sich über den Karton, der heute angekommen ist, und beginnt, die Bücher auszupacken. Weitermachen. Auch, wenn sie die Zukunft nicht kennt, nicht weiß, ob alles noch Sinn hat, ob sie schließen muß oder auf seichte Unterhaltungsliteratur umsatteln, um ihren Buchladen über die Runden zu bringen – weitermachen. Ohne absehbare Perspektive, mit Gottvertrauen. Weitermachen.
Marei steht mit dem Rücken zur Tür, als sie das kurze harte Geräusch der Türklinke hört. Sie ist immer noch dabei, Bücher auszupacken. Dann folgt das Bimmeln der Kuhglocken, die anzeigen, daß ein Kunde den Laden betreten hat. Almglocken, so laut, daß sie es auch hört, wenn sie im hinteren Raum ist oder in der Teeküche. Marei nimmt an der Zeitspanne, bis sich die Tür wieder schließt, nebelig und ein bißchen desinteressiert wahr, daß es sich um zwei Kunden handeln muß. Wieder Almglocken, und das paßt nun so gar nicht zu dem Buch, das Marei jetzt gerade in der Hand hält. »Wolfsaga« heißt es, und der Einband ist wunderschön, dunkelblau mit einem strahlenden Mond. Das Buch wird sie ins Schaufenster legen, dachte sie gerade, bevor es läutete. Aber dazu kommt sie nicht mehr.
Das Gehusche hinter ihrem Rücken hat sie ein bißchen stutzig gemacht, aber sie kann ihren Blick noch nicht von dem Wolf vor dem blauen Nachthimmel losreißen, und als sie sich endlich umdreht, geht alles ganz schnell. Das sind keine Kunden. Die wollen keine Bücher.
Nur den einen sieht sie noch, der mit seinem Messer in Richtung Kasse fuchtelt und ihr bedeutet, sie solle sich beeilen. Den anderen riecht sie. Er steht dicht neben ihr und hält ihr sein Messer an den untersten Rippenbogen. Drängt sie in Richtung Kasse. Lautlos. Sie hat keine Chance. Draußen strömen Leute vorbei. Doch die wollen zum Juwelier oder zum Zeitschriftenhändler. In einen Buchladen verirrt sich heutzutage kaum einer mehr. Warum hat sie diese blöden Plakate ins Fenster gehängt? Niemand kann von draußen hereinsehen. Und wenn einer hereinsehen könnte? Was würde das nützen? Würde der wirklich erkennen, daß hier ein Überfall stattfindet? Der neben ihr steht so dicht, daß sein Messer in ihrem Pullover verschwindet. Der andere hat aufgehört zu fuchteln und nur noch »Los, aufmachen!« gefaucht. Sein Messer hält er unter seiner Jacke verborgen, so daß man von draußen nicht einmal sähe, daß die beiden bewaffnet sind.
Als beide mit dem Kasseninhalt den Laden verlassen haben, hält Marei die Wolfsaga immer noch in der Hand. Der Mensch ist des Menschen Wolf.
Marei steht mit dem Rücken zur Wand.
Jetzt nicht die Türklinke anfassen.
Sie reißt alle Fenster auf, bevor sie die Polizei anruft. Wen eigentlich? Die Kripo, oder?
Kalle Blomquist hat seine Verbrecher mit Fingerabdrücken überführt.
Die bei der Kripo lachen sich tot, wenn sie jetzt für eine geklaute Tageskasse mit vielleicht dreihundert Mark Inhalt die Spurensicherung schicken sollen. Versuchen kann man’s trotzdem.
Tatsächlich lassen sie sich überreden, Fingerabdrücke von der Türklinke zu nehmen. Sie hätten vor Tagen schon zwei ähnliche Überfälle gehabt, einen davon im Nachbarblock bei einem Stempelmacher. Da wüßten sie schon gerne, ob sich die Fingerabdrücke decken.
Aha, denkt Marei. Buchladen und Stempelmacher, das sind die Läden, wo häufig mal gar kein Kunde zu sehen ist. Wahrscheinlich lockt das Einbrecher und räuberisches Gelichter.
Wie in einem anderen Aggregatzustand bringt sie die Protokollaufnahme mit den beiden Kripobeamten hinter sich. Sie erstattet Anzeige, beschreibt mehr schlecht als recht, wie die beiden Räuber aussahen und erinnert sich während der Beschreibung, daß einer klein und der andere größer als sie war. Daß der Große die meiste Zeit schräg hinter ihr stand und sie ihn kaum gesehen hat. Sie weiß nicht mehr, wann wer wo gestanden hat. Sie friert.
Als die Polizisten gehen, schließt sie die Fenster. Sie spürt die Angst um ihre bloße Existenz so stark und schmerzhaft, daß nichts anderes in ihren Gedanken noch Raum fassen kann. Wieso ausgerechnet sie? Sie wollte gerade einen Überlebensplan aufstellen. Weitere Ausgaben kürzen, neue Ideen für Abendveranstaltungen und Sonderverkäufe ausbrüten. Gerade wollte sie Rotstiftpläne entwerfen, um den drohenden Offenbarungseid abzuwenden. Und dann kommen die und klauen ihr dreihundert Mark. Mindestens. Wahrscheinlich sogar mehr. Sie hat das Gefühl, daß von den dreihundert Mark ihr Leben abhängt. Das kann sie keinem erzählen. Die sagen dann alle nur, sie solle mal nicht so schwarz sehen. Seit sie wirklich zum ersten Mal ernsthaft Angst um ihr ökonomisches Überleben hat, ist sie so allein wie nie zuvor in ihrem Leben. Die meisten Menschen grenzen sich davon ab, indem sie billigen Trost spenden. So schlimm wird’s schon nicht sein. Sie macht das Theater dann mit. Sie hebt sich die wirkliche Überlebensangst für die intimen Stunden mit sich selbst auf. Sie zittert.
Wie jetzt gegen diese Panik ankommen? Wie soll sie in Zukunft gute Lügen erfinden? Bislang hat sie allen ihre roten Zahlen verschwiegen. Das wird schon wieder, war ihre Devise nach außen hin. Das wird schon wieder. Und wenn einer fragte, sagte sie, daß es ihrem Buchladen gut gehe. Erst sagte sie noch gut, dann sagte sie ganz gut. Als es nur noch ganz gut ging, setzte sie ein paar Abendveranstaltungen an. Dann verkauften sich Bücher zu den jeweiligen Themen. Diese Umsätze redete sie sich schön. Doch sie reichten vorn und hinten nicht. Sie kann den Zweckoptimismus verteidigen, solange Kunden im Laden sind. Sobald die Ladentür geschlossen ist, kehrt die Panik wieder. Allabendlich. Es geht immer mehr ums nackte Überleben. Und sie weiß plötzlich, daß sie mutterseelenallein ist mit der Verantwortung dafür. Seit Jahren fühlt sie sich überfordert. Sie hat das Gefühl, daß der Überfall nur ein Symbol für ihre angeschlagene Situation ist. Es geht an die Substanz, schon lange. Wie soll sie noch mehr Kraft nur aus sich selbst ziehen?
Neulich hat sie im Fernsehen einen Hirsch gesehen. Er war ein paar Tage zuvor angebissen worden, aber entkommen. Vom Wundbrand geschwächt, war er eine leichte Beute für die nächsten. Ein gefundenes Fressen, das sich mit letzter Kraft gegen ein paar Raubtiere wehrte und wehrte, verletzt war und schwächer wurde und am Schluß noch einmal vor Schmerz und vor Protest aufschrie. Dann ruhig liegen blieb, atmete, müde war, zu müde zum Schreien, zu müde zum Protestieren, und dann, als ihm immer noch niemand die Kehle durchbiß, aber hinten schon einer hungrig und genüßlich an ihm knabberte, einen allerletzten Schrei zu seinem Schöpfer emporstieß und mit letzter Kraft vor Schmerz röhrte, so als wollte er sagen: »Hast du mich nur dafür geschaffen? Damit ich Beute für die anderen bin?«
So wie der Hirsch fühlt sich Marei in letzter Zeit immer öfter. Was macht es für einen Sinn zu schreien? Wer hilft einem? Kurz vor Schluß der Sendung informiert der Kommentator noch trostreich und salbungsvoll darüber, wie gerecht und weise die Natur sei. Im Tierreich würden nur die alten, kranken und schwachen Tiere gerissen.
Sie weint. Nach und nach fällt ein wenig Spannung von ihr ab. Am Sonnabend wird sie den Laden früh schließen und ein wenig an die See fahren. Dorthin, wo keiner ist.
Sand
Hier am Meer gibt es keine Wurzeln. Vielleicht fühlt sie sich hier deshalb so zu Hause. Auf einmal hatte sie gewußt, daß es nur noch das Meer sein kann, das ihr jetzt hilft. Obwohl es sonst nicht so sehr ihre Landschaft ist. Marei ist Waldläuferin, eigentlich. Doch auf einmal mußte es das Meer sein. Vielleicht, weil hier alles so klar unterteilt ist: Wasser und Himmel und Sand. Im Wald dagegen ist alles miteinander verwoben und verwurzelt, verflochten und verstrickt. Alles greift ineinander. Gehört zusammen. Im Wald lernt man, feine Details miteinander zu verästeln. Hier am Meer dagegen lernt man, in großzügige Konturen einzuteilen, klare Linien zu ziehen. Sie bezweifelt, daß die Polizei jemals herausfinden wird, wer ihre Tageskasse geraubt und diese Dauerangst dagelassen hat. Nichts ist mehr so wie vor dem Überfall.
Zuerst wußte sie nicht, wohin. Der Strand sollte breit sein, breit und feinsandig, das Wasser endlos. Keine Bucht, keine Inseln, keine Grenzen für das Auge. Menschenleere Jahreszeit. Ruhe. So hatte Marei es sich gewünscht. Und genau so ist es nun hier. Der Frühling hat noch nicht einmal richtig begonnen.
Der Gesang des Meeres ist zweistimmig. Wenn sie die Augen schließt, kann sie die beiden Stimmen voneinander unterscheiden.
Da ist der gleichmäßige, ruhige Rhythmus der Wellen am flachen, sanft ansteigenden Ufersand. An- und abschwellend fast nur in der Lautstärke. Der Ton bleibt der gleiche, fast der gleiche, nur unmerklich in der Tonlage schwankend.
Darüber liegt der grollende Rhythmus der größeren Wellenberge, die schräg auf die kleine steile Sandbank branden. Diese Stimme singt langsamer, unregelmäßiger, so scheint es. Eher einem dreihebigen Rhythmus folgend, aber auch diesem eher mit anarchischem Gleichmut. Komm ich heut nicht, komm ich morgen. Das Anrollen der Welle dauert länger. Kurz bevor der Wellenkamm bricht, singt das Wasser seinen höchsten Ton, um kurz darauf in sein tiefstes Grollen umzuschlagen, wenn der weiße Schaum einen Augenblick lang nicht weiß, ob er Wasser oder Luft sein will und dann mit ruhigen Armen vom Meer zurückgeholt wird, als hätte es nie den leisesten Zweifel gegeben.
Marei gräbt ihre Zehen in den weichen, kalten Sand und sieht hinaus aufs Meer. Es ist ihr eigenes Leben, das sie hier ein bißchen sortieren möchte. Neu ordnen. Sie hat sich von Robert getrennt. Das ist jetzt schon fast fünf Jahre her. Robert war der letzte einigermaßen präsente Freund in ihrem Leben, der mehr als nur Liebhaber war. Seitdem hat sie nur noch Scheidungsleichen und indisponierte Eremiten kennengelernt. Kaltstarts in die Sackgasse. Und nun hat sie auch noch ihren Buchladen in die roten Zahlen gewirtschaftet. Dafür hat sie anderthalb Jahre gebraucht. Und sie hat eine Wohnung, in der sie nicht mehr zu Hause ist. Und das nicht erst, seit ihr Sohn Jasper zum Schüleraustausch nach Atlanta abgeflogen ist. Die Nachbarn sind auch nicht gerade leiser geworden, seit sie wissen, daß Marei nachts in der Wohnung allein ist. Wenn nachts um vier Gepolter und Möbelrücken stattfindet, können die sich schon morgens um neun an nichts mehr erinnern. Totalamnesie. Sie sind es nie gewesen. So geht es jetzt seit Monaten. Eigentlich seit Jahren. Seit Marei hier wohnt, hat sich schon dreimal die Mieterstruktur in der Trampelwohngemeinschaft über ihr geändert.
Was hat sie Jasper beigebracht, der seit seinem dreizehnten Lebensjahr auf keiner Friedensdemo mehr fehlt? Daß die Welt ohne Waffen funktioniert, ohne Krieg und ohne Zähnefletschen? Hat sie ihn wirklich aufs Leben vorbereitet? Hat er bei ihr bekommen, was ein Kind von seiner Mutter braucht? Hat sie die gleichen Fehler wiederholt wie ihre Eltern? Oder andere? Da nützt es nichts, wenn sie mit Jaspers Vater seit Jahren unkomplizierte Besuchs- und Urlaubsregelungen praktiziert. Im Grunde muß sie zehn Monate im Jahr doch Mutter und Vater gleichzeitig sein.
Aufräumen müßte man mal. Ihr eigenes Leben ist es. Nur sie ist verantwortlich. Sie allein. Und sie ist für zwei verantwortlich. Warum hat sie ihr Leben nicht besser in den Griff bekommen? Alles, was einmal wichtig war, ist weg im Moment. Sogar Jasper. Und vielleicht ist es gut, daß seine Abwesenheit sie so mit sich selbst konfrontiert. Sie kann sich gegen aggressive Leute immer nicht zur Wehr setzen, schafft es häufig nicht, sich durchzusetzen. Sie muß wohl oder übel erkennen, daß andere Aufgaben anstehen als noch vor zehn Jahren. Irgendwie hatte sie es gar nicht so recht bemerkt, daß auch sie nun bald in der Lebensmitte angekommen ist. Die Jahre sind ihr einfach so davongelaufen. Vielleicht war sie einfach zu dumm zum Leben. Aber die anderen lernen ja auch nichts dazu. Manchmal wünscht sie sich jemanden, an den sie sich anlehnen kann. Ein Stück Verantwortung abgeben, manchmal.
Sie versucht, die Farben des Meeres mit ihren Worten zu fassen, aber sie merkt, daß die feinen Nuancen, die sich vor ihren Augen miteinander vermischen, sich einer einfachen Beschreibung entziehen. Sie trifft die Worte nicht, ihre Worte treffen die Farben nicht.
Das Meer ist ihr Gott, nicht Mann, nicht Frau, ein Es. Es ist einfach da. Das Meer wird ihr helfen. Es war da von Anfang an. Urbrühe. Da kommen wir alle her. Einzellig, neutral, sorglos sind wir da herumgeschwommen. Gleich nach der Zellteilung waren wir wer. Brauchten nicht jahrelange Besserwisserei zu ertragen. Konnten alles, was wir können mußten. Nestflüchterparadies.
Wärmer war es damals auch auf der Erde. Marei wird es kalt an den Füßen im klammfeuchten Sand. Wie soll sie jetzt die Schuhe wieder anziehen, ohne daß der Sand in den Strümpfen scheuert?
Das ganze Elend des Menschengeschlechts ist diese langjährige Abhängigkeit. Alle Psychologen der Welt wären überflüssig, wenn der Mensch nicht knappe zwanzig Jahre lang am Rockzipfel hängen würde. Zellteilung und: blubb fertig. Das wäre die Lösung. Das Kind schnürt sich einfach ab, schwimmt davon und winkt noch einmal aus mittlerer Ferne. Das war’s dann. Keine Abhängigkeitskonflikte, keine seelischen Wunden, die einen für den Rest des Lebens meschugge machen. Warum ist die Schöpfung auf die Idee gekommen, ausgerechnet den Menschen mit diesem extremen Nesthocker-Schicksal zu schlagen?
Herr Schmid war der erste Mann in Mareis Leben. Herr Schmid war der Mann, der Marei Lesen und Schreiben gelehrt hatte. Marei wurde eingeschult in dem Jahr, als sie von Eichenrade in die Großstadt umzogen. Herr Schmid war der Klassenlehrer. Am Mittagstisch erzählte Marei manchmal, was Herr Schmid am Vormittag in der Schule gesagt hatte. Nicht lange, und die Mutter fegte Herrn Schmids Weisheiten in unwirschem Tonfall vom Tisch.
»Ach! Herr Schmid hat gesagt, Herr Schmid hat gesagt, was hat Herr Schmid denn nun schon wieder gesagt? – Na, wenn Herr Schmid das gesagt hat, dann muß es ja stimmen.«
Herr Schmid war der erste, der elterliche Autorität durch profundes Wissen zu untergraben in der Lage war.
Manchmal in letzter Zeit hat sie bedauert, daß ihre Mutter so früh gestorben ist. Als ihre Mutter starb, empfand sie es nicht als früh. Früh für das Leben ihrer Mutter schon. Sie ist nur achtundsechzig Jahre alt geworden. Aber nicht früh für Marei. Sie dachte, das könnte normal sein, daß eine Mutter stirbt, wenn man siebenundzwanzig ist. Was ist schon normal? Sie hat nie geahnt, daß ihr die Mutter eines Tages so fehlen würde. Nichts wünscht sich Marei in letzter Zeit häufiger, als daß ihre Mutter noch leben würde.
Die Muscheln mit herausgebrochenen Ecken läßt Marei liegen. Sie nimmt nur die, die heil sind. Oder fast heil. Und am liebsten weiße. Aber auch die mit leichten Schattierungen. Gelb und bräunlich, manchmal ins Rötliche spielend, dann wieder grau und bläulich an den Rändern. Nie sieht eine Muschel genauso aus wie die andere. Zu Hause wird sie Sand und Tangreste abwaschen und Muscheln und Steine in ein Glas füllen. Bei den Steinen muß Marei sich zusammennehmen. Sie kann unmöglich alle mitnehmen, die hübsch sind. Wie soll sie das schleppen? Wenn Herr Schmid noch leben würde! Gerne hätte sie ihm noch dafür gedankt, daß er ihr Lesen und Schreiben beigebracht hat. Kaum, daß sie allein lesen konnte, holte sie sich Bücher über Förster, Bücher über Füchse, Bücher über Tiere und Kinder und deren Abenteuer aus der Bücherei. Die Mutter war nur die ersten Male mit dabei. Den Weg zur Bücherei fand Marei schnell allein.
Bei Herrn Schwarz hatten sie Singen, und später dann noch so eine große, blonde Handarbeitslehrerin für Kreuzstich, Kettenstich und unsichtbaren Stich, der bei Marei nie unsichtbar wurde.
Und dann gab es da noch den Lehrer mit der Wolfsgeschichte. Seit es mit ihrem Buchladen bergab geht, kommen die Gedanken an diese Schulstunde immer öfter zu Besuch. Mareis Erinnerung daran ist so klar und ruhig und lebt in ihr, als hätte diese Stunde gestern stattgefunden. Der Wolfserzähler. Der Lehrer mit den schwarzen Haaren. Er sah aus wie Pierre Brice. Jedenfalls kam es ihr immer ein bißchen so vor. Er hatte etwas von Winnetou, etwas Archaisches, Bodenständiges, Erdverbundenes. Und er konnte die Geschichte mit den Wölfen so schön vorlesen. Nur seinen Namen hatte sie lange Zeit vergessen, sich derart vage nur an ihn erinnert, daß sie falsch wurde, die Erinnerung.
Einen Augenblick lang ist wieder alles so wie vor dreißig Jahren. Der Lehrer mit den Kragenecken im Pullover sitzt am Pult, und die Wölfe heulen zwischen den verschneiten Tannen. Die Pferde geben ihr Bestes, und Marei sitzt gebannt hinter ihrer hellbraunen Schülerbank und stellt sich vor, daß es heute noch Wölfe in unseren Wäldern gäbe …
Im Religionsunterricht bei Herrn Schmid hatten sie die Schöpfungsgeschichte behandelt und ein Bild dazu gemalt. Gott hatte nicht nur Himmel und Erde geschaffen, sondern auch alle Tiere im Wasser, in der Luft und auf dem Land. Die Meerestiere schuf er am fünften Tag. Und zuletzt, am sechsten Tag, die Menschen. Dann soll er angeblich zu den Menschen gesagt haben: Macht euch die Erde untertan.
Doch was ist, wenn die ihn nur falsch verstanden haben, und Gott hatte in Wahrheit zu den Walen gesagt: Macht euch die Erde untertan? Wenn die Menschen nur alles in den falschen Hals bekommen haben? Was dann? Wie sähe die Welt heute aus, wenn die Wale das Sagen hätten?
Marei hatte damals ein Bild zur Schöpfung gemalt, auf dem viel Blau oben und unten war, und etwas Weißes, das keiner von den Erwachsenen dechiffrieren konnte. Aber der Geist Gottes schwebte über den Wassern, das war doch klar. Marei verstand gar nicht, was an ihrem Bild zur Schöpfungsgeschichte unklar sein sollte. Ein großer Wal pustete eine Fontäne aus dem blauen Wasser.
Ein Wal. Der ertrinkt nicht. Der taucht immer wieder auf. Marei dagegen hat das Gefühl, daß es sie immer weiter nach unten zieht. Das kann man keinem erzählen. Da reden alle nur was von »Kopf hoch« und »Ohren steif halten« und sagen: »Das wird schon wieder.« Aber wo ist der Sinn ihres Lebens, wenn sie nur noch gegen ihren Untergang anstrampelt? Nie einmal drei ruhige Atemzüge hintereinander tun kann. Immer nur knapp über dem Meeresspiegel. Das ist kein Leben mehr, das ist nur noch ein Überleben. Schon lange. Das wird nicht wieder. Aber noch ist Jasper nicht volljährig. Noch kann sie ihn nicht allein lassen. Sie hat ihn zur Selbständigkeit erzogen, damit er auf eigenen Füßen steht, falls es bei ihr einmal gar nicht mehr weitergeht. Aber noch ist es zu früh.
Wenn jetzt der Wal käme und sie ins Meer holte. Wenn der Wal, so wie er Jona gerettet hat, jetzt käme, sie vor den Haien zu retten. Sie kann ihre Wunden nicht mehr zählen. Es ist diese Ballung von kleinen Angriffen, die an die Substanz geht. Und sie muß alles allein auffangen. Kein Ort mehr, nirgends, an dem nicht neue Blessuren drohen.
Wie war die Geschichte mit Jona und seinem Wal? Und wo begann sie? Am Ufer? Nein, im Meer hat der Wal sich den Jona geschnappt, ihn gerettet, und dann an Land gebracht.
Im Maul? Im Bauch? Egal. Die Leute denken sich viel aus, wenn sie sich Dinge nicht erklären können. Immer haben irgendwelche Meeressäuger Menschen gerettet. Ein Fisch kann nicht begreifen, daß der Mensch am Ertrinken ist. Der Wal kann. Weil er selbst ertrinken kann. Der Wal hat Jona vor dem Ertrinken gerettet. Ihn an Land gespuckt, heißt es. Auch Delphine stoßen die Menschen mit ihrer Schnauze nach oben, über die Wasseroberfläche, wenn sie Ertrinkende retten. Wer weiß, wer da am Ufer gestanden hat, als Jonas Wal dieses kleine Menschlein aus dem riesigen Meer ins Trockene gestupst hat. Warum war Jona überhaupt in die Bredouille gekommen? So bibelfest ist sie nicht. Das muß sie zu Hause nachschlagen.
Marei hat die Schuhe wieder angezogen, ist aufgestanden und verabschiedet sich freiwillig und widerstrebend zugleich für heute vom Meer. Sie dreht sich um. Eine andere Welt empfängt ihren Blick, als hätte die Landschaft darauf gewartet, endlich wieder ihrer Aufmerksamkeit habhaft zu werden. Da gibt es Bäume, da gibt es Sträucher. Dünen mit Strandhafer. Wattig und schwer versinken Mareis Schritte im Sand, immer tiefer, je weiter sie sich vom Wasser entfernt, je trockener der Sand wird. Der Weg zurück durch die Dünen ist jedes Mal das Auftauchen aus einer anderen Welt, aus einem Reich, das nur Himmel und Wasser kennt. Rückkehr aus einem Traum. Pelzig stehen dichte Halme auf den Dünenkämmen gegen den Himmel über dem Land, fahlgelb und zerzaust wie ein struppiges Tier. Zu Mareis Füßen fließt der trockene Sand die Dünenhänge hinunter über Muscheln und Steine und herabgefallene, verwehte Zweige der ersten Bäume, die die Dünenlandschaft säumen. Jeder Schritt verändert das Bild, ohne daß Fußspuren bleiben. Der Wind tut das Seine dazu. Halbverwehte Geheimnisse im Sand, die nach Lust und Laune des Seewindes mal diese, mal jene Ecke ihres Seins dem erstaunten Augenzeugen preisgeben.
Leseratten
Sie weiß, daß sie jetzt eigentlich tatkräftig irgend etwas anpacken müßte. Aber Marei ist nicht tatkräftig im Moment. Sie fühlt sich weich wie Mus und möchte am liebsten nie wieder aufstehen. Sie wünscht sich nur noch eines: ein Buch aufschlagen und lesen, und sich nie wieder um irgend etwas kümmern müssen. Am liebsten »Die Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn«. Obwohl Jasper auf Mark Twain schimpft, jetzt, in seinen Briefen. – Einmal wieder so lesen, wie man als Kind lesen konnte! Nur Leseratte sein dürfen. Nicht an morgen denken müssen. Nicht bei jedem Buch sofort auch den beruflichen Nutzen der Leserei mit im Auge haben müssen. Oft hat sie Jasper in den letzten Jahren beneidet, wenn sie in sein Zimmer kam und er in eines von seinen Büchern versunken war. Selbst wenn er Stephen King las, hat sie ihn nicht gestört.
Wenn bloß erst Wochenende wäre. Sie möchte ein Buch und eine Wolldecke und einen ganzen Tag Zeit einpacken. Statt dessen muß sie hier im Arbeitsalltag ausharren und sinnvolle Entscheidungen treffen. Eigentlich weiß sie ihre Entscheidung schon. Der Überfall hat nur bestätigt, was seit langem in ihr brodelt. Die Kasse mit den Tageseinnahmen ist weg. Die Lust, in dieser Großstadt einen Buchladen zu betreiben, auch. Sie hat auch keine Lust mehr, jeden zweiten Morgen zu den Nachbarn hochzugehen und sich anzuhören, daß sie wieder gar nichts gemacht hätten, als mit großem Getöse Marei halb fünf aus dem Schlaf gerissen wurde.
»Dann waren es eben die, die zwischen uns wohnen«, hatte sie das letzte Mal gesagt und im Grunde resigniert. Man müßte irgendwo aufs Land ziehen. Ob die Leute da mehr Bücher lesen?
Die Leseratte ist eine stark vom Aussterben bedrohte Tierart. Nur vereinzelt bekommt man heute noch scheue Exemplare zu sehen, wenn man sich ganz still verhält und keinen Lärm macht. Die Pleitegeier dagegen vermehren sich rasant, brüten mehrmals pro Jahr. Wie kann man auf die dumme Idee kommen, mit Büchern Geld verdienen zu wollen? Warum hat sie ihre Stelle als Sozialpädagogin aufgegeben? Nein, so herum darf man nicht denken. Sie hatte keine Lust mehr auf den Lärm und die Enge in den Neubauvierteln, in den Hochhäusern. Sie hat die Kids verstanden, die ihr eigenes Jugendzentrum kaputtgeschlagen hatten, nachdem herausgekommen war, daß man das Telefon angezapft hatte. Nur damit konnte man der Behörde nicht kommen. Die argumentierten mit einem Versehen. Niemand konnte das Gegenteil nachweisen. Drei Jugendliche hatten Hanfpflänzchen auf dem Balkon gezüchtet. Das reichte für zwei Razzien und die Wanze. Irgendwer wollte auch noch Terroristen ein und aus gehen gesehen haben. Das müssen Nachbarn hinter der Tüllgardine gewesen sein. Und für dieses Arbeitsklima, diese Erfolgserlebnisse den ganzen Tag zwischen Beton und Hundekot zu verbringen und dabei den Jugendlichen noch Mut für den Start in ihr Leben zu machen? Das war Marei zu viel gewesen. Oder zu wenig. Wie man es nimmt. Besonders hatte sie darunter gelitten, ihre Mädchengruppe allein lassen zu müssen. Der Abschied war ihr schwergefallen. Aber sie hatte Glück gehabt, daß zu diesem Zeitpunkt Hinnerk Behrens dort Pastor wurde. Den kannte sie aus ihrer Studienzeit, hatte Seminare zu Religionsdidaktik und Jugendsekten mit ihm gemeinsam belegt. Sie hatte dann zwei Abende mit ihm zusammengesessen und ihm ihre Jugendlichen ans Herz gelegt, als sie ihm die Arbeit im Jugendzentrum übergab. Nur – eine Mädchengruppe konnte er natürlich schlecht leiten. Irgendwann war Marei dennoch so weit, die Verantwortung für »ihre« Kids loszulassen. Sie wollte weg von den Hochhäusern. Sie hatte danach vorübergehend eine Arbeit in einer Beratungsstelle übernommen, und das nicht in einer Trabantenstadt, sondern in einem gewachsenen Stadtteil, ohne Hochhäuser.
Und dann kam Jasper. Das heißt, eigentlich kam erst Claudio, oder besser: der war schon da. Als Marei schwanger wurde, ließen sie sich beide ganz gerne vom Schicksal überrumpeln, sowohl Claudio als auch Marei selbst. Irgendwie war die Zeit auch reif dafür, ein Kind in die Welt zu setzen und mal Nägel mit Köpfen zu machen. Claudio hatte zu der Zeit ein paar sehr gutbezahlte Aufträge, zum Teil in Italien. Marei hatte angefangen, an ihrem Jesusmärchen zu schreiben, und darin ihre Erfahrungen mit der Jugendarbeit einfließen lassen. »Wenn Jesus ein Mädchen geworden wäre« hieß der Titel. Bald nach der Veröffentlichung wußte Marei, daß es nun endgültig nur noch Bücher sein sollten. Als Jasper fünf Jahre alt war und sie sich mit Claudio auseinandergelebt hatte, war sie zurück nach Deutschland gezogen und hatte den kleinen Buchladen übernommen, der gerade einen neuen Besitzer suchte. Und nun, gute zehn Jahre später, hat sie wieder das Gefühl, eine Veränderung steht an. Bloß welche?
In der Stadt zu wohnen hat Marei schon lange keine Lust mehr. In der Stadt zu arbeiten auch nicht. Ob das alte Forsthaus bei Eichenrade noch steht? Wieso hat sie keinen Buchladen in Eichenrade? Oder mitten im Wald? Plötzlich ist ihr alles fremd, was sie mit eigenen Händen, mit eigenem Kopf, mit eigener Arbeit aufgebaut hat. Die Wohnung, der Buchladen, als ob ein anderer für sie bestimmt hätte, daß das alles mitten in der Stadt sein muß. Eine Zeitlang hatte Robert immer mehr, immer öfter die Arbeit im Buchladen übernommen, wenn Marei mal für ein paar Tage wegfahren mußte. Kongresse, Tagungen, Buchhändlertreffen. Wenn Marei dann wiederkam, war meistens das Schaufenster »umgestaltet«. Marei wußte manchmal nicht mehr, ob es nun ihr Buchladen oder ein Gemeinschaftsprojekt war. Robert wollte alles anders als Marei. Unter seiner Obhut wurde die Schaufenstergestaltung wuselig und unübersichtlich. Marei kämpfte um die klare Linie.
Andererseits: Unter Roberts Obhut fühlte Jasper sich wohl. Das war auch schon viel wert.
Robert ist Übersetzer. Robert übersetzt alles. Kochbücher, Sportbücher, Reisebücher, politische Romane bzw. was er dafür hält. Marei setzt gerne Schwerpunkte, auch farblich. Robert liebt aus jedem Dorf einen Köter. Marei will in jeder Dekoration ein erkennbares Schwerpunktthema, und möglichst eine monochrome Gestaltung. Blickfang sein, Eye-catcher zwischen all den kakadubunten Schaufenstern links und rechts die Straße rauf und runter. Robert hatte immer noch hier und da eine Marginalie, die fast auch zum Thema paßte, wenn er das Schaufenster dekorierte. Robert spöttelte über Mareis Vorliebe für alte Försterbücher und Tiergeschichten. Er hatte angefangen, ausgestopfte Tiere aus dem biologischen Fundus der gegenüberliegenden Schule auszuleihen. Manchmal fand Marei die Idee gar nicht schlecht, mit ein paar Schaufenstertieren etwas Leben in die Bude zu bringen. Aber Robert verstand nicht, daß sie auch dabei auf farbliche Gestaltung Wert legte. Jasper sah mit großen Augen von einem zum anderen, wenn er ihre heftigen Dispute zu diesem Thema miterlebte.
»Mag Mama den Fuchs nicht?«
Maulaffen
Ob das alte Forsthaus bei Eichenrade noch steht? Natürlich. Warum sollte es nicht mehr stehen? Marei hat den Ort gemieden, seit die Großeltern dort nicht mehr wohnen. Selbst damals, als sie vor einigen Jahren mal mit Robert am kleinen Waldsee spazieren war, hatte sie nicht den Weg über Eichenrade genommen. Mit Robert kam einfach nicht die Stimmung für Nostalgie auf. Den größeren Waldsee, wo früher immer der Fuchs am Ufer entlangschnürte, hatte sie ihm gar nicht erst gezeigt. Sie hatte das Gefühl, daß Roberts Blicke und sein Genörgel den heiligen Ort ihrer Kindheit entweihen würden. Er hatte über die Frösche gequengelt. Dann waren sie nie wieder in die Gegend gefahren.
Aber Robert ist ja nun nicht mehr. Sie kann jetzt tun und lassen, was sie will. Auch nach Eichenrade fahren. Nur, sie kann sich doch nicht bei fremden Leuten vor die Tür stellen und Maulaffen feilhalten. Außerdem: Was soll sie da? Sie kann ja schlecht hingehen und sagen: Mein Opa war hier mal Förster. Darf ich mal gucken, wie es bei Ihnen heute so aussieht?
Sie weiß nicht, ob da nicht eher die Wehmut übermächtig würde, wenn sie dort heute fremde Leute ein- und ausgehen sähe. Und in Neukaten, wo die Großeltern zum Schluß die Pensionswohnung hatten, wird sie erst recht nichts mehr wie früher vorfinden. Wenn das Storchennest weg wäre, das alte Wagenrad von Bauer Paulsen, das man von Opas Küchenfenster aus sehen konnte, das würde Marei nicht verkraften.
Und die Graureiherkolonie am See, ob es die noch gibt? Und die Nistecke der Blaukehlchen? Als Kind hatte Marei immer gedacht, das Blaukehlchen wäre der Mann vom Rotkehlchen und die Jungen wären auch alle blau und rot, je nachdem ob es Jungen oder Mädchen sind. Doch Opa hatte nur gelacht und gesagt, das seien zwei völlig verschiedene Vögel, die Blaukehlchen und die Rotkehlchen.
Marei war davon nicht zu überzeugen. Sie hatte weiterhin das Blaukehlchen und das Rotkehlchen miteinander verheiratet. Auch dachte sie immer, der Grünspecht und der Pirol gehörten zusammen. Sie hatte Opas großes Buch mit den vielen bunten Vögeln jeden Abend durchgeblättert, als sie noch nicht selbst lesen konnte, und hatte die Vögel immer nach Farben geordnet. Daß die Pinguine auch in dem Buch abgebildet waren, hatte sie anfangs gewundert. Als die Großmutter ihr erklärte, daß auch Pinguine Vögel seien und Federn hätten, da hatte Marei sie kurzerhand mit den Elstern verschwägert. Das paßte von der Farbe her. Warum die Großmutter so lachte, verstand sie damals nicht. Marei hatte ihre eigenen zoologischen Ordnungen.
Einer von Mareis Lieblingsvögeln war das Haselhuhn, und Oma hatte sogar mal ein Paar davon in ihrem kleinen Hühnerstall gehabt. Der Hahn war allerdings bald vom Habicht geholt worden, und für das Haselhuhn hatte Marei nie einen farblich passenden Partner gefunden. Höchstens den braunweiß-gescheckten Schweißhund von Oberförster Friedler, aber das Huhn und die alte Senta mochten sich nicht. Sehr zu Mareis Leidwesen. Wenn Friedler mit seiner Senta um die Ecke bog, war die scheue Henne immer schnell im Stall verschwunden. Die dicke Berta war da zutraulicher und ließ sich von dem Hund gar nicht beeindrucken. Berta war Mareis Lieblingshuhn. Sie konnte so schön zuhören und lief nicht weg, wenn Marei anfing, ihr eine von ihren selbsterfundenen Geschichten und Tierfabeln zu erzählen. Der dicken Berta hatte Marei auch die Geschichte von den Elstern und den Pinguinen erzählt, und die dicke Berta hatte nicht gelacht. Sie hatte am nächsten Tag ein Ei gelegt, und Berta legte nicht jeden Tag.
Doch, man könnte einen Buchladen in Eichenrade aufmachen.
Wurzeln
In den letzten Jahren ist diese Sehnsucht nach dem Forsthaus der Großeltern stärker und stärker geworden. Und die Sehnsucht nach den Wochenenden mit den Eltern im Wald. Der Wald war die Freiheit für Marei.
Sie brauchte keinen Rock anzuziehen, sondern durfte Hosen tragen. Und eine alte hellgelbe Windjacke, die sie von irgend jemandem geschenkt bekommen hatte. Der Wald war ihre Freiheit. Sie hoffte immer, ein bißchen so auszusehen wie der Fernsehjunge von Lassie. Aber die alte Windjacke durfte wochentags nur unten im Wäschepuff liegen. Unter der Schmutzwäsche. Sonnabends vormittags erwachte Marei zum eigentlichen Leben. Sie zog die gelbe Windjacke unter der Wäsche hervor, suchte ihre blauen Stoffturnschuhe und war Waldläuferin, Tierfreundin, Vagabundin der Landstraßen und der Waldwege …
Sommerfrösche
Die Seerosenblätter auf dem Waldsee glänzen in der Junisonne wie eine Handvoll hingeworfener Silbermünzen. Marei sitzt am Ufer, auf einem kleinen Erdwall, der von Steinen und Moos bedeckt ist. Seit Tagen hat es nicht geregnet, der Waldboden ist trocken und die Luft erst jetzt, am frühen Abend, erträglich. Kleine braune Frösche, manche nicht größer als ein Fünfzig-Pfennig-Stück, springen mit leisem Geknisper durch das trockene Laub vom Vorjahr. Vor ein paar Jahren war sie mit Robert hier …
Robert verstand nicht, warum er zwischen den Fröschen herumhüpfen mußte. Er kicherte zwar dabei, aber Marei spürte genau, daß er es eigentlich nicht nur lustig fand.
»Mensch, das konnte ich doch nicht wissen, daß hier heute Krötenwanderung ist«, entschuldigte sie sich für die kleinen dunkelbraunen Waldfrösche. Es war wirklich schwierig gewesen, die kleinen, tarnfarbenen Springer auf dem Waldweg zu entdecken. Der Weg lag voller Laub, und die Fröschchen waren nur wenig dunkler als das trockene Buchenlaub. Kaum zu sehen. Und viele. Man wußte nicht, wo man hintreten sollte. Marei verstand das Problem nicht. Auch sie kam nur im Stop-and-go-Verfahren weiter. Das war kein Grund, auf die Frösche wütend zu werden.
Aber dieses Jahr ist sie nun allein hier. Sie muß nicht mehr zwischen Robert und den Fröschen vermitteln, die sich gegenseitig zu stören schienen. Aus dem Wasser ragt ein kleines graues Stück Fischrücken. Am anderen Ufer springt etwas. Plötzlich sind es zwei, dann drei, die sich da durch das warme Juniwasser treiben lassen. Der See spiegelt die Kronen der Eichen und Buchen mit hellem Sommerbraun zwischen den Grüntönen wider. Weit entfernt hört man ein paar Kinderstimmen. Vor ihren Füßen knispert und springt es. Marei schneidet einem der Winzlinge mit der Hand den Weg ab, und mit dem nächsten Sprung hat sie ihn auf ihrer Handfläche sitzen. Da sitzt er nun mit flatternder Kehle. Das kleine Herz pumpt aufgeregt.
»Na, du kleine braune Waldunke, vorgestern noch Kaulquappe gewesen, was?«
Das Fröschchen starrt sie aus seinen kleinen schwarzen Augen an. Der dunkelbraune Körper mit den winzigen Gliedmaßen fühlt sich kühl an. Wie kann man bloß so kleine Finger haben?
Dem braunen Fröschchen wird es zu bunt mit der Warterei auf der Menschenhand, und es springt mutig geradeaus, Marei genau ins Gesicht. – »Huch, Kleiner, das war falsch.« Doch er berappelt sich, springt schnell weiter und ist im trockenen Laub nicht mehr zu sehen.
Solche Abenteuer hatte sie haufenweise, wenn sie früher mit den Eltern im Wald war.
Das Schönste waren die Streifzüge allein. Meistens hatte die Mutter Kirschpfanne gebacken. Die schmeckte immer, kalt genausogut wie warm. Nach dem Essen pusteten die Eltern die Luftmatratzen auf und legten sich hin, und Marei stromerte mit ihrem Taschenmesser allein durch den Wald. Schon die Tatsache, daß man keine Karbonade mit Erbsen essen mußte, sondern daß es Kirschpfanne gab, machte den Sonnabend zu einem Festtag. Marei wartete im Wald auf den Fuchs. Wölfe gab es leider nicht mehr. Marei fürchtete sich nicht. Sie hatte Fury und Lassie bei sich. Die Zeit war schwerelos, der Waldboden weich. Ein Gewölle zu finden, oder eine Losung, einen spitzen Mäuseschädel oder einen Unterkiefer von einem größeren Tier, all das waren besondere Funde. Opa wußte immer, was das alles bedeutete. Er konnte auch die Fährten lesen, wenn der Waldboden feucht genug war, um die Trittsiegel zu halten. Wenn Marei allein war, wußte sie oft nicht so genau, was sie nun wirklich vor sich hatte. Sie rätselte und entschied sich dann selbstsicher für eine Hirschlosung, wenn ihr ein Hase zu langweilig erschien, oder eine Dachsfährte, wenn sie einen Marder nicht abenteuerlich genug fand. Die Eulen taten ihr leid. Sie stellte sich vor, daß die an ihrem Gewölle genauso würgten, wie Marei wintersonntags an ihrer Karbonade.
Warum man die Kirschen nicht entsteint in den Eierteig der Kirschpfanne einbacken konnte, verstand Marei nie. Die Mutter sagte, dann würde der Teig matschig, und so mußte man sonntags im Wald die Kirschkerne wieder ausspucken wie die Eulen ihr Gewölle. Aber die Kirschpfanne schmeckte gut, trotz der Kerne.
Bevor Marei in die Schule kam, wohnten sie alle in Eichenrade. Die Eltern hatten sich in Eichenrade kennengelernt. Opa war damals dort Förster. Als die Eltern dann mit Marei in die Stadt umgezogen waren, fuhr man sooft wie möglich zu Besuch nach Eichenrade. Später dann nach Neukaten, als die Großeltern in die Pensionswohnung umgezogen waren. Und manchmal fuhren sie auch in andere Wälder. Marei erinnert sich, daß sie damals jeden Sonnabend, jeden Sonntag, wenn das Wetter es nur irgend zuließ, den grünen VW-Käfer vollpackten und irgendwo Halt machten. Auspackten und da waren. Überall war Landschaft, mitten am Weg. Das Butterbrotpapier faltete man nach dem Essen zusammen, packte es wieder ein und benutzte es ein zweites Mal. Wenn irgendwo eine leere Flasche herumlag, schimpfte man über die Leute, die ihren Müll nicht wieder mit nach Hause nehmen können.
Auch der Abfall paßte wieder ins Auto, wenn man zurückfuhr. Schließlich hatte man ihn auch mitgebracht.
Man hatte pastellfarbene Campingtassen und -teller, Klapphocker, Luftmatratzen und den runden Klapptisch, der genau vor den Ersatzreifen unter der Kühlerhaube paßte. Irgendwann war das Aufpusten der Luftmatratzen zu mühselig und man kaufte einen Blasebalg. Später kam sogar eine Klappliege zum Repertoire dazu.
Aber das Wichtigste war das hellbraune Taschenmesser, das Marei zum Geburtstag bekommen hatte. Man konnte eine große und eine kleine Klinge daraus hervorziehen, und der Griff hatte ein geflammtes Emaille-Muster, das weiß und hellbraun ineinander verfloß. Wenn die Großen endlich auf ihren Luftmatratzen lagen und Ruhe gaben, ging Marei allein los. Sie stellte sich vor, was wäre, wenn sie andere Kinder zum Spielen dabei hätte, und sie hatte Lassie in ihrer Phantasie bei sich. Der erzählte sie, was sie von Opa über die Fichtenwälder wußte. Die Wurzeln reichten nicht tief genug.
Man hatte die Dummheit begangen, reine Fichtenwälder anzupflanzen und das nannte sich Waldbau, und der Opa schimpfte darüber. Aber er könne es auch nicht ändern, schließlich sei er nicht der Oberförster oder die Regierung, und überhaupt hätten wir leider keinen Kaiser mehr und früher wäre so manches besser gewesen. Und vor hundert Jahren, da hätte schon ein Förster einen Artikel in einer Zeitung geschrieben, in dem er vor Monokulturen warnte, also davor, eine Fichte neben die andere zu stellen, weil die eben keine Wurzeln haben. Doch den hat damals keiner ernst genommen; das war so um 1850, da hat der das schon vorausgesehen!
»Aber die haben doch Wurzeln«, widersprach Marei, die oft genug hingefallen war, wenn sie beim Herumlaufen im Wald nicht nach unten geguckt hatte. Opa holte ein großes Buch mit einer Zeichnung von zwei Bäumen, auf der auch ihre Wurzeln unter der Erde zu sehen waren. Das Wurzelgeflecht der Fichte war eindeutig zu flach, und Marei verstand, daß die Wurzeln der Fichte zwar ausreichen, um darüber zu stolpern, aber nicht, wenn ein Sturm über Lichtungen und Waldränder fegt.
»Das nächste Mal, wenn Sturm war, nehme ich dich mit in den Wald, bevor meine Leute aufgeräumt haben. Da wirst du ein paar umgerissene Fichten zu sehen bekommen«, schmunzelte Opa vielversprechend, und Marei freute sich auf den nächsten Sturm.
»Wann ist der?« fragte sie, aber Opa hoffte, daß der Sturm überhaupt nicht käme, und das fand sie nun wieder doof. Überhaupt mußte man immer auf so furchtbar vieles warten. Man konnte nicht einfach losgehen und einen Hirsch sehen wollen, einen Fuchs oder eine Eule. Alles war dem Zufall überlassen. Der Sturm genauso wie der Fuchs.
Das war dasselbe, ob sie nun allein die Mittagsruhe der Eltern im Sonntagswald zum Herumschnüren nutzte oder bei Oma und Opa in Eichenrade zu Besuch war. Die Tiere kamen nur dann, wenn sie selbst Lust dazu hatten.





























