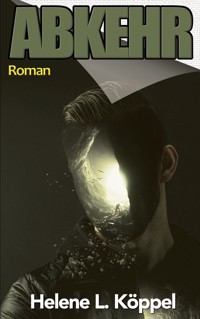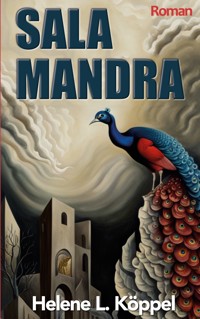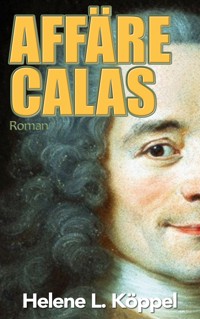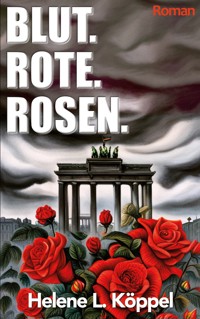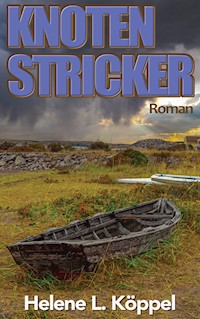Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Töchter des Teufels
- Sprache: Deutsch
Nach ihrem Roman "Die Erbin des Grals" aus dem Jahr 2003, nimmt Helene L. Köppel die Vorgänge im südfranzösischen Bergdorf Rennes-le-Château noch einmal aus einem anderen Blickwinkel unter die Lupe. Rennes-le-Château, im Jahr 1920: Marie Dénarnaud, die ehemalige Haushälterin und Geliebte des verstorbenen Priesters Bérenger Saunière, lädt ihre Freundin Henriette ein, um mit ihr über die alten Zeiten zu plaudern. Gut gelaunt zerpflücken die beiden Damen gleichermaßen Kirchen- und Küchengeheimnisse - doch als es um Saunières Briefe geht, die er ihr während seiner Strafversetzung im Jahr 1911 schrieb, muss Marie aufpassen, damit sie sich nicht um Kopf und Kragen redet! Diese privaten Briefe (erstmals ins Deutsche übersetzt) gewähren interessante neue Einblicke in die historisch verbürgten Ereignisse in Rennes-le-Château, zu Beginn des 20. Jahrhunderts.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 254
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Straßen, die bergauf führen, führen auch bergab.(Heraklit)
Der Pfarrer kauft Grundstücke und Häuser, allerdings auf den Namen Marie Denarnaud, und die hübsche Brünette mit den verschmitzten Augen und der schlanken Taille wird zu einer echten Châtelaine.(Robert Charroux)
Für Marie
Marie Dénarnaud
(* 12. August 1868, Espéraza - † 29. Januar 1953, Rennes-le-Château)
Inhaltsverzeichnis
Vorwort der Autorin
Der Ursprung von Rennes-le-Château
1. Henriette kommt an!
2 . Der neue Bischof in Carcassonne
3. „Grüße an alle da oben!“
4. »Wir wollen uns doch nicht blamieren, liebe Marie!«
5. „Niemals mehr abbeißen, als man kauen kann!“
6. »Die Klausurschwestern singen wirklich auf eine bezaubernde Art.«
7. Die Tugend der Keuschheit
8. Die Blauen Äpfel
9. »Dein ergebener und liebevoller Bérenger!«
10. »Man hat sie mir weggenommen!«
11. „Kind zu verkaufen!“
12. Tout Paris ist für die freie Liebe!
13. »Dein, von ganzem Herzen!«
14. „Geduld, nur noch zwei Tage!“
15. »Aber du hast mir nur ein einziges Mal geantwortet!«
16. Der Brief aus Granès
17. „Saunière hatte eben Geschmack!“
18. Adieu, Marie!
19. Ab in die Flohkiste, Mesdames
Nachwort
Danke
Quellen und entnommene Zitate
Die Autorin
Historische Romane der Autorin
Romanreihe "Töchter des Teufels"
Weitere Romane der Autorin
Romanreihe "Untiefen des Lebens"
Vorwort der Autorin
Jedes Geheimnis hat seinen Ort: In der verfallenden Dorfkirche von Rennes-le-Château fand Abbé Sauniere im Jahr 1886 einen Topf mit Goldmünzen, vergilbte Pergamente und unter einer Gruft sogar einen funkelnden Schatz …
So lautete der Anfang des Klappentextes meines erstmals im Jahr 2003 bei Rütten&Loening, Berlin veröffentlichten Romans Die Erbin des Grals. Eine wahrhaft »zeitlose« Geschichte, denn die Protagonisten – der Priester Bérenger Sauniere und seine Haushälterin und Geliebte Marie Dénarnaud (die Erbin des Grals) – haben ja tatsächlich in Rennes-le-Château gelebt.
Einige Jahre nach dem Erscheinen meines Romans überließ mir Jürg Caluori, ein guter Freund und Experte in der Causa Rennes-le-Château, Kopien von neun handschriftlichen Briefen zur Auswertung. Briefe, die Bérenger Saunière im Jahr 1911 aus dem Kloster Prouille (Fanjeaux, Département Aude) an »seine Marie« geschrieben hat.
Vorweg: Saunières Briefe liefern nicht den einen aufregend neuen Erklärungsansatz in Sachen »Geheimnis von Rennes-le-Château«, auf den man vielleicht wartet. Sie erlauben vielmehr einen neugierigen bis voyeuristischen Blick auf die Beziehung des Priesters zu Marie, die er liebte, einen differenziert-kritischen auf seine kirchlichen Vorgesetzten, mit denen er sich stritt – und einen ehrlichen Blick auf sein eigenes Wesen, seine schillernde Persönlichkeit. Diese auch für mich neuen Erkenntnisse habe ich in den nun vorliegenden Roman sowie in die Charakterentwicklung (Maries Reifung) einfließen lassen. Die Rahmenhandlung ist ausschließlich fiktiv.
Für die Übersetzung der neun Briefe ins Deutsche stand mir dankenswerterweise meine liebe Freundin Ruth Sztukowski zur Seite, wobei uns Saunières kleine Handschrift manchmal zum Verzweifeln, sein Humor jedoch, der zwischen vielen Zeilen aufscheint, oft zum Lachen gebracht hat. Aber es gab auch Momente, die uns überrascht, nachdenklich gemacht und berührt haben.
Freuen Sie sich also auf eine Zeitreise in das Jahr 1920, drei Jahre nach Saunières Tod und zwei Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, den die Franzosen La Grande Guerre nennen. Verfolgen Sie, wie Marie Dénarnaud und ihre Freundin Henriette gleichermaßen Kirchen- und Küchengeheimnisse zerpflücken – und nebenher den einen oder anderen kritischen Blick auf die illustren Gäste des Priesters zur Zeit der Belle Epoque werfen. Gäste, die von den beiden damals bekocht, bewirtet – und manchmal auch belauscht wurden.
Im Vordergrund dieses Romans aus Fiktion und Wirklichkeit stehen aber die Briefe, die der Herzensbrecher und Feinschmecker Bérenger Saunière seiner Marie geschrieben hat. Von seinen Vorgesetzten bereits bei Amtsantritt als »respektlos, unabhängig und rebellisch« beschrieben (nicht zuletzt auch »offen anti-republikanisch«), sah er sich selbst gern als Priester mit einer Künstlerseele. Dass er in seinem turbulenten Leben als Seelsorger von Rennes-le-Château den »Gral« fand, ist nicht gesichert, dass er als »findiger Geschäftsmann« Geld scheffelte und dabei bisweilen in den »Fettnapf« trat – nun, wer will es ihm heute noch verübeln. Manchmal ein Narr zu sein, macht einen noch lange nicht zum Narren, meint Marie dazu. Recht hat sie!
Helene L. Köppel
Der Ursprung von Rennes-le-Château
(Text: Abbé Bérenger Saunière) (Übersetzung: Jürg Caluori)
Rennes-le-Château hat seinen Ursprung in der Garnisonsstadt Rhedae, die ca. 30.000 Menschen beherbergte und im V. Jahrhundert von den Westgoten auf der sich nach Südosten erstreckenden Ebene gegründet wurde, die am Fuße des heutigen Ortes liegt. Es war die Hauptstadt des riesigen Territoriums, das als Rhedez bekannt war und 1170 von der Armee des Königs von Aragon zerstört wurde.
Im XIV. Jahrhundert wurde sie von Pierre II. de Voisins, dem Sénéchal von Carcassonne, wieder befestigt. Die Stadt blühte noch einmal auf, aber dann wurde sie von den Spaniern wieder eingenommen, die nur die alte, Maria Magdalena geweihte Kirche, das alte Herrenhaus und ein paar andere Häuser stehen ließen.
Und so endete die einst schöne Stadt Rhedae, indem sie 1362 zum bescheidenen Dorf Rennes-le-Château wurde. Nach diesen Katastrophen wurde das kleine Dorf, so scheint es, von der Außenwelt weitgehend vergessen.
Dennoch begann vor einigen Jahren in der Umgebung des alten Herrenhauses, das noch stand, so etwas wie eine Wiederbelebung des geschäftigen Treibens von einst:
Die Kirche, die verfallen war, wurde vollständig restauriert und prächtig ausgeschmückt. Die Umgebung des Heiligtums, die einst mit Schutt gefüllt war, wurde mit einem schönen Kalvarienberg geschmückt, der halb von Sträuchern und Blumen verdeckt ist.
Die Villa Béthanie, ein wunderschönes stilvolles Haus, mit einem großen Garten, auf dessen Anhöhe eine schöne Statue unseres Erlösers mit ausgebreiteten Armen steht, wurde gerade fertiggestellt.
Ein breiter gewundener Weg, der auf dem Berggipfel angelegt wurde, hat die alten Wälle ersetzt. Eine elegante Veranda hat den Platz des alten Wachturms eingenommen.
Und am anderen Ende befindet sich der Magdala-Turm, ein zinnengekröntes Wunder der Zivil- und Militärarchitektur, der als Bibliothek dient.
Diese Kunstwerke sind an die Stelle der alten kriegerischen Strukturen getreten. Die Zinnen und Türmchen bieten nun eine erhöhte Plattform für die Betrachtung des wunderbaren Horizonts, der sich nach allen Seiten hin erstreckt, soweit das Auge reicht.
Heutzutage haben Scharen von friedliebenden Menschen die Scharen von Kriegern ersetzt. Sie gehen dort hinauf, um, umgeben von einer unvergleichlichen Landschaft, die Kunstwerke eines Priesters mit der Seele eines Künstlers zu bewundern, eines Priesters, der seine Kirche und seine Gemeinde liebt.
(Dieser Text befand sich auf der Rückseite der 33 verschiedenen Ansichtskarten, die Bérenger Saunière drucken und an Touristen verkaufen ließ; Quelle: »Le Fabuleux Tresor de Rennes-le-Château«, Jacques Rivière)
1 __________ Henriette kommt an!
Orangerie und Belvédère, Rennes-le-Château (HLK 2006)
»Als ich Bérenger Saunière kennenlernte«, vertraute Marie im Frühjahr 1886 ihrem Tagebuch an, … »den Mann, der mich zur Mitwisserin eines unbegreiflichen Geheimnisses werden lassen sollte, war ich gerade achtzehn Jahre alt …«
Wie die Zeit vergeht! Heute, am 12. August 1920, feiert Marie ihren zweiundfünfzigsten Geburtstag – und Bérenger ist schon drei Jahre tot. Um ihren Festtag nicht allein verbringen zu müssen, hat sie ihre langjährige Freundin Henriette nach Rennes-le-Château eingeladen. Henriette hat das Herz auf dem rechten Fleck. Mit Henriette kann Marie über fast alles reden. Doch wie redet man über Ereignisse, die einen selbst in den Grundfesten erschüttert haben? Marie wird sich, bei aller Vertrautheit, vorsehen müssen. Aus leidvoller Erfahrung weiß sie, dass ein einziges unbedachtes Wort Folgen nach sich ziehen kann. Sie braucht nur zurückzudenken, etwa an Bérengers Beichtvater, der sogar für einige Zeit im Irrenhaus saß. Und einer reicht, findet Marie noch immer, grundgütiger Himmel!
Faust und Pomponnette schlagen an …
Maries Herz klopft schneller. Sie nimmt die Schürze ab, zupft an der weißen Bluse mit der Hohlsaumstickerei am Kragen, streicht den grauen Rock glatt. Dann eilt sie aus dem Haus, die Tür hinter sich zuschlagend. Und wahrhaftig – Henriette ist schon in Sicht, umkreist von den aufgeregten Hunden.
»Huhuu!« Marie schwenkt die Arme und eilt ihr entgegen.
Henriette lässt den Tragkorb von den Schultern gleiten und winkt zurück. Dann nimmt sie ihren Strohhut ab. Es ist der von früher, erkennt Marie beim Näherkommen, der mit den rot- und schwarzlackierten Kirschen. Und schon liegen sich die beiden Frauen in den Armen und drücken sich die obligatorischen »Bises« auf die Wangen.
»Welch eine Freude!«, sagt Marie; ihre Augen leuchten.
Schwer atmend meint Henriette, der Aufstieg nach Rennes habe sie fraglos einiges an Kraft gekostet. Gleichwohl strahlt auch sie – um nach dem Gratulieren sogleich Maries schlanke Taille zu bewundern: »Tadellos, ma chère! Wie gelingt dir das nur!«
Marie schmunzelt. »Und du? Du hast dich doch auch kaum verändert!«, sagt sie fröhlich.
Frohgemut machen sie sich auf den Weg hinauf zur Orangerie, wo Marie vorhin schon für das Kaffeetrinken eingedeckt hat. Der Kies knirscht unter ihren Füßen … Doch als Marie feststellt, dass Henriette kaum Schritt mit ihr halten kann und beim Plaudern noch immer schwer atmet, bleibt sie im Parkschatten vor einer der Bänke stehen, damit sie sich hinsetzen kann. Sie selbst nutzt die Pause, um die Hunde für ein paar Stunden in den Zwinger zu sperren.
»Eine Frage, meine Liebe«, sagt Henriette, als Marie sich wieder bei ihr einfindet. »Du verwendest die Rufnamen der alten Hunde? Aus Gewohnheit? Oder hat das Saunière so verfügt?«
»Mon Dieu, du bist von hier, du kennst das doch!«, antwortet Marie mit einer wegwerfenden Handgebärde. »In Rennes geht es immer um die Gegensätze und die Tradition: Faust, so schwarz wie der Pudel, der sich in einen Teufel verwandelt, mit dem er dann einen Pakt eingeht – und Pomponnette, so weiß wie ein unschuldiges Gänseblümchen. Aber, unter uns – pst! –, es soll auch ein berühmtes Lokal in Paris geben, das diesen Namen trägt, und …«, Marie schnappt nach Luft. Vor lauter Freude über ihren Besuch hat sie viel zu schnell geredet. »Und Tradition ist eben die Weitergabe des Feuers!«, setzt sie gewichtig hinterher. »Das ist von Jean Jaurès!«
»Jaurès? Den sie in Paris erschossen haben?«
Marie nickt. »Als er vor dem Krieg warnte, ja. Vor einem schrecklichen Völkermord. Und hat er nicht recht behalten?«
Henriette nimmt ihren Korb wieder auf. »Heilige Jungfrau, all die blutigen Schlachten, das ganze Elend!«, klagt sie – kommt dann jedoch, übergangslos, auf eine Geburtstagsfeier von früher zu sprechen, bei der sie damals in der Küche geholfen hätte. »Die kleine Tochter deines Bruders, die dir so ähnlich sah, Marie, hieß sie nicht Olive? Was ist denn aus ihr geworden? Wie geht es ihr?«
»Gut«, sagt Marie lächelnd. »Sie ist verheiratet und hat vier Kinder bekommen. Kurz hintereinander.«
Henriette lacht auf. »Und dabei geht es ihr wirklich gut?«
Marie bleibt stehen und dreht sich zu ihr um. »Nun ja, kennst du eine Frau, die sich nicht mitunter ein anderes Leben wünscht?«
»Selbst eine wie du, liebe Marie?« Henriette zieht ein Tuch aus dem Ärmel ihrer grau-weiß gestreiften Bluse und tupft sich damit den Schweiß von der Stirn.
Marie richtet den Blick auf die Kieselsteine zu ihren Füßen. Es ist die Kirchenglocke, die die Stille jäh durchbricht: Das Angelusläuten. »Schlag zwölf bereits!«, ruft sie erschrocken. »Wir reden und reden, und du wirst schon halb verdurstet sein!«
Ein schnelles Ave Maria – und die beiden setzen ihren Weg nun zügiger fort, wobei Henriette ihren abgerissenen Gesprächsfaden wieder aufnimmt: »Hat die Kleine damals nicht sogar bei dir bleiben wollen?«
»Bei mir?« Marie lacht verschmitzt. »Lass die Kirche besser im Dorf, Henriette! Bei ihm hat sie bleiben wollen, bei ihm, bei Bérenger!« Einmal den Namen laut ausgesprochen (den sie sonst immer nur nachts flüstert), wird ihr ganz warm ums Herz.
»Bei ihm? … Aber ja, jetzt wo du es sagst! Ich erinnere mich: Der Drache der Heiligen Marthe, nicht wahr? Saunière hat ihr mit dieser Geschichte den Kopf verdreht, Jesus Christus!«
»Mit der Zähmung der Tarasque, ja, ja!«, bekräftigt Marie – bereits die Treppe im Blick, die hinauf zum Belvédère, zum Glaspavillon und zur Volière führt. »Und wie läuft es bei euch in Arques? Wie geht es deinem Mann Arsène? Und seiner großen Familie?«
Die Freundin erzählt von der Hochzeitsfeier der jüngsten Enkelin ihres Mannes, bei der sie, Henriette, am Vorabend stundenlang Beignets hätte backen müssen, weil die zuständige Magd sich tags zuvor beim Melken den Arm gebrochen hätte. »Die Braut sah wunderschön aus«, fährt sie begeistert fort. »So zierlich wie du, Marie! Und sie trug an diesem Tag die Anstecknadel ihrer verstorbenen Großmutter Magali am Ausschnitt.«
»Magali? Arsènes erste Frau?«
»Ja. Sie starb 1910. Es sei ein Blutsturz gewesen, sagt man … Ihre Hochzeitsnadel – un bijou, Marie! Elf Orangenblüten mit goldenen Stempeln, die Blätter kunstvoll aus Golddraht geformt. Einzigartig!«
Vor der Treppe nimmt Marie ihr beherzt die Kiepe ab, die überraschend schwer ist: Neben der bestellten Wolle und Henriettes Waschzeug (sie bleibt heute wie ausgemacht über Nacht), hat sie zwei harte Würste, ein Stück Schinkenspeck und jede Menge Pflaumen aus ihrem Bauerngarten mitgebracht, gelbe und blaue … Während Marie mit dem Tragkorb in der Hand nahezu mühelos die Stufen erklimmt, zieht sich Henriette, die um die Hüften etwas fülliger geworden ist, wie Marie festgestellt hat, mit beiden Händen am Geländer hoch, Tritt um Tritt – wobei die Finken und Girlitze in der Volière lärmen, als ob sie ihr Beine machen wollten.
Auf der Aussichtsplattform angekommen, stellen sich die Freundinnen nebeneinander an die Mauer, um einen Blick auf das Kunterbunt der unter ihnen liegenden Wälder, Felder und Wiesen zu werfen, aber vor allem auf die Orte Couiza und Espéraza, wo gemeinsame Bekannte leben. Erst der klagende Schrei eines Mäusebussards, der sich direkt vor ihren Augen in den blauen Himmel schraubt, holt sie in die Gegenwart zurück. Endlich betreten sie den Pavillon, dessen Türen auf Durchzug stehen. Mit einem erleichterten Stöhnen lässt sich Henriette auf eine der Bänke fallen und streckt die müden Beine aus. »Sieh nur, Marie, meine Stiefel sind wie früher rostrot vom Staub!«
Nachdem sich beide erfrischt haben, wird der dicke Wiesenblumenstrauß, der auf dem Tisch steht, bewundert. Den hätten ihr die Dorfkinder am Morgen gebracht, erklärt Marie. »Ich bereite die Kleinen nämlich wieder auf die Erstkommunion vor. Wie früher. Das hält mich jung!«
»Och, das freut mich aber für dich, Marie!«, meint Henriette. »Die Last, die man liebt, ist nur halb so schwer … Und Arbeit, die Freude macht, ist schon zur Hälfte fertig!«, setzt sie unnötigerweise nach. »Sag mal, lacht mich da etwa dein berühmt-berüchtigter Brombeerlikör an, der Farbe nach?« Sie deutet auf die kleine Glaskaraffe mit Stöpsel.
»Aber ja, meine Liebe! Für nach dem Kaffee.«
»Der ja auch schon bereit steht, wie ich sehe. Fleißige Marie!« Und plötzlich – Marie bleibt das Herz fast stehen – beginnt die Freundin den altbekannten Werbespruch zu trällern: »Hält kalt und heiß, ohne Feuer, ohne Eis! … Tja, nur Saunière konnte sich schon damals eine doppelwandige Silberkanne leisten!«, schiebt sie hinterher – muss dann aber selber lachen.
Henriette, wie sie leibt und lebt!, denkt Marie und lächelt nachsichtig. Sie deckt den Tisch zu Ende und zieht dann mit einem nicht minder beseligten »Voici!« das Tuch vom großen Kuchenblech: »Johannisbeeren mit Sauerrahm und – Mandeltörtchen!«
»Oh! Etwa die mit Rosenwasser?«
»Nach dem Rezept meiner Mutter, ja.« Marie schenkt Kaffee ein, verweist auf die Crème fleurette, verteilt Kuchenstücke und Törtchen. Schließlich setzt sie sich mit einem Aufatmen Henriette gegenüber. Die Tassen in den Händen, lächeln sich die Freundinnen zu. Die Vorfreude auf die nächsten Stunden, in denen die Ereignisse von früher wohl wie überreife Erbsen aus der Schote aufs Tapet kullern werden, steht ihnen ins Gesicht geschrieben. Dass sich Henriette jedoch als Erstes nach Bérengers Rechtsstreit mit der Kirche erkundigt, verblüfft Marie. »Aber du warst doch damals noch in Rennes!«
»Meine gute Marie«, antwortet Henriette, mit einem Mal seltsam gestelzt, »wann immer ich in diesen Jahren etwas hinterfragt habe, hast du den Finger auf den Mund gelegt! Das soll kein Vorwurf sein, vielleicht durftest du ja nicht reden. Aber heute, nach Saunières Tod, ist die Sache doch eine andere, oder?«
»Natürlich, meine Liebe. Dann nur zu, stell mir Deine Fragen!«
Tartelettes aux amandes à la mode de maman
(Mandeltörtchen nach Art der Mutter)
Für den Teig
250 g Mehl
30 g Butter
1 Ei
1 Eigelb
3 EL Wasser
Für die Füllung
250 g Mandeln
Rosenwasser, aber sparsam
3 Eiweiß
1/8 ltr. frische Sahne
125 g Zucker
Zum Bestreichen
1 Eigelb
1 EL Rosenwasser
Mürbteig zubereiten und 2 Stunden kühl stellen,
Mandeln mahlen und mit Rosenwasser beträufeln,
Eiweiß steif schlagen, Mandeln, Sahne und Zucker unterrühren.
Mürbeteig in kleine Förmchen geben, Rand formen.
Mandelmasse einfüllen. Backen bis die Ränder braun werden.
(E: 180 °, ca. 45 Min.)
Zum Schluss mit dem Gemisch aus Eigelb und Rosenwasser bepinseln
und nochmals 5 - 10 Minuten weiterbacken.
Creme de mûres à la Marie
(Maries Brombeerlikör)
1,5 kg Brombeeren
2 ltr. Rotwein
700 g Zucker
Brombeeren gut waschen, abtropfen lassen,
dann mit dem Rotwein aufkochen. Durchpassieren.
Zucker hinzugeben (immer etwa halb soviel wie Früchte!)
24 Stunden stehen lassen.
Dann abermals zum Kochen bringen
und 10 Minuten kochen lassen.
In Flaschen abfüllen.
2 __________ Der neue Bischof in Carcassonne
Paul-Félix Beuvain de Beauséjour 1839 - 1930
»Was genau hat man Saunière eigentlich angelastet, Marie, dass er nicht mehr Priester sein durfte? Weil er es zu etwas gebracht hat?«
Zu etwas gebracht? Marie spürt das Kribbeln in ihrem rechten Mittelfinger, wie manchmal, wenn ihre Gefühle in Wallung geraten. Sie atmet tief durch. »Im Grunde ging es damit los«, sagt sie, »dass der neue Bischof von Carcassonne, Monseigneur Beauséjour, ihm im Jahr 1909 – nach einer Visitation – plötzlich vorwarf, sich an den Gebühren für die Seelenmessen bedient zu haben. Ganz oder teilweise, wie er schrieb. Außerdem habe er mit diesen Geldern Bauarbeiten und Reparaturen in Rennes ausgeführt, sowie – wörtlich! – sehr kostspielige und völlig nutzlose Bauten errichten lassen, die sich überdies gar nicht in seinem Besitz befinden würden, wie es hieß.«
Henriette, die Stirn gerunzelt, legt das Törtchen, das sie in der Hand hält, auf ihren Teller zurück. »Damit spielte er wohl auf die Villa und den Turm an, nicht wahr? Aber was bedeutet: nicht in seinem Besitz? Vor Saunières Tod gehörte doch alles ihm!«
Marie zögert keine Sekunde. »Eben nicht!«, sagt sie. »Alle neuen Gebäude waren tatsächlich auf meinem Grund und Boden errichtet worden.«
Mit einem Mal erröten sich Henriettes Wangen wie die eines kleinen Kindes. »Auf deinem Grund? Aber woher … Ich meine, du warst doch vormals nur eine einfache Hutmacherin?«
Marie greift zur Kanne und schenkt ihr nach. Sie selbst trinkt einen großen Schluck Wasser. Wahrheitsgetreu erzählt sie, dass Bérenger sie bereits im Jahr 1892 testamentarisch zu seiner Allein- und Universalerbin bestimmt hätte. »Und nach der Beglaubigung durch den Notar«, fährt sie fort, »hat er die erforderlichen Grundstücke eben auf meinen Namen erworben.« Schnell schiebt sie noch hinterher, es hätte sich dabei auch um eine Vorkehrung gehandelt – in Anbetracht der Unsicherheiten und Spannungen, die schon damals der späteren Trennung von Kirche und Staat vorausgegangen seien.
»Hach!«, entschlüpft es Henriette. »Das alles habe ich nicht gewusst, Marie. Keiner der Dörfler wusste das. Aber offenbar ist es dem neuen Bischof zu Ohren gekommen.«
»So war es. Als die Anklage eintraf, hat Bérenger mehrmals seine Ein- und Ausgaben für ihn aufgelistet und später sogar an Eides statt erklärt, dass das Gros der Gelder, die er für seine angeblich … nutzlosen Bauten eingesetzt hätte, aus ganz anderen Quellen stammte.«
Henriettes Augen leuchten plötzlich auf. »Und woher genau?«
Marie greift erneut zum Wasserglas … In ihrem Kopf taucht Bérenger auf: Wie er sich mit seinen verstaubten Kleidern in die Küche schleicht. Wie von seinem Arm Blut auf den Boden tropft. Wie er ihr zuraunt: »Gold! Ich habe Gold gefunden, Marie!«
»Woher diese Gelder waren?« Sie streicht sich nachdenklich übers Kinn. »Also, da muss ich etwas ausholen: Bérenger verfolgte nämlich einen Plan, einen Herzensplan, der vorsah, Rennes-le-Château eines Tages zu einem Heiligen Hügel auszubauen, und dafür …«
»Wie der Berg in Jerusalem?«, fällt ihr Henriette ins Wort.
»Aber nein«, entgegnet Marie. Ein Stirnrunzeln erscheint auf ihrem Gesicht. »Er benannte sein Vorhaben nur so! Es sollte schlicht ein Altersruhesitz für Priester werden. In seinen Memoiren schrieb er – man kann es nachlesen! –, dass er hier in Rennes ein großes und recht komfortables Haus gebaut hätte, um seine Tage in seiner alten Gemeinde zu beenden. Und dass er die Idee gehabt hätte, diese Villa nach ihrer Fertigstellung dem Bischof von Carcassonne als Altersheim für alte und gebrechliche Priester anzubieten. Es sei ja alles hier vorhanden: Eine Kapelle für die Messe, Bibliothek und Lesekabinett, verschiedene Gärten, Terrassen, Veranda, Spazierwege. Nichts sollte ihnen fehlen«, schrieb er wörtlich, »nicht einmal ein Platz auf dem Friedhof der Pfarrei nach ihrem Tod …«
Henriette nickt anerkennend. »Aber ja, tadellos sein Plan, Marie! Daran gab es doch nichts auszusetzen, oder?«
Marie zuckt die Achseln. »Sollte man meinen! Für die langen Sommermonate waren sogar Literatur- und Musikabende vorgesehen«, ergänzt sie noch, »hier oben auf dem Belvédère!«
»Und du hättest die alten Herren bekocht, alles klar!« Henriette klatscht fröhlich in die Hände. »Dieser Saunière aber auch!«, sie zwinkert Marie zu, »den Kopf stets voller Pläne. Hach, immer wenn ich in Arques an ihn denke«, schwärmt sie, »sehe ich ihn leibhaftig vor mir, wie er mit seinem geliebten Regenschirm zu seinem allsonntäglichen Nachmittagsspaziergang aufbricht … Aber du wolltest mir ja gerade erzählen, wie er an das Geld für seine Bauten kam … Für seinen Herzensplan!«, setzt sie nach.«
»Ach, er besaß, gottlob, stets gute Kontakte in den spendenfreudigen Adel«, antwortet Marie, »aber eben auch gute Ideen, um auf sich und sein Vorhaben aufmerksam zu machen: So ließ er eine Reihe von schönen Ansichtskarten anfertigen, ganze dreiunddreißig Motive, die Rennes und seine Umgebung zeigen. Diese Karten wurden aber nicht nur an Touristen und Badegäste unten in Rennes-les-Bains und anderen Badeorten erfolgreich verkauft«, fährt sie lebhaft fort, »Bérenger hat sie in großer Zahl auch kirchlichen Einrichtungen in ganz Frankreich zum Kauf angeboten.«
»Die Karten, aber ja, ich erinnere mich! Warst du nicht selbst auf einer zu sehen? Am neuen Brunnen? Du stehst und daneben sitzt Saunière – na, vermutlich mit seinem Schirm!« Sie lacht. »Aber ja, Marie, die waren wunderschön, diese Karten!«
Marie strahlt, so sehr freut sie sich. »Alle waren des Lobes voll gewesen, und den Text, den Bérenger auf die Rückseite drucken ließ, den hat er mit nichts nichts weniger als seinem Herzblut verfasst. Das kannst du mir glauben!«
»Das mache ich auch, Marie, unbesehen! Herzensplan, Herzblut … Sie lächelt breit und wedelt dabei auffällig mit der rechten Hand.
»Gleichwie, meine Liebe, es kam ordentlich Geld herein. Die Kasse klingelte. (Es ist nicht die ganze Wahrheit, denkt Marie bei sich, aber es ist zumindest eine!) Und über diese Karten«, fährt sie beflissen fort, »haben die Menschen eben nicht nur Rennes und seine Geschichte, sondern auch Bérenger kennengelernt. Als Priester und als Mensch!« Sie hält kurz inne … »Nun, es wird dich an dieser Stelle nicht groß überraschen, wenn ich dir erzähle, dass sich unter den begeisterten Rückmeldungen aus den Klöstern und Hospizen auch nicht wenige Bitten zum Gedenken an die Verstorbenen befanden.«
»Heilige Mutter Gottes«, platzt es da aus Henriette heraus, »die vom Bischof verbotenen Seelenmessen! Jetzt kapiere ich den Zusammenhang, Marie …«
Marie nickt betrübt. »Es war fatal. Das neue Verbot bezog sich zwar nur auf Gebühren, die von außerhalb der Diözese eintrafen; Seelenmessen aus dem hiesigen Bistum waren weiter erlaubt. Womit wir allerdings, nach der Werbeaktion mit den Karten, nicht gerechnet hatten, war, dass gerade die Anfragen von außerhalb überhand nahmen! Was Bérenger vor dem Bischof übrigens nie geleugnet hat; er hat auch nichts beschönigt. Er habe alle diese Messen gewissenhaft abgerechnet, schrieb er ihm, und übernehme die volle Verantwortung für seine Handlungen. Man hat ihm dennoch die Amtsausübung bis zur Klärung des Falles entzogen …«
Marie beugt sich ein Stück vor. »Wie hätte er sich denn nach dem Verbot verhalten sollen, frage ich dich, Henriette? Die Bitten plötzlich zurückweisen? Als Priester? Als Seelsorger? Oder hätte er etwa nach Paris schreiben sollen: Tut mir leid, liebe Mutter Oberin, mein Bischof verbietet es mir jetzt? Wie wäre er vor den Nonnen dagestanden, die sich um das Seelenheil ihrer verstorbenen Mitschwestern sorgten, und das Jahr um Jahr, immer vor dem jeweiligen Todestag. Sie vertrauten Bérenger!«
Henriette bläst die Backen auf. »Das stimmt natürlich, was du sagst. Und wie ging es danach weiter?«
Marie hebt die Schultern. »Bérenger befand sich in ernster Gewissensnot«, sagt sie bedrückt. »Er musste sich entscheiden zwischen dem Gehorsam gegenüber seinem Vorgesetzten und seiner Pflicht als Seelsorger … Tja, und er hat sich für das Letztere entschieden, auch weil ihm zu Ohren gekommen war, dass der Bischof diese Gebühren zukünftig für sich selbst hat einziehen wollen. Wobei …«
»Ja, Marie?«
»Nun, ich habe mich insgeheim oft gefragt, ob die Unbeugsamkeit des Bischofs nicht auch mit Bérengers Weigerung zusammenhing, die Inventarliste zu unterschreiben. Das war damals, im Jahr 1905, als es endgültig um die Trennung von Staat und Kirche ging und alle Kirchengebäude in die Hände des Staats fielen.«
»Aber welche Inventarliste?«
»Da gab es einen Stichtag, zu dem das gesamte bewegliche und unbewegliche Inventar gewissenhaft gezählt und aufgelistet werden musste, denn es sollte geschätzt werden. Darunter fielen auch zahlreiche Gegenstände, für deren Finanzierung Bérenger ebenfalls gesorgt hatte – wie die zwei goldenen Messkelche, die goldene Monstranz, die neuen Stolen, Hemden und Soutanen, die Altar- und Tischtücher und so weiter …«
»Und weshalb hat Saunière die Liste nicht unterschrieben?«
Marie seufzt. »Weil er eben – wie weite Teile der Kirche – gegen diese Trennung war und die Republik ablehnte. Auch Bischof Billard, Beauséjours Vorgänger, war glühender Monarchist gewesen … Erinnerst du dich noch an Bérengers Antrittspredigt hier in Rennes? Nein? Ich mich schon: Es war ein strahlender Herbstsonntag gewesen, als er im Oktober 1885 – während der Wahlen! – mit donnernder Stimme von der alten, baufälligen Kanzel rief: »Hört auf meine Worte, Brüder und Schwestern von Rennes, die Republikaner sind die Feinde der katholischen Kirche! Diese Freigeister hindern euch daran, zur Messe zu gehen … Nun, die Republikaner siegten und Bérenger wurde vom französischen Religionsminister suspendiert. Zur Strafe musste er zurück ins Priesterseminar von Narbonne, um dort Latein zu lehren. Natürlich ohne Bezüge!«
»Daran erinnere ich mich. Wie lange war er damals weg gewesen?«
»Von Dezember 1885 bis Juli 1886. Erst, als die Dorfbewohner Druck gemacht haben, weil sie ihn wiederhaben wollten, hat ihn der Präfekt der Aude wieder in sein Amt eingesetzt … Aber zurück zur strittigen Inventarliste: Schlussendlich hat der Curé von Espéraza sie für ihn unterschrieben – und Bérenger hatte danach, offenbar für alle Zeiten, seinen Ruf im Bistum Carcassonne weg!«
Marie atmet einmal tief durch, dann erklärt sie Henriette, dass Bérenger dem Bischof wiederholt versichert hätte, dass er die Bauten weitgehend mit seinen Ersparnissen aus dreißig Jahren Amtstätigkeit hätte errichten lassen – sowie mit Zuwendungen von Personen, deren Namen er jedoch, bis auf wenige Ausnahmen, nicht nennen könne. Es sei ihnen Diskretion zugesichert worden. »Doch Beauséjour wollte dies einfach nicht akzeptieren«, fährt sie leise fort. »Als sich der Streit gefährlich hochschaukelte, sah sich Bérenger gezwungen, einen Anwalt mit seinem Fall zu betrauen: Maître Mis aus Limoux – der jedoch mit dem Kirchenrecht nicht so recht vertraut war und uns schlecht beriet. Als es dann noch im selben Jahr 1909 hieß, dass Bérenger Rennes sofort verlassen und die Pfarrei Sainte-Marie in Coustouge übernehmen müsse, andernfalls sei er seines Amtes endgültig enthoben, da wurde mir wirklich himmelangst, Henriette! Doch Bérengers neuer Anwalt – Abbé Huguet, dieses Mal ein Kirchenrechtler! – meinte damals, es käme einem Schuldeingeständnis gleich, wenn er in diese Versetzung einwilligte. Also blieben wir hier.«
»Und wie ging es weiter?«
»Die Fronten verhärteten sich. Schließlich bot Bérenger dem Bischof aus freien Stücken seinen Rücktritt an, doch als er zugleich darum bat, im hiesigen Presbyterium, also im Pfarrhaus, bleiben zu dürfen – sowie um die Gunst einer Privatkapelle – erboste das Beauséjour wohl derart, dass er dies nur akzeptieren wollte, wenn Bérenger Rennes für immer verließ. Aber das kam ja für uns nicht infrage. Wir drehten uns im Kreis.«
»Und dann hat man euch Abbé Marty vor die Nase gesetzt, ich verstehe.«
Marie nickt. »Der sich jedoch, du erinnerst dich vielleicht daran, im Tal eine Wohnung suchen musste, weil Bérenger das Pfarrhaus von der Gemeinde längst angemietet hatte, sogar für neunundneunzig Jahre. Das wiederum trieb den Bischof zur Weißglut. Zur verhängten Suspension a divinis, also dem Entzug der Weihegewalt auf Zeit, traf dann im Jahr darauf eine weitere Anklageschrift ein, in der man Bérenger Ungehorsam gegenüber dem Bischof vorwarf, und ihm eine Strafe aufbrummte: Zehn Tage Rückzug in ein Kloster seiner Wahl, um dort Exerzitien zu verrichten, also spirituelle Übungen. Nach dieser ‚Einkehr‘ hätte er jedoch abermals seine Finanzen offenlegen müssen. Nun, Bérenger entschied sich für das Kloster Prouille, das zur Gemeinde Fanjeaux gehört, zögerte seine Abreise jedoch mehrmals hinaus, um Zeit zu gewinnen, denn sein Fall lag damals ja schon in Rom. Im Kloster war er tatsächlich erst im April des Jahres 1911.«
»Also, daran erinnere ich mich noch. Auch, dass er dir aus diesem Kloster Briefe schrieb, nicht wahr?«
Marie lächelt. »Aber ja, das tat er! Nur leider war mit dieser Beugestrafe das Verfahren gegen ihn nicht aufgehoben. Es ging also weiter, immer weiter. Für uns Jahre voller Drangsal«, betont sie bitter.
»Aber er wurde dann doch freigesprochen, das war ja ein Erfolg!«
Marie senkt die Augen, schweigt für einen Moment. »Freilich haben wir uns gefreut, als es endlich hieß, der Fall sei unklar und der Vertreter der Anklage, also Bischof Beauséjour, habe nichts beweisen können … Doch Beauséjour hat dieses Urteil nicht akzeptiert. Und er saß am längeren Hebel. Er schrieb erneut nach Rom und warf uns nun Prachtentfaltung und einen aufwändigen Lebensstil vor. Als ob wir hier oben eine fürstliche Hofhaltung betrieben hätten! Und dann ging alles wieder von vorne los. Ich kann dir gar nicht sagen, Henriette, wie oft Abbé Huguet, der Kirchenanwalt, für uns im Zug nach Rom saß! Als Bérenger dann im Frühling 1915 – also nach insgesamt sechs Jahren Streit! – endgültig seines Amtes enthoben wurde, war das, Schande und Schmach, fast wie ein Befreiungsschlag für uns gewesen.«
»Furchtbar, Marie! Und wie lautete schließlich dieses endgültige Urteil?«
Marie winkt müde ab. »Die Seelenmessen waren ja bereits vom Tisch: Dafür Freispruch. Abschließend warf man Bérenger Aufsässigkeit und beleidigendes Verhalten gegenüber seinem Vorgesetzten vor. Rom ließ ihn jedoch wissen, dass eine Strafmilderung in Betracht gezogen würde, falls er Abbitte leiste.«
»Aber ein Kniefall verbot sich für Saunière.«
»Natürlich – und ich glaube, den hat auch keiner erwartet.«
»Tapfere Marie!« Henriette greift nach Maries Hand.«