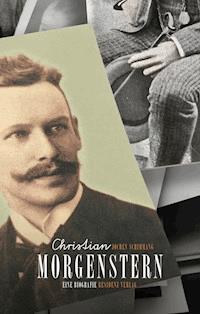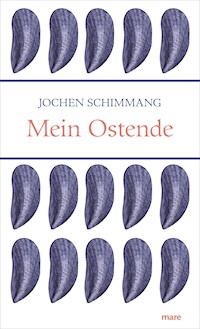Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Nautilus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Vor 50 Jahren, im August 1969, starb Adorno – und Jochen Schimmang übt sich in Abwesenheitspflege. In melancholischen bis heiteren, zum Teil autobiografisch gefärbten Geschichten erzählt er von Formen und Figuren des Verschwindens. Von Menschen, Gebäuden, ganzen Vierteln; von Techniken, Gesten, Sprechweisen. Ein Jubilar versteckt sich mit seiner Frau auf dem Dachboden vor seinen Freunden, die zum 70. Geburtstag aus allen Himmelsrichtungen auf ihn einstürmen, obwohl er viel lieber nur mit zweien von ihnen essen gegangen wäre. Rothermund macht sich auf die Suche nach dem verschwundenen Maler Guthermuth. Ein Spaziergang durch Frankfurt zeigt, wer, außer Adorno, noch alles nicht mehr dort wohnt. Aber Spaziergänge sind ohnehin sterbende Institutionen, ein Sich-Verirren in der Welt kann zum Verwirren der Welt werden. Milieus, die sich nicht mehr erreichen, Nomaden in Monaden. Nur Gott ist nicht verschwunden, er taucht pünktlich um halb sieben in der Kirche auf – im Fischgrätmantel. Jochen Schimmangs feinsinnige Erzählungen gehen auf Spurensuche nach Lücken und Verlusten und zeigen zugleich, dass "Identität" eine höchst fragile Konstruktion ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 235
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jochen Schimmang
Adorno wohnt hier
nicht mehr
Erzählungen
Nautilus
Der Autor dankt dem Deutschen
Literaturfonds für die Förderung der
Arbeit an diesem Buch.
Dank an Paola Dannenberg, Rolf Laube,
Hans-Helge Ott, Gerd Riese und die
freundliche Frau aus dem Kettenhofweg 123
für wertvolle Hinweise und Informationen.
Mein größter Dank gilt Wolfgang Utschick
für Gastfreundschaft, Geduld und die
gemeinsamen Gänge durch den Frankfurter
Sommer. Dieses Buch ist ganz besonders
für ihn.
Edition Nautilus GmbH
Schützenstraße 49 a · D - 22761 Hamburg
www.edition-nautilus.de
Alle Rechte vorbehalten
© für diese Ausgabe Edition Nautilus 2019
Die Erzählung »Die Endspielmaschine«
wurde erstmals abgedruckt in:
WESPENNEST, Heft 153, November 2008
Alle anderen Texte sind
Originalveröffentlichungen
Erstausgabe Juli 2019
Umschlaggestaltung:
Maja Bechert, Hamburg
www.majabechert.de
ePub ISBN 978-3-96054-201-8
Inhalt
Gutermuth und Rothermund
Gott um halb sieben
Adorno wohnt hier nicht mehr
Happy Birthday, alter Künstler
Herr Rutschky oder Der Optimismus
Valerie Voss, Abwesenheitspflegerin
Die Endspielmaschine
Mia san mia.
Bayrische Vereinsweisheit
Identität ist die Urform von Ideologie.
Adorno, Negative Dialektik
Gutermuth und Rothermund
I
Die Augen einen Spaltweit geöffnet, vorsichtig tastender Blick, der zuerst kaum mehr erfasst als eine unbestimmte Morgendämmerung. Ein Streifen milchigen Lichts, der durch die nicht ganz geschlossene Jalousie fällt. Im Bad nebenan das helle Geräusch fließenden Wassers, jetzt zum Stillstand gebracht, dann der bellende Raucherhusten eines älteren Mannes. Eines älteren als ich. Zielsicherer Griff zur Nachttischlampe, vor dem Einschlafen eingeübt. Ihr Licht klar und hell, aber sanft beschirmt. Du bist auf vertrautem Gelände, sagt es, das ist dein Stück Welt an diesem Morgen. Du bist in der Welt, du bist nicht herausgefallen. Nichts Heimatlicheres, nichts Intimeres als ein Hotelzimmer kurz nach sieben Uhr früh, endlich allein.
Die ganze Zeit seit meiner Ankunft gestern Nachmittag war ich betreut worden. Als könne man einen Philosophen nicht allein durch die Welt laufen lassen; als würde er sein Hotel nicht finden, nicht die Universität und nicht den Hörsaal, in dem er seinen Gastvortrag halten soll. Als sei der Philosoph dadurch gekennzeichnet, dass er ein gestörtes, weil zu vergrübeltes Weltverhältnis habe.
Also wurde ich am Hauptbahnhof abgeholt und in mein Hotel gefahren, das nur wenige Straßen vom Bahnhof entfernt lag. Also wurde ich nach einer Stunde zu einem »kleinen Imbiss« mit meinem Gastgeber abgeholt, also wurde ich nach dem Vortrag in größerer Runde zu einem Essen ausgeführt, das immer lärmender wurde, je länger es dauerte. Nicht einmal den Weg zurück in mein Hotel ließ man mich allein machen, zu Fuß oder in einem Taxi, sondern eine tapfere wissenschaftliche Hilfskraft, die den ganzen Abend nüchtern geblieben war, fuhr mich dorthin. Ein Wunder, dass man mich wenigstens allein ins Hotel und in mein Zimmer ließ.
Nun aber der vollkommene Frieden eines Hotelzimmers in der Frühe eines gewöhnlichen Märztages, eines Freitags. Der ältere Mann nebenan verließ schon sein Zimmer. Ich hörte schwach, wie er die Tür zuzog, die von außen nicht mehr abgeschlossen werden musste. Man kam nur mit einer dieser gelochten Chipkarten ins Zimmer, die in den Hotels mehr und mehr die alten klobigen Schlüssel ablösen.
Ich griff nach dem Buch auf meinem Nachttisch, einem abgewetzten Taschenbuch mit rotem Einband, dessen orange Titelschrift auf dem Buchrücken schon beinahe verblasst war. Die Jefferson Street ist eine stille Straße in Providence, las ich. Ich hatte dieses Buch schon vier- oder fünfmal gelesen, es war seit mehr als vierzig Jahren in meinem Besitz. Als ich darin bis zu der Stelle gekommen war, wo der Erzähler einen Greyhound-Bus besteigt, legte ich es beiseite, ging unter die Dusche und dehnte den letzten ganz und gar geschützten Moment des Tages ins beinahe Unendliche, bis meine Haut vom Wasser fast aufgeweicht war.
Als ich nach dem Frühstück das Hotel verließ, sah ich mich zuerst nach allen Seiten um wie einer, der sich verstecken muss. Nicht ganz ohne Grund. Ich hatte meine Gastgeber von der Universität nur davon abbringen können, mich auch noch an diesem Tag zu betreuen, indem ich vorgegeben hatte, schon den allerersten Zug um sechs Uhr elf nehmen zu müssen. Es wäre nicht angenehm gewesen, wenn ich der wissenschaftlichen Hilfskraft oder gar Professor Herbach selbst begegnet und meine Lüge aufgeflogen wäre.
Ich blieb also einen kurzen Moment auf der Schwelle zwischen innen und außen, bevor ich auf den Bürgersteig trat und mich ein böiger Windstoß endgültig in den Tag zerrte. Eben noch hätte ich umkehren und die vor fünf Minuten besiegelte Verlängerung meines Aufenthaltes im Hotel rückgängig machen, hätte meine Sachen packen und zum Bahnhof gehen können. Nun war ich draußen und sah Mülleimer säuberlich vor den Häusern aufgestellt, sah einen Transporter, der versuchte, sich aus der Einkeilung durch zwei Autos zu befreien, sah und hörte, wie auf der anderen Straßenseite rasselnd die Jalousie vor einem feinen Schmuckgeschäft hochgezogen wurde. Zwei Frauen in leichten dunklen Wollmänteln gingen an mir vorüber, sicher auf ihrem Weg ins Büro, die Taschen jeweils über der rechten Schulter. Aus der Gegenrichtung kam – schleppender Schritt, bei dem er das linke Bein leicht nachzog – ein alter Mann mit einem beinahe überquellenden Einkaufstrolley. Im ersten Stock des Hauses neben dem Schmuckgeschäft stieß jemand das Fenster auf, und man hörte in Straßenlautstärke ein Streichorchester spielen. Aus einem Hauseingang kam schnüffelnd ein Hund ohne Begleitung. Und wie so die Welt langsam aufging in dieser Stadt, brach plötzlich hinter den eher milchig weißen als grauen Wolken auch die Sonne hervor.
Nie zuvor war ich in dieser Stadt gewesen. In gewisser Weise war sie die vollkommene Stadt. Sie war nicht klein und nicht riesengroß. Man verband mit ihr nicht irgendeine Bedeutung, das war das Freundliche an ihr. Sie war keine Hauptstadt, nicht die Stadt des Rattenfängers, des Lügenbarons oder des Dichterfürsten. Sie war auch nicht die Stadt des Tangos oder eines besonderen Gebäcks. Sie war keine Textilmetropole und keine Chemiestadt. Sie war nicht die Hauptstadt der Mode oder der Banken. Sie war eine Industrie- und Handelsstadt, aber eine zweitrangige, sie hatte eine Universität, aber eine mittelmäßige, sie hatte einige Museen, deren Ruf blass blieb. Ein Fluss zerschnitt sie in zwei ungleiche Teile, aber über den Fluss gab es keine herzbewegenden Lieder oder preisgekrönten Dokumentarfilme. Die Straßen waren breit und zumeist gerade, viele kreuzten sich und bildeten im Zentrum ein Schachbrettmuster. Die beiden größten, die sich im Zentrum schnitten, waren von Platanen gesäumt, so dass ich mich einen Augenblick lang in einer französischen Stadt wähnte.
An einer Ecke entdeckte ich ein Museum, das einem einheimischen Maler gewidmet war, 1931 gestorben. Es gab also doch so etwas wie einen Sohn der Stadt, einen berühmten zwar nicht, aber wenigstens einen bekannten – für die Eingeweihten. Es reicht sicher für den Eintrag unter Söhne und Töchter der Stadt im Wikipedia-Artikel, dachte ich. Er hieß Robert Gutermuth, und ich hatte noch nie von ihm gehört. Aber die von ihm gemalte Stadtansicht, die ich auf einem Plakat am Eingang sah, gefiel mir: ein Blick von einer Brücke auf eine sich ausfransende Vorstadtlandschaft, mit Fabriken, Schuppen, Schrottplätzen und Schrebergärten, im Hintergrund das Zentrum. Ich ging hinein und war der einzige Besucher. Die Bewohner der Stadt hatten zu tun.
Vier Räume hatte das Museum. Die Stadtlandschaften, wie ich draußen eine gesehen hatte, füllten den ersten Raum, von sehr kleinen bis zu großen Formaten. Ein Teil der Bilder zeigte die Stadt, in der ich mich gerade befand, der andere das Berlin der zwanziger Jahre des letzten Jahrhunderts. Das waren die beiden Lebensstationen von Robert Gutermuth gewesen. Drei Jahre vor seinem Tod war er wieder in seine Geburtsstadt zurückgekehrt. Im zweiten Raum fanden sich Portraits, oft von Kaufleuten, Industriellen und Funktionsträgern der Stadt. Ich entdeckte aber auch ein Portrait von Franz Hessel, dem Gutermuth in Berlin begegnet sein musste. Der dritte Raum hieß Die Reise nach Cornwall. In dem Büchlein, das ich mir zusammen mit der Eintrittskarte gekauft hatte, wurde erzählt, dass Gutermuth auf Kosten eines Mäzens im Jahr 1911 zwei Monate in Cornwall gewesen war. Der Ertrag der Reise hing jetzt in diesem Raum. Es handelte sich weniger um Bilder von schroffen Steilküsten, vom Meer und von malerischen Orten an der Küste, obwohl auch das dabei war. Die Mehrzahl der Bilder zeigte die Zinn- und Erzminen, die damals noch arbeiteten, zeigte Fördertürme und Maschinenhäuser. Auf zwei Bildern waren auch Bergleute zu sehen, die abends im Pub zusammen ihr Bier tranken.
Im vierten Raum, dem kleinsten, hing nur ein einziges Bild in einem sehr großen Format. Es zeigte die Stadtlandschaft, die auf dem Plakat am Eingang des Museums zu sehen war. Auf dem Plakat war jedoch nicht zu ahnen gewesen, wie groß das Bild war. Ich führte die übliche Schrittfolge eines Museumsbesuchers aus, der vor einem monumentalen Bild steht, nah heran und dann wieder drei Schritte zurück, nach links, nach rechts und so weiter. Schließlich setzte ich mich auf einen Stuhl, der in angemessener Entfernung vom Bild stand. Menschen sah man auf ihm nur von oben, von der Brücke: unscharfe Figuren in einer gegenständlichen Welt, die ihrerseits in überdeutlichen Konturen gemalt worden war, so scharf abgegrenzt, wie sie sich dem natürlichen Blick niemals darbietet. Über der Stadt hing eine fahle Sonne. Endlich ging ich zu dem Schildchen links neben dem Bild und las: Märzlicht, Öl auf Leinwand, 250 x 250 cm, 1930.
An der Kasse erklärte man mir den Weg zu der Brücke. Draußen überflog ich noch einmal das Büchlein und begriff zum ersten Mal, dass Gutermuth 1931 nicht verstorben, sondern verschwunden war. Er war eines Vormittags aus dem Haus gegangen und nicht dorthin zurückgekehrt, auch sonst nirgendwo gesehen worden. »Aus dem Haus gegangen« war hier keine Metapher. Eine Nachbarin hatte ihn wirklich aus dem Haus gehen sehen, um elf Uhr morgens. Er war damals vierundvierzig Jahre alt. Obwohl Gutermuth allein gelebt hatte, dauerte es nicht lange, bis man ihn vermisste, weil er Termine wegen eines großen Auftrags nicht wahrnahm, den er von einem ortsansässigen Kaufmann erhalten hatte. Alle Nachforschungen blieben ergebnislos; Gutermuth blieb verschwunden.
Geschichten dieser Art sammle ich seit vielen Jahren. Das Schönste an der Welt wird für mich mehr und mehr, dass man noch immer in ihr verschwinden kann, auch wenn es von Jahr zu Jahr schwieriger wird. Das ist meine Art der Weltfrömmigkeit. Von allen Seinsweisen der Welt ist diejenige als Versteck für mich die faszinierendste. Ich las alle Bücher über Verschollene, egal, ob fiktiv oder real. Gutermuths Geschichte kannte ich noch nicht, und das erstaunte mich etwas. Aber ich hatte ja zuvor auch von Gutermuth noch nichts gehört.
Ich ging jetzt über die Brücke in die Vorstadtlandschaft hinein, auf die ärmliche Seite des Flusses. Das Märzlicht machte die Umrisse der Dinge in der Tat sehr klar und scharf, wenn die Konturen auch nicht so hart umrissen waren wie auf dem Bild. Es war ein Uhr mittags, und zu meiner Überraschung wärmte die Märzsonne tatsächlich. Beinahe war es der erste warme Tag des Jahres. Ein Tag für einen Aufbruch, dachte ich, und wanderte jetzt durch die Landschaft, die Gutermuth gemalt hatte. Manches hatte sich naturgemäß geändert, das ehemalige Industriequartier hatte sich in ein Gewerbegebiet verwandelt, und die hohen Backsteinbauten von damals beherbergten heute Firmen, die Namen wie Meinders Personal Consulting, New Line Software oder WestLogistik trugen. Manche der alten Bauten waren ganz abgerissen worden und hatten containerähnlichen Flachbauten Platz gemacht, auf denen sich Schilder mit ähnlich kryptischen Namen fanden. Je weiter ich mich vom Fluss entfernte, desto mehr franste das Gelände aus. Zuerst kamen noch einige Straßen mit Wohnhäusern, dann folgten die Schrebergärten, die noch kaum belebten Gärten im März. Vereinzelte Krokusse leuchteten, gleichsam noch etwas misstrauisch und vorsichtig.
Kurz verschwand die Sonne hinter einer großen grauen Wolke, ein Wind kam auf und blies fünf Minuten heftig, dann legte er sich, die Sonne kehrte zurück. Zwischen zwei Gärten saß ein Maler vor seiner Staffelei, dick vermummt in einer winterlichen Jacke, um deren Kragen ein Schal geschlungen war. Er trug Handschuhe. Ich blieb in einiger Entfernung stehen und sah ihm beim Malen der Gärten zu, sah zu, wie langsam ein Bild in der Art Gutermuths entstand. Vielleicht hatte die durch das Museum gepflegte Erinnerung an den Maler zur Herausbildung einer Art Gutermuth-Schule in den nachfolgenden Generationen beigetragen.
Ich zog das Büchlein aus meiner Manteltasche und verglich die wenigen Abbildungen darin mit dem, was ich auf der Staffelei entstehen sah. Die Parallelen waren verblüffend. Zögernd ging ich auf den Maler zu, das Büchlein noch immer in der Hand. Er warf einen Blick darauf und sagte:
»Ja? Möchten Sie mich etwas fragen?«
Wir waren lange durch die Stadt gegangen, hatten schließlich in einem Restaurant gegessen, doch die eigentliche Geschichte wollte mir Rothermund nur in meinem Hotelzimmer erzählen. Vom Restaurant zum Hotel waren es zehn Minuten Fußweg in der fortgeschrittenen Dämmerung, in der plötzlich in den Straßen die Laternen aufflammten und um sich dieses tröstliche, vielversprechende Zwielicht schufen, das ich so liebe. Bevor wir das Hotel betraten, ließ Rothermund sich noch einmal von mir versichern, dass ich niemandem diese Geschichte weitererzählen würde, die er mir auch nur deshalb anvertraute, weil ich ortsfremd war und zur Stadt keine weiteren Beziehungen hatte. Ich hatte noch immer keine Ahnung, worum es gehen mochte, bis er oben in meinem Zimmer sagte:
»Also, ich bin Gutermuth.«
Im ersten Moment verstand ich gar nicht, was er sagte, und dann schüttelte ich den Kopf.
»Gutermuth wäre heute gute hundertdreißig Jahre alt, wenn er noch lebte, und so sehen Sie mir wirklich nicht aus.«
Rothermund, der Gutermuth zu sein behauptete, antwortete:
»Gutermuth ist immer so alt, wie ich bin, und keinen Tag älter.«
Ich begann nun zu begreifen und unterbrach ihn nicht mehr, als er mir zügig und ohne Schnörkel die ganze Geschichte erzählte.
Die Stadt, in der ich am Morgen erwacht war, hatte immer darunter gelitten, dass sie, außer im unternehmerischen Bereich, niemals einen großen Sohn oder eine große Tochter hervorgebracht hatte. Besonders der Kulturdezernent litt darunter, aber auch der Oberbürgermeister und die anderen maßgeblichen Herren und Damen in der Stadt. Als Rothermund eines Tages erkannt hatte, dass er ein zwar guter, aber nicht überragender Maler werden würde, führte er ein sehr geheimes Gespräch mit dem Kulturdezernenten, dem eine ganze Reihe von Gesprächen mit anderen Funktionsträgern folgte. Über keines davon gibt es schriftliche Zeugnisse, nicht die geringste Aktennotiz. Auch der Vertrag, den die Stadt mit Rothermund schloss, damit er Gutermuths Bilder malte und seine Biografie erfand (die dann ein arbeitsloser Kunsthistoriker schrieb, der später die Leitung des Museums übernahm), war nur mündlich geschlossen worden und galt weiterhin per jährlichem Handschlag.
»Ich soll nun noch eine kleine Serie Schrebergärten malen, die der Stadt aus dem privaten Vermächtnis eines in Amerika gestorbenen Millionärs übereignet werden, dann ist meine Mission beendet. Wenn noch zu viele alte Gutermuths entdeckt werden, wird das unglaubwürdig.«
»Und was wird dann aus Ihnen? Wie verdienen Sie dann Ihr Geld?«
»Nun, die Stadt hat mir bisher meine Arbeit vergütet. Danach wird sie mir mein Schweigen vergüten. Ich fordere keine unbilligen Summen. Ich möchte nur mein Auskommen haben und reisen können. Ich bin offiziell im Übrigen Angestellter des Kulturamts, für besondere Aufgaben. Meine Bank muss ja auch wissen, woher regelmäßig das Geld kommt und dass alles seine Ordnung hat.«
Die Konstruktion der Biografie war das schwierigste Stück Arbeit gewesen. Die Zeitzeugen und Familienangehörigen, die etwas zu Gutermuth gesagt hatten, mussten selbstverständlich alle verstorben sein – auch jene Frau, die ihn damals aus dem Haus hatte gehen sehen. Nachkommen hatte er nicht. Ein Grab für ihn wäre zu aufwendig gewesen, deshalb war er einfach verschwunden.
»Schließlich ist er eines Tages auch einfach aufgetaucht«, sagte Rothermund jetzt. »Er ist meiner Kenntnis nach der einzige Verschwundene, den es niemals gegeben hat. Manchmal melden sich bei der Stadt noch alte Menschen, die behaupten, ihn 1952 in Zürich oder 1966 in New York gesehen zu haben. Wir nehmen das natürlich dankbar auf und streuen es in der Presse, denn das gibt ihm mehr Wirklichkeit. Mehr Fleisch, gewissermaßen. Am schwierigsten wird es sein, ihn in die Kunstlexika zu schmuggeln. Bisher haben wir das erst in einem Fall geschafft.«
»Die hiesigen Stadtlandschaften, auf zwanziger Jahre getrimmt«, sagte ich, »das kann ich nachvollziehen. Aber wie haben Sie das Berlin von damals hinbekommen? Und das alte Cornwall der Zinnminen?«
»Nun, es gibt Fotos, und es gibt Bilder von damals«, sagte Rothermund. »Und oft malt es sich nach Fotos und Bildern besser als nach der Wirklichkeit.«
Es war schon neun, als ich am nächsten Morgen erwachte. Den Frühstücksraum okkupierte eine lärmende Reisegruppe, deren Angehörige sich über die Tische hinweg unterhielten. Wir hatten Samstag, wahrscheinlich waren sie am Abend zuvor angekommen. Ich konnte mir nicht vorstellen, was sie in dieser Stadt suchten. Wie potenzielle Bewohner des Gutermuth-Museums sahen sie nicht aus. Ich ging gleich wieder nach oben und packte meine Sachen. Dann zahlte ich und ließ meine Tasche an der Rezeption verwahren. Ich schlenderte zum nächsten Buchladen, kaufte mir Gutermuths Biografie und las in einem Café beim Frühstück das Kapitel über sein Verschwinden. Gutermuth hatte es natürlich einfacher gehabt als ich, weil er nie gelebt hatte.
Die Sonne kam nur ab und zu durch den Dunst, der den blauen Himmel und die weißen Wolken des gestrigen Tages abgelöst hatte. Es war kühl, aber fast windstill. Der Tag war nicht wirklich grau und bleiern, eher diesig und luftig zugleich. Genau der richtige Tag, fand ich.
Ich ging zum Hotel zurück, ließ mir meine Tasche geben und ein Taxi rufen. Eine junge Frau mit dunklem Haar und einem großen leeren Gesicht kam aus dem Fahrstuhl, einen Stadtplan in der Hand. Bevor sie zum Ausgang ging, zögerte sie einen Moment und sah mich prüfend an. Ich konnte mich nicht erinnern, sie je zuvor gesehen zu haben. Vielleicht hatte sie aber mich schon einmal gesehen. Vielleicht hatte sie mich einmal irgendwo bei einem Vortrag erlebt; vielleicht war sie sogar eine ehemalige Studentin von mir. Ich vergesse leicht Gesichter. Dann wandte sie ihren Blick ab und verließ das Hotel. Sie ist vielleicht die Frau, dachte ich in diesem Moment, die später sagen wird, sie habe mich noch an diesem Morgen in diesem Hotel gesehen, kurz nach zehn. Jeder Zweifel ausgeschlossen.
Dann kam der Taxifahrer ins Foyer, ein junger Asiate. Er nahm meine Tasche; ich folgte ihm zum Wagen und stieg ein. Er sah mich an und wartete, und als ich nichts sagte, fragte er schließlich:
»Wohin fahren wir?«
»Ins Blaue«, sagte ich. »Fahren Sie los.«
Gott um halb sieben
Daumen und Zeigefinger der linken Hand halten den rot-gelb und schwarz geschuppten Leib des Fisches, und der Daumen der rechten klappt die Schwanzflosse auf: dann liegt das Feuerzeug frei. Sie hätte sich auch für türkis-schwarze Schuppen entscheiden können oder für blau-weiß, ganz maritim. Das kleine Feuerzeug dazu muss sie extra kaufen. Es knackt hörbar, als es in den Hohlkörper gedrückt wird, »und wenn es leer ist«, sagt die Verkäuferin, »müssen Sie es mit der Zange rausziehen, anders geht es nicht«. Das ist nicht die Verkäuferin, denkt Simone, das ist die Chefin selbst. Eine von denen, die sich mittags bei Enzo Meeresfrüchtesalat bestellen oder schwarze Tagliatelle und sich über die kleinen Tische hinweg mit den Kolleginnen vom Schmuck, von den Hüten oder von der Wellness unterhalten. Zwei Schichten Schminke, und es hilft alles nichts gegen die Melancholie. Manchmal hilft Prosecco.
In diesen Tagen haben sie kaum Zeit für Enzo und brauchen ihn nicht. Keine verlässt das Geschäft für mehr als eine Espressolänge, soweit man nicht ohnehin den eigenen Kaffeeautomaten im Laden hat. In der restlichen Zeit stehen sie wachsam an der Kasse wie früher der Wächter am Burgtor. Draußen im schmutzig-warmen Dezemberdunkel zieht die Karawane vorbei, und oft lösen sich ganze Kamelrudel und betreten das Geschäft. Keine Weihnachtsmusik, nirgends auf der Straße. Wer das will, muss zu Karstadt oder in den Kaufhof gehen. Hier ist Rock, Pop, HipHop wie üblich. Business as usual, mit besten Resultaten. Eine Woche vor dem Fest äußert sich der Einzelhandel zufrieden.
Zehn Grad plus, die vertraute warme Watteluft der Kölner Bucht. Zauberhafte Welt der Ware. Keine Ironie. Ironie ist vorbei. Die Musik, die Farben, die Menschen in ihrer lässigen Winterkleidung. All die schönen Dinge in den Schaufenstern, in den Regalen, auf den Tischen. Welche Erlösung vom Büro. Büro ist Staub, ist Muff, ist Enge: daran hat die digitale Revolution nichts geändert. Mag sein, diese Zweimannfirmen irgendwo in der alten Fabriketage in Ehrenfeld, die sind anders. Kühn, frisch, jung, abenteuerlich und virtuell. Dynamisch? Nein, nicht dynamisch, das ist veraltet. Eher cool. Dynamisch, das sind diese schwungvollen Verkaufslöwen, über die jeder grinsen muss.
Bei uns gibt es noch alles, was zum richtigen Büro gehört, auch wenn wir inzwischen jeder auf einen Bildschirm starren. Keine Coolness, sondern Trägheit. Alles verklebt. Die seit drei Tagen dreckige Kaffeetasse beim Kollegen nebenan. Die alten Scherze und nachmittags die Teilchen vom Bäcker. Die Türklinken immer schmierig. Fetthandspuren, da kann die Putzfrau am Abend zuvor noch so sehr gewienert haben.
Die Türklinken sind das Schlimmste. Sie weiß nicht, ob sie das noch ein weiteres Jahr aushalten mag, bis zum Millennium, über das jetzt schon alle reden. Nachher, wenn sie zu Hause ist, muss sie sich reinigen. Badeorgie. Das Gedrängel im Body Shop vorhin, der Kampf um die schönste Lotion, den weichsten Balsam, den köstlichsten Schaum. Aber da war mehr Zusammenhalt als Ellbogen. Eine Konsumentin hackt der anderen kein Auge aus. Nicht an solch einem belebten Ort.
An der Kasse wartend, glaubte sie einen Augenblick, draußen Clemens gesehen zu haben, andere Straßenseite, flüchtig vorbeigewischt, dann bei König links ab. Sogar die ewige Wolljacke, dunkeloliv, hochgestellter Kragen, ganz wie vor drei Jahren. Aber das kann nicht sein, das war er nicht, sie hätte sonst den ganzen Wellnesskram fallen gelassen und wäre gerannt. Ihr Zögern, ihre Lähmung sagen ihr, dass er es nicht gewesen ist. Sie hat recht gehabt, nicht hinterherzulaufen, sondern ordentlich zu warten mit ihrem hübschen kleinen Warenkorb. Clemens ist verschwunden, verlorengegangen für immer. Weg ist weg. Sie hat alles nur für sich gekauft, wie im letzten und vorletzten Jahr auch. Das Feuerzeug ist ein kleiner Gag für den Alltag. Letztes Jahr war es ein Küchenwecker in Form einer Tomate, im selben Geschäft. Dazu jetzt die Jacke, ganz weich fallende warme Wolle, anthrazit, schön abgesetzter schwarzer Kragen aus Baumwollsamt, große Seitentaschen, in denen die Hände bequem verschwinden können: hat sie gleich anbehalten. Den alten Kram in die Tüte. Große Knöpfe, drei etwas unregelmäßige Rauten. Auf die Knöpfe kommt es besonders an, sie sind ihr Wappen. Die Jacke wird ihre Hülle bis zum nächsten April, die spürt sie und hat doch daran nichts zu tragen. Dazu noch einer von den Schals, die sie liebt, breit, aber nicht dick, schwerelos fast, locker zu schlingen und nicht beengend, keine Erstickungsgefahr. Diesmal einer in Aubergine, ein bisschen mehr Farbe als in den letzten Jahren. Handschuhe hätte sie auch neue gekauft, aber das bringt sie nicht über sich bei zehn Grad plus und der Menschenwärme überall um sich herum.
Die wird jetzt zu viel, in dieser Sekunde, da sie vor dem Schmuckladen steht und sich mit dem neuen Feuerzeug eine Zigarette anzündet. Hitzewellen in der Sechs-Uhr-Dunkelheit, und das Gequatsche um sich herum kann sie nicht mehr hören. Die Rempeleien, die Enge, der Schmutz, die Bakterien. Nach zwei Zügen wirft sie die Zigarette weg.
Fünfzig Meter nur, da muss sie durch, dann hat sie die Kirche erreicht. Die steht stumm und freundlich im Zentrum des Andrangs, und doch gibt es einen Hof um sie herum, eine nicht genau markierte Bannmeile. Sobald Simone die Mittelstraße überquert, sich unter Mühen durchgewühlt und den Platz erreicht hat, ist sie völlig allein. Hierhin will niemand, zu diesem mütterlichen Gebäude mit dem rundbäuchigen Kleeblattchor, so schön und so prunklos.
Einen Atemzug, als sie auf das Tor zugeht, fürchtet sie, es könnte verschlossen sein. Es wäre das erste Mal. Schon früher hat sie sich manchmal hierhin geflüchtet. Im Sommer, wenn die Hitze die Straßen weiß machte und sie nichts mehr sah. An Samstagen direkt vom Wochenmarkt, der sich unverschämt nah an die Kirche drängt, nur weg von den Marktfrauen, von ihren Kundinnen, von der beschissenen Liebedienerei und Jovialität, den breiten Mündern und verzerrten Gesichtern. Einmal, als sie auf dem Heimweg vom Büro plötzlich weinen musste, direkt vor Marc O’Polo, weil ihr eine Kränkung vom Vortag wieder eingefallen war. Ein anderes Mal, als sie glaubte, man habe ihr bei Karstadt das Portemonnaie geklaut. Sie fand es dann zu Hause auf dem Grund ihrer Tasche.
Nie hat sie mehr als fünf oder sechs andere im Inneren der Kirche angetroffen. Flüsternde Touristen. Ein junges Liebespaar mit gefüllten Einkaufstüten, andächtig vor der kleinen Statue der schmerzensreichen Mutter. In den Bänken eine Beterin hier und da. Mit leisen Schritten undefinierbare Männer der Kirche, sie kennt sich nicht aus. Stille, halbes Dunkel, halbes Licht, Kühle und Wärme. Draußen das Welttheater, die rheinische Fassung.
Ihre Furcht ist grundlos. Das Tor der Kirche ist auch diesmal unverschlossen. Simones Augen brauchen eine Minute, um sich an das Halbdunkel zu gewöhnen, das durch die Kerzen an der Krippe und vor der Statue des Heiligen Antonius mit den beiden Hilfesuchenden unruhig tanzt. Sie sieht zweimal hin, dreimal, aber es ist wahr: diesmal ist sie wirklich allein. Keine Betenden, keine Erschöpften aus dem Zentrum des Konsums, keine Kirchenmänner, nur sie, die Bedrängte, in der bedrängtesten aller Kirchen dieser Stadt.
Wenn sie ihr Kunstgeschichtestudium beendet hätte, hätte sie wahrscheinlich ihre Arbeit über diese Kirche geschrieben. Deshalb weiß sie noch heute so viel darüber, dass es manchmal stört, denn sie möchte von diesem Bau nicht mehr als seine Freundlichkeit und seinen Schutz. Von diesem Bau wie auf einer Insel, umspült von Geld und Autos und Wünschen. Früher hat die Kirche einmal ganz am Rand der Stadt gestanden, dann hat sich die Stadt an sie herangeschlichen, hat sie hier und da angefressen, hat versucht, sie zu verschlingen. Immer wurde der Bau gestutzt und abgerissen und neu gebaut und ausgebaut und zurückgebaut und ist niemals gewichen, auch die Bomben haben nur halbe Arbeit geleistet. Und sieht so aus, als habe er von Anfang so gestanden wie jetzt, stumm und freundlich seit neunhundert oder tausend Jahren.
Das Gitter ist geöffnet, und sie geht auf der linken Seite langsam am Chorgestühl entlang zum Altar, an den Beichtstühlen vorbei. Einer ist mit dem Namen des Pfarrers beschriftet. Zu anderer Stunde könnte sie zu ihm kommen und ihm erzählen: von dem Unrecht, das ihr geschehen ist, der großen, nie zuvor dagewesenen Liebe, die zehn Wochen währte, und dann war der Liebste plötzlich verschwunden. Nicht mehr da von einem Tag auf den anderen, seine Wohnung aufgelöst, leer, eine Nachricht an sie, dass er für immer gehen müsse. Keine Erklärung, kein Hinweis, nicht die Spur einer Spur. Aber was soll denn der Pfarrer Biskupek dazu sagen? Vielleicht könnte er den Heiligen Nepomuk um Rat fragen, dessen kleines Standbild sie hier sieht. Der ist der Patron der Beichtväter. Bisher wusste sie nicht, dass die Beichtväter einen eigenen Heiligen haben. Außerdem hat sie keine Ahnung mehr, wie Beichten funktioniert. Es ist mehr als fünfzehn Jahre her, dass sie gebeichtet hat, da war sie dreizehn oder vierzehn.
Wie immer ist der Altarraum abgesperrt, und sehnsüchtig wirft sie einen Blick auf die Figürchen der Apostel, denen die Kirche gewidmet ist. Sie müsste ein Fernglas bei sich haben, um mehr zu sehen, denn die eleganten Holzplastiken stehen auf einem Altaraufsatz und sind kaum zu erkennen für gewöhnliche Kirchenbesucher wie sie. Mitte vierzehntes Jahrhundert, auch das weiß sie noch. Ein Retabel nennt man so einen Altaraufsatz. Das hatte sie schon vergessen, aber Clemens hat es ihr einmal erklärt. Woher kannte er sich da aus, er war doch nur ein Koch? Sie hat ein paar Fotos von den Figuren gesehen, darauf waren sie besser zu erkennen. Hübsche Kerle, und doch kann sie keine richtige Sympathie für sie aufbringen. Die Sendboten, die Apostel, Prediger und Jünger sind ihr verdächtig seit ihrer eigenen kurzen missionarischen Zeit. Das ist zum Glück lange her. Keine Tiere und keine tierischen Produkte essen, sich nicht mit Tierhäuten bekleiden. Kein Eingriff nirgendwo, keine Chemie, diese Tätigkeit nur bei Vollmond, jene nur bei Neumond. Sie atmet noch einmal durch, als sie daran denkt. Seitdem will sie mit den Missionaren aller Couleur nichts mehr zu tun haben.