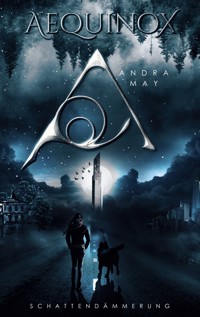
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Aequinox
- Sprache: Deutsch
»Dann muss ich wohl deutlicher werden«, sagte er und seine dunkelblauen Augen fingen ihren Blick ein. »Du gehörst mir, und zwar vom ersten Tag an. Ohne mich wärst du gar nicht mehr am Leben. Du bist nicht frei, bist es nie gewesen.« Akasha weiß schon lange, dass sie nicht wie andere Jugendliche ist. Seit ihre telekinetischen Kräfte erwacht sind, kämpft das eigenwillige Mädchen damit, diese im Zaum zu halten. Gelingt ihr dies nicht, schwebt jeder in ihrer Nähe in Gefahr. Doch was sie nicht ahnt: Einer der mächtigsten Männer der Welt hat sie und ihre besonderen Fähigkeiten bereits im Visier. Nathaniel Keren, CEO des multinationalen Abiss Konzerns, will ihre Gabe für seine Zwecke einsetzen - mit oder ohne ihr Einverständnis. Als sie sich weigert, macht er deutlich, dass ihm jedes Mittel recht ist, um ihren Willen zu brechen. Akasha bleibt nur die Flucht ins Unbekannte. Aber Mr. Keren hat nicht vor, sie entkommen zu lassen. Er setzt seine beste Jägerin auf sie an, mit der Akasha mehr verbindet, als sie ahnt. Doch der Konzern ist nicht die einzige Fraktion, die Interesse an ihren Kräften hat. Sie muss erkennen, dass Freund und Feind manchmal nicht voneinander zu unterscheiden sind. Eine gnadenlose Jagd beginnt, die Akasha über die ihr bekannte Realität hinausführt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 496
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Widmung
Für mich
Triggerwarnung
Der Text enthält Schilderungen von:
Physischer und psychischer Gewalt (Schusswaffen, Misshandlung, Machtspiele)
Mobbing
Sexueller Gewalt (nicht explizit)
Verfolgung
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Teil 1: Stormridge
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Teil 2: Auf der Flucht
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Danksagung
Prolog
Denver Children’s Home
Einige Tage später
»Ich hasse Kinder!«, sagte Erin Kelaino, als sie vor dem Kinderheim stand. Sie steckte den Zeitungsartikel in ihre Manteltasche, ehe sie zu ihrer Begleiterin sah, einer elegant gekleideten Mittvierzigerin mit kurzen rotblonden Haaren. »Wollen wir dann, Mrs. Masterson? Es wird nicht besser, wenn wir hier draußen herumstehen.«
Mrs. Masterson starrte mit zusammengepressten Lippen auf die Eingangstür des Waisenhauses, ihre Hände tief in den Manteltaschen verborgen. Erin wartete geduldig, denn sie wusste sehr genau, was im Kopf der Frau vor sich ging.
»Mir ist klar, dass Sie Ihre Nichte nicht bei sich haben wollen«, sagte sie schließlich.
»Oh! Wirklich? Sie sind in der Tat eine talentierte Telepathin.« Erin ließ die Ironie kalt.
»Der Hass auf Ihre tote Schwester und alle ihrer Art darf Sie nicht davon abhalten, Ihre Pflicht zu tun. Unser Souverän hat entschieden: Sie sind ihre Tante und einzige Verwandte hier.«
»Halten Sie sich aus meinem Kopf raus, Kelaino!«
Mrs. Masterson blickte sie mit zusammengekniffenen Augen an. Erin lächelte humorlos.
»Bei Ihnen brauche ich meine Gabe nicht, Ihre Gefühle stehen Ihnen ins Gesicht geschrieben. Bevor wir das Mädchen holen, sollten Sie Ihre Emotionen unter Kontrolle bringen. Das Kind ist imstande diese zu spüren, das wissen Sie.«
»Was ich weiß, ist, dass ich ein kleines, abartiges Monster in mein Haus hole!«
»Sie sollen Ihren Job erledigen«, entgegnete Erin ungehalten, »Sie müssen das Kind nicht lieben, nur großziehen. Sie sind selbst Mutter einer Tochter, somit dürfte das für Sie kein Problem sein.«
»Halten Sie Viktoria aus der Sache heraus. Allein der Gedanke, dass meine Tochter mit dieser Monstrosität aufwächst … Wer weiß, wozu dieses Kind eines Tages in der Lage sein wird.«
»Das ist die Frage, nicht wahr?«, stellte Erin fest.
Teil 1: Stormridge
Kapitel 1
Bar Harbor, Maine, 10 Jahre später
»Verflixte Scheiße!« Akasha stolperte aus ihrem Bett und stieß schmerzhaft gegen die Kante ihres Nachttisches. Wer den Spruch »Morgenstund hat Gold im Mund« erfunden hatte, war nie mit pelzigem Geschmack im Mund und Sabber am Kinn aufgewacht. Ich bin einfach kein Morgenmensch, dachte Akasha missmutig, während sie ihre Kleidung, die überall im Zimmer verstreut lag, zusammensuchte. Sie hob das T-Shirt von gestern hoch, roch kurz dran – ging noch. Mit ihren Klamotten auf dem Arm tapste sie die steile Treppe hinab, die von ihrem Zimmer unter dem Dach in den ersten Stock führte. Das Haus war ruhig, eine greifbare Stille füllte die Räume und Flure. Nur ab und an knarrte eine Stufe unter ihren bloßen Füßen.
Auf ihrem Weg kam sie an einigen leerstehenden Zimmern und Salons vorbei. Die Möbel waren seit Jahren mit Tüchern verhängt, die Fensterläden geschlossen. Schwaches Licht drang durch die Lamellen. Ein muffiger Geruch hing in der Luft, gegen den kein Lüften half. In den Wänden hörte sie Mäuse huschen. Zumindest hoffte Akasha, dass es nur Mäuse waren. Eine Tür mit wackeliger Klinke führte ins Bad, wo eine Badewanne mit Klauenfüßen vor sich hin rostete. Wasser gurgelte in den Kupferrohren, als sie den Hahn am Waschbecken aufdrehte. Das Herrenhaus Stormridge hatte wahrlich bessere Zeiten gesehen, aber ihre Tante fand es unnötig, Geld in den »alten Kasten« zu investieren. Kein Wunder, sie lebte auch seit fünf Jahren nicht mehr hier, sondern in einem schicken Apartment in New York.
Im Spiegel sah ihr eine verschlafene Sechzehnjährige entgegen, mit wirrem schwarzem Haar und halb geschlossenen Augen. Akasha stützte sich am Waschbecken ab und beugte sich näher zu ihrem Spiegelbild, bis ihre Nase fast das Glas berührte. Ihre zweifarbigen Augen, eines grün, eines blau blickten skeptisch. Die Heldin betrachtet ihr Antlitz im Spiegel, dachte sie mürrisch, und stellt fest, sie bekommt einen Pickel! Sie streckte ihrem Spiegelbild die Zunge raus, bevor sie sich die Zähne putzte.
Als sie ihre Haare zu einem lockeren Pferdeschwanz band, verhedderte sich ihr Medaillon in einer langen Haarsträhne. Vorsichtig befreite sie den filigranen Anhänger. Mehrere konzentrische Kreiselemente mit verschlungenen Verzierungen umgaben einen blaugrün schimmernden Edelstein in der Mitte. Hinter diesem verbarg sich ein komplexer Öffnungsmechanismus, den Akasha leider nicht bedienen konnte. Zugern hätte sie gewusst, ob sich etwas dahinter verbarg, aber selbst der Juwelier im Ort war nicht in der Lage gewesen, das Medaillon zu öffnen. Kurz hielt sie das silberne Schmuckstück in der Hand, ehe sie es unter ihrem T-Shirt verschwinden ließ. Der wohlbekannte Schmerz des Verlusts loderte in ihrer Brust auf. Wie jedes Mal schob Akasha ihn beiseite. Das Medaillon war alles, was ihre tote Mutter ihr hinterlassen hatte. Es stammte aus einer Vergangenheit, die mit ihr gestorben war. Da niemand wusste, wer ihr Vater gewesen war, stellte dieser Anhänger die einzige Verbindung zu einem Leben dar, welches für sie hinter einem Schleier des Vergessens lag.
Eine halbe Stunde später betrat Akasha die geräumige Küche des Herrenhauses. Das alte Anwesen lag an der Küste der Insel Bar Harbor in Maine, obwohl es wirkte, wie den schottischen Highlands entrissen. Seine grauen Mauern hatten Kriege und Revolutionen miterlebt und manche der Einheimischen hielten es für ein Geisterhaus. Akasha widersprach den Anhängern dieser Theorie nicht. Die Sonne schien durch die Sprossenfenster. Es sah erneut nach einem heißen Sommertag aus. Akasha stellte das Radio an und lauschte den Nachrichten, während sie ihr Müsli zubereitete.
»… heute vor 20 Jahren schenkte uns der Abiss Konzern eine bis dato unbekannte Art der Energieversorgung, die NPGs, dank derer wir ein neues Kapitel in der Geschichte der Menschheit aufschlagen konnten. Die Sorgen um Ressourcenknappheit, Energieengpässe und den Klimawandel liegen lange hinter uns. Stattdessen genießen wir Wohlstand und Fortschritt. Darum feiern wir heute, am 4. Mai, den Tag der wahrhaftigen Energiewende.«
»Ja, ja, das wissen wir alle«, murmelte Akasha und stellte das Radio aus. Zu allem Überfluss muss ich heute auch noch ein Referat dazu halten.
Auf dem Weg zum Schulbus klingelte Akasha an der Tür des Nebengebäudes. Eine mürrische, hagere Frau öffnete die Tür. Sie strahlte wie immer Frustration und Bitterkeit aus.
»Was willst du?« Immerhin wirkte Ms. Alltacht halbwegs nüchtern.
»Ich brauche Geld zum Einkaufen, der Kühlschrank ist leer.«
Ms. Alltacht grunzte Unverständliches und holte ihr Portemonnaie, aus dem sie Akasha ein paar Scheine in die Hand drückte.
»Hier, und bring mir Zigaretten mit.« Akasha wandte sich zum Gehen.
»Bevor ich es vergesse«, hielt Ms. Alltacht sie zurück. »Der nächste Besuch deiner Tante steht an.«
»Ich weiß, ich habe in freudiger Erwartung die Tage im Kalender durchgestrichen.«
Tatsächlich hatte Akasha mit einem mulmigen Gefühl in der Magengegend bemerkt, wie der Termin näher rückte. Einmal im Monat flog ihre Tante von New York hierher, um in Stormridge nach dem Rechten zu schauen. Mit unverhohlenem Widerwillen, weswegen die Besuche kurz blieben. Ein Umstand, der Akasha nur recht war.
»Deine Ironie kannst du dir sparen. Ich werde am Wochenende das Haus putzen und du wirst mir helfen.«
»Na toll, gehört es zur Strafe, dass die Verurteilte ihre Hinrichtung auch noch vorbereiten muss?«
»Wenn du es auf diese Weise sehen willst.«
Und damit knallte Ms. Alltacht ihr die Tür vor der Nase zu.
Vielen Dank für das tiefschürfende Gespräch. Akasha warf der geschlossenen Tür noch einen finsteren Blick zu, bevor sie zur Bushaltestelle lief.
Einige Haltestellen später stieg ihre Freundin Anne ein. Sie hatten beide vor einem Jahr auf die Mount Desert Island High gewechselt und verstanden sich sofort. Zwei Außenseiterinnen, die wussten, dass sich der Schulalltag zu zweit besser aushalten ließ. Mit einem Seufzer plumpste Anne auf den Sitz neben Akasha und strich ihren Rock glatt. Ein Blick in Akashas Gesicht ließ sie zurückzucken. »O Man, schaust du heute finster.«
»Ich schaue immer so, das ist mein Gesicht«, murrte Akasha.
»Aber heute siehst du aus wie eine personifizierte Gewitterwolke. Ist was passiert?«
»Meine Tante kommt zu Besuch.«
»Ah, verstehe«, entgegnete Anne, »ist es wieder soweit?«
»Sieht so aus.«
»Lebt deine Tante noch in New York?«, fragte Anne. Akasha konnte ihre Neugier deutlich wahrnehmen. Für Anne klang New York nach Abenteuer, und die Vorstellung, jemanden zu kennen, der dort lebte, versetzte sie in Aufregung.
»Ja, der Konzern, für den sie arbeitet, hat seinen Sitz dort.« Zudem ergab sich dadurch eine elegante Möglichkeit, sich meiner zu entledigen, fügte Akasha in Gedanken hinzu. »Mariven hofft jeden Monat darauf, dass ich ihr den Gefallen getan habe, mich von den Klippen zu stürzen.« Bei Akashas bitteren Worten rutschte Anne unbehaglich auf ihrem Sitz hin und her. Sie kannte die Abneigung ihrer Freundin gegenüber ihrer Tante mittlerweile nur zu gut.
»Du weißt, du kannst jederzeit mit zu mir kommen, meine Mutter mag dich sehr gerne.« Akasha schnaubte belustigt.
»Deine Mutter hält mich für einen Freak. Sie ist sich nicht sicher, ob ich der richtige Umgang für dich bin.« Nach einem Blick in Annes erschrockenes Gesicht bereute sie ihre harschen Worte. Aber da sie der Wahrheit entsprachen, nahm sie sie nicht zurück.
»Hey, schau mal, wen wir hier haben. Unser Schulfreak und ihr Pummelchen in trauter Zweisamkeit.«
Die gehässigen Worte waren im ganzen Bus zu hören. Akasha brauchte nicht hochzusehen, um zu wissen, dass zwei Jungen aus ihrer Stufe eingestiegen waren. Anne zog den Kopf ein, ließ ihre braunen Haare wie eine Gardine vor ihr Gesicht fallen und schaute auf den Boden. Nach Jahren des Mobbings riet ihr der Instinkt bestimmt ›Wenn ich mich verstecke, lässt das Raubtier von mir ab‹. Phillip und Dan taten Anne diesen Gefallen nicht, stattdessen ließen sie sich auf die Sitze vor ihnen fallen, um sich über die Rückenlehnen zu beugen. Akasha stöhnte innerlich auf. Sie wusste, was jetzt kommen würde.
»Freaky Freak, welcher Außerirdische hat eigentlich deine Mutter gevögelt, dass sowas wie du dabei herausgekommen ist, hm?«
»Vielleicht ein sechsarmiges Tentakelmonster, das würde erklären, warum du zu viele Finger hast.« Dan lachte über seinen eigenen Witz. »Hast du woanders ebenfalls ein paar Körperteile zu viel?« Er schielte auf Akashas Oberweite, um dann abzuwinken.
»Nee, da ist eher zu wenig, anstatt zu viel.«
»Na, mit schlechter Ausstattung kennst du dich ja aus«, erwiderte Akasha, unbeeindruckt von seiner Beleidigung, »oben wie unten, schätze ich.« Die täglichen Sticheleien ihrer Mitschüler war sie seit ihrem ersten Schultag gewöhnt. Ihre Klassenkameraden spürten schon damals, dass sie anders war. Nicht nur ihr Äußeres, aufgrund ihrer zweifarbigen Augen und ihrer doppelten Mittelfinger, sondern dass es etwas Tiefergehendes war. Kinder besaßen eine Antenne für solche Dinge, im Gegensatz zu den Erwachsenen, die ihre Instinkte unter den Erwartungen der Gesellschaft begruben.
»Ganz schön große Klappe für einen Freak.« Phillip holte blitzschnell aus, um ihr eine zu scheuern, aber Akasha war schneller und fing seinen Schlag ab. Sie packte seine Handfläche mit der freien Hand und verdrehte diese, bis Phillip schmerzerfüllt aufheulte.
»Man nennt es übrigens Polydaktylie, wenn man einen Finger zu viel hat, Idiot.«
»Ruhe da hinten«, brüllte der Busfahrer, »sonst lauft ihr den Rest des Weges!«
Nur widerwillig ließen sich Dan und Phillip auf ihre Sitze fallen, aber für den Rest der Fahrt herrschte Ruhe.
»Sobald ich die Schule erfolgreich beendet habe, fahre ich nie wieder Bus«, stöhnte Anne, während sie und Akasha, wie Mastvieh zusammengequetscht, aus dem Schulbus gedrückt wurden.
Die Mount Desert Island High School war ein moderner Backsteinbau, den über 600 Schüler besuchten. Beim Läuten der Schulklingel beschleunigten Akasha und Anne ihre Schritte. Sie kamen besser nicht zu spät zu Mr. Jones Geschichtsunterricht. Die letzten Meter rannten die beiden und huschten mit den anderen Nachzüglern ins Schulgebäude. Heute standen Referate auf dem Programm. Passend zum Tag der Energiewende, ging es um das Ereignis, welches vor 20 Jahren so vieles verändert hatte.
Akasha schaute von ihren Notizen hoch und wartete kurz, bis ihre Mitschüler zur Ruhe gekommen waren. Ihre schwitzigen Hände wischte sie an ihrer Jeans ab. Vor einer Klasse stehen und reden gehörte definitiv nicht zu ihren Stärken. Aber da musste sie jetzt durch.
»Der Abiss Konzern baute im Jahr 2000 den ersten Nullpunktgenerator, kurz NPG genannt, welcher Energie aus dem Quantenvakuum bezieht«, begann sie. Zu ihrer Erleichterung klang ihre Stimme ruhig und fest. »Was bedeutet das? Das Vakuum ist mitnichten leer, wie viele denken, vielmehr ist es ein brodelnder See von virtuellen Teilchen und Antiteilchen, welche beständig entstehen und sofort wieder vergehen. Diese Teilchen aber besitzen Energie, Vakuumsenergie, und genau diese zapfen die NPGs an.« Akasha wies auf eine Abbildung, die über den Beamer an die weiße Wand hinter ihr geworfen wurde. Vor ihr umgaben Schwaden aus Langeweile ihre Mitschüler, nur unterbrochen von einzelnen leuchtenden Punkten der Konzentration.
»Dies ist naturwissenschaftlich gesehen eigentlich nicht möglich. Die wissenschaftliche Welt debattiert darum bis heute über die Funktionsweise der NPGs, denn niemand weiß genau, wie sie diese Energie anzapfen. Aber der Abiss Konzern verweigert jegliche Auskunft darüber, mit dem Verweis, alle Forschungsergebnisse unterlägen der Geheimhaltung.«
»Ich wünschte, dieser Vortrag unterläge auch der Geheimhaltung«, flüsterte Amber ihrer Freundin Michelle laut genug zu, dass jeder es hören konnte.
»Ruhe!«, ermahnte Mr. Jones sie. Blöde Kuh, bei deinem Vortrag mit Michelle hast du nur den Beamer bedient, dachte Akasha.
»Mit den Nullpunktgeneratoren«, fuhr sie unbeirrt fort, »steht der Welt endlich eine Energiequelle zur Verfügung, die ohne die zahlreichen Probleme der fossilen Energieträger, wie Umweltzerstörung und Klimawandel, ausreichend Energie produziert. Mittlerweile gibt es 7 NPGs weltweit, welche die Vereinigten Staaten, Kanada, Europa und Australien mit Strom versorgen.
Die sieben existierenden NPGs sind allerdings nicht imstande, alle Länder zu versorgen. Bis jetzt weigert sich der Abiss Konzern, zusätzliche Generatoren zu bauen. Die Konzernleitung verweist auf die hohen Kosten. Somit sind viele Staaten weiterhin auf fossile Energieträger angewiesen. Dazu gehören China, Russland, Indien und viele andere Staaten, die weiterhin Kohle und Öl zur Energiegewinnung nutzen.«
Geschafft! Erleichtert atmete Akasha auf und sah zu ihrem Lehrer herüber.
»Vielen Dank, Akasha. Das war ein guter Vortrag«, sagte Mr. Jones mit einem Lächeln. Seine Zufriedenheit spiegelte sich darin wieder. Er wandte sich der Klasse zu. »Diejenigen, die es noch nicht geschafft haben, ihr Referat fertigzustellen, bekommen bis nächste Woche Zeit.« Er warf einen Blick auf seine Notizen. »Es fehlen noch die Referate zu den Themen Auswirkungen der Energiewende auf die Umwelt. und Der Abiss Konzern – Die mächtigste nichtstaatliche Organisation der Welt. Haltet euch ran!«
Nach der Stunde strömten alle Schüler aus dem Klassenraum. »Hey, wen haben wir denn da?«, rief Tim, als er an Akasha vorbeikam, »das Mädchen aus dem Geisterhaus.«
Sie stöhnte innerlich auf. Die Mobbing Gang begibt sich in Stellung. Frust, Gehässigkeit und Abneigung strahlten von den anderen Jugendlichen, Akashas Magen verknotete sich. Das brauche ich jetzt nicht. Zum Glück konnte sie sich gegen die Gefühle der anderen abschirmen. Es kostete sie Konzentration, ihren Geist zu schließen, aber es half. Wie eine Mauer um ihren Verstand hielt ihre Abschirmung die Emotionen draußen.
»Wer in dem spukigen Kasten wohnt, bei dem sitzt doch selbst eine Schraube locker«, stichelte Michelle und warf ihre langen blonden Haare zurück. »Mein Dad erzählte mir, dass der Erbauer des Hauses verrückt wurde, seine Familie umbrachte und in den Wäldern verschwunden ist.«
»Vermutlich begegnete er deinen Vorfahren und erkannte, dass die Welt dem Untergang geweiht ist«, konterte Akasha.
»Wenn es mehr so Freaks wie dich gäbe, mit Sicherheit.« Sie zupfte am Bund ihrer Skinny Jeans, welche ihre langen Beine betonte, um gleich darauf ihre schulterfreie Bluse etwas tiefer zu ziehen. Anschließend musterte sie Akasha abfällig. Diese begegnete ihrem Blick ungerührt. Michelles Sprüche kannte sie schon zu lange, um sich noch etwas dabei zu denken. »Hast du dich heute Morgen wieder in der Altkleidersammlung angezogen? Zerrissene Jeans und Boots sind sowas von out.«
»Dafür ist Secondhand nachhaltiger und ich muss nicht das Atmen einstellen. Sei vorsichtig, Michelle, noch mehr Spannung hält dein Hosenknopf nicht aus.«
»Ich habe halt einen knackigen Arsch in der Hose, anders als du.«
»Du bist ein Arsch, das beschränkt sich nicht bloß auf deine Kehrseite!«
»Blöde Kuh!«, fauchte Michelle und wollte sich auf Akasha stürzen, doch ihre Freundin Amber zog sie weiter.
»Komm, der Freak ist die Aufregung nicht wert.«
»Euch auch einen schönen Tag«, rief Akasha ihnen fröhlich hinterher.
Michelle uns sie verband eine lange Tradition der gegenseitigen Abneigung. Während Ambers IQ die Länge eines TikTok-Videos umfasste, gehörte Michelle zu den Besten ihres Jahrgangs. Nur in Mathe und den Naturwissenschaften musste sie sich Akasha geschlagen geben. Ein Umstand, den sie nur schwer ertragen konnte.
»Du solltest sie nicht provozieren«, meinte Anne. Besorgnis umgab sie wie eine zweite Haut und ihre großen braunen Augen schauten ängstlich wie die eines Hundewelpen.
»Machst du dir Sorgen um dich oder um mich?«, fragte Akasha. Im Gegensatz zu Anne waren ihr die Ansichten ihrer Mitschüler schon lange egal. Meinungen über die eigene Person bekam man umsonst und ungefragt, ob man wollte oder nicht. Was nicht hieß, dass sie einer verbalen Auseinandersetzung aus dem Weg ging.
»Um dich natürlich«, entgegnete ihre Freundin leise.
»Im Gegensatz zu dir, kneife ich nicht bei jeder Gelegenheit.« Eine gewisse Schärfe hatte sich in ihre Stimme geschlichen und unbewusst ballte sie die Fäuste.
»Ich meine nur, wir müssen noch ein paar Jahre mit ihnen auskommen.«
»Wenn wir den Schwanz einkneifen, werden die Jahre noch länger. Los, komm, wir haben Mathe bei Mrs. Clemens.«
Eine Mathe- und Informatikstunde später, saßen sie zusammen in der Mensa zum Mittagessen. Die Sonne schien hell durch die großen Fenster auf die langen Reihen von Tischen, an denen Schüler und Schülerinnen saßen und zusammen lachten und redeten. Anne löffelte gerade voller Begeisterung ihren Nachtisch. Akasha öffnete ihre mentale Abschirmung wieder und ließ sich gedankenverloren in dem Meer der verschiedenen Emotionen treiben, welches den Saal flutete. Freude und Sorglosigkeit, ebenso Traurigkeit, Verliebtheit, Ängste und Sorgen spürte sie. Die normale Mischung einer High School. Plötzlich tauchte am Rand ihrer Wahrnehmung ein Gefühl auf, welches in ihr das Bild eines suchenden Hyänenrudels hervorrief. Sie blickte auf und sah vier Jungen auf ihren Tisch zukommen. Nicht ohne Grund hatte sie sich für einen der kleineren Tische in der hintersten Ecke entschieden. Sie legte keinen Wert auf Besuch.
Akasha kannte die Clique. Dan und Phillip waren in ihrem Jahrgang. Mike und Sami gehörten zum Jahrgang über ihnen. Bekannt als Unruhestifter und Schläger, gingen alle Schüler den Vieren aus dem Weg. Lange schon hatten sie das Stadium überschritten, wo sie sich von den schulinternen Sanktionen abschrecken ließen. Die Mittagspause nutzten die Jungen gerne als Gelegenheit, Ärger zu verursachen. Der heutige Tag war keine Ausnahme und Akasha wusste, wer in den Genuss ihrer Aufmerksamkeit kommen würde. Seit einigen Wochen zeigte Sami ein unwillkommenes Interesse an ihr. Er tauchte unverhofft in ihrer Nähe auf, versuchte, sich ihr zu nähern oder sie alleine abzupassen. Das wusste sie zwar zu verhindern, dennoch war es lästig, ständig auf der Hut sein zu müssen. Sie brauchte keine Aufmerksamkeit. Nicht von Jungen im Allgemeinen, und ganz sicher nicht von solch einer missratenen Masse an organischem Material wie Sami. Leider verstand dieser ein »Nein« nicht.
»Hi ihr zwei Süßen.« Sami ließ sich auf den Stuhl neben Akasha fallen. Er war groß, muskulös und besaß die Ausstrahlung eines Bad Boys. Dunkle Locken fielen ihm in die Stirn und seine Lederjacke, die er trotz der Wärme trug, knarzte bei jeder Bewegung. Dan nahm den Platz neben Anne ein, die anderen beiden blieben lässig an ihren Tisch gelehnt stehen. Anne wurde kreidebleich und ließ ihren Löffel in die Schüssel zurückfallen.
»Oh, lasst euch von uns nicht beim Essen stören«, höhnte Phillip, »du musst fleißig futtern, Schwabbelbacke, sonst verlierst du dein Kampfgewicht.« Anne sah aus, als würde sie ihren Nachtisch lieber erbrechen. Dan stieß sie von der Seite an.
»Los, Dickerchen, essen sollst du, hast du nicht gehört.« Die anderen grinsten. Dan sieht selbst aus, als würde er im Bus zwei Sitze benötigen, dachte Akasha. Sie spürte die sadistische Freude der Gruppe daran, anderen Leid zuzufügen. Sie sogen Annes Angst gierig auf, welche sie wie eine Wolke umhüllte. Die Angst der Opfer war der Beweis für ihre Stärke. Akasha ballte ihre Hände zu Fäusten. Plötzlich legte Sami seinen Arm um ihre Schultern.
»Na, meine Hübsche, endlich haben wir zwei ein wenig Zeit für uns.«
»Ich weiß wirklich nicht, in welchem Paralleluniversum du dich gerade befindest, aber hier gibt es kein uns!«, stellte sie klar und versuchte, seinen Arm abzuschütteln. Seine Finger krallten sich in ihre Schulter.
»Ich habe schon gemerkt, dass du eine kleine Wildkatze bist.« Er grinste. »Ich werde dich zähmen.« Zu Akashas Entsetzen schnüffelte er an ihren Haaren. »Du riechst gut.« Das ließ sich von ihm nicht behaupten. Akasha versuchte die Luft anzuhalten; sein Atem roch, als hätte er zum Frühstück einen Kadaver von der Straße gekratzt und der Körpergeruch stand dem in nichts nach. Sein Versuch, dies mit möglichst viel Aftershave zu überdecken, half nicht wirklich.
»Du leider nicht! Kleiner Tipp: Ein wenig Zeit für die Körperhygiene wäre gut investiert.«
»Quatsch, ich bin keiner von diesen Weicheiern. Von denen hat nämlich keiner gemerkt, dass du das hübscheste Mädchen hier an der Schule bist, nur ein bisschen schräg und schnippisch. Aber da steh ich drauf.«
»Und du bist ein Arschloch und da stehe ich gar nicht drauf! Selbst wenn ich in der Todeszelle säße, hätte ich Besseres zu tun, als mich mit dir abzugeben«, konterte Akasha und schüttelte seinen Arm endlich ab.
Mittlerweile waren andere auf die Szene aufmerksam geworden und an den Nachbartischen wurde es still. Sami sah sich vor der ganzen Schule blamiert und sein Gesicht verzog sich zu einer zornigen Grimasse.
»Der Spruch wird dir leidtun.«
»Mir tut es nur leid, dass deine Mutter im entscheidenden Moment nicht verhütet hat«, erwiderte Akasha. Sofort stieg Samis geballter Zorn gleich einer steilen Wand vor ihr auf. »Und jetzt wäre ich dir wirklich dankbar, wenn du dir deine unterbelichteten Spießgesellen schnappen würdest und anderen Leuten auf die Nerven gehst.«
»Na warte«, zischte Sami und griff nach ihr. Akasha sah seine Reaktion voraus, wich ihm aus, schnappte sich die Gabel auf ihrem Tablett und rammte ihm das Besteck tief in den Oberschenkel. Kurz schrak sie zurück, bei dem Gefühl von Metall, welches sich in Fleisch bohrte. Hatte sie das gerade wirklich getan?
Sami brüllte laut auf.
»Du miese Schlampe! Ich bringe dich um!«
»Da geht die Liebe hin, welch ein Jammer«, bemerkte Akasha. Sie sprang auf, stieß Mike und Phillip beiseite, um Anne von ihrem Stuhl zu reißen. Aber sie unterschätzte Dan. Er wirkte schwerfällig, reagierte jedoch blitzschnell und hielt Anne fest, die mit einem überraschten Geräusch auf ihren Stuhl zurückplumpste.
»Hier geblieben«, fauchte er. Mike und Phillip erwachten aus ihrer Starre und packten Akasha von hinten. Sie trat Mike gegen das Schienbein, gleichzeitig rammte sie Phillip ihren Ellenbogen in die Seite. Die beiden stöhnten auf, hielten sie aber weiterhin fest. Jetzt besaßen sie die Aufmerksamkeit des gesamten Speisesaals und endlich auch die der Lehrer. Mr. Jones und Mrs. Spencer hasteten zu ihnen.
»Was ist hier los?«, verlangte Mr. Jones zu wissen.
Mike und Phillip ließen Akasha so plötzlich los, als bestünde sie aus glühenden Kohlen. Sami hatte mittlerweile die Gabel aus seinem Bein gezogen, die er Mr. Jones unter die Nase hielt.
»Gut, dass Sie kommen. Das Biest hat mir eine Gabel ins Bein gerammt, das ist Körperverletzung! Ich werde sie verklagen!« Er gestikulierte in die Runde. »Die anderen können das bezeugen.« Seine Freunde nickten beflissen.
»Das stimmt nicht«, heulte Anne auf. Dan gab ihr einen Hieb in die Seite, um sie zum Schweigen zu bringen. Mr. Jones wandte sich an Akasha.
»Stimmt das?«
»Ja. Aber es war reine Notwehr.«
»Gut, das klären wir im Büro des Direktors«, entschied Mrs. Spencer. »Ihr kommt alle mit.«
Unter den Blicken der halben Schule verließen sie die Mensa. Als sie vor der Tür des Direktors ankamen, ließ dieser die vier Jungs zuerst herein. Akasha fragte sich, was er ihnen noch sagen konnte, was sie nicht schon seit ihrem ersten Tag an der Highschool in regelmäßigen Abständen zu hören bekamen.
Anne und sie blieben draußen, hockten nervös auf den gepolsterten Stühlen und warteten. Ab und an kamen Lehrer oder Lehrerinnen vorbei und warfen ihnen neugierige bis mitleidige Blicke zu.
»Meine Eltern bringen mich um, wenn sie hören, dass ich zum Direktor musste«, murmelte Anne. In ihrer erstickten Stimme klangen erste Tränen mit. Verzweiflung verdunkelte ihren Geist.
»Quatsch! Warum sollten sie? Es war nicht deine Schuld. Im Gegenteil.«
Begleitet von Mrs. Spencer und Mr. Jones, drängten die vier Jungs kurze Zeit später wieder aus dem Büro. Sie warfen Akasha und Anne im Vorbeigehen finstere Blicke zu, die Akasha ignorierte. Als nächstes rief der Direktor Anne auf. Mit gesenktem Kopf schlich sie durch die Tür. Akasha rieb ihre schweißfeuchten Hände an ihrer zerrissenen Jeans trocken. In Gedanken begann sie die zwanzig ersten Stellen der Zahl Pi aufzusagen. Manch einer würde sie für verrückt halten, aber die Zahlenfolge beruhigte sie; es war besser, als über das anstehende Gespräch mit dem Schulleiter nachzudenken. Sie wollte keinen Ärger, aber oft redete und handelte sie schneller, als ihre Vernunft nachkam.
Anne blieb ebenfalls nicht lange bei Mr. Baxter. Als sie herauskam, lächelte sie ihr aufmunternd zu. Akasha war an der Reihe. Mit unsichtbaren Gewichten an den Füßen betrat sie das Zimmer des Direktors und ließ sich in den Stuhl vor dem Schreibtisch fallen. Mr. Baxter, ein voluminöser Mann in Höhe und Breite, sah mittlerweile genervt aus. Sie spürte Müdigkeit und einen Hauch von Resignation, als er seine Brille hochschob und sich durch das schüttere Haar fuhr. Mrs. Taylor, die Schulpsychologin, stand neben ihm. Keine glückliche Kombination, stellte Akasha fest. Im Gegensatz zu dem Direktor strahlte die gertenschlanke Psychologin kühle Professionalität aus. Ihre Emotionen waren kontrolliert, kaum etwas drang nach außen.
Mrs. Taylor sah sie bei jeder Begegnung an, als betrachte sie eine wandelnde Fallakte. Die Psychologin war nach Akashas Ansicht übermotiviert. Regelmäßig versuchte Mrs. Taylor mit ihr zu sprechen und Akasha hatte Mühe, sie abzuwimmeln. Dass Akasha keine Eltern mehr hatte, und die Haushälterin von Stormridge neben ihren sonstigen Aufgaben auch Akashas Erziehung übernahm, ließ die Psychologin aufhorchen. Mr. Baxter lauschte ihrer Version der Dinge. Anschließend sagte er:
»Akasha, ich kann verstehen, dass dir die Situation Angst bereitet hat und das Verhalten der Jungs war indiskutabel, aber wieso hast du keinen Lehrer gerufen?«
»Es war gerade keiner in der Nähe.«
»Und deswegen stichst du Sami eine Gabel ins Bein?«
»Etwas anderes hatte ich nicht zur Hand.«
»Das ist nicht witzig, Akasha. Was du gemacht hast, erfüllt den Tatbestand der Körperverletzung«, stellte Mrs. Taylor klar.
»Wieso? Ich dachte, in diesem Land wird das Recht zur Selbstverteidigung großgeschrieben?«
»Ich glaube, du nimmst die Sache nicht ernst genug. Samis Eltern könnten Strafanzeige erstatten. Du bist zwar minderjährig, dir würde nicht viel passieren, aber deine Chancen auf ein Stipendium wären dahin.«
Akasha biss die Zähne zusammen. Sie brauchte finanzielle Unterstützung, wenn sie studieren wollte. Daran hätte sie denken sollen, bevor sie zur Gabel griff.
»Akasha, wie bist du nur darauf gekommen, jemanden zu verletzen? Ich weiß, dass du es Zuhause nicht leicht hast und es dir schwerfällt, soziale Kontakte zu knüpfen. Trotz allem kenne ich dich als eine gute und fleißige Schülerin.«
»Was Mr. Baxter sagen möchte«, schaltete sich Mrs. Taylor ein. »Ist, dass dein Sozialverhalten, im Gegensatz zu deinen schulischen Leistungen, zu wünschen übrig lässt. Damit verbaust du dir viele Chancen und machst dir das Leben unnötig schwer.«
Die anderen machen mir das Leben auch unnötig schwer, dachte Akasha.
»Ich bin halt nicht so der gesellige Typ«, entgegnete sie stattdessen. »Außerdem, sollte es hier nicht um Sami und sein Verhalten gehen? Er hat uns angegriffen.«
»Das ist richtig und er wird seine Strafe bekommen, aber wir machen uns Sorgen um dich«, erklärte Mrs. Taylor. »Wir möchten nicht, dass du dich in die falsche Richtung entwickelst.«
Akasha verstand. Eine Schülerin mit schwierigem sozialem Hintergrund, ohne nennenswerte Kontakte, aber mit einem Hang zu gewalttätigem Verhalten, ließ vermutlich einige Alarmglocken bei den Lehrern läuten.
»Wenn du Probleme hast«, setzte die Psychologin an. »Kannst du jederzeit zu mir kommen. Egal, worum es geht.« Hoffnungsvolle Spannung umgab sie. Akasha tat es fast leid, sie zu enttäuschen.
»Vielen Dank, Mrs. Taylor, ich weiß Ihr Angebot zu schätzen. Ich habe überreagiert und bin mir meines Fehlverhaltens bewusst.« Sie senkte den Kopf und setzte eine zerknirschte Miene auf. »Ehrlich, Mr. Baxter, ich weiß nicht, warum ich das getan habe. Ich war wütend und …«
Sie brach ab und überlegte, ob sie ein paar Tränen verdrücken sollte, damit es überzeugender wirkte. Akasha wusste, was die Erwachsenen hören wollten und war bereit, es ihnen zu geben, damit sie heil aus dieser Sache herauskäme. Mit traurigem Blick sah sie Mr. Baxter direkt an, obwohl sie es hasste, anderen in die Augen zu blicken. »Wissen Sie, Direktor, Anne und ich – wir hatten Angst. Die waren zu viert und … und wir nur zu zweit – keiner hat uns geholfen und Sami wurde zudringlich… «
»Ich verstehe«, sagte Mr. Baxter rasch. »Anne hat mir die Situation schon ausführlich geschildert und ich kann nachvollziehen, dass du dich und deine Freundin schützen wolltest. Aber Gewalt ist dabei niemals das richtige Mittel, verstehst du das?«
»Natürlich, Mr. Baxter, das weiß ich. Ich kann wirklich nicht sagen, was über mich gekommen ist. Aber es wird nie wieder vorkommen.«
»Akasha«, warf Mrs. Taylor ein. »Vielleicht solltest du mal in meine Beratungsstunde kommen.«
Solange ich mich nicht vor angreifenden Zombies verstecken muss, setze ich keinen Fuß in Ihr Büro, dachte Akasha. Mr. Baxter redete noch eine Weile auf sie ein und Mrs. Taylor beobachtete ihre Reaktion mit Therapeutenaugen. Aber Akasha wusste, dass die größte Gefahr gebannt war. Sie nickte eifrig, beteuerte weiterhin Besserung und versprach auf keinen Fall erneut eine Gabel gegen einen Mitschüler zu erheben. Aber natürlich, würde sie heute zur Strafe nachsitzen. Genauso wie die vier Jungs. Und er würde ihre Tante informieren. Schließlich blieb der Tatbestand bestehen, dass sie einen Mitschüler verletzt hatte. Zumindest wollte er für sie ein gutes Wort bei Samis Eltern einlegen.
Mist, fluchte Akasha innerlich, das wird Ärger geben. Doch darüber konnte sie sich später Sorgen machen.
Der Nachmittag war weit fortgeschritten, als sie nach dem Absitzen ihrer Strafe blinzelnd aus dem Schulgebäude ins Licht der Sonne trat. Es war ein heißer Tag, der sich am besten am Strand oder im Freibad verbringen ließ. Beides waren Orte, die Akasha ungern aufsuchte. Zu viele Menschen auf engstem Raum verursachten bei ihr ein Gefühl des Unwohlseins. Daher machte sie sich auf den Weg nach Hause. Der Schulbus fuhr um diese Zeit nicht mehr, also lief sie nach Hause.
Der Anfall traf sie mit plötzlicher Wucht. Das Schwindelgefühl war so stark, dass Akasha es gerade noch schaffte, sich an einer Straßenlaterne festzuhalten, um einen Sturz zu verhindern. Gleichzeitig setzten starke Kopfschmerzen ein, ihr Gesichtsfeld verschwamm. Nicht schon wieder, dachte sie verzweifelt. Ihr letzter Anfall lag gerade zwei Wochen zurück. Sie ließ sich auf eine Bank in der Nähe fallen, zog die Knie an und bettete ihren Kopf darauf. Langsam schaukelte sie hin und her, in dem verzweifelten Bemühen, dem Schmerz und dem Schwindel zu entfliehen.
Aus den Augenwinkeln bemerkte sie die verwunderten Blicke der Passanten. Akasha wusste, dass sie rasch nach Hause musste. Bald würde auf die Kopfschmerzen, den Schwindel und die Übelkeit ein wachsender Druck in ihrem Kopf folgen. Wie ein Sturm, der seine Freiheit suchte. Sie musste um jeden Preis die Kontrolle behalten, bis sie zu Hause, oder zumindest außerhalb der Stadt war. Stormridge lag eine Stunde Fußmarsch entfernt, der Stadtrand zum Glück näher. Akasha atmete tief durch und rappelte sich mühsam hoch. Sie wartete, bis die schwarzen Punkte vor ihren Augen verschwanden und die Welt aufhörte, im Kreis zu tanzen. Die Sonne, die sie gerade noch als angenehm empfunden hatte, stach ihr plötzlich in den Augen. Vorsichtig setzte sie sich in Bewegung, langsam, Schritt für Schritt. Die vier Jugendlichen, die in Papiertüten gehüllte Flaschen in den Händen hielten und sie beobachteten, bemerkte sie nicht.
Einige Zeit später brachte die Straße sie zu den Randbezirken der Stadt. Hier herrschte Stille, das muntere Treiben in der Innenstadt und am Hafen schien weit entfernt zu sein. Die Hitze des Tages drückte auf die Häuser, die Straße war menschenleer. Sie starrte mit gesenktem Kopf auf das flirrende Straßenpflaster, während sie sich mühsam vorwärts schleppte. Bis sie in etwas hinein lief. Überrascht sah sie auf und blickte in Samis grinsendes Gesicht. Und ich hatte gedacht, der Tag könnte nicht mehr schlimmer werden.
»Hi Kätzchen, hast du mich vermisst?«
»Kann ich nicht behaupten«, entgegnete Akasha. Aus dem Augenwinkel sah sie den Rest der Clique, der sich um sie versammelte.
»Glaube ich sofort. Aber ich wollte dich gerne wiedersehen, um mich für die Sache heute Mittag zu bedanken.« Er zeigte auf sein Bein, wo sich unter der Jeans ein Verband abzeichnete. Akasha vermochte sich nur schwer darauf zu konzentrieren, das Bein verschwamm, teilte sich, fand wieder zusammen.
»Tja, keine Ursache, hab‘ ich gerne gemacht.« Über die hämmernden Kopfschmerzen hinweg vernahm sie ihre eigene Stimme kaum.
Im nächsten Moment packte Sami ihre Schultern und schleuderte sie gegen die Hauswand eines leerstehenden Ladenlokals. Schmerzhaft prallte sie gegen den Beton.
»Du kommst dir wohl besonders witzig vor, hm?«, zischte er in ihr Ohr. Akasha roch Alkohol in seinem Atem. »Mal sehen, ob das noch der Fall ist, wenn wir mit dir fertig sind.«
Er griff in ihre Haare, riss ihren Kopf nach hinten und zog sie in eine Gasse zwischen den Häusern. In einem verdreckten Hinterhof drückte er Akasha erneut gegen die Wand.
»So, du kleines Miststück. Jetzt zeig ich dir, was es heißt, sich mit mir anzulegen. Ich wollte es auf die nette Tour machen, aber du weißt mein Angebot anscheinend nicht zu schätzen. Übrigens, schreien kannst du dir sparen, hier hinten hört dich keiner und das Haus vorne ist unbewohnt. Wir sind ganz unter uns.«
Akasha wusste, dass sie in Schwierigkeiten steckte, aber weniger wegen Sami und seiner Spießgesellen. Kribbelnde Energie brachte ihre Nervenbahnen zum Vibrieren. Kam es ihr nur so vor oder war die Luft elektrisch aufgeladen? Die Härchen auf ihren Armen stellten sich auf. Sami verschwamm vor ihren Augen und teilte sich in zwei, beide wurden von leuchtenden Punkten umschwirrt. Sie wusste, was das bedeutete. Ihre Kräfte drängten nach draußen. Normalerweise hielt sie die Energie nie so lange zurück. In diesem Moment ballten beide Samis ihre Fäuste und rammten sie ihr in den Magen. Akasha keuchte vor Schmerzen, krümmte sich und rang nach Atem.
»So, Kleine«, raunte er, beugte sich vor und stemmte seine Arme rechts und links neben Akashas Kopf gegen die Wand. Sein saurer Atem streifte ihr Gesicht, er roch nach Schweiß. »Jetzt wollen wir mal sehen, wie du dein schlechtes Benehmen mir gegenüber wiedergutmachen kannst.« Seine drei Kumpels lachten anzüglich. Ihre alkoholisierte, unheilvolle Freude hüllte Akasha ein. Sie bemühte sich, flach zu atmen, zum einen, weil ihr Magen dann nicht so weh tat, zum anderen, weil Samis Mundgeruch nur so zu ertragen war.
»Ey, ihr Drei steht draußen Schmiere.« Sami gab seinen Kumpels einen Wink, woraufhin diese sich widerwillig trollten. Kälte zog durch Akashas Glieder und sammelte sich in ihrer Magengegend. Die Jungen machten ihr Angst, aber mit Sami allein zu sein ängstigte sie noch mehr. Ihr Schädel war dem Druck nicht länger gewachsen. Sie konnte kaum klar denken. Ihre Sicht verschwamm erneut. Dennoch durfte sie ihre Kontrolle auf keinen Fall aufgeben. Auf einmal lag Samis Hand an ihrer Wange, zwang ihr Gesicht in seine Richtung.
»Du bist wirklich scharf, weißt du das? Schade, dass du so ein Freak bist.« Seine Hand strich ihre Kieferlinie entlang. »Deine Haut ist so weich.«
Akasha hob ihren Blick, sah in Samis träge, dunkle Augen. Sie verabscheute ihn. In diesem Moment hasste sie ihn sogar von ganzem Herzen. Wut stieg in ihr auf. Wut und der Wunsch, ihn in seine Schranken zu weisen. Ihn selbst spüren zu lassen, was es hieß, das Opfer zu sein. Aber das kannst du doch, wisperte eine fremde Stimme in ihrem Kopf, du könntest ihm wehtun, ihn auf die Knie zwingen – wenn du es willst.
Irgendetwas in ihrem Blick schien Sami plötzlich zu irritieren. Er zuckte vor ihr zurück. Das gefiel ihr. Ihre Selbstbeherrschung schwankte nur einen kurzen Moment. Doch das genügte ihren Kräften schon. Sie entschlüpften ihrer Kontrolle. Akasha spürte, wie die kribbelnde Energie durch ihren Körper, und mit Wucht nach vorne schoss. Sami wurde rückwärts gegen die vier Meter entfernte Hauswand geschleudert. Blut lief in einem Rinnsal aus seiner Nase. Er sackte an der Wand zusammen. Gleichzeitig fuhr eine starke Windböe durch den Hinterhof, wirbelte altes Papier und Unrat auf. Mehrere Mülltonnen wackelten, schwankten und stürzten um. Ein schmaler Riss zog sich durch die Wand hinter Sami. Mit lautem Scheppern fielen einige Dachziegel zu Boden, bevor der Sturm sich legte. Ein Teil von Akasha frohlockte bei diesem Anblick, ein anderer Teil war entsetzt. Die anderen drei kamen, durch den Lärm aufgeschreckt, zurückgelaufen. Sie starrten ihren Freund und das Chaos drum herum erschrocken an.
»Hey, Mann«, rief sein Kumpel Mike, »was war das denn? Ist alles okay?« Sami reagierte nicht. Seine Augen waren nach oben verdreht.
Los, beweg dich, dachte Akasha panikerfüllt.
Sein Geist wirkte wie eine zähe Masse, die nur langsam wieder in Bewegung kam. Schließlich zuckte sein Körper ein paarmal, Sabber lief ihm das Kinn herunter. Endlich fanden seine Augen ihren Fokus wieder. Schwerfällig rappelte er sich auf.
»Was’n los …?«, nuschelte er.
»Keine Ahnung! Aber hier sieht es aus, als hätte es ein Erdbeben gegeben.« Dan klang misstrauisch, trotz seines Alkoholpegels. Mike lachte.
»Vielleicht waren die paar Bier vorhin doch zu viel für dich? Übrigens, du hast Nasenbluten.« Sami fasste in sein Gesicht und schaute verwirrt, als er das Blut an seinen Fingern entdeckte. Er übergab sich ohne Vorwarnung neben der Hauswand und fiel auf die Knie.
»Igitt«, rief Dan. »Ey, was soll das, Alter?«
»Mir geht‘sch irgendwie nisch gut«, nuschelte Sami zwischen Würgreflexen. »Lass uns abhau‘n.«
»Was? Ohne ein wenig Spaß gehabt zu haben? Du wolltest dir die Kleine zur Brust nehmen«, empörte sich Dan.
»Ich sagte, wir hauen ab!«, brüllte Sami plötzlich und fuhr hoch.
»Alles klar, Mann. Wir hauen ab. Du bist der Boss.«
Ohne ein weiteres Wort stemmte Sami sich hoch und schwankte die schmale Gasse entlang auf die Straße zu, seine Kumpel folgten ihm. Dan warf Akasha einen letzten Blick zu.
»Heute hast du Schwein gehabt, du kleine Schlampe. Das wird nächstes Mal nicht der Fall sein.«
Sobald Akasha alleine war, lehnte sie ich erschöpft an die Wand und versuchte ihren rasenden Herzschlag unter Kontrolle zu bringen. Der Druck in ihrem Inneren ließ langsam nach, ihre Sicht klärte sich, der Kopfschmerz verschwand. Letzte Energiereste zuckten durch ihren Körper. Entkräftet sackte sie an der Wand zu Boden. Mittlerweile zitterte sie am ganzen Körper und ihr Magen schmerzte. Heute hatte sie – ungewollt – ihre Kräfte gegen ein lebendes Wesen gerichtet. Bei dem Gedanken lief es ihr kalt den Rücken herunter.
Fuck, fuck, fuck, so eine Scheiße! Plötzlich verspürte Akasha den Drang, sich zu übergeben. Nur mühsam unterdrückte sie diesen, stand auf und stolperte auf wackeligen Beinen ins Freie. Die helle Sonne und das friedliche Treiben auf der Straße erschienen ihr seltsam unpassend, nach der Gewalt und dem Schrecken, die sie gerade erlebt hatte. Akasha senkte den Kopf, so dass ihre langen schwarzen Haare ihr Gesicht verbargen und ging, so zügig wie möglich, weiter.
Sie erreichte Stormridge, schlich durch den Hintereingang herein und steuerte das erstbeste Badezimmer an. Dort drehte sie den Hahn auf und spritzte sich kühles Wasser ins Gesicht und in den Nacken. Kurz ließ sie ihre zitternden Hände auf ihren Augen ruhen, versuchte ruhig und gleichmäßig ein- und auszuatmen. Als sie aufsah, begegnete sie dem Blick ihrer ungleichen Augen. Sie war blass, aber darüber hinaus merkte man ihr nicht an, was sie gerade erlebt hatte. Wie selten doch das Äußere das Innere widerspiegelt, dachte sie und ihre Gedanken wanderten zurück zu dem Tag vor zwei Jahren, als die Anfälle sie das erste Mal heimgesucht hatten.
Sie stolperte in ihr Zimmer, ließ die Tür in Schloss fallen, zog die Gardinen zu und warf sich auf ihr Bett. Ihr Kopf hämmerte unerträglich, als ob etwas Großes sich seinen Weg nach draußen bahnen wollte. Zum Glück hatte die Schulkrankenschwester ihr erlaubt nach Hause zu gehen.
»Bestimmt bekommst du deine Tage«, waren ihre Worte gewesen. Oder einen Hirntumor, dachte Akasha. Sie vergrub ihren Kopf in den Kissen, in dem Versuch den Schmerzen zu entkommen. Ihr war übel und sie fürchtete sich zu allem Elend auch noch übergeben zu müssen. Tatsächlich schaffte sie es Sekunden später gerade noch zu ihrem Mülleimer, bevor ihr Frühstück wieder dessen Weg nach draußen fand. Erschöpft und schweißgebadet rollte sie sich auf dem Boden zusammen und betete, dass ihr Leiden endlich ein Ende nehmen würde.
Akasha schüttelte über diese unwillkommenen Erinnerungen den Kopf. Der Schmerz war vergangen, aber er hatte etwas freigesetzt; etwas, das sich ihrer Kontrolle entzog.
Die Zeit schien sich zu Ewigkeiten zu ziehen, während sie dort lag. Nichts existierte, außer dem Druck in ihrem Kopf. Ein Poltern ließ sie hochblicken. Ihr Nachttisch wankte. Verständnislos starrte sie darauf und bemerkte plötzlich, wie ihre Kopfschmerzen weniger wurden. Dann begannen die Bilderrahmen zu wackeln und mit lautem Bersten auf dem Boden zu zerschellen. Aber das war erst der Anfang.
Bei ihrem ersten Mal hatte sie ihre Zimmereinrichtung zerlegt. Da sie keine Ahnung hatte, was sie tun sollte, drang die Kraft einfach aus ihr heraus und tobte unkontrolliert durch den Raum. Sie ging danach tagelang nicht zur Schule, aus Angst, dort einen Anfall zu erleiden. Sie blieb in ihrem abgedunkelten Zimmer, in dem Möbel wackelten und Gegenstände umherflogen und überlegte verzweifelt, was mit ihr nicht stimmte. Ihre Altersgenossinnen bekamen ihre Periode, sie bekam telekinetische Blutungen. Innerhalb kürzester Zeit baute sich eine Energie in ihrem Körper auf, die aus dem Nichts zu kommen schien. Wie einem Akku an der Ladestation floss ihr ein Potenzial zu, welches sie weitergeben musste.
Gleich nach ihrem ersten Anfall versuchte sie herauszufinden, was mit ihr geschah. Ihre erste Anlaufstelle für Informationen war das Internet. Wie zu erwarten, spuckte die Suchmaschine unzählige Treffer aus. Davon waren die meisten denkbar unnütz. Seiten mit dem Titel ›Weltverschwörung‹ oder ›Mystikwelten‹, Einträge in Chatrooms unter dem Titel ›Wie ich meine Psikräfte aktiviere‹. Nichts, was sie weitergebracht hatte. Dank ihres Faibles für Fantasy und Science-Fiction, wusste sie, wie man das Phänomen nannte, von dem sie betroffen war: Telekinese. Die Fähigkeit, Materie allein mit den Gedanken zu beeinflussen. Eine Begabung, die nach allgemeiner Meinung in das Reich der Fantasie gehörte. Sogar Institute, die sich mit der Erforschung von paranormalen Gaben beschäftigten, schoben solche Phänomene in den Bereich psychischer Störungen.
Akasha fühlte sich damals unendlich hilflos und einsam. Es gab niemanden, mit dem sie darüber reden konnte oder wollte. Ihre Tante Mariven würde sie in eine Anstalt einliefern lassen. Ms. Alltacht würde ihrer Tante sagen, sie solle sie in eine Anstalt einliefern lassen. Mr. Abercrombie, den alten Gärtner, wollte sie damit nicht belästigen. Er könnte bei der Erwähnung paranormaler Kräfte einen Herzinfarkt bekommen. Anne würde auf jeden Fall hysterisch werden. Sie war allein.
Als sich Wochen später, entgegen ihren Hoffnungen auf einen einmaligen Zwischenfall, der nächste Anfall ankündigte, wusste sie, was sie zu tun hatte. Mit der Zeit wurde sie immer besser darin, die ersten Anzeichen zu erkennen und Vorsorge zu treffen. Gedankenlesen beherrschte sie zwar nicht, aber sie wusste, ob jemand log, ob er sich glücklich oder traurig fühlte. Früher war sie der Meinung gewesen, alle Menschen besäßen diese Fähigkeit. Als Kind sagte sie brav die Wahrheit, in der Annahme, jeder würde merken, wenn sie Lügen erzählte. Ihre Überraschung war groß, als sich herausstellte, dass nur sie diese Gabe besaß.
Ihre ungewöhnlichen Fähigkeiten behielt sie für sich. Menschen reagierten selten mit Verständnis auf übernatürliche Fähigkeiten, eher mit Panik und Scheiterhaufen. Mit einem letzten Blick in ihr blasses Gesicht verließ sie das Badezimmer.
Später am Abend, als die Hitze einer lauen Wärme gewichen war, ging Akasha in den Park von Stormridge, um frische Luft zu schnappen. Dort stieß sie auf den Gärtner, Mr. Abercrombie. Der alte Mann wirkte, trotz seiner 70 Jahre, agiler als mancher Teenager, den Akasha aus ihrer Schule kannte. Gerade schnitt er mit einer riesigen, alten Heckenschere an einem der Sträucher herum, dessen Name Akasha sich nie merken konnte. Zu seinen Füßen lag Cuchulain, ein großer, schwarzer Mischlingsrüde, der schon an die 14 Jahre auf dem Buckel hatte. Der alte Mann und der Hund waren unzertrennlich. Jetzt hob Cuchulain seine graue Schnauze, um in Akashas Richtung zu schnuppern. Über seinen Augen lag ein trüber Schleier, aber seine Nase war so gut wie eh und je.
Akasha war mit dem Hund aufgewachsen. Als ihre Tante sie hier mit Ms. Alltacht und Mr. Abercrombie zurückließ, war dieser so nett gewesen, ihr in den ersten Wochen Cuchulain für die einsamen Tage und Nächte in Stormridge zu überlassen. Anders als ihre Tante wusste er, dass ein Mädchen in einem riesigen, leeren Haus Angst bekam. Cuchulains großer, warmer Körper tröstete sie nachts, wenn der Gedanke an die verlassenen Zimmerfluchten von Stormridge ihr den Schlaf raubte. Mit ihm verbrachte sie die Tage spielend im Garten.
»Hallo Mr. Abercrombie«, grüßte Akasha den alten Gärtner höflich und kraulte Cuchulain hinter den Ohren. Im Gegensatz zu Ms. Alltacht mochte sie Mr. Abercrombie sehr gerne. Er strahlte zufriedene Ruhe, Gelassenheit und eine stoische Akzeptanz aller Dinge aus. Oft half sie ihm bei seinen Pflichten im Garten und genoss die gemeinsame Stille. Zwischen ihnen waren nicht viele Worte nötig, aber wenn sie reden wollte, hörte er zu.
»Hallo Akasha«, erwiderte Mr. Abercrombie, ohne von der Arbeit aufzusehen.
Auf seinem Handrücken erkannte sie seine alte Tätowierung: zwei sich überschneidende Kreise, die ein Auge in ihrer Mitte bildeten. Eine wulstige Narbe zog sich quer darüber. Es hatte sie immer gewundert, dass ein so unscheinbar wirkender Mann wie Mr. Abercrombie tätowiert war, dazu an einer für jeden sichtbaren Stelle. Eine Jugendsünde, war seine Erklärung gewesen. Die Emotionen hinter seiner Aussage ließen Akasha damals vermuten, dass mehr dahintersteckte. Ohne ein Wort darüber zu verlieren, lud sie die abgeschnittenen Äste in die Schubkarre.
»Ich hörte, dass deine Tante Ende nächster Woche kommt?« Der Gärtner trennte mit einem kraftvollen Schnitt einen weiteren Ast ab.
»Hm«, meinte Akasha mit wenig Begeisterung und griff nach dem abgeschnittenen Ast. Mr. Abercrombie lächelte verständnisvoll.
»Ihr steht euch immer noch nicht besonders nahe, oder?« Akasha schnaubte belustigt.
»Kommt drauf an, stehen sich Harry Potter und Lord Voldemort nahe?«
»Wer?«, fragte der Gärtner mit verwunderter Stimme.
»Vergessen Sie es.«
»Hat sie dir letztes Mal wieder die abgelegte Kleidung von Viktoria mitgebracht?«
»Aber klar, und ich habe sie wie immer beim Secondhand Shop verkauft. Füllt meine Kasse.« Akasha schwieg kurz, bevor sie fortfuhr: »Ich frage mich, was sie jeden Monat hier will? Sie hasst das Haus und sie hasst mich. Aber um mir klarzumachen, dass sie mich für eine Versagerin hält, muss sie nicht extra nach Maine kommen, sie könnte mich genauso gut am Telefon zur Schnecke machen.« Mr. Abercrombie sah zum ersten Mal von seiner Arbeit auf.
»Du bist vieles, Akasha, aber keine Versagerin. Erzählst du ihr jemals etwas über dich? Weiß sie, wie es dir geht? Wie es dir wirklich geht, meine ich?«
Mr. Abercrombie sah sie mit einem freundlichen Lächeln an, Akasha spürte echte Anteilnahme hinter seinen Worten.
»Warum sollte ich ihr erzählen, wie es mir geht? Es ist nicht klug, dem Feind die eigenen Schwächen zu offenbaren. Nein, je weniger sie über mich weiß, desto besser.«
Kapitel 2
New York, am gleichen Tag
Die Abendsonne schien durch die Fensterfronten des Abiss Towers, dessen Spitze sich weit über die anderen Hochhäuser der Stadt erhob. Mr. Keren stand im letzten Licht des Tages, die Arme hinter dem Rücken verschränkt. Sein Blick schweifte über Manhattan und das dahinter liegende Meer. Leise Töne von Bachs Partita Nr. 4 erklangen im Hintergrund. Der Raum war erfüllt von den Strahlen der Abendsonne, Musik und der tiefen Ruhe, die der Mann ausstrahlte. Eine weibliche Computerstimme durchschnitt diese Atmosphäre.
»Mr. Keren, Ihr Adjutant ist auf dem Weg zu Ihnen. Soll ich ihn einlassen?«
»Danke, EYE. Lass ihn zu mir.« Sekunden später glitt eine Fahrstuhltür am anderen Ende des Raumes auf und ein junger Mann in einem grauen Anzug trat heraus. Nervös sah er sich um, strich sich kurz über seine gegelten Haare und näherte sich zögerlich.
»Mr. Keren, bitte entschuldigen Sie die Störung. Sie wollten benachrichtigt werden, sobald Mrs. Masterson sich auf den Weg macht.« Zunächst zeigte der Mann am Fenster keine Reaktion. »Richtig, Mr. Drew. Wann ist sie losgefahren?«, fragte er schließlich. Seine Stimme, obwohl leise, drang bis in den letzten Winkel des Raumes.
»Vor einer Stunde. Sie verbringt zuerst ein paar Tage bei ihrer Tochter. Beide treten nach ihrem Aufenthalt in Stormridge eine Urlaubsreise nach Europa an. Ich denke, sie treffen Ende kommender Woche auf dem Anwesen ein.« Die Stimme seines Adjutanten zitterte leicht, sein Herz schlug schneller. Er fühlte sich offenbar nicht wohl in der Gegenwart seines Chefs. Ein Umstand, den Mr. Keren bei seinen Angestellten schätzte.
»Ihre Tochter, hm. Gut, canceln sie meine Termine für die nächsten zwei Wochen. Es wird Zeit, dass ich mir meine Investition, die ich in Mrs. Mastersons Hände gelegt habe, genauer ansehe.«
»Waren ihre monatlichen Berichte nicht zufriedenstellend?«, hakte sein Adjutant nach. Kurz besiegte seine eigene Neugier die Nervosität.
Mr. Keren wandte sich kurz um und lächelte schmal. »Sagen wir, die Berichte wirkten unmotiviert und ich möchte mir lieber selbst ein Bild der Lage machen.«
»Natürlich, Sir! Was ist mit Ihrer Telefonkonferenz mit dem Direktor des IWF? Und nächste Woche steht ein Termin mit dem Finanzminister von …«
»Wenn ich canceln sage, meine ich genau das. Mit dem Direktor des IWF werde ich von unterwegs aus telefonieren.«
»Ich verstehe, Sir. Ich kümmere mich darum. Soll ich eine Unterkunft für Sie auf den Namen der Firma buchen und Ihrem Fahrer Bescheid geben?«
»Nein«, sagte Mr. Keren und wandte sich wieder dem langsam dunkler werdenden Himmel zu, »ich fahre selbst und werde Mrs. Mastersons Gastfreundschaft in Anspruch nehmen.« Mr. Drews Augen weiteten sich vor Überraschung. »Dann informiere ich die sechs Familien über Ihre Abwesenheit.«
»Nein! Die Familien müssen nicht alles wissen.«
»Soll ich Mrs. Masterson darüber informieren, dass Sie- «
»Sie tun gar nichts! Um den Rest kümmere ich mich.« Mehr zu sich selbst fügte er hinzu: »Ich war lange nicht mehr dort und bin wirklich gespannt, was sie aus meinem Besitz gemacht hat.«
Kapitel 3
Akasha rannte an der Hand ihrer Mutter, bereits eine Ewigkeit. Die Schritte ihrer Verfolger hallten dicht hinter ihnen von den Wänden der hohen Gebäude wider. Rauch lag in der Luft, ließ sie husten, erschwerte das Atmen. Irgendwo hinter ihnen hörte sie das Brausen von Flammen. Akasha war sich bewusst, dass sie die Finger ihrer Mutter auf keinen Fall verlieren durfte, und umklammerte sie mit aller Kraft. Sie spürte die Angst und den Schmerz ihrer Mutter, obwohl diese versuchte, es vor ihr zu verbergen. Ihre Gefühle vermischten sich mit Akashas eigener Angst. Es gab keinen Ausweg für sie, sie konnten ihren Verfolgern nicht entkommen. Diese Gewissheit ihrer Mutter schwappte zu ihr herüber. Ihr kindlicher Verstand wusste, dass ihnen Schlimmes drohte, sobald die Männer sie eingeholt hätten. Panik brandete durch ihren Körper und ließ etwas in ihr erwachen, etwas so Unbeherrschbares wie das Flammeninferno hinter ihnen.
Plötzlich erklang lautes Hämmern in der Ferne, eine Hand ergriff ihren Arm und riss sie herum. Das wutverzerrte Gesicht ihrer Tante starrte sie an.
»Es ist alles deine Schuld!« Akasha schreckte hoch, schlug um sich. Doch der Griff um ihren Arm war mit dem Traum verschwunden. Erschöpft fiel sie zurück in die Kissen. Die immer wiederkehrenden Träume hinterließen ein schales Gefühl in ihr. Ferne Trauer über etwas, das sie verloren hatte, gemischt mit dem irrationalen Gedanken verfolgt zu werden, welcher sie auch nach dem Aufwachen begleitete. Sie kannte den Ursprung dieser Träume. Ihre Mutter kam bei einem selbstverschuldeten Feuer ums Leben. Akasha überlebte den Brand wunderbarerweise unverletzt, konnte sich aber an nichts erinnern. Ein lautes Hämmern an ihrer Zimmertür schreckte Akasha erneut auf.
»Aufstehen habe ich gesagt, verflixt noch mal!«
Ms. Alltachts wütende Stimme holte Akasha endgültig in die Realität zurück. Verwirrt schaute sie auf ihren Wecker, es war halb sieben – an einem Samstag. Akasha hatte das Gefühl gerade erst eingeschlafen zu sein. Was wollte die Haushälterin so früh von ihr?
»Falls es Ihnen nicht aufgefallen ist«, rief sie ungehalten zurück, »es ist Samstag. Ich kann ausschlafen!«
»Nichts da«, kam die prompte Antwort. »Du wirst mir am Wochenende beim Hausputz helfen. Die Arbeit macht sich nicht von alleine!«
Mist, dachte Akasha. Sich zu sträuben würde nichts bringen, die alte Schnapsdrossel war unglaublich hartnäckig. Darum quälte sie ihren Körper aus dem Bett. Vorsichtig tastete sie ihr Gesicht ab. Es schmerzte noch ein wenig. Bald würde jedoch nichts mehr zu bemerken sein. Leider heilte ihr Inneres nicht so schnell wie ihr Äußeres. Für eine Sekunde fühlte sie erneut Samis Hände und roch seinen Atem. Ihr Herz schlug schneller und Tränen drängten nach oben, aber das ließ sie nicht zu. Vielleicht würde die Hausarbeit sie ablenken. Bevor sie ihr Zimmer verließ, holte sie ihr Taschenmesser aus der Schublade ihres Nachttisches. Es war ein Geschenk von Mr. Abercrombie zu ihrem 13. Geburtstag. Kurz wog sie es in der Hand, dann steckte sie es in ihre Hosentasche. Ab jetzt wollte sie es lieber bei sich tragen, nur um sicherzugehen. Ihre Kräfte würden sie nicht immer retten.
Auf dem Weg nach unten kam sie an einem mannshohen Spiegel vorbei, mit silbernen Verzierungen und einem langen Sprung in der Mitte. Eine Bewegung im Glas ließ sie innehalten. Sie drehte sich um, blickte auf die reflektierende Oberfläche und lächelte. Ein alter Bekannter stand auf der anderen Seite des Glases und sah ihr entgegen. Der Mann war nur verschwommen zu erkennen, wenig mehr als ein Schemen. Akasha nannte ihn von klein auf der Einfachheit halber ›Den Mann hinter den Spiegeln‹.
Sie kannte ihn schon so lange sie hier lebte. Kein anderer sah ihn. Nur sie. Manchmal winkte er ihr zu und sie winkte zurück. War er ein Geist? Eine Person, die hier in Stormridge gelebt hatte? Akasha wusste es nicht, jedoch hatte er ihr in all den Jahren nie Angst gemacht. Er tat nicht mehr, als hin und wieder in den Spiegeln des Hauses aufzutauchen. Manchmal, wenn sie sich in dem leeren Haus einsam vorkam, setzte sie sich im Schneidersitz vor einen der Spiegel. Meistens dauerte es nicht lange und er erschien. Dann erzählte sie ihm von ihrem Tag. Er war ein geduldiger Zuhörer und Akasha fühlte sich mit ihm nicht so allein. Auch jetzt winkte Akasha ihm zu und er winkte zurück. Seltsamerweise hatte sie die Existenz eines Geistes in diesem Haus nie infrage gestellt. Trotz ihrer Vorliebe für die Naturwissenschaften, gehörten übersinnliche Phänomene zu ihrem Leben, so lange sie zurückdenken konnte. Nicht zuletzt war sie selbst eines.
Stunden später hockte sie in einem der Badezimmer und schrubbte das Klo. Über ihr flackerte das Deckenlicht. Die Nachwehen ihrer Kräfte.
»Bist du hier endlich fertig?« Sie fuhr hoch. Ms. Alltacht stand vor ihr, mit einem Schrubber in der Hand, und musterte sie mit finsterem Blick.
»Ja, gleich«, entgegnete Akasha. In dem Augenblick zersprang die Glühbirne über ihren Köpfen mit einem Knall, Scherben fielen zu Boden. Die Haushälterin schrie auf und fixierte sie.
»Hexenkind.« Akasha rechnete fast damit, dass Ms. Alltacht das Zeichen gegen den bösen Blick machen würde.
»Schön wärs«, konterte sie. »Wenn ich Hexenkräfte hätte, wären Sie schon längst zu einer Kakerlake geworden. Obwohl das unfair diesen faszinierenden Insekten gegenüber wäre.« Für eine Frau in ihrem Alter bewegte die Haushälterin sich ziemlich schnell.
»Du undankbares Miststück«, presste sie hervor, und holte mit ihrer schrubberfreien Hand aus, um ihr eine Ohrfeige zu verpassen. Akasha wich geschickt zur Seite aus.
»Die Zeiten sind vorbei, Ms. Alltacht, das sollten Sie wissen«, stellte sie fest. Früher hatte sie öfters die Hand der Haushälterin zu spüren bekommen, mittlerweile war Akasha jedoch schneller als die Alkoholikerin. Ms. Alltacht grinste böse.
»Deine Tante wird von deinem schlechten Benehmen erfahren und ich bin sicher, sie wird darüber nicht erfreut sein.«
»Meine Tante findet an nichts Freude, was mit mir zu tun hat«, gab Akasha zurück und war erstaunt über den bitteren Ton, der sich in ihre Worte geschlichen hatte.
»Kein Wunder, hat sie sich mit dir doch ein Wechselbalg ins Haus geholt, das nur Unglück bringen wird. Sie hätte dich besser am Tag deiner Ankunft im Meer ertränkt.« Unversöhnlicher Hass tränkte ihre Worte.
Akasha rollte nur genervt mit den Augen, die Geschichte kannte sie schon. Die Haushälterin hatte es ihr nie verziehen, dass ihre Tante mit ihrer Tochter Viktoria vor Jahren das Haus, die Stadt, und sogar die Insel verlassen hatte. Ms. Alltacht vergötterte Viktoria mit der gleichen Inbrunst, mit der sie Akasha von Anfang an hasste. Ausgerechnet mit dem ungeliebten Findelkind zurückgelassen worden zu sein, konnte sie nie verwinden.
»Ja, das hätte uns beiden viel Ärger erspart, nicht wahr?«, schoss Akasha zurück. Ms. Alltacht lächelte und verließ den Raum.
Kapitel 4
An diesem Montagmorgen saß Akasha mit einem flauen Gefühl in der Magengegend im Bus. In der Schule angekommen, hielt sie nach Sami und seiner Clique Ausschau.
»Suchst du jemanden?« Anne war ihr seltsames Verhalten aufgefallen.
»Ähm, nein. Ich schaue mich nur um.«
»Weil du über das Wochenende vergessen hast, wie unsere Schule aussieht?«
Bevor Akasha antworten konnte, entdeckte sie Dan, Phillip und Mike, die sich an den Schließfächern herumdrückten. Sami war nirgends zu sehen. Dabei hingen die Vier immer zusammen ab.
»Fuck«, entfuhr es ihr. Anne folgte ihrem Blick und erbleichte sichtlich.
»Die schon wieder. Komm. Lass uns verschwinden!«
»Warte, noch nicht.«
Jetzt entdeckten die Jungs sie und kamen mit schnellen Schritten näher. Dan baute sich vor ihr auf, während seine Freunde ihnen den Weg abschnitten. Er packte Akasha, drückte sie gegen die Schließfächer und beugte sich nah an ihr Ohr.
»Was hast du Schlampe mit Sami gemacht?«, zischte er. »Und erzähl mir keinen Scheiß. Sami liegt im Krankenhaus – im Koma! Irgendein neuro… Scheiß sagen die Ärzte und ne parti…irgendwas Degeneration oder so. Also: Was hast du gemacht!«
Mittlerweile waren Mike und Phillip zu ihnen gestoßen und schirmten sie von den Blicken der anderen Schüler ab. Nicht, dass Akasha von dort Hilfe erwartet hätte. Anne schaute derweil wie ein ängstliches Kaninchen zu. Erfolglos versuchte Akasha sich aus Dans Griff zu befreien.
»Woher soll ich wissen, was ihr für Drogen genommen oder Mist geraucht habt? Ich habe nichts gemacht!«, versuchte sie sich zu rechtfertigen. Dan glaubte ihr kein Wort. Allerdings wusste er nicht, was passiert war. Daher blieb ihm nur ihr zu drohen.
»Wenn Sami nicht wieder aufwacht, bist du geliefert. Ist das klar?«
»Wenn ich erzähle, was ihr gemacht habt, seid ihr geliefert«, konterte Akasha. Dans Gesicht verzog sich vor Wut und er schlug mit der flachen Hand gegen die Spindtür neben ihrem Kopf.
»Machst du das Maul auf, bist du dran, und deine kleine fette Freundin auch!«
Abrupt ließ er sie los, gab seinen Kumpels ein Zeichen und die drei mischten sich unter die anderen Schüler.
»Alles okay?«, fragte Anne besorgt. Akasha nickte, während sie den Jungs hinterher sah. Jetzt wusste sie, was sie wissen wollte. Es gab angenehmere Arten an Informationen zu kommen, aber sie konnte kaum einem Lehrer sagen, dass Sami telekinetische Energie abbekommen hatte und sie deswegen um seine Gesundheit fürchtete.





























