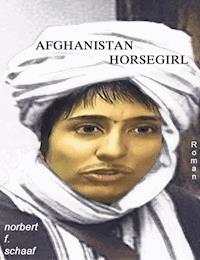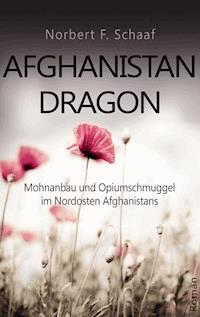
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der Schweizer UN-Drogenbeauftragte Professor Beat Hodler reist im UN-Auftrag an den Hindukusch, um den missbräuchlichen Mohnbau und Opiumabsatz in Afghanistan zu erforschen. Schon am Ausgangspunkt seiner Eruierungen in Kabul trifft er auf extreme Widersprüche, die zu entschlüsseln den Mediziner reizt, da die Behauptungen eines reichen Teppichseidenfabrikanten sinnfällig und bitter, doch dabei zugleich höchst seltsam klingen. Der Prof entschließt sich zu einem riskanten Unternehmen, gegen erhebliche Widerstände: Er zieht ins Hochgebirge nahe der Grenze zu Tadschikistan. Dort oben im äußersten Nordosten in einem kleinen Dorf lernt Hodler die Faktoren für den Mohnanbau sowie den Opiumabsatz in diesen Gebieten kennen, derweil der Dorfälteste gleichzeitig in einem Kabuler Gefängnis darüber grübelt, wer in der Hauptstadt ausgerechnet an seiner Verhaftung interessiert sein könnte. Der Prof trifft den kreativen, innovationsfreudigen Agraringenieur Khaled und dessen uneigennützige Geliebte Sanaubar, die ihren Lebensunterhalt mit dem Ritzen der Mohnkapseln verdient und sich um Shanzai kümmert, eine jugendliche Versehrte, die aufgrund eines Selbstmordattentats ihre Arme und ein Bein verloren hat, jedoch nicht ihren heiteren Lebensmut und unersättlichen Wissensdurst. Wiederholt gerät der Prof in Lebensgefahr und überlebt knapp einen Anschlag, da er argen Dunkelmännern verschiedenster Couleur begegnet, so Marodeuren, Söldnertrupps, al-Qaida-Terroristen, War Lords, Drogenbaronen, aber auch in Opiumgeschäfte verwickelten Diplomaten und Geheimdienstlern wie dem berüchtigten, sagenhaften US-Agent, der als der "weiße Ibrahim" bekannt ist. Ein Drogenthriller erster Güte. Leseprobe: romane-im-internet.de
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 506
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Norbert F. Schaaf
AFGHANISTAN DRAGON
Mohnanbau und Opiumschmuggel im Nordosten Afghanistans
Afghanistan Dragon - Opiumthriller
Norbert F. Schaaf
Copyright 2011 Norbert F. Schaaf
published at epubli GmbH, Berlin
www.epubli.de
Titelillustration: nailiaschwarz / photocase.com
ISBN 978-3-8442-1189-4
Vorwort / Warnsatz:
Dieses Buch ist geeignet, dass sich in ihren Gefühlen gewisse Leute verletzt fühlen könnten: Drogenhändler, Geheimagenten, Militärs, Manager, Politiker sowie Fundamentalisten unterschiedlicher Religionen. Gleichwohl sind alle handelnden Figuren rein fiktiv und Ähnlichkeiten mit Realpersonen rein zufällig. Das Nachwort indes ist kein unwichtiger Bestandteil des vorliegenden Buches.
Vorspann
Sanaubar richtete sich auf.
Sie biss die Zähne zusammen, die linke Faust in die Hüfte gestemmt. Schmerzvolle Stiche bohrten sich ihr wie mit rasiermesserscharfem Krummdolch ins Rückgrat. Diese Qualen waren ihr alltägliche Erfahrung, doch an sie gewöhnen würde sie sich nie. Den dritten Tag schon war sie auf dem Mohnfeld. Größer gewachsen als die meisten anderen Frauen musste sie in stark gebückter Haltung arbeiten. Nur so vermochte sie mit dem kleinen, gekrümmten Messer jene haarfeinen Schnitte in die Kapseln zu ritzen, aus denen ganz allmählich, im Verlauf etlicher Stunden, die weiße, sämige Milch herausquoll.
Sanaubar war geschickt im Anritzen der Mohnkapseln. Doch bekam man klebrige Finger dabei, die Sonne versengte einem das Gesicht und den Nacken wie ein Brandeisen. Selbst mit einem grobmaschigen Gitternetz als Sehschlitz einer Burka wäre die Arbeit nicht zu vollbringen. Das mandeläugige Mädchen in gelber hijab, dem Kopfschleier, hatte sich daher mit einer Mischung aus Hühnerblut und Erde eingerieben, doch auch das hielt die weißglühend vom Himmel herab stechenden Lichtstrahlen nicht völlig ab, die ihr die Augäpfel zu verschmoren drohten. Und doch war diese Arbeit noch die weniger unbequeme; jene Frauen, die einen Tag nach dem Anritzen den geronnenen Saft von den Kapseln abschabten und in kleine Blechdosen sammelten, waren weitaus schlechter dran. Die schwarzoxidierte Masse war widerspenstig, ab und zu fiel ein solches Klümpchen auf die Erde, wenn man schon glaubte, es an der Klinge zu haben. Dann war die Mühe umsonst gewesen. Es nützte nichts, das Klümpchen aufzuheben, denn daran klebten Erde und Pflanzenteilchen, die die Masse verunreinigten und im Wert minderten. Andernteils murrten die Männer, wenn die Frauen am Abend ihre Büchsen nicht gefüllt hatten.
Das Feld, auf dem die Frauen arbeiteten, lag eine gute Stunde von Karambar entfernt, auf einer schwer zugänglichen Hochfläche, die sich schroff, steil bis abschüssig, zwischen felsigen Hängen der kälteblauen Berge wie ein am Hang ausgerollter bemalter Filzteppich erstreckte. Es hatte zwar genügend Wasser, doch nur karges Erdreich. Hier in der Bergregion des nordöstlichen Afghanistan gab es nicht viel bebaubaren Boden. Ein Feld wurde bestellt, solange es eine Ernte versprach, ehe man es brachliegen ließ, bis es wieder eine niedere Vegetation zeigte. Hatte diese eine gewisse Dichte erreicht, drosch man sie zusammen und grub Gezweig, Laubwerk und Binsengras unter. Dadurch gewann der Boden gerade so viel Kraft, dass er erneut bestellt werden konnte, freilich nur für eine kürzere Periode als zuvor.
Vorwiegend wurde Mohn angebaut, seit unerdenklichen Zeiten schon. Die rosa oder malvenfarbigen Blüten bedeckten beinahe jedes Stück verwertbaren Bodens im Gebirge, im Bergwind wogende Blumenmeere. Der Mohn vertrug die Sonne, aber auch die Kälte der Nächte und kam mit wenig Feuchtigkeit aus. Und er war seit unzähligen Generationen das einzig gewinnbringende Tauschobjekt der Gebirgsbewohner. Sicher könnte man Trockenreis ziehen, man tat es auch in bescheidenem Umfang in unmittelbarer Nähe der Ansiedlungen, doch man brauchte zum Leben auch Öl und Salz, Geschirr und Werkzeug, Seife und elektrische Geräte, Brennstoff für die Lampen und Öfen sowie Kattun, um sich zu kleiden, und vieles mehr. Dies alles konnte man in den Tälern eintauschen gegen Opium. Ein einziger Sack voll brachte Salz und Öl für ein ganzes Jahr. Das klebrige, bräunliche Rohopium war deshalb für die Bergbewohner von jeher das Gold unter allen Erzeugnissen.
Die Menschen aus den Bergen interessierten sich nicht dafür, ob ihre Ware für medizinische Zwecke verarbeitet wurde oder als illegal hergestelltes Heroin in die Hände von Süchtigen geriet. Sie hatten die Mägen ihrer Kinder zu füllen. Niemand sonst tat das. Jede Regierung in Kabul hatte zwar schon vor einigen Jahren und wiederholt den Handel mit Opium verboten, doch das war eine Anordnung, um die sich in den Bergen niemand scherte. Wovon sollte man leben, wenn nicht vom Opium? Die Regierung gab keinen Reis. Sie ließ auch kaum Straßen bauen, die in die Berge führten, damit die Bewohner andere Produkte in die Täler transportieren könnten. Die wenigen, die es nun gab, waren zwar asphaltiert, jedoch viel zu unsicher, um sie regelmäßig zu benutzen. Der Regierung war es gleichgültig, ob in Karambar die Kinder hungerten oder nicht. Die Staatsmacht bestand nur aus Stammesfürsten und Kriegsherren, die an dem Handel mit dem Rohopium zumeist beteiligt waren.
1
Sanaubar dehnte und reckte und streckte sich. Die Gebirgswelt in der Weite um sie herum wirkte überwältigend, wenn sie aber auf den Erdboden herabschaute, herrschten Kargheit und Härte vor, die Natur und Klima der felsigen, zerklüfteten Landschaft eingeprägt hatten. Freilich sollte niemand sich täuschen: Das Gebirge gab sich einmal sonnig-heiter, ein andermal eisig-schroff.
Seufzend machte sich Sanaubar wieder an die beschwerliche Arbeit, ohne ihre grübelnden Gedanken verbannen zu können. In Karambar machte sich niemand Illusionen über die Regierung. Wer sich auf sie verließ, war verloren. Der Präsident, eine vom Ausland eingesetzte Marionette in der albernen Mischkleidung aus verschiedenen Trachten einiger Landesstämme, redete ab und zu von der Notwendigkeit, etwas für die arme Bergbevölkerung zu tun, doch alles sah danach aus, als könnte er seine Herrschaften von dieser Notwendigkeit nicht überzeugen – falls er es überhaupt versuchte. So blieb alles beim Alten. Vor einiger Zeit war manches geändert worden, nachdem die ersten Flugzeuge der Briten und der Deutschen, vor allem jedoch der US-Amerikaner über den Bergen erschienen waren. Zunächst waren sie verschwunden, doch bald wiedergekehrt. Vielfach mit Hubschraubern, die keine Landebahn benötigten. Rasch war eine Militärinvasion daraus geworden. Mit ihr war eine neue Händlerschaft erstarkt, die nach allmählicher Verdrängung der bisherigen Aufkäufer in den Tälern wohnte und meist für die Kabuler War Lords und Kriegsgewinnler oder andere Schieber arbeitete. Diese neuen Händler sprachen englisch und trugen saubere, frisch gebügelte Uniformen. Sie brachten in ihren Flugmaschinen Säcke und Kisten mit erstaunlichen Dingen noch in den letzten Winkel des Landes: von der Taschenlampe mit eingebauter Wasserwaage über den Zimmerspringbrunnen bis zum Modell eines Hexenhäuschens, und die Bergbewohner fanden es günstig, dass sie ihr Rohopium nicht mehr mühsam über die halsbrecherischen Pfade in die Täler transportieren mussten.
Es hatte den Anschein, als sei der Wohlstand in die Berge eingezogen. In den Lehmhäusern brannten am Abend helle Benzinlampen, die Kinder aßen Fleisch aus Dosen und tranken Milch, die als Pulver geliefert wurde. Sie naschten von dem Zuckerwerk, das die Fremden verteilten, und die Frauen trugen bunte Kattunkleider. Hier und da spielte ein Radio, flimmerte ein Fernsehgerät. Die Männer hatten Feuerzeuge und Digitalarmbanduhren. Das war jedoch nur eine Weile so gegangen. Heute luden die Fremden kaum anderes aus als Waffen, und die waren für die Leute in den Bergdörfern nutzlos. Zwar verfügten die Männer in Karambar wohl über Jagdflinten, meist sehr alte Exemplare, und sie freuten sich, wenn sie sie gegen neuere Modelle tauschen konnten. Wozu jedoch sollten sie Maschinengewehre oder Granatwerfer brauchen?
Das Problem löste sich vorerst dadurch, dass bunt zusammengewürfelte Haufen von dozds aus dem nordwestlichen Pakistan über die Grenze kamen. Angehörige der Taliban, die seit ihrem Machtverlust wieder Kleinkriege gegen die eigene Staatsmacht im Lande führten. Für sie waren Maschinengewehre und Granatwerfer nützlich. Sie bezahlten mit Opium dafür. In Karambar lagerten in den Erdgruben unter den Lehmhäusern wochenlang Plastiksäcke, gefüllt mit der braunen Opiummasse, bis die Fremden sie holten und wieder Maschinengewehre dafür brachten sowie Handgranaten, Panzerfäuste und Munition. Nahrungsmittel gab es nur noch selten, die waren angeblich knapp geworden. Nach und nach war Karambar, wie viele andere kleine Gebirgsdörfer, zu einer Umschlagstelle geworden: Waffen gegen Opium. Was die Kinder von Karambar essen sollten, kümmerte die Fremden nicht. Dennoch würde es bald im Dorf eine Besserung geben. Mir Khaibar, der qariadar, der Dorfälteste, war zusammen mit Jalaluddin, dem Onkel des Mädchens Sanaubar, nach Faïzabad gezogen, vor mehr als zwei Wochen schon. Die beiden Männer hatten alle verfügbaren Kamele mit Rohopium beladen, um es in Faïzabad, der ersten großen Stadt im westlichen Tal, gegen Geld einzutauschen. Dafür würden sie alles kaufen, was das Dorf benötigte: Salz, Mehl, Dörrfisch, geräuchertes Geflügel, Speiseöl, Tee, Zucker, Seife und Zahnpasta.
Vor dem Aufbruch der Karawane waren lange Debatten darüber geführt worden, ob man sie bewaffnen sollte oder nicht. Eine Anzahl junger Männer war bereit gewesen, zum Schutz mitzugehen. Schließlich hatten sie sich entschieden, lieber unbewaffnet aufzubrechen. Gewiss, sie könnten einer der in den Bergen vagabundierenden Horden von al-Qaida-dozds in die Hände fallen. Die Banditen würden die Männer töten und das Opium rauben, um es selber den Fremden zu verkaufen, mit denen sie auf gutem Fuß zu stehen wussten. Doch Mir Khaibar hatte gemeint, mit einigem Geschick ließe sich eine solche Begegnung vermeiden. Ebenso wie Jalaluddin kannte er jeden Steg in den Bergen, und die Karawane würde auf einer Route marschieren, die so gut wie sicher war.
Die Männer müssten indes längst zurück sein. Sanaubar war ein wenig beunruhigt. Sie lebte seit ihrer Kindheit bei ihrem Onkel. Kaka Jalaluddin hatte versprochen, ihr aus Faïzabad eine Haarspange mitzubringen und noquls, die leckeren Konfektstücke in Form von Maulbeeren. Nun war sie neugierig, ob er das auch nicht vergessen hatte. Sanaubars Haar fiel weit über ihre Hüften herab, geflochten in einen dicken Zopf. Wer sie auf dem Mohnfeld sah, das Gesicht voll von verkrustetem Hühnerblut und von Erde, konnte dennoch feststellen, dass sie ein außerordentlich schönes Mädchen war. Sie hatte ein zierliches Kinn, hohe Wangenknochen, ausdrucksstarke rehbraune Augen, dichte, wunderschöne geschwungene Brauen, eine glatte Stirn und in der Mitte gescheiteltes Haar, das wie ein kostbarer Schal ihre Hüften umspielte. Sie bewegte sich mit einer fließenden Grazie, die Blicke auf sich zog. Als der ausländische Pilot der ersten Maschine, die bei Karambar gelandet war, sie angesehen hatte, war er überrascht gewesen. „Was machst du hier in den Bergen? Du gehörst nach Kabul! Dort könntest du mit deinem Aussehen eine Million machen!“
Sanaubar hatte nur lachen können. Der Pilot war von ihrem Lächeln auf den Lippen und von ihren großen dunklen Augäpfeln mit den sanft geschwungenen Lidern so beeindruckt gewesen, dass er ihr mehrmals Geschenke aus Kabul mitgebracht hatte, ein Kleid, ein Stück duftender Seife oder Schokolade. Er hatte lange um sie geworben, und das Mädchen war ihm ausgewichen. Warum hatte er sich so töricht angestellt? Hatte er nicht gemerkt, dass sie nicht mit ihm allein sein wollte? Es ihm offen zu sagen, wäre unhöflich gewesen. Also hatte sich ihr Onkel Jalaluddin eines Tages entschlossen, dem Amerikaner mitzuteilen, dass Sanaubar einem jungen Mann versprochen sei, der Vollwaise war und wie das Mädchen seit seiner Kindheit in Jalaluddins Haus lebte und nach seiner Rückkehr vom Studium in Kabul auch wieder leben würde. Jalaluddin hatte ihre Eltern gekannt. Sie waren kurz hintereinander gestorben am Berghusten, jener tückischen Krankheit, die es seit jeher in den Bergen gab.
Der allein stehende Jalaluddin hatte den Jungen wie einen Sohn aufgezogen. Als er entdeckt hatte, dass Khaled ein außergewöhnlich kluger, begabter Junge war, hatte er durch Vermittlung der Tante Sanaubars, die in Kabul lebte, einen Studienplatz für ihn gekauft. Damals war ihm das noch aus dem Ertrag des Opiumhandels möglich gewesen. Heute war er froh, wenn Khaled in diesem Sommer das Studium beendete, sein Examen machte und nach Karambar heimkehren würde.
Für jeden im Dorf war klar, dass Sanaubar und der Student dann heiraten würden. Und Khaled würde dem Dorf raten können, wie aus der Lage herauszukommen war, in die es die Fremden gebracht hatten.
Auch Sanaubar wartete mit Ungeduld darauf, dass Khaled kam. Sie befürchtete zwar nicht, dass er sich in Kabul ein anderes Mädchen gesucht hatte, denn sie wusste, dass er sich in der großen Stadt nicht wohl fühlte und über manche Lebensgewohnheiten der Leute dort den Kopf schüttelte. Er ging auch Auseinandersetzungen nicht aus dem Weg, bei einer Demonstration war ihm das Nasenbein eingeschlagen worden. Und Sanaubar sah, dass in Karambar möglichst bald etwas verändert werden musste, wenn das Dorf nicht zugrundegehen sollte. Das Unternehmen, das Mir Khaibar und Jalaluddin begonnen hatte, der heimliche Verkauf von Opium in Faïzabad, würde ein wenig helfen, wenn auch nicht auf die Dauer.
Wie oft sagte Khaled zu ihr: „Dostet darum.“ Und sie bestätigte: „Ich liebe dich auch.“ Er nannte sie: „Meine malika, meine gul.“ Und sie fühlte sich wie eine Königin, wie eine Blume. Und er sagte: „Du bist maghbool wie der Mond.“ Khaled sah sie ehrlich als eine ausgesprochene Schönheit, sie selbst sich allenfalls als apart. Sie habe einen kleinen melancholischen Zug um die zart geschwungenen Lippen, sagte ihr Khaled, und ein heiteres Lächeln in den Augen. Dieser Ausdruck aber könne wechseln, dann sehe er Melancholie in ihren Augäpfeln und das Lächeln um ihren Mund und wieder umgekehrt – je nach ihrer Stimmung und ihrem Befinden. Selten einmal lächelten Augen und Lippen zugleich. Und stets nur, wenn sie sich unbeobachtet glaubte.
Sanaubar schätzte freilich am meisten an Khaled, dass er sie teilhaben ließ an seinen wissenschaftlichen Forschungen und politischen Ansichten, an seinen Gedanken und Plänen, an seinen Befürchtungen und Hoffnungen. Khaled und Sanaubar gingen liebevoll miteinander um und voller Zärtlichkeit, doch nicht dies, sondern ihre Diskussionen ritzten das Bewusstsein.
2
Versonnen, mit lächelnden Augen und Lippen, ritzte das Mädchen geschickt eine Mohnkapsel nach der anderen. Ab und zu streckte es sich und schaute nach der Sonne, die nur noch knapp über den Berggipfeln im Westen stand. In einer Stunde würde das Licht fahl werden. Das bedeutete jedoch nichts weiter, als dass die Sonne hinter den Felszacken entschwand, danach dauerte es noch zwei Stunden bis zum Einbruch der Dunkelheit, und Sanaubar wollte zur Nacht ins Dorf zurück. Sie blieb nicht in einer der aus Zweigen und Lehm errichteten Hütten am Rand des Felsens, wie die meisten anderen Frauen, die sogar ihre Kinder mit hierher genommen hatten. Ihr Gefühl sagte ihr, dass Jalaluddin und Mir Khaibar heute noch zurückkehren würden, da wollte sie zu Hause sein.
Sie wunderte sich, als sie einen Mann aus der Schlucht herauskommen sah. Die Männer arbeiteten jenseits des Berges, auf einem Steilhang, an dem das Ernten noch schwerer war als auf dem leicht aufsteigenden Feld. Es war noch zu früh, dass die Männer sich einstellten, um gleich ihren Frauen den Abend zu Hause zu verbringen. Doch der Mann rief schon von weitem ihren Namen.
Sanaubar steckte das Messer weg und trat vorsichtig, so dass sie möglichst keine der Mohnpflanzen knickte, vom Feld auf den schmalen Pfad, der zur Schlucht führte, und lief dem Mann entgegen. Als sie vor ihm stand, sagte er ein wenig betreten: „Geh ins Dorf zurück, hamshira jo!“
„Dann ist die Karawane gekommen, ja?“
„Jalaluddin ist da.“ Er drehte sich um und ging.
Sanaubar wunderte sich zwar, dass er so bedrückt erschien, doch lief sie los, ohne sich weiter Gedanken darüber zu machen. Auf dem Weg summte sie eine alte Hazara-Weise über Tulpenfelder vor sich hin, eine afghanische Melodie, die immer dann in ihrem inneren Ohr aufklang, wenn sie an ihre Liebsten dachte – Khaled und Shanzai.
Drei Dutzend Häuser, an den Rändern eines kleinen Plateaus verteilt, bildeten das Dorf Karambar. Ein wenig niedriger Wald stand ringsum, ein paar Flächen waren mit Büschen und Gestrüpp bewachsen, und dazu gehörten die liebevoll angelegten kleinen Felder mit Trockenreis, Gemüse, Erdnüssen, Minze und Kartoffeln, auf deren Gedeih und Ernte so wenig Verlass war wie auf ausreichend Wasser. Die Häuser verdienten ihren Namen kaum, es waren meist recht primitive Hütten aus gebrannten Ziegeln, mit einem Lehm- und Strohgemenge beworfen. Die Lehmhütte, in der Sanaubar geboren war und ihr ganzes Leben gewohnt hatte, war spärlich eingerichtet, aber sauber, beleuchtet von zwei Petroleumlampen. Es gab ein unteres Stockwerk für die Männer, ein oberes für die Frauen. Matratzen oder Matten lagen an allen Seiten der Räume, dazwischen abgetretene Herati-Teppiche mit ausgefransten Rändern, in je zwei gegenüberliegenden Ecken standen dreibeinige Stühle und kleine Holztische. Die Wände waren nackt bis auf ein angenageltes Regalbrett und einen Wandteppich. Der im Frauenstockwerk hatte eingenähte Perlen, die die Worte Allah-u-akbar formten, ein saughat, ein Souvenir von einer Auslandsreise des Hausherrn. Ein paar Töpfe und Pfannen hingen oben an Pfosten, ein Bild des Präsidenten, es fanden sich gewebte Matten und allerlei selbstgefertigte Gebrauchsgegenstände. Sogar ein batteriebetriebener chinesischer Schwarzweißfernseher war vorhanden, noch aus der Zeit, als die Fremden brauchbare Dinge gebracht hatten, oder aus Cola-Büchsen gefertigte Trinkgefäße, und Salzbehälter, die ursprünglich Konservendosen gewesen waren. In dieser kleinen Hütte war Sanaubar an einem feuchtkalten Wintertag Ende der Neunzehnhundertachtziger Jahre zur Welt gekommen und ihre Mutter kurz nach der Geburt verblutet.
Verfolgte man die Geschichte Karambars bis zu ihrem Anfang zurück, fand man den Namen dieser Ortschaft schon um jene Zeit erwähnt, da es weit im Norden, in den Tälern jenseits des Oxus, den Mongolenheeren des Dschingis Khan gelang, neue Reiche zu erobern. Das war an die achthundert Jahre her. Von da an waren die Völker aus den von den Mongolen eroberten Gebieten südwestwärts geströmt, und sie zogen auch über die Berge durch das Gebiet um Karambar. Viele von denen, die heute in den großen Städten des Landes wohnten, die Staat und Wirtschaft verwalteten, waren Abkömmlinge dieser Zugewanderten.
Jene, die immer in den Bergen gewohnt hatten, waren dort geblieben. Die Gründung des Reiches der Paschtunen hatten sie aus der Entfernung verfolgt. Gewiss, sie begrüßten es, dass Afghanistan, das „Land der Tartaren“, erstarkte und dass es sich seiner Nachbarn erwehren konnte. Doch im Grunde veränderte das nicht ihr Leben. Zuweilen gab es Auseinandersetzungen mit anderen Stämmen, die ebenfalls in den Bergen angesiedelt waren, den Shinwari etwa. Doch man einigte sich immer wieder. Es gab Zeiten, da leistete man sich sogar Beistand, wenn die Steuereintreiber aus dem Süden in die Berge kamen und allzuviel badraga, den erpressten Binnenzoll, forderten oder auch bei den Einmärschen fremder Truppen, gleich ob aus Großbritannien, Russland, den USA oder der EU.
Für die Bewohner der großen Städte im Süden und Westen war die Hochgebirgsbevölkerung immer eine unbekannte Größe gewesen. Man war daran gewöhnt, dass aus ihrem Gebiet das Opium kam, jene aus dem Mohn gewonnene Droge, die in der Geschichte Asiens schon oft eine Rolle gespielt hatte. Die Bergbewohner selbst genossen sie bislang nur sparsam, sie kannten ihre Wirkung. Meist nahmen sie sie gegen Schmerzen, oder sie kauten die zähe, braune Masse gegen den Hunger. Die modernen Dealer, die Drogenbarone, hatten sich gemäß der ihnen eigenen Geschäftstüchtigkeit nach und nach in den Tälern der Berge angesiedelt und traten als Zwischenhändler auf. Hin und wieder gab es Auseinandersetzungen zwischen ihnen und den lokalen Machthabern, den Großgrundbesitzern und den Kriegsherren oder War Lords, die selbst das Geschäft machen wollten. Der Mohn blühte dessen ungeachtet weiterhin in den Bergregionen, und der kalte Wind wog die Blumen wie sanfte Ozeane, während in den Kapseln der weiße Saft heranreifte, bis die farbigen Blütenblätter schließlich abfielen und die Dorfleute mit ihren kleinen Messern kamen. Es gab in Afghanistan Millionäre, die ihren Reichtum einzig dem Opium verdankten. Von den Bergbewohnern indes wurde niemand reich. Selbst ein bescheidener Wohlstand blieb aus. Man fristete sein Leben, das war alles.
Nun hatten die Fremden, voran die US-Amerikaner, die Kabuls Marionettenregierung ins Land gerufen hatten, den Drogengeschäften freien Lauf gelassen. Uniformierte, die mit Flugzeugen kamen, verdrängten die afghanischen Aufkäufer auf die Balkan- und die Russlandroute, teils mit Gewalt, teils mit besseren Preisen. Sie wollten nicht nur ein bisschen von der braunen Substanz kaufen, die durch komplizierte Destillationsprozesse in Heroin verwandelt werden konnte – sie wollten möglichst ganze Ernten. Und sie wandteen seltsame Mittel an, um ans Ziel zu gelangen. Sie bestachen, sie täuschten, sie überredeten, sie zwangen. Afghanistans Regierung, die auf ihrem Territorium ein halbes Dutzend Luftstützpunkte der Vereinigten Staaten hatte errichten lassen, duldete sie stillschweigend. In vielen Fällen machte sie sich zum Helfer der US-Amerikaner. Der Unmut darüber wuchs. Doch Amerikas Abgesandte verfügten in diesem Lande über so viel Macht, dass sie den Unmut nicht zu fürchten brauchten, jedenfalls nicht im Augenblick.
3
Jalaluddin, der alte Mann mit dem wettergegerbten Gesicht und dem eisgrauen, borstigen Haar, hockte auf dem Eisenholzstamm vor seiner Behausung in Karambar. Er war müde von dem langen Weg durch die Berge. Viele Tage war er, von zwei Männern begleitet, mit den Tragtieren hierher unterwegs gewesen. Er hatte in Faïzabad so lange gewartet, bis er eingesehen hatte, dass sich nichts mehr hatte ändern lassen. Nun grübelte er, wie das zu erklären sei, was sich da abgespielt hatte. Über dem Dorfplatz lag bereits Schatten. Der Sonnenball war hinter den Bergkuppen untergetaucht. Im Dorf herrschte Stille. Nur ein paar Hühner gackerten schläfrig, und aus dem Sträucherstreifen, der das Dorf säumte, kamen vereinzelte Vogelrufe. Kein Rauch von Kochfeuern lag in der Luft und nicht der Duft des Tabaks, den der Nachbar rauchte. Nur ein paar alte oder kranke Leute waren zuhause geblieben, die anderen waren auf den Feldern. Das Geplärr der Kinder fehlte.
Sanaubar winkte Jalaluddin, der in Gedanken versunken auf dem Baumstamm saß, schon von weitem zu. Sie war außer Atem, denn fast den ganzen Weg vom Feld ins Dorf war sie gelaufen, nun ließ sie sich mit hart klopfendem Herzen neben dem Alten auf den Stamm sinken.
„Jalaluddin, was ist denn?“ fragte sie besorgt.
Er sah sie an und blickte dann über sie hinweg auf die Berge. Es dauerte lange, bis er das erste Wort sprach.
„Sie haben Mir Khaibar verhaftet.“
„Verhaftet? Wer? Und warum?“
Immer noch über den Sinn der Vorgänge sinnierend, berichtete er: „Mir Khaibar hat mit dem Händler gesprochen und ist dann zurückgekommen. Damit wir mit den Packtieren nicht durch die Stadt mussten, hat uns der Händler eins von den kleinen japanischen Dreiradautos geschickt. Wir haben alles aufgeladen, und Mir Khaibar war mitgefahren, um den Handel abzuwickeln. Ich habe mir ein wenig Faïzabad angesehen. Ich war lange nicht in der Stadt. Am späten Abend war Mir Khaibar immer noch nicht zurück. Da bin ich zu dem Händler in Chakir gegangen. Der hat es mir erzählt. Die Polizei ist gekommen, als Mir Khaibar dabei war, die Säcke abzuladen. Polizisten aus Faïzabad. Sie haben ihn mitgenommen und die Fracht.“
Das Mädchen starrte ihn an. Jalaluddin nickte müde. „Und sie haben nichts weiter gesagt, qariadar?“
„Gesagt haben sie, dass sie ihn wegen unerlaubtem Verkauf von Rohopium mitnehmen.“
„Dem Händler haben sie nichts getan?“
„Nein. Er hat noch erwähnt, dass es das erste Mal war seit langer Zeit, dass so etwas geschah. Überall wird gelegentlich Opium angeboten, meistens kleinere Mengen, aber die Polizei hat sich sonst nie darum gekümmert.“
„Weißt du, wohin sie ihn gebracht haben?“
„Ins Stadtgefängnis. Ich war dort, aber man ließ mich nicht zu ihm. Ich bin auch zu einem Anwalt gegangen. Der Händler hat es mir geraten. Der Anwalt hat mit den Beamten im Gefängnis gesprochen. Und die haben ihm gesagt, er soll sich die Mühe sparen. Mir Khaibar wurde zur weiteren Untersuchung des Falles nach Kabul gebracht. Wenn er einen Beistand braucht, wird er ihn dort bekommen.“
Jalaluddin hob die Hände und drehte die Handflächen nach oben, raue, rissige Handflächen. Eindringlich sah er Sanaubar an und schloss bedrückt: „So bin ich heimgekommen. Kein Geld, nicht einen einzigen Afghani. Das Opium ist verloren, und niemand weiß, was aus Mir Khaibar wird.“
Eine Weile saßen sie nebeneinander und überlegten. Was da geschehen war, konnten sie sich nicht erklären. Gewiss, es gab das Verbot des Opiumhandels. Doch warum musste Mir Khaibar der erste sein, auf den es angewandt wurde? Und warum sollte er nach Kabul gebracht werden?
Sanaubar entschied schließlich: „Wir müssen etwas unternehmen. Ich werde meiner Khala schreiben. Vielleicht wird sie herausfinden, wie wir Mir Khaibar helfen können.“
Jalaluddin äußerte zögernd: „Du willst dich an Shalla wenden? Aber – vielleicht ist es ihr nicht recht?“
„Sie wird uns helfen.“
Shalla war die jüngste Schwester ihres früh verstorbenen Vaters. Ihr Leben war ein wenig seltsam verlaufen, Sanaubar wusste nicht viel darüber. Sie hatte ihre Tante ein einziges Mal gesehen, vor einigen Jahren, als Shalla in Begleitung ihres Mannes für einige Tage in das Dorf gekommen war. Und es war wohl der Mann, der Jalaluddin zweifeln ließ. Shalla war mit einem Kanadier verheiratet, der sich vor annähernd dreißig Jahren in Afghanistan niedergelassen hatte. Es hieß, sie habe diesem Kanadier, als sie selbst noch ein Kind gewesen war, das Leben gerettet, damals, während des schlimmen Krieges gegen die Russen. Doch die Einzelheiten dieser Geschichte kannte Sanaubar nicht. Jalaluddin gab vor, sie auch nicht genau zu kennen. Sanaubar erinnerte sich nur daran, dass Shalla ihr Hilfe versprochen hatte, für den Fall, dass sie sie einmal brauchen sollte. „Wir sind ziemlich wohlhabend“, hatte sie gesagt. „Wir haben keine Kinder. Wenn du in Not kommst, erinnere dich an uns.“
Sanaubar hatte von Khaled erfahren, dass er die Verwandten gelegentlich besuchte. Schließlich verdankte er ihnen die Vermittlung seines Studienplatzes.
„Ich werde sofort schreiben“, erklärte das Mädchen. Sie lief zum Haus, um Papier und einen Stift aus einem Kampferholzkasten zu holen.
In der Hütte angekommen sah sie zuerst nach Shanzai, einem versehrten jugendlichen Mädchen, das bei einem Selbstmordattentat auf dem Bazar in Faïzabad ihre gesamte Familie sowie sämtliche Gliedmaßen eingebüßt hatte außer dem rechten Bein. Geschehen damals, kurz vor der „Zeit der dunklen Bärte“, als die Bürgerkriegsparteien des Golbud-Din Hekmatyar und des Ahmad Schah Massoud sich bis aufs Blut zerfleischt hatten.
Shanzai hatte selbst keine Erinnerung daran; sie war noch zu klein gewesen, und eine schwere Gehirnerschütterung hatte wohl auch vorlegen. Gelegentlich veranlasste sie Sanaubar, ihr den Hergang zu erzählen. Es war an einem heißen Sommertag gewesen. Kinder waren auf dem Nachhauseweg von der Schule. Kurz bevor sie den Rand des Bazars erreichten, geschah es. Eine gewaltige Detonation. Ein infames Selbstmordattentat, wie sich rasch herausstellte. Die Eltern, als man ihnen die schreckenerregende Nachricht brachte, eilten herbei, irrten hysterisch kreischend am Unglücksort herum, eine Mutter sammelte Teile ihres Sohnes in ihre Schürze ein, Shanzais Kaka Noor, der Bruder ihrer Mutter, barg von seiner Nichte, was übrig geblieben war, die Verwandten fanden erst Tage oder Wochen später von ihrer geliebten Angehörigen einen Arm, einen Ellbogen, eine Hand und das Bein, dessen Fuß noch in Strumpf und Schuh steckte und bereits in Verwesung übergegangen war, auf dem Dach eines der umstehenden Häuser. Shanzai konnte schwerversehrt gerettet werden. An den schmerzhaften, langwierigen Prozess der Genesung hatte sie nur schemenhafte Erinnerungen – bruchstückhaft wie das, was das Leben von ihr übriggelassen hatte.
„Hallo, Sanaubar jo“, grüßte Shanzai, während sie der Freundin auf ihrem einen Bein entgegenhüpfte mit der geschmeidigen Anmut eines jungen Kängurus. „Ist etwas Schlimmes passiert?“
Sanaubar antwortete ausweichend. „Es sind schlimme Zeiten, Shanzai jo.“
„Auf Sonnenglut folgt Regenguss“, sagte Shanzai.
„Es war etwas Schlimmeres als schlechtes Wetter.“
„Es gibt gar kein schlechtes Wetter. Das sagt auch Khaled jo. Es gibt nur nützlicheres und schädlicheres Wetter.“
„Ach, Shanzai jo, zurzeit scheint sich alles zum Schlechteren zu wenden.”
„Es kommen auch wieder gute Zeiten“, sagte Shanzai. Sie stand still mit erhobenen Haupt und der stromlinienförmigen Grazie eines Flamingos, die Sanaubar lächeln ließ.
Nachdem Sanaubar ihrem Pflegling die hijab auf ihrem pechschwarzen Haar gerichtet und sie mit dünnem chai versorgt hatte, kehrte sie mit den Schreibutensilien zu Jalaluddin zurück und ließ sich wieder auf dem Stamm nieder. Sie musste bei jedem Wort nachdenken, denn sie schrieb nicht oft. Gelernt hatte sie es von einem ehemaligen Soldaten, der ins Dorf zurückgekehrt war. Man hatte ihm bei der Armee Lesen und Schreiben beigebracht, und er hatte seine Kenntnisse an einige jüngere Leute im Dorf weitergegeben. Jalaluddin sah dem Mädchen zu, wie es das Papier mit den seltsam verschlungenen Linien der Dari-Schrift füllte. Als sie endlich fertig war, brach die Nacht herein.
„Ich bringe den Brief morgen nach Shari-i-Buzurg“, sagte Sanaubar. „Wenn ich zeitig genug aufbreche, kann ich vor Nachteinbruch dort sein. Am nächsten Abend bin ich zurück.“
Jalaluddin nickte nur, obwohl er sie nicht gern allein den fünfzig Kilometer weiten Weg durch die Berge machen ließ. Von Shari-i-Buzurg, der nächsten Poststation aus, würde der Brief mindestens noch eine Woche bis Kabul brauchen. Was mochte bis dahin aus Mir Khaibar geworden sein?
Während es dunkelte, kochte Sanaubar eine bescheidene Reismahlzeit. Irgendwo wurden shahnai-Flöten geblasen und dohol-Trommeln geschlagen. Jalaluddin dachte daran, dass er am frühen Morgen auf die Mohnfelder hinausgehen musste. Bei dem beschlagnahmten Opium hatte es sich um Gemeinschaftseigentum gehandelt. Wie sollte er nur den Dorfbewohnern den Verlust beibringen? Der Alte strich unruhig durch den großen Raum des Lehmhauses. Er fasste hier einen Kochtopf an und dort eine Matte, stand herum, ein wenig ratlos, bis Sanaubar zu ihm trat und ihn aufforderte: „Leg dich schlafen, Jalaluddin. Es wird alles gut werden. Mach dir jetzt keine Gedanken mehr.“
Sie selbst verließ noch einmal das Haus und lief zur Wasserstelle. Aus den Bergen sickerte ein Rinnsal bis in die Nähe des Dorfes, wo die Bewohner einen Schacht angelegt hatten, in dem sie es auffingen. Sanaubar schöpfte mehrere Eimer voll und trug sie in das Badehaus. Es diente allen. Heute aber war niemand da außer Sanaubar. Sie warf das verblichene Kleid ab, dessen einst tiefblaue Farbe die Sonne in ein schmutziges Grau verwandelt hatte. Dann ließ sie sich das Wasser aus den Eimern über den Körper laufen. Sie griff in den Haufen feinen Sandes, der im Badehaus lag, und rieb damit die Haut. Seife gab es nicht, sie war teuer, und man musste sie aus Faïzabad holen. Darum begnügte man sich mit dem Sand aus den Bergen.
Als Sanaubar ins Lehmhaus zurückkehrte, saß Jalaluddin immer noch auf seiner Matte, die Gedanken an Mir Khaibar plagten ihn. Doch er dachte auch daran, dass es heute eigentlich ein kleines Fest hatte geben sollen. Wäre das Missgeschick in Faïzabad nicht passiert, hätte man heute qurma gegessen, Steckrüben auf Reis, oder sogar naan-Brote aus dem tandoor-Ofen mit turkmenischen Kebab aus Hammelfleischstückchen, das Jalaluddin aus Faïzabad hatte mitbringen wollen. So aber hieß es, auf all das zu verzichten, denn das Opium war verloren, und sie hatten kein Geld, um Nahrung zu kaufen.
Nachdem Sanaubar Shanzai mit Reis versorgt, zu Bett gebracht und zugedeckt hatte, löschte sie die Öllampe und legte sich auf ihr Mattenlager. Sie behielt das Kleid an; das war so üblich, denn die Nächte in den Bergen waren stets empfindlich kühl, doch wiederum nicht kühl genug um diese Jahreszeit, dass man sich unter die schwere Decke aus Yakfell hätte verkriechen wollen, die man höchstens während der frühen Morgenstunden zu er tragen vermochte.
„Schlaf gut, Sanaubar jo“, wünschte Shanzai. „Du hast heute wahrlich genug getan.“
„Du auch“, gab Sanaubar zurück.
Die junge Frau hörte noch, wie Jalaluddin unten mehrmals aufstand und im Raum umherging, ohne Ruhe zu finden, ehe sie einschlief. Sie wachte auf, als sich der Himmel über den Bergen im Osten gerade rötlich einzufärben begann. Jalaluddin und Shanzai schliefen. Die junge Frau fachte das Kochfeuer an, das im bukhari, dem traditionellen afghanischen Ofen noch schwach glomm, legte etwas argol, die Yak-Fladen, in die Glut und wärmte ein wenig von dem Rest der Abendmahlzeit des vergangenen Tages. Als der Reis leicht angebraten war, rief sie Shanzai und Jalaluddin, und sie aßen gemeinsam. Shanzai löffelte den Reis anmutig-geschickt mit dem Fuß. Nach dem Mahl half Sanaubar ihrem Schützling Shanzai in einen weiten, fußlangen Umhang, damit sie sich in Abwesenheit ihrer Pflegerin einmal selbst zu behelfen vermochte, so dass sie in kleinen Sprüngen nach draußen zur Senkgrube an der Berglehne sich hinbewegen konnte, sich mit dem Rücken an einen Baum lehnen, den Umhang hochschieben und ihre Notdurft verrichten.
Schließlich steckte Sanaubar den Brief in eine Tasche des Kleides und band einige getrocknete Aprikosen und ein wenig Salzgemüse in ein Tuch. Damit brach sie auf, nicht ohne Jalaluddin an die gebührende Versorgung Shanzais gemahnt zu haben. Die Strahlen des Sonnenballs, der über die Berge stieg und mit seinem Licht die Landschaft überflutete, trafen Sanaubar bereits weit vom Dorf entfernt. Sie ging auf einem steilen Pfad aufwärts, dem ersten Pass zu. Bis Shari-i-Buzurg würde sie fünf solcher Bergketten zu überwinden haben. Weit war das Land: Berg an Berg, Einöde an Einöde lagen wellenförmig hingebreitet, eine harte Landschaft in Sandgelb und Stahlblau. Rechterhand stürzte der Bergrücken schroff in den Talgrund hinunter. Zur Linken türmten sich die Felswände, wie im Aufbäumen erstarrte gellende Rufe von Urweltgiganten, die einander zu ewiger Unfruchtbarkeit verfluchten. In erregend steilem Absturz bisweilen glitt der Pfad talwärts. Zwischen nackten Felsen stand etwas niedriger Wald, und dort war es kühl. Sanaubar kannte den Weg genau. Eine Stunde bevor der Sonnenball entschwand, würde sie nach Shari-i-Buzurg hinabsteigen. Zeitig genug, um den Brief in der Posthalterei abzugeben. Danach wollte sie ein paar Stunden auf dem Hof einer Karawanserei schlafen, bevor sie den Rückweg antrat.
4
Beim steilen Landeanflug hinter dem eisbedeckten Hindukusch auf Kabul International Airport nahmen die Passagiere neugierig und skeptisch die weite Stadtlandschaft der afghanischen Kapitale in Augenschein. Nach den gefältelten Bergketten im Karakulmuster, eine steinerne Springflut eng rollender Felswellen, sahen sie nun in den Schutt geschrammte Strukturen, alle Ton in Ton mit Siedlungsumrissen in erstarrten, grundlegenden, naturnahen Formen: sandbraune Stadt in einer sandbraunen Ebene zwischen sandbraunen Bergen in einem sandbraunen Dunst aus Staub. Die Karrees der Gebäudeblöcke schienen unversehrt, wie über Meilen ausgerollter, grobtexturierter Filzteppichboden. Umfassungsmauern standen neben Bombenkratern, Einzelwände neben Schürfblessuren. Ein paar leuchtende Farbtupfer stachen hervor, die Karos der Grünflächen und Parks. Beim Näherkommen wirkte die Haut der Erde indes windelweich geprügelt, schwerverletzt und großflächig verschorft.
Den umkämpften Airport Kabuls flankierten Flugzeugwracks, demolierte Helikopter, baufällige Hangars, Autofriedhöfe und verlassene militärische Stellungen.
In den ersten Morgenstunden des neuen Tages landete die vierstrahlige Boeing problemlos. Sie kam nach stark klimaschädlichem, Zirruswolken bildendem Langstreckenflug über Hawaii und Bangkok aus den Vereinigten Staaten. Die schwere Maschine rollte langsam aus und blieb unweit der Abfertigungsgebäude stehen. Noch einmal heulten die Düsentriebwerke auf, bevor sie abgestellt wurden. Die kleinen Karren mit den Gangways fuhren heran, die Türen wurden geöffnet, ein Strom von Reisenden quoll heraus: Journalisten und Geschäftsleute, Soldaten und ausländische Zivilisten mit mürrischen Gesichtern. Begrüßt von Transparenten mit den Konterfeis von Präsident Karzai, Kriegsheld Massoud und Siemensvorstand Kleinfeld: Welcome to Kabul. Der Flug war ein wenig unruhig gewesen. Man schätzte dies nicht, in der Nacht wollte man in seinem Sessel zurückgelehnt schlafen. Doch nun schien alles vergessen zu sein.
Kabuls Flughafen war ein reiner Repräsentationsbau ohne intaktes Innenleben. Die Passagiere drängten sich durch dunkle Gänge, vorbei an abgeschälten Wänden mit offenliegenden Leitungs- und Rohrsystemen. Es gab provisorische Schalter und ein asthmatisches Förderband, das die Gepäckstücke durch ein Mauerloch in die völlig überfüllte Wartehalle spie. Schmale Neonröhren sprühten asymmetrisch-flatteriges, nervtötendes Licht gegen unverputzte Ytong-Blöcke und auf überreizte Passagiere.
Die Zivilisten fanden sich in Grüppchen zusammen, Ausländer, fast ausnahmslos. Sie würden in schlecht klimatisierten Zimmern unmoderner Hotels wohnen, und nach zwei, drei Wochen würden manche zurückfliegen, mit Kamerachips voller Schnappschüsse, mit ein oder zwei nachgemachten „echten“ Seidenteppichen oder Antiquitäten, mit einem Lapislazuli-Kästchen, einem Talisman gegen den bösen Blick, einige auch mit einer Erkrankung, die durch Penicillin zu heilen war. Das Land verdiente an den Besuchern. An den Soldaten verdiente es auf andere Weise. Meist waren es Angehörige der Einheiten, die auf den Stützpunkten stationiert waren, Piloten, Ranger, GIs. Der Krieg war scheinbar vorbei, doch die Regierung der Vereinigten Staaten betrachtete Afghanistan weiterhin als einen großen, unversenkbaren Flugzeugträger in Mittelasien, und besonders die US-Amerikaner blieben hier, solange das irgend möglich war. Sie zahlten einen hohen Preis dafür. Doch das Geschäft war auf ihrer Seite. Afghanistan nahm eine erhebliche Menge jener Konsumgüter auf, die US-Amerika in Massen erzeugte und die anderswo nur noch schwer abzusetzen waren. Wenn man dafür Stützpunkte erkaufen konnte, so war das ein guter Handel. Aber selbst das fiel schon nicht mehr so sehr ins Gewicht. Ein großer Teil der einheimischen Industrie befand sich ohnehin in den Händen US-amerikanischer Monopole, ganz gleich ob sie Waschpulver herstellten, Kattun oder Coca-Cola. Diese Stadt wirkte im Kern wie ein Anhängsel der Vereinigten Staaten. Die Herrschaften, die sie regierten, garantierten das. Was das Land betraf, so sah das ganz anders aus.
Der kleingewachsene, untersetzte Mann, der als einer der letzten aus der Boeing gestiegen war und sich ein wenig verloren vorkam, während er zur Abfertigung ging, fiel nicht auf. Er war in einen hellen Anzug gekleidet und trug einen leichten Borsalino-Reisehut, der seine Sean-Connery-Halbglatze verhüllte, nicht aber seinen Haarkranz aus silbergrauen Locken. Um den Hals trug er an einem dünnen schwarzen Lederband eine randlose Brille mit leicht getönten Gläsern, so dass sie seine Augen nicht verbargen, aber doch die Farbe der Augäpfel verschleierten. Weniger um seine Augen zu schützen, als vielmehr die seiner Mitmenschen. Seine Pupillen waren nämlich von zweierlei Farbe. Wenn er in den Spiegel blickte, kam er sich vor wie ein Husky; das rechte Auge war rehbraun sanft, das linke azurblau weichherzig. Er hatte indes schon des Öfteren erfahren, dass sich manch ein Zeitgenosse irritiert fühlte. In diesem Land der Dschinns und des Aberglaubens würde mancher sich wohl mehr als irritiert fühlen. Der Mann kratzte sich den graumeliert spießenden Dreitagebart, er nahm begierig die Szenerie auf, die sich ihm darbot. Er reiste offenbar einzeln, und er hatte wohl auch keine Reisebekanntschaft gemacht, denn er schlenderte für sich allein zur Abfertigung, wo er nach einigem Warten seinen Pass vorlegte.
Der Beamte las laut den Namen: „Professor Beat Hodler?“
Der kleine Mann nickte.
„Arzt?“
Wieder nickte er. Der Beamte blätterte in dem Pass, fand das Visum und stempelte es ab. Mit einem freundlichen Lächeln übergab er dem Mann das Dokument zurück und bedeutete ihm, sich zur Zollabfertigung zu bemühen, einem niedrigen Tisch, der viele Meter lang war und auf den die Fluggäste ihre Gepäckstücke wuchteten. Hodler hatte keine Eile. Er stellte sich neben seinen Rollkoffern auf und wartete. Er blickte einzelnen kleinen Grüppchen vermummter Frauen nach, die indes polychrome Armreifen und goldene Ringe trugen und phantasievoll gemusterte mit Borten versehene Burkas mit eingewebten Edelsteinen. Ob es der Versuch war, Individualität herzustellen, Harnisch zu beseelen, oder lediglich Zeichen für das Vordringen der globalen Märkte zu den Körpern auch der afghanischen Frauen, sogar den verschleierten? Ein US-Amerikaner mit einem Gerätekoffer schlenderte vorüber, auf seiner Brust der T-Shirt-Aufdruck TEARS DOWN GROUP. Ein Beamter erschien und blickte Hodler fragend an, worauf der Schweizer seinen Gepäckschein reichte und auf die beiden nicht gerade großen Koffer deutete. Der Beamte erbat nochmals den Pass, erkundigte sich wiederum, ob Hodler Arzt sei, und als ihm das bestätigt wurde, legte er eine Hand auf einen der Koffer und fragte: „Berufsgepäck?“
Hodler verneinte.
Der Beamte wollte wissen: „Führen Sie Medikamente mit?“
„Kopfschmerztabletten.“
„Alkohol, Drogen?“
„Nein.“
Der Beamte setzte ein Lächeln auf, während er Pass und Gepäckschein aushändigte. Mit einem Stückchen Kreide machte er kleine Kreuze auf die Koffer, bevor er Hodler höflich einen angenehmen Aufenthalt wünschte. Hodler bedankte sich ebenso freundlich. Seine Koffer waren nicht schwer. Er rollte sie mühelos aus der Halle. Auf dem Vorplatz mit seinem breiten Sicherheitsabstand zu allen, die hier auf Heimkehrer warteten, blickte er sich suchend um. Unter den Werbebannern für Handys und neue Suppen sah er ausgemergelte Gestalten, die Gesichter von Entbehrung gezeichnet, die jedoch nach innen zu glühen schienen, mit hungrigen, stechenden Augen. Menschen mit solchen Augäpfeln vermochten ihr Leben in die Haut anderer einzubrennen. Die Männer schauten mit geschlossenen Mündern. Sie hatten allen Grund zu Misstrauen gegenüber den Ankömmlingen, die alle etwas wollten: ihren Profit, ihren Einfluss militärischer und politischer Art, ihr Land, ihre Frauen, ihre Würde. War je etwas Gutes gekommen von draußen, seit sie auf diese Welt gekommen waren?
Hodler entdeckte die Reihe Taxis, japanische und nordamerikanische Autos. Einer der Fahrer lief herbei und verstaute die Koffer, während Hodler einstieg.
„Man hat mir das Hotel Oriental empfohlen“, sagte der Professor, als der Fahrer sich hinter das Lenkrad klemmte. „Ist es ein vernünftiges Hotel?“
Der Fahrer war ein noch junger Afghane, der sehr kurz geschnittenes Haar trug und überhaupt den Eindruck eines Soldaten machte, der gerade ausgemustert worden war und in einem neuen Beruf zu arbeiten begann. Er wiegte den Kopf und antwortete: „Oriental ist ein gutes Hotel, Mister. Nicht eins von den teuersten, aber sauber und modern.“
„Klimatisiert?“
„Natürlich! Liegt in der Pul-e-Mahmood Khan. Geschäftsreisende wohnen meist dort.“
„Dann ist es richtig für mich. Fahren Sie mich bitte dorthin.“ Hodler blickte den Fahrer verwundert an, da dieser den Motor noch nicht anließ, sondern ihn fragend ansah. „Ist noch etwas?“
Der Fahrer hatte längst begriffen, dass dieser kleine Mann zum ersten Mal in Kabul war. Er würde ihn trotzdem nur in vertretbarem Ausmaß betrügen. Nachdenklich sagte er jetzt: „Pul-e-Mahmood Khan, das wären dann sechzig Afghani, Mister...“
„Aah“, machte Hodler. Es war offenbar üblich, sich vor der Fahrt über den Preis zu einigen. Er rechnete schnell, ehe er anbot: „Ich habe noch kein afghanisches Geld eingewechselt. Würden Sie mit drei Euro zufrieden sein?“ Immerhin lag der Flughafen nur etwa drei Kilometer nordöstlich der Hauptstadtperipherie.
Der Fahrer startete sogleich. „Damit bin ich sehr zufrieden, Mister.“ Ein Fahrgast, der nicht kleinlich war. Eigentlich wären zwei Euro für die Fahrt in dem nicht mehr ganz neuen und auch nicht gerade modernen Wagen genug. Während Hodler sich zurücklehnte, empfahl ihm der Fahrer: „Mister, wenn Sie einen bestimmten Tipp wollen, sagen Sie es bitte. Einen guten Stadtführer? Wir haben hier sehr gute Badehäuser mit Massage.“
Hodler lächelte. Er kannte das aus den Reiseführern, die er gelesen hatte. Doch er war nicht gekommen, um in einem hamam zu schwitzen und sich massieren zu lassen. Ein Restaurant, das war schon wichtiger.
Der Fahrer riet ihm: „Marco Polo oder Haji Baba, das sind die Restaurants mit der besten einheimischen Küche. Wenn Sie chinesisch essen wollen, empfehle ich Ihnen den Golden Dragon oder das Great Shanghai. Beide in der Kocheh-Morgha, der Chicken Street, wo Sie auch Teppiche und Antiquitäten erwerben können – alles sehr billig und bestimmt echt. Ein Taxi fährt Sie von Ihrem Hotel in ein paar Minuten dorthin. Bezahlen Sie nicht mehr als hundert Afghani, das ist reichlich!“
„Danke“, sagte Hodler. Hühnerstraße, dachte er, das klingt fast schon abgeschmackt. Der Chauffeur sprach ein einigermaßen gutes Englisch, doch das war wohl in dieser Stadt nichts Außergewöhnliches. Hodler blickte aus dem Fenster. Seine Augen klaubten automatisch all die Merkmale auf, die stützten, was vorab bekannt war: Ruinen, Kreuze, Grabhügel mit wehenden Flaggenfähnchen, Waffen, Einschusslöcher, Brandspuren, ausgebrannte Panzer, gestrandetes schweres Gerät und am Straßenrand einbeinige Kinder, einarmige junge Männer, minderjährige Witwen.
Die Stadt begann mit niedrigen Behausungen, doch dahinter türmten sich hohe Betonklötze in den Sandfarben von Schmirgelpapieren der neuen Bauten auf. Der Gegensatz konnte nicht größer sein: Eine riesige, neuerrichtete Moschee mit integrierten Schulgebäuden neben Glaspalästen für Banken, Hotels und Hochzeitshallen sowie einem gerade aufgebauten überdimensionierten Shopping-Center mit westlichem Interieur und der entsprechend modisch gestylten, vielfach weiblichen Kundschaft. Manchmal hatten die Architekten diesen modernen Bauwerken ein paar Arabesken verliehen, die daran erinnern sollten, dass dies ein orientalisches Land war. Ein Anblick, der Hodler nur bedingt beeindruckte.
Spürfahrzeuge donnerten vorbei, Panzer, Jeeps, Geländewagen der Schutztruppen und Kleinbusse der Nicht-Regierungsorganisationen. Ab und zu passierten sie knallbunte einzelne Zapfsäulen, die Tabernakel der Epoche des Klimawandels. Wenn er sich recht erinnerte, hatte sich so oder so ähnlich der Autor Roger Willemsen in dem Bericht seiner afghanischen Reise ausgedrückt.
Vor dem Hotel half der Fahrer ihm, die Koffer zu tragen. Hodler bedankte sich freundlich, doch der Mann wehrte den Dank ab. Er wünschte einen guten Aufenthalt und entfernte sich, zufrieden mit sich und dem unerfahrenen Fahrgast, dem er trotzdem nicht so viel Geld abgenommen hatte, wie es vielleicht möglich gewesen wäre.
Hodler schrieb sich in das Gästebuch ein und erstand die Kopie eines Stadtplans, während ein Hoteldiener in burgunderroter Polyesterlivree, weißem Hemd mit Ansteckkrawatte und steifer Schirmmütze bereits mit seinem Gepäck im Treppenaufgang verschwand, vorbei an einem mit einer Kalaschnikow bewaffneten Guard. Der Fahrstuhl war wohl wegen Stromausfall außer Betrieb. Der junge Mann, der Hodler abfertigte, nickte höflich, als der Gast sich erkundigte, ob er ihm auf der Karte eine paar Wege zeigen könne.
„Ja, sehr freundlich. Das Büro für industrielle Kooperation?“ fragte Hodler. „Es soll in der Straße fünfzig, der Sarak-e-Mehmana liegen.“
„Straße fünfzehn“, korrigierte der junge Mann lächelnd. Er kannte nicht nur die Straße, sondern auch dieses Büro, ließ es sich jedoch nicht anmerken. Er tippte mit dem Zeigefinger auf die Karte. „Hier, nicht weit vom Kriegsopfer-Hospital, Sir.“
Unvermittelt fiel der Strom aus. Kommentarlos klappte der Portier sein Handy auf und orientierte sich am kalt-blauen Licht der Displays. Das Gespräch ging weiter.
„Und dann“, sagte Hodler, „suche ich noch einen Herrn, der hier eine Fabrik für Seidenfasern besitzt. Leider weiß ich die Straße nicht, nur seinen Namen. Mister Spencer Wright.”
„Oh, Mister Wright!“ Der junge Mann machte mit seinem Bleistift ein Kreuz auf die Karte. „Natürlich ein bekannter Name. Große Fabrik für echte Seide, ja Sir. Hier finden Sie ihn. Darulaman-Boulevard, nicht weit vom Hafis Park. Möchten Sie seine Telefonnummer, Sir?“
„Dafür wäre ich Ihnen sehr verbunden“, gestand Hodler erleichtert.
Der junge Mann schrieb eine Nummer aus dem Telefonverzeichnis ab und gab Hodler den Zettel. „Sie können von Ihrem Zimmer aus telefonieren, Sir.“
Auf seinem Zimmer öffnete Hodler sogleich die Koffer und entnahm einen neuen, hellen Anzug. An der Wand hing ein eingeschweißter DIN-A4-Computerausdruck mit Touristen auf Liegestühlen vor Bambushütten darauf. Unten aufgedruckt stand: AFGHANISTAN. Auf dem Bett lag eine Tagesdecke aus mit fetten roten Rosen bedrucktem Velours. Durch das aus Europa oder China importierte Plastikfenster blies der stetige Kabuler Wind sandfarbenen Staub herein, die Sommersonne warf sandgefärbte Strahlen hindurch. Nach dem Duschen bestellte Hodler einen Imbiss aus Sandwiches und Früchten. Danach hatte er das Bedürfnis, ein Stündchen zu schlafen, und er schob den Besuch im Büro für industrielle Kooperation auf bis zum frühen Nachmittag. Den in der Mitte des Zimmers an der Decke befestigten Ventilator, der den Zusatz „vollklimatisiert“ im Hotelprospekt rechtfertigen sollte, stellte er ab. Er schlief kaum eine Stunde, doch als er aufwachte, fühlte er sich ausgeruht.
Ein Blick auf die Uhr zeigte, dass er noch Zeit hatte. Er las Mitschriften aus TV-Gesprächsrunden, die er sich aus dem Internet ausgedruckt hatte, von Aussagen des langjährig orienterfahrenen Deutsch-Franzosen Pierre Scholl-Latour, der sagte, es gehe den großen amerikanischen Konsortien nicht nur darum, die Erdölförderrechte in Aserbaidschan, Kasachstan, Turkmenistan und Usbekistan zu erwerben, weswegen sie sich überhaupt erst wieder für Afghanistan interessierten, sondern auch darum, den Transport des „schwarzen Goldes“ sicher und kostengünstig unter eigene Kontrolle zu bringen. Den US-amerikanischen Prospekteuren sei daran gelegen, die russischen Leitungen und die iranische Route zu umgehen. Stattdessen hätten sich die texanischen Investoren für den Bau einer eigenen Pipeline durch Afghanistan entschieden. Nun gelte es, diese Trasse politisch und militärisch zu stabilisieren. Nicht aus Dankbarkeit für ihren heldenhaften Kampf gegen den Sowjet-Giganten nehme man sich der Afghanen wieder an, sondern „aus schnödem Kalkül und merkantiler Habgier“.
Ein Leichnam herrsche über die menschenwimmelnde, hässliche Metropole Kabul, die vom Krieg so grausam verstümmelt worden sei. Gerade weil die Machtverhältnisse an der Spitze Afghanistans extrem verworren seien, gewinne der tote Massoud eine so überdimensionale Bedeutung. Gewiss gebe es da den Interimspräsidenten Hamid Karzai, einen Paschtunen aus vornehmem Geschlecht, der der Königsfamilie aus Kandahar nahestehe. Karzai sei in der Stunde des großen Gedenkens an den Tadschiken Massoud in die USA abgereist. „Dort gehört er auch hin“, sagten die Afghanen; denn längst sei dieser ehemalige Pfründenempfänger der texanischen Öl-Firma Unocal in den Augen des Volkes zur US-amerikanischen Marionette geworden, der verlängerte Arm der USA. In Washington habe man den extravagant gekleideten Feudalherrn, dessen Anhang weggeschmolzen sei wie das Gletschereis im Klimawandel, nachsichtig als „Gucci-Mudschahid“ belächelt. In Kabul sei man weniger tolerant. Dort wisse man, dass die absurde Versammlung auf dem Petersberg bei Bonn in Deutschland, die ihn im Herbst 2001 zur tragenden Figur des Post-Taliban-Regimes proklamiert habe, eine fremdgesteuerte Farce gewesen sei, bei der die CIA die Strippen gezogen habe. Der afghanische US-Bürger und Businessman Zalmav Khalilzad habe von Anfang an als Graue Eminenz und als Vertrauensperson des US-Präsidenten über entscheidenden Einfluss verfügt und seinen Freund Karzai ins Spiel gebracht. Die sogenannte Wiederwahl Karsais sei eine neuerliche Farce, die vor brutalen Repressalien zum Leidwesen des Wahlvolkes und massivem, dummdreisten Wahlbetrug nicht zurückschrecke.
Hodler überflog einen Artikel, herauskopiert aus dem deutschen Polit-Magazin „Spiegel“, worin der US-amerikanische Verteidigungsminister Donald Rumsfeld – noch einer, dachte Hodler, der sein Land am Hindukusch verteidigt – Afghanistan „eine ziemliche Erfolgsgeschichte“, nannte, die jedoch „leider weitgehend unbemerkt bliebe“. Auch von mir, dachte Hodler mit Blick aus dem Fenster. In den nächsten Kreisverkehr fuhren US-Panzer mit gekreuzten Sternenbannern und ließen das Geschützrohr in alle Richtungen kreisen.
Eine weitere Kopie enthielt Äußerungen Hekmatyars: Der Kommandeur des Hezb-e-Islami verglich die Aktion der USA mit dem Fehlschlag des sowjetischen Expansionsstrebens und sogar mit der gescheiterten Eroberungspolitik Hitlers. „Ich bin davon überzeugt“, so erklärte er wörtlich, „dass der begonnene Widerstand gegen die US-Truppen von Tag zu Tag intensiver wird. Die Bush-Administration war bemüht, Informationen über die ablehnende Haltung der Afghanen gegenüber der amerikanischen Präsenz, über den Zustand des Krieges, über die Höhe der eigenen Verluste und über die ständige Zunahme der Angriffe auf ihre militärischen Basen der eigenen Öffentlichkeit vorzuenthalten. Auf Dauer konnte diese Täuschung jedoch nicht von Erfolg sein. Der Druck der amerikanischen Bevölkerung auf die Bush-Administration wird zunehmen und sie zwingen, ihre Soldaten aus Afghanistan abzuziehen.“
Über die Taliban äußerte sich Hekmatyar nuanciert. Die „Koranschüler“ hätten selbst in abgelegenen Regionen für eine Sicherheit gesorgt, die heute nicht einmal im Zentrum der Hauptstadt Kabul vorhanden sei. Sie seien auch – im Gegensatz zu den heutigen Behörden – energisch gegen die Opiumproduktion vorgegangen. Aber diese Bewegung habe eine völlig unzureichende Kenntnis des Islam besessen und sich durch ihr rücksichtsloses, grobes Auftreten unbeliebt gemacht.
Das Hochkommen von al-Qaida betrachtete er als eine zwangsläufige Folge der US-amerikanischen Bevormundung der arabischen Länder und der verfehlten Palästinapolitik Washingtons. „Die Auflehnung gegen die US-Hegemonie“, so führte Hekmatyar aus, „benötigte eine Führung, um sich in eine lebendige Organisation umzuwandeln.“
Für die in Kabul stationierten deutschen Soldaten der ISAF-Brigade war folgende Aussage von Bedeutung: „Während die Truppen der USA und ihre Verbündeten gegen das afghanische Volk einen ungerechten Krieg führen und täglich Dutzende wehrloser Afghanen ihr Leben verlieren, spielt die sogenannte `International Security Assistance Force´ die Rolle einer schmerzlindernden Tablette. ISAF legitimiert die verbrecherischen Ziele amerikanischer Kriegführung. Die amerikanischen Einheiten bezeichnen sich ebenfalls als Friedenstruppe. Die Afghanen sind zu dem Ergebnis gekommen, dass die Präsenz ausländischer Soldaten in ihrem Land keinerlei Garantie für Frieden und Sicherheit bietet, sondern dass sie Unfrieden und Unsicherheit stiftet. Die Funktion von ISAF dient der Konsolidierung einer verräterischen Räuberbande, die ihre Willkürherrschaft über das afghanische Volk ausübt.“ Erst nach Ausschaltung sämtlicher ausländischer Einflüsse, so meinte der Verantwortliche der zur Zeit stärksten Widerstandsbewegung am Hindukusch, seien die Probleme Afghanistans auf dem Wege dauerhafter Verständigung und Versöhnung zu lösen.
5
Etwa um diese Zeit fand der junge Mann in Livree, der Hodler im Hotel empfangen hatte, Gelegenheit, unbeobachtet zu telefonieren. Er verlangte Mister Wright persönlich zu sprechen und sagte nach einer kleinen Weile gedämpft in die Muschel: „Mister Wright, dies ist ein Hinweis für Sie vom Empfangschef des Hotels Oriental. Ein Professor Beat Hodler, Schweizer, aus den Vereinigten Staaten kommend, hat nach Ihnen gefragt. Es wird Sie interessieren, dass er sich außerdem erkundigte, wie er zum Büro für industrielle Kooperation kommen kann.“
Er lächelte und deutete sogar eine leichte Verbeugung an, während er sagte: „Oh, keine Ursache, das war eine Selbstverständlichkeit, Mister Wright!“ Alles sprach er in seiner Landessprache Pashto.
Hodler hatte indessen ein Taxi bestiegen, sie passierten Militärposten, der Chauffeur zeigte auf das Ministerium für Grenzen und Stammesangelegenheiten. Der Schweizer war ein wenig enttäuscht, denn das Taxi fuhr schon nach kurzer Zeit dicht an den linken Straßenrand und hielt. Hier, inmitten eines modernen Viertels, lag das Büro für industrielle Kooperation. Das Gebäude, in dem es untergebracht war, unterschied sich kaum von den anderen sandfarbenen Betonklötzen, die mit ihm in einer Reihe standen. Kabul hatte wohl in den letzten Jahren keine Gelegenheit versäumt, sein äußeres Bild jenem anzugleichen, das man von den Großstädten Nordamerikas gewöhnt war.
Hodler hatte andere mittelasiatische Städte besucht, und er erinnerte sich gern an das bunte Durcheinander, das dort herrschte, an die Straßenhändler und die Rikschas, die spielenden Kinder am Straßenrand, und die Eselskarren und die Lastenträger, an die Düfte um die Straßenküchen herum, das Geschrei der Handwerker und das Menschengewimmel auf den Bürgersteigen. Kabul war anders, zumindest das Zentrum der Stadt. Der Professor war sich nicht klar darüber, ob er es moderner nennen sollte. Die mondäne Oberfläche wirkte aufgetragen, sie ließ erkennen, dass sie dünn war, künstlich. Wenn man die Schriftzeichen unter den Pepsi-Cola-Plakaten und Füllhalterreklamen, den Tafeln mit riesigen Zahncremetuben oder Taschenlampen gegen lateinische Beschriftungen austauschte, könnte das hier auch Florida sein oder Kalifornien. Der Unterschied war gering, denn selbst die Erzeugnisse, die sie anpriesen, waren die gleichen wie in den Vereinigten Staaten.
Beat Hodler entsann sich der Feststellungen eines seiner Kollegen, der längere Zeit in diesem Lande verbracht hatte und nach dessen Urteil Afghanistan unter dem Einfluss der Vereinigten Staaten im Begriff war, immer mehr von seinen nationalen Eigenarten zu verlieren. Zweifellos hatte dieser Prozess in der Hauptstadt begonnen und schon ein großes Ausmaß angenommen, darüber konnten die gepflegten Moscheen nicht hinwegtäuschen, die zwischen den Hochhäusern standen. Hätten diese Leute, die da auf den Bürgersteigen gingen, nicht orientalische Gesichter, dachte Hodler, könnten sie ebenso gut aus Palm Beach stammen oder Santa Monica. Die jungen Männer trugen Anzüge im gleichen Schnitt wie die dort, und die Kleider der Mädchen in den Shopping-Centern und Diskos unterschieden sich kaum von denen, die man in Los Angeles sah oder in Miami. Wer hatte einmal von den mystischen Schatten geschrieben, die der Halbmond in die lampenlosen Gässchen warf, auf die bizarren Konturen der Häuser mit ihren Dächern, wo Wäschestücke in allen nur erdenklichen, im Halbdunkel mitunter erschreckenden Formen vom leisen Wind gehoben und wieder fallen gelassen wurden? Von der Klangromantik eines aus einem anderen Stadtteil herüberklingenden Flötenlieds? Und der Duftromantik der Wohlgerüche des Orients, die sich im Bazar der Stoffhändler aus dem Odeur von Kattun und Pferdemist zusammensetzten? Kabul konnte er kaum damit gemeint hatten. Oder aber seine Feststellung beschränkte sich auf einzelne Orte wie jene Parkanlage, dem Shar-e-Nau, wo sich Kinder gegenseitig auf Schaukeln stießen oder Volleybälle über zerrissene Netze schlugen, die zwischen Mispel- und Persimonenbäume gespannt waren, und wo kleine und große Jungen Drachen steigen ließen. Oder die Hochzeitshallen, wo auch in düstersten Jahren kostspielige Vermählungen gefeiert wurden von afghanischen Familien, die sich nicht selten dafür lebenslang verschuldeten.
Ich werde umdenken müssen, begriff Hodler. Vieles vergessen und einiges hinzulernen. Dies war das Asien, wie es die Vereinigten Staaten ausprägten, wenn ihrem Einfluss freie Bahn gelassen wurde. Sollte man es bewundern? Oder sollte man nicht vielmehr betrauern, was da verlorenging?
Die Zufahrt zu dem modernen Bau war mit wuchtigen Betonklötzen und soliden Schranken gesichert und wurde von einem halben Dutzend bewaffneter Männer bewacht. Um das ganze Gelände zog sich eine hohe Mauer. Hodler betrat das Gebäude, nachdem er einer gründlichen Leibesvisitation unterzogen worden war, und blickte sich in der geräumigen Halle um. An einem Empfangstisch saß eine junge Afghanin in einem hautengen Kleid aus gelbem Kattun. Als Hodler auf sie zu ging, schlug sie die Beine übereinander; dabei war zu sehen, dass ihre Unterwäsche die gleiche Farbe hatte wie ihr geschlitztes Kleid. Sie trug eine Sonnenbrille, Hodler konnte ihre Augen nicht erkennen. Er nickte ihr zu und erklärte, er wolle zu Mr. Oates. Das Mädchen lud ihn höflich ein, Platz zu nehmen in einem Stahlrohrsessel. Während sie zum Telefon griff, dachte Hodler darüber nach, wie wohl das Leben eines solchen Mädchens aussehen mochte. War sie womöglich schon eine junge Frau? Was tat sie, wenn sie nicht hier saß und Besucher anmeldete? Worüber sprach sie mit ihrem Freund oder mit ihrem Mann? Hatte sie Sorgen? Oder lebte sie in dieser Umgebung, ohne sich Gedanken über das zu machen, was um sie herum vorging?
Sie bat ihn, sich noch ein wenig zu gedulden, während sie auf die Verbindung wartete. Mit einem freundlichen Lächeln, das nicht von den Augen ausging, die hinter den dunklen Gläsern versteckt waren, sondern von den Mundwinkeln, die sich leicht verzogen. Ein Geschöpf dieser Stadt. Sollte man aus ihrem modernen Kleid den Schluss ziehen, dass sie leichtfertig war? Oder hatte sie sich einfach einer Lebensform angepasst, die in Mode gebracht worden und gleichzeitig verfemt war? Waren Kleid und Brille, das offenbar von einem geschickten Friseur gepflegte schwarze Haar und das freundliche Lächeln mehr eingeübte Routine als Ausdruck ihrer eigenen Denkweise? Man müsste länger hier leben, dachte er. Man müsste die Seele dieser Menschen erforschen, wenn es sie unter der Oberfläche von Chrom und Neon, von Chicagoer Kattun und Gesichtscreme noch gab. Ich bin sicher, es gibt sie. Doch es wird schwer sein, sie zu entdecken.
Sechs Stockwerke über der Halle betätigte in diesem Augenblick ein etwa fünfzig Jahre alter, untersetzter US-Amerikaner, der hinter einem schweren Schreibtisch saß, einen kleinen Schalter. Auf einem der vier Bildschirme, die in die Wand eingebaut waren, erschien das Bild des Professors, im Stahlrohrsessel sitzend. Der Amerikaner betrachtete den Besucher eine Weile. Das Büro, in dem er sich befand, war von einer ausgezeichneten Klimaanlage gekühlt. Die Einrichtung bestand aus Teakholz. Neben einer Anzahl technischer Einrichtungen war das Zimmer noch mit bequemen Sesseln und einem kleinen runden Tisch ausgestattet. Fotografierte Landschaften aus den Vereinigten Staaten schmückten die Wände und verliehen dem Raum eine Nüchternheit, die durch die beiden gekreuzten Sternenbanner hinter dem Schreibtisch unterstrichen wurde.
„Schicken Sie ihn herauf“, sagte der US-Amerikaner in die Sprechanlage. Und schaltete das Bild ab. Der Mann wirkte genau so nüchtern wie seine Umgebung. Er zog sein schwarzweißkleinkariertes Sakko, das er einem eingebauten Garderobenschrank entnahm, über das blaugestreifte Hemd mit dem Seidenschlips in rötlichen Farben. Mechanisch griff er nach einer Zigarre, doch zündete er sie nicht an, sondern trat an eines der großen Fenster und blickte durch die Scheiben auf die Straße hinunter. Die Hände auf den Rücken gelegt, wippte er leicht mit den Fußspitzen auf und ab. Eine schlechte Angewohnheit noch aus seiner Ausbildungszeit. Er war weder erregt noch verärgert, er war auch durch den Besuch nicht überrascht. Mr. Oates, leitender Resident der Central Intelligence Agency in Kabul, hatte den Herrn Professor Beat Hodler erwartet. Ein Wissenschaftler, Mediziner. Schweizer. Mitglied der internationalen Kommission für die Bekämpfung des Drogenmissbrauchs mit Sitz in New York. Keiner von den eifervollen jungen Karriereleuten. Fünfzig vielleicht. Er wirkte gelassen, soweit man das auf dem Bildschirm zu erkennen vermochte. Jedenfalls ein nicht mehr junger Mann, ohne die Illusion, Rom an einem Tag zu erbauen. Nun ja, man hatte solche Leute aus internationalen Gremien oft genug erlebt. Dieser hier würde auf die Freuden der Kabuler Badehäuser verzichten, er würde auch kaum in die Gefahr zu bringen sein, über dem Lächeln einer Barfrau im UN-Quartier sein Anliegen zu vergessen. Vermutlich würde er nicht einmal viel Zeit damit vergeuden, nach echten Antiquitäten zu suchen; ein paar Souvenirs vielleicht für die Frau oder die Töchter zu Hause. Dinge, die zwischen dem Touristenkitsch lagen und dem teuren, kunsthistorisch wertvollen Sammlerstück. Wir werden sehen.
Der Chefagent drehte sich um, als die gepolsterte Tür mit der schlichten Aufschrift `ABRAHAM TRACY OATES´ von seiner Sekretärin geöffnet wurde. Miss Douglas war noch nicht lange in Kabul. Wie die meisten Neulinge hatte sie sich erst an das Klima gewöhnen müssen. Gegenwärtig war sie dermaßen erkältet, dass sie näselnd sprach, was nicht gerade dazu beitrug, ihre Attraktivität zu fördern. Miss Douglas war ein farbloses, molliges, großbrüstiges, kleingewachsenes Geschöpf, dessen Wert in seiner absoluten Zuverlässigkeit lag. Man war nicht einmal genötigt, ihre Liebhaber zu überprüfen, sie hatte keine. Miss Douglas verbrachte ihre Freizeit gewöhnlich mit dem Hören von Schallplatten. Klassische Musik in guten Zeiten, Gospel in schlechten.
„Sir, dies ist Professor Beat Hodler“, flötete sie.
Oates verkniff sich ein Lächeln. Es klingt wie eine gestopfte Trompete, dachte er. Oder wie ein Saxophon. Doch er brachte es fertig, ihr mit ernster Miene zuzunicken, bevor er Hodler die Hand entgegenstreckte. „Ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen.“
Er führte den Besucher zu dem kleinen runden Tisch und ließ sich dort mit ihm nieder. Bevor er das nächste Wort sagte, öffnete er eine große silberne Zigarettendose und hielt sie Hodler hin. Als dieser ablehnte, stellte er die Dose wieder zurück, und zwar genau auf den Kontakt, der das Tonband auslöste. Kurz darauf erschien Miss Douglas mit einem Tablett, auf dem zwei Gläser Limonade standen, eine Flasche Bourbon sowie ein Eiskübel.
Hodler blickte der Sekretärin nach, die das Zimmer umgehend verließ, und er erinnerte sich verwundert, dass die Empfangsdame in der Halle goldfarbige Härchen an ihren gebräunten Beinen gezeigt hatte. Miss Douglas trug undurchsichtige Nylonstrümpfe. Welch unterschiedliche Geschöpfe leben doch zuweilen unter einem Dach! Hodler wandte sich Oates zu, der bereits die Bourbonflasche entkorkte. „Bitte nur einen symbolischen Schluck, Mister Oates“, bat der Schweizer. „Ich bin nicht gewohnt, Alkohol zu trinken.“