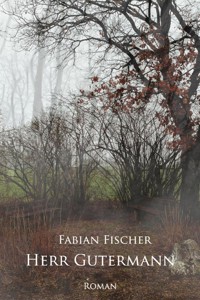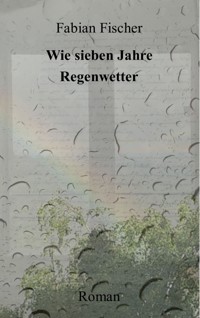Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Agnete ist 97 Jahre alt und lebt allein am Waldrand. Eines Tages bekommt sie Besuch von einem seltsamen Mann. Was will er von ihr? Kennt er womöglich ihr Geheimnis? Falls ja: Wieso will er dann nur reden? Agnete fasst Vertrauen und begibt sich mit ihm auf eine Reise in ihre Vergangenheit. Unwissend, dass diese Reise große Auswirkungen auf ihre Zukunft haben wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 368
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fabian Fischer
Agnete
Roman
Impressum
Texte: © 2023 Copyright by Fabian Fischer
Umschlag:© 2023 Copyright by Fabian Fischer
Verantwortlich
für den Inhalt:Fabian Fischer
Niddagaustraße 54
60489 Frankfurt am Main
Druck:epubli – ein Service der Neopubli GmbH, Berlin
Für alle, die ohne Kaffee nicht leben könnten.
∞
Mein Dank geht an
Timo, Simone, Kathrin, Rebekka und Karsten.
Im Haus am Waldesrand
Ursprung
Vater Frostig
Geld (fr)i(s)st die Welt
Mutter? Fratze!
Waldarbeiter Walter
Von Engeln, Feen und Büchern
Aufbruch in niemandes Land
Unter Hügeln
Das Schicksal bestimmt
Heimat. Feindesland. Niemandsland.
Spieglein, Spieglein, an der Wand – Wessen Ende ist bekannt?
Willkommen hier im Niemandsland,
wo vieles war, und wenig ist.
Mittendrin, doch unbekannt, lebt das Böse, unerkannt.
Schleier, Nebel, Nacht, Krieg und Ruhe,
Stille, hat der Tod gebracht.
Verbrechen finden immer statt,
in Häusern, Dörfern und der Stadt.
Auf dem Land, am See und Waldesrand,
geht es deutlich fleißiger her.
Hier eins weg, dort eins weg, bald ist nichts mehr da.
Tote gibt es immer, wird es immer geben.
Menschen werden sterben, Menschen werden leben.
Blut und Knochen, sind begraben,
in Erd‘ und Äst‘, nie durchnässt.
Wenn Wasser wird Gift, dein Licht erlischt.
Holz braucht Leben, Flamme braucht Leben,
das Niemandsland nur beider Tod.
(Inschrift auf einem Wegstein bei Sundernach)
Im Haus am Waldesrand
»Ob ich’s war? Da kann ich entweder lange rumeiern und Ablenkungen suchen. Ich kann Verwirrung stiften, Gegenfragen stellen. Oder ich gebe es einfach zu. Möchtest du einen Kaffee haben? Ich habe gerade erst einen aufgesetzt, kurz bevor du an der Tür geklingelt hast. Du müsstest den Pfeifton sogar draußen gehört haben. Dieser schöne Ton, der mir tagein, tagaus zuruft, dass mein schwarzes Lebenselixier fertig ist. Wobei das ja nicht nur ein Ton ist. Es ist auch ein Zischen, ein Pfeifen, ein immer lauter werdender Schrei. Ich frage mich gerade, ob meine Fensterscheiben zerspringen würden, wenn ich die Kanne nicht vom Herd nehmen würde. Ob das Glas dann zu Staub zerstoben und die Hauswände wie Spielkarten in sich zusammenstürzen würden? Vielleicht würde sich unter dem zusammengekrachten Haus ein tiefer, schwarzer Schlund öffnen, der alles um sich herum in die Dunkelheit reißen würde. Vielleicht würden – wenn der Pfeifton noch lauter und schriller rufen würde – die Bäume dort hinten umknicken und alles und jeden, von der Ameise bis hin zum Wolf im Ganzen verschlucken. Sicher, die Vögel könnten wahrscheinlich ihre Flügel ausbreiten und in die Lüfte aufsteigen. Sie würden dem Pfeifton und dem Schlund entkommen. Nur wie lange? Irgendwann träfe es auch sie. Die Welt würde aufgefressen von diesem Schlund. Und alles nur wegen meines Kaffees?«
»Agnete, du schweifst ab. Ich liebe deinen Erzählstil, ich konnte sogar das Bersten der Fensterscheiben und das Splittern der Baumstämme hören, das frisch freigelegte Holz riechen. Aber darum geht es gerade nicht. Ich wollte nur von dir wissen, ob du es warst.«
Über Agnetes zerfurchtes Gesicht huschte ein zarter Schmunzler. Natürlich schweifte sie ab. Genau das wollte sie ja auch. Mehr noch: Sie wollte ihren Besucher ablenken. Vom Thema abbringen, und dann in Ruhe ihren Lebensabend weiter verbringen. Ohne ihn.
»Ja, stimmt. Da habe ich mich gerade wohl selbst etwas mitgerissen. Wie ein kleines Fischerboot in einem Sturm an der bretonischen Küste, das hilflos über die tosenden Wellen getragen wird und dann irgendwann mitsamt der Steuerfrau an irgendeinem namenlosen Felsen zerbricht.«
»Das ist aber ein schwieriger Vergleich, Agnete. So wie ich dich einschätze, bist du doch eher die Welle oder der Sturm.«
Agnetes Mundwinkel hoben sich leicht nach oben. Im nächsten Moment schluckte sie aber das bereits aufsteigende Kichern wieder herunter. Er hatte recht. Die Steuerfrau in ihrer Vorstellung trug keinen ihrer Gesichtszüge. Sie ähnelte vielmehr ihrer Mutter. Bis sie am Felsen zerschellte. So wie die blöden Vögel an ihrem Haus.
»Ach du, das ist charmant. Vielleicht ein Wind. Ein laues Lüftchen. Aber ein Sturm? Als Steinbock?«
Der Mann musterte sie unbemerkt. Dann nickte er ihr leicht zu.
»Hast ja recht, das passt nicht so wirklich. Dann doch vielleicht eher der Felsen.«
Nun gluckste Agnete.
»Stock und Stein, bricht dein Bein. So geht doch der Spruch, nicht wahr? Möchtest du nun einen Kaffee?«
»Warum nicht, ja.«
»Ohne Zucker, nehme ich an?«
»Ja, korrekt. Aber warum nimmst du das an?«
»Nun, du siehst so extravagant aus. Weitgereist. Gebildet. Und wenn ich damit richtig liege, weißt du, dass nur Idioten ihren Kaffee mit Zucker trinken. Dann weißt du, dass man die Aromen nicht verfälschen darf. Dass man seinen Geschmacksknospen die schokoladige, fruchtige Bitterkeit nicht vorenthalten darf.«
»Damit liegst du richtig. Du scheinst eine gute Menschenkenntnis zu haben. Eine gute … Kenntnis.«
»Wie wahr, wie wahr. Mir kann man denke ich nichts vormachen. Auch keine Fremden. Auch du nicht.«
Beide grinsten sich an. Dann stand Agnete von ihrem Sessel auf und lief in die Küche.
»Etwas Kuchen hätte ich auch da. Frisch ist der nicht mehr, zwei Tage alt. Aber mit deinen Zähnen solltest du ihn zerbeißen können, als ob er gerade frisch aus dem Ofen gekommen ist.«
»Kuchen klingt fabelhaft. Ich kaue gern auf Sachen rum, also mach dir da mal keinen Kopf.«
»Ist recht. Bin gleich wieder bei dir.«
Kurze Zeit später betrat Agnete wieder das schwach ausgeleuchtete Wohnzimmer. Sie trug ein schwer beladenes Tablett mit zwei großen Stücken Streuselkuchen und zwei vollen Tassen Kaffee. Mit jedem Schritt knarzten die alten Holzdielen. Sie balancierte geschickt um die zwei schweren Teppiche, deren verschlissene Enden steif nach oben standen.
»Soll ich … brauchst du …«
Sie winkte ab.
»Hilfe? Ach was. 97 Jahre sind doch kein Alter. Wenn der Krebs nicht wäre, könnte ich sicher problemlos 100 werden. Oder fragst du das, weil ich eine Frau bin?«
»Papperlapapp. Ich bin vieles, aber sicher nicht misogyn. Du weißt von deinem Krebs? Aber woher? Ich habe gelesen, dass du nicht zum Arzt gehst.«
Sie stellte das schwere Tablett auf den Beistelltisch neben ihrem Sessel und setzte sich hin. Dann versuchte sie, ihren Wollrock glatt zu streichen.
»Das ist korrekt. Ich war 1981, nein, 1982 zuletzt beim Hausarzt. Der ist irgendwann kurz danach verstorben und niemand kam nach. Ist wohl keine sonderlich interessante Gegend für Ärzte. Für Menschen insgesamt nicht. Mit Ausnahme von mir natürlich.«
»Das stimmt wohl. Es ist auch, bitte erlaube mir den Kommentar, alles andere als einladend hier. Bei dir meine ich nicht, du bist die Gastfreundschaft in Person. Ich meine die Gegend. Die Landschaft, die Wege, die Luft. Es wirkt auf mich …«
»Unfreundlich?«
»… gefährlich. Unsicher. Tot.«
»Gefährlich? Unsicher? Aber was sollte dir denn hier passieren?«
Der Mann musterte Agnete. Für einen Moment hatte er das Gefühl, dass sie weder Fischerboot noch Stein noch Sturm war, sondern ein tiefes, dunkles Gewässer. Und die waren meist am gefährlichsten. Zerdrückten einen innerhalb von Sekunden. Oder bargen gefährliche Monster, die einen in einem Satz verschluckten und wieder in der Dunkelheit verschwanden. Er beobachtete sie noch etwas, dann gab er sich selbst Entwarnung. Sie war kein tiefes Gewässer, zumindest gerade nicht. Er lächelte seinen Gedanken weg und fuhr fort.
»Mir sollte nichts passieren, darum mache ich mir keine Sorgen. Ich wollte eher das allgemeine Gefühl beschreiben. Egal, tut mir leid, das steht mir auch gar nicht zu. Es gibt deutlich schlimmere Ecken. Da stirbt man, sobald man seine Augen aufschlägt und das Schrecken sieht. Es gibt aber eben auch deutlich gefälligere Ecken. Zurück zu dir: Bist du seit 1982 nicht mehr krank gewesen?«
»Doch doch, öfters. Teilweise auch schwerer krank. Aber ich bin hart im Nehmen. Da hilft eine leicht masochistische Ader.«
Agnete musste kurz selbst über ihre eigenen Worte lachen. So viele schlechte Erfahrungen sie in ihrem langen Leben gemacht hatte, so wenig hatten sie ihr geschadet. Und dabei half ihr – so zumindest die Theorie – ihr starker Charakter.
»Wie meinst du das?«
»Ich habe mich immer selbst behandelt, wenn etwas war.«
»Und womit?«
»Ach, immer unterschiedlich. Das Haus ist groß, voller Räume, Schränke und Schubladen. Hier gibt es unzählige Utensilien, die man verwenden kann. Und Tabletten, Salben, Cremes. Alle abgelaufen natürlich, aber das meiste Zeug kann man noch verwenden. Und zum Sterilisieren hilft der gute alte Alkohol oder eine ordentlich heiße Flamme.«
»Beeindruckend.«
»Danke! Nur an die Schönheitschirurgie habe ich mich nicht herangetraut, sonst würde ich jetzt vielleicht etwas glatter aussehen.«
Agnete legte ihre Hände auf die Wangen und zog sie nach hinten. Dann ließ sie wieder los und gluckste. Auch ihr Gegenüber musste grinsen und schloss eine weitere Frage an.
»Und woher weißt du dann von deinem Gast, wenn du so lange nicht beim Arzt warst?«
»Man kann mir nichts vormachen, das merkst du doch. Auch mein Körper kann das nicht vor mir verheimlichen. Ich schätze mal Lunge, vielleicht auch noch woanders. Aber als Gast würde ich den Scheißer nicht bezeichnen. Eher als Eindringling. Wenn er mir nicht so nah auf die Pelle gerückt wäre, hätte ich ihm schon längst zwischen seine zwei Augen geschossen. Peng, peng.«
Agnete formte ihre zwei Hände zu einer schweren Pistole und betätigte den imaginären Abzug. Dann gluckste sie wieder. Der Mann zog seine Augenbrauen nach oben.
»Was ist los? Was ist so lustig daran?«
»Ach, eigentlich nichts. Nichts ist lustig. Ich habe mir den Scheißer eben nur wirklich mit einem Gesicht vorgestellt. Mit einer großen, plattgedrückten Nase, aus denen dicke Büschel von Haaren rausschauen. Und mit einem schweren, hängenden Auge, das immer leicht gerötet ist. Widerlicher Scheißer. Nichts ist lustig daran. Aber da alles irgendwann zu Ende ist, bringt es herzlich wenig, sauer zu sein oder böse zu werden. Und damit wird alles doch lustig. Unbeschwert. Der Scheißer bringt mich vielleicht ums Eck, aber ich nehme ihn mit. Und damit haben wir beide verloren. Oder gewonnen, wenn man es positiv sehen möchte.«
»So stellst du ihn dir vor?«
»Ja, schon. Wieso?«
»Nur so. Ich bin erstaunt, wie wenig man dir vormachen kann. Wie … sehr du in dich reinschauen kannst. Und wie genau du deinen Scheißer beschrieben hast.«
Agnete hob ihre Augenbrauen nach oben.
»Er sieht so aus?«
»Ja.«
Sie schloss die Augen und versuchte, ihren Eindringling im Oberkörper zu spüren. Heute hatte er sich noch nicht bemerkbar gemacht. Auch die letzten Wochen nicht. Ihr Gemütszustand verschlechterte sich immer dann, wenn er sich bemerkbar machte. Dann wollte sie am liebsten ihren Brustkorb öffnen und ihr Herz mit bloßen Händen herausreißen. Oder anderen.
»Dann könnte ich ihm ja wirklich zwischen die beiden Augen schießen.«
»Könntest du. Aber das wäre doch schade um dich.«
»Um mich?«
»Klar. Du sagst ja selbst, dass du noch etwas hier sein willst. Und deine Geschichten warten nur darauf, erzählt zu werden. Also, gute Überleitung: Warst du es?«
Agnetes Blick fror ein. Gleichzeitig stieg ihr Puls an. Da war er nun. Der Eindringling machte sich bemerkbar. Vor ihrem inneren Auge spielte sich ein Film ab. Ihre Pupillen wurden glasiger und ihr Sichtfeld verschwamm. Dann setzte sie sich aufrecht hin, griff leicht zitternd nach einer Tasse Kaffee und hielt sie sich unter die Nase.
»Er riecht so herrlich. Nicht wahr? Wie der Boden, die feuchte Erde. Wie die Sonne und der Regen. Wie all das, was ihn zum Leben erweckt und zu mir gebracht hat.«
Der Mann hielt sich ebenfalls die Tasse unter die Nase und erwiderte nichts. Es herrschte Stille. Die beiden saßen in wuchtigen dunkelgrünen Sesseln und schwiegen. Ihre Augen fixierten sich gegenseitig, beobachteten. Sie kämpften miteinander. Äußerlich blieben sie ruhig, beinahe schon meditativ. Aber in ihren Augen loderte ein Feuer. Er sah das Potenzial in ihr. Er sah aber auch die Gefahr, die von ihr ausging. Denn diese Art von Feuer konnte sich in alle Richtungen bewegen, immer abhängig davon, womit man es einzudämmen versuchte. Zähmen konnte man es mit etwas Geschick. Nur löschen sollte man es nie versuchen. Denn dieses Feuer wollte immer brennen. Es wollte immer etwas erwärmen oder verbrennen. Eine Minute verging, dann die zweite. Das Feuer in Agnete brannte nun lichterloh. Gleich würde es sie verzehrt haben. Und dann … Darüber wollte er gar nicht nachdenken. Sie würde irgendwann aufwachen und sich an die letzten Stunden nicht mehr erinnern können. Gleich würde es passieren. Sie müsste nur noch den letzten Widerstand aufgeben. Doch etwas in ihr hielt sie davon ab. Ihr Gegenüber hatte keine Angst. Er war vorsichtig, aber nicht ängstlich. Auf seine Art, wie er vor ihr saß, hatte er eine beruhigende Wirkung auf sie. Und sie müsste lügen, wenn sie sagen würde, dass sie diese beruhigende Wirkung nicht genoss. Mit jedem Lidschlag wurde ihr Feuer kleiner. Es scherte kurz aus, wollte wieder stärker brennen. Doch die Sekunden und Minuten vergingen und Agnetes Feuer war auf Kochstellengröße geschrumpft. Sie atmete langsam durch die Nase aus, zog frische Luft durch sie ein und blies die verbrauchte Luft aus ihren zwei Nasenlöchern wieder aus. Sie presste ihre Lippen enger zusammen und verengte ihre Augen. Dann schüttelte sie ihren Kopf. Ihr Eindringling im Körper schwieg wieder. Der Augenzweikampf war vorbei und sie hatte ihn verloren. Und sie freute sich darüber. Sie wirkte erschöpft, während ihr Gegenüber scheinbar keinerlei Anstrengung verspürt hatte.
»Was solls. Ja, ich war’s.«
»Na also, war das so schwer? Und wie fühlst du dich damit?«
Agnete stellte die Kaffeetasse auf den Beistelltisch und überlegte.
»Eigentlich sehr gut. Die alte Piaf hat ja schon davon gesungen, also kann ich doch auch sagen, dass ich nichts bereue.«
»Du hörst Piaf?«
»Gelegentlich. Selten. Ich bin eher für die richtigen Klassiker zu haben. Brahms, Schumann, Dvořák. Aber ich bin keine engstirnige Person, ich bin für vieles offen.«
»Für Kaffee mit Zucker?«
Agnete rümpfte die Nase.
»Nun veralberst du mich. Ich bin für vieles offen, aber nicht für alles.«
Dann griff sie wieder zur Kaffeetasse, setzte sie an den Mund, schloss die Augenlider und atmete tief ein. Ein, zwei Schlucke rannen ihren Gaumen hinunter und sie fokussierte sich darauf, wie sie sich ihren Weg in den Magen bahnten. Sie wollte ihren Kaffee genießen und dafür ihre Umgebung ausblenden.
»Schon recht, das war wirklich nur ein Scherz. Ich sehe, dass du eine sehr offene Person bist. Immerhin hast du mich ja auch ins Haus gelassen, obwohl wir uns gar nicht kennen.«
Agnete öffnete wieder ihre Augen und musterte ihr Gegenüber. So fremd sie einander waren, so schnell hatte sie Vertrauen zu ihm aufgebaut. Das war die letzten Jahrzehnte nicht so gewesen. Verirrte Wanderer oder von Zuhause ausgerissene Mädchen hatte sie an der Tür direkt zum Teufel geschickt. Heute lief das aber anders ab. Die Klingel hatte geläutet, Agnete war aus der Küche in den Flur zur Vordertür geeilt und hatte sie geöffnet. Ein “Hallo Agnete, darf ich …?” hatte gereicht, dass sie ihm Platz gemacht und den Weg ins Wohnzimmer gewiesen hatte. Sie hatte – bis eben – keinerlei bewussten Widerstand verspürt. Ganz im Gegenteil: tief in ihr drinnen wusste sie, dass diese Begegnung Sinn machte. Und ihr vielleicht sogar helfen würde. Ihnen allen.
»Probier den Kuchen. Ich mache ihn nach dem Rezept meiner Urgroßmutter. Seit 128 Jahren wird er unverändert in diesem Haus gebacken. Mit viel Liebe und mit viel Butter.«
»Für manche sind Liebe und Butter ein Synonym, Agnete.«
Sie griff nach ihrem Teller und grinste.
»Fett macht fröhlich, hat meine liebe Oma immer gesagt. Eine sehr weise Frau, wie ich finde.«
»Das stimmt, das stimmt. Nun lassen wir aber mal deine Urgroßmutter und auch deine Großmutter ihre wohlverdiente Ruhe genießen und reden über dich.«
»Schmeckt dir der Kuchen?«
»Ja, er ist wirklich köstlich. So einfach wie gut. Ich mag auch eher große als kleine Streusel.«
Während sie beide große Bissen nahmen, herrschte wieder Stille. Dann, als der Mann die letzten großen Streusel heruntergeschluckt hatte, ließ er sich etwas in den Sessel fallen, schlug sein rechtes Bein über das linke und räusperte sich.
»Also, du bereust nichts?«
Agnete biss auf die Gabel und zog sie dann unter lautem Knirschen aus dem Mund.
»Nein, tu ich nicht.«
Ihre alten Zähne gruben sich in den Kuchenteig. Zerteilten und zermalmten ihn, bis sie ihre Gabel von Neuem in den Mund schob.
»Das könnte ich akzeptieren. Werde ich aber nicht.«
»Wieso nicht?«
»Weil du noch so viel vor dir hast, Agnete. Und fehlende Reue ist …«
Sie winkte ab.
»Ich bin 97 Jahre alt.«
»Ja, das weiß ich. Aber wer sagt, dass es damit schon aus ist?«
Agnete hörte auf, zu kauen.
»Wie meinst du das?«
»Das tut jetzt nichts zur Sache. Später vielleicht. Lass uns erst einmal über dich reden. Ich will deine Geschichte hören. Das wird dir auch guttun. Hast du Zeit?«
»Alle Zeit im Leben, mein Lieber.«
»Das ist gut. Im Leben und hoffentlich auch außerhalb davon. Also lass uns beginnen. Du bist hier geboren, nicht wahr?«
Agnete strich wieder über ihren Rock, schaute nach links, schaute nach rechts. Schaute über ihre linke Schulter zum Klavier. Ihre Augen wanderten die hinter dem geschlossenen Klavierdeckel verborgene Tastenreihe entlang und blieben erst an einer Stelle über dem schwarz glänzenden Instrument hängen. Nur Forensiker mit der passenden Ausrüstung hätten hier einen rechteckigen Abdruck finden können.
»Ein Bilderrahmen?«
Agnete blickte erschrocken zu ihrem Gesprächspartner. Woher wusste er davon? Er war hier noch nie gewesen.
»Ja, da hing mal ein Bilderrahmen. Mit einem Bild meiner Familie. Ich habe es irgendwann einmal abgenommen. Es müsste im Keller sein. Oder im Dachgeschoss. Ist schon zu lange her. Woher weißt du das? Man sieht doch nur die Wand?«
»Ich weiß viel, ich sehe viel. Das war ein schönes Bild, nicht wahr?«
Agnete lächelte sanft.
»Oh ja, das war es. Ein Ölgemälde, so fein und handwerklich meisterhaft erschaffen, dass es ohne Probleme in einem großen Kunstmuseum hängen könnte.«
»Und dennoch hast du es fortgeschafft.«
»Dennoch, ja. Oder trotzdem. Oder genau deswegen. Es war einfach zu perfekt. Und damit eine riesige Lüge. Schande über den Maler, der uns so falsch dargestellt hat. Ich spucke Gift und Galle auf ihn.«
»Zu schön dargestellt?«
»Zu schön, zu freundlich, zu harmonisch. Das Bild zeigte die perfekte Familie.«
»Und das wart ihr wohl nicht, Agnete? Euer Haus ist zumindest perfekt. So viele gedrechselte Möbel, wunderschöne Tapeten. Die Eingangstür mit dem Spruch, wie ging der nochmal? „Tritt ein und werde Teil …«
Agnetes Blick verfinsterte sich auf einmal, dabei verzog sich ihr Mund ins Groteske. Ihr Körper zuckte leicht erst zur linken Seite, dann nach hinten. Sie wollte die Bewegungen nicht ausführen. Sie konnte sich aber nicht dagegen wehren. Dann schob sie ihren Kopf nach vorn, fixierte den Mann und spuckte auf den Boden.
»Alles eine Lüge.«
Sie war aufgekratzt. Und gleichzeitig ungemein verletzbar.
»Ich verstehe.«
Der Mann blieb regungslos sitzen. Er schaute noch einmal auf den Spuckbatzen auf dem Boden, lächelte Agnete dann aber an. Sie beruhigte sich wieder. Setzte ihre Kaffeetasse an den Mund, schloss erneut die Augen und begleitete mit ihren verbleibenden Sinnen den nachtschwarzen Trank in ihrem Mund. Er floss die Speiseröhre hinab, vorbei an ihrem wuchernden Scheißer an der Lunge und erreichte schließlich ihren Magen.
Ursprung
»Ich bin hier geboren. Am 20. Januar 1927 um 4:57 Uhr. Steinbock. Aber recht nah am Wassermann. Das sage ich immer dazu, auch wenn es wahrscheinlich wenig aussagt. In dem Regal dort drüben liegt ein Stammbaum, mit dem meine Familie an diesem Ort bis ins Jahr 1647 zurückverfolgt werden kann. Ist bestimmt nicht bei jeder Familie so, nicht wahr?«
Der Mann nickte, wenn auch etwas widerwillig. Er kannte zahlreiche Familien, die deutlich älter waren. Natürlich kannte er auch zahlreiche Familien, die erst kürzlich die zweite oder dritte Generation begründet hatten. In gewisser Weise hatte Agnete also nicht unrecht.
»Kurz vor Ende des Dreißigjährigen Kriegs ist mein Urahn Johann Beltz geboren. Nicht in diesem Haus, das ist ja höchstens 150 Jahre alt. Wobei die Grundmauern teilweise vorhanden sind, im Keller sieht man meine ich noch an der ein oder anderen Stelle deutlich ältere Steine.«
»Im Dreißigjährigen Krieg, also vor 1648?«
Agnete nickte. Ihr Gegenüber kannte das Kriegsende, er war also definitiv gebildet. Belesen. Weit gereist. Lange gereist. Lange weit gereist, wenn sie ihn genauer betrachtete.
»Höchst spannend. Das war eine extrem wilde Zeit. Religionskrieg, Territorialkrieg. Dynastischer Krieg. Kriege, muss ich wohl korrekterweise sagen. Sehr turbulent, voller Umbrüche. Ganz egal was es aber nun war oder vielleicht auch etwas von allem, das war keine gute Zeit. Zeigst du mir die Stellen? Die Grundmauern?«
»Im Keller? Nein. Du kannst ruhig allein runtergehen, ich bleibe oben. Ich war schon eine gefühlte Ewigkeit nicht mehr unten. Früher war ich dort aber öfter.«
»Zum Wäsche waschen?«
Agnete winkte ab.
»Nein, nicht zum Waschen. Das Gerät steht in der Küche und ganz früher hatten wir so etwas gar nicht. Da wurde die Kleidung zum Lüften in den Garten gehängt und ganz schwer verschmutzte Sachen konnten wir an dem Bach in der Nähe waschen.«
»Ein Bach? Den habe ich gar nicht gesehen?«
»Den gibt es auch nicht mehr, der ist vor Ewigkeiten versiegt.«
»Verstehe. Dann zurück zum Keller: Wozu warst du dann unten? Hast du Verstecken gespielt?«
»Nein, nein. Neben den alten moderigen Zimmern unten ist noch ein schön gefliester Raum. Den hat Vater irgendwann mal so hergerichtet.«
»Als Hobbyraum?«
Agnete fragte sich, was die ganze Fragerei gerade sollte. Wieso interessierte ihn der Keller so sehr?
»Ja, zum Wild ausnehmen oder so. Er war in seiner Freizeit Jäger. Und da war noch ein Vorzimmer, vielleicht eher ein Durchgang. Mit einem Schränklein, in dem Vater Süßigkeiten aufbewahrte. Dafür bin ich runter gestiegen.«
»Das macht Sinn.«
»Ich war aber wie gesagt schon ewig nicht mehr unten. Ich wurde immer etwas unruhig, wenn ich dort länger blieb.«
»Wieso das?«
»Weiß ich nicht mehr. Es tat mir einfach nicht gut. So wie jetzt gerade auch nicht, wenn ich daran denke. Zurück zu deiner Ursprungsfrage: Ich bin hier im Haus geboren. Auf dieser Etage, im Gästezimmer hier gleich nebenan. Meine Mutter konnte nicht mehr die Treppe in ihr Zimmer hinaufgehen, also haben sie improvisiert. Ich war wohl keine leichte Geburt. Sowohl meine älteren als auch jüngeren Geschwister waren leichter herauszubringen …«
Agnete redete ohne Punkt und Komma. Der Mann applaudierte innerlich, wie schnell und gleichzeitig bildhaft Agnete ihre Geburt und ihre ersten sieben Jahre auf dieser Erde nacherzählen konnte. Sie schien seit langer Zeit nicht mehr Kontakt mit der Außenwelt gehabt zu haben und nun umso froher darüber zu sein, mit jemandem sprechen zu können. Gleichzeitig gab sie aber auch viel Belangloses zum Besten. Sie warf so einige Nebelkerzen. Ob bewusst oder unbewusst, das konnte der Mann noch nicht feststellen. Aber ihn konnte man nicht so leicht verwirren. Das war eine seiner großen Stärken. Als Agnete schließlich Luft holen musste, reagierte der Mann.
»Warst du ein Wunschkind?«
Agnete stockte. Sie ärgerte die Frage. Vor allem ärgerte es sie, dass er sie unterbrochen hatte. Der letzte Mensch, der das getan hatte, war ein mittelalter Wanderer mit seltsamem Dialekt gewesen. Das musste so zwanzig Jahre her gewesen sein. Danach hatte er sie nicht mehr unterbrochen. Sie ballte die Faust und kicherte in sich hinein. Dann schaute sie wieder zu ihrem Gegenüber.
»Ob ich ein Wunschkind war? Wieso fragst du mich das?«
»Weil ich hier bin, um Fragen zu stellen. Um die Menschen vor mir besser zu verstehen.«
Agnetes Augen verengten sich leicht.
»Nun, ich verstehe nicht ganz, aber ich hinterfrage jetzt auch nicht weiter. Du wirst deine Gründe haben, nehme ich an. Ich kann dir nicht sagen, ob ich ein Wunschkind war. Unglücklich waren weder meine Mutter noch mein Vater, mich zu haben. Aber ich nehme an, dass mein Vater zufrieden war, dass er bereits zwei Söhne hatte. Wenn er nur Mädchen gehabt hätte, wäre die Situation vielleicht eine ganz andere gewesen.«
»Das ist normal. Nicht gut, das meine ich damit nicht. Aber das war schon immer so. Die meisten Männer wollen Söhne bekommen. Damit sie von ihnen lernen können. Damit die Familie weiterlebt. Wie lächerlich das alles ist. Familiennamen. Gene. Das eine ist zu banal, das andere viel zu komplex. Aber der gewöhnliche Mann kombiniert beides gern, wenn es um seine Kinder geht.«
»Mein Vater war nicht so. Sicher, ich habe gesagt, dass er bereits zwei Söhne hatte, als ich meinen ersten Schrei gemacht habe. Aber er war zu gebildet und gesellschaftlich zu aufgeschlossen, als dass er Mädchen oder Frauen so abgewertet hätte. Und als Historiker, ganz genau genommen war er Kunsthistoriker, hat er denke ich auch verstanden, dass auch Frauen stark sein können. Vielleicht nicht meine Mutter, aber andere. Ich war stark. Ich bin stark. Das hat mein Vater dann auch gemerkt.«
»Dann?«
»Damals. Aber nur noch eines: Ich hatte eine schöne Kindheit. Ich bin wohlbehütet aufgewachsen. Hier war immer was los, Großeltern, Urgroßeltern. Väterlicherseits, wohlgemerkt. Mütterlicherseits kannte ich niemanden.«
»Haben die woanders gewohnt?«
Agnete zuckte mit den Schultern. Sie fragte sich, wohin das Gespräch noch so führen würde.
»Ich nehme es an. Über die wurde aber nie gesprochen. Wenn ich ehrlich bin, habe ich da aber auch nie groß nachgefragt.«
»Irgendwelche Verwandten? Tanten, Onkel, Cousinen?«
»Nicht, dass ich wüsste. Im Stammbaum findet sich auch nichts dazu. Zumindest erinnere ich mich nicht daran.«
»Okay, verstehe.«
»Es gab vereinzelt Gerede. Oder sagen wir Erzählungen.«
»Über deine Verwandten?«
»Über die Familie allgemein. Da war alles dabei. Dass wir von einer Magd abstammen oder sogar vom deutschen Kaiser, der hier auf seiner Durchreise vorbeigekommen ist. Manchmal wurden auch beide Geschichten kombiniert, dann stammten wir von der Magd und dem Kaiser ab.«
»Möglich wäre das ja.«
»Natürlich. Hier in der Nähe kreuzen sich ein paar alte Straßen und soweit ich das weiß, waren die Kaiser früher viel unterwegs. Zu ihren Pfalzen, Tagungsorten und so weiter.
Aber Belege gibt es nicht.«
»Nein. Sonst würden wir, würde ich ja nicht hier wohnen, sondern auf irgendeinem Schloss oder einer Burg. Also war das sicher nur Geschwätz. Wunschdenken. Aber wozu, das weiß ich nicht. Das Haus ist doch schön genug.«
»Es ist ein wirklich schönes Haus. Diese Mischung aus Stein und Holz ist ungewöhnlich. Man findet sie nicht mehr so oft. Fachwerk, Stein, Schindeln. Aber wie hier die Wände verbaut wurden, wie die Stockwerke aufeinander aufbauen und sich gegenseitig stabilisieren, das ist wirklich selten. Noch dazu in dieser Größe, das ist vielleicht sogar einzigartig. Wenn ich ehrlich bin, lebst du in einer Art Schloss.«
»Du bist lustig. Aber dann müsste es auch ein Schlossgespenst geben. Und geheime Zimmer und Wege.«
»Das müsste es, da gebe ich dir recht.«
Agnete blieb kurz an seinem ernsten Gesichtsausdruck hängen, dann schweifte ihr Blick umher.
»Das Klavier dort hinten ist meins, darauf habe ich zum ersten Mal mit sieben Jahren gespielt. Zwölf Jahre Unterricht, danach habe ich nie mehr wieder gespielt.«
»Wer hat dich denn unterrichtet? Deine Mutter?«
»Nein.«
»Dein Vater?«
»Auch der nicht. Das war meine Großmutter, Elisabeth. Sie hatte sehr viele Talente.«
»So? Welche denn noch?«
Die sehr schnelle und energische Nachfrage irritierte Agnete. Aber sie ließ sich weiter auf das Gespräch ein. Ein Teil ihres Körpers genoss es sogar, so viel preisgeben zu können.
»Nun, sie konnte fehlerfrei die tollsten Klavierstücke spielen. Sie konnte fabelhaft kochen. Geschichten erzählen. Und sie konnte einen schnell gesund machen. So eine Oma wünscht sich doch jeder, nicht wahr?«
»Gesund machen? Inwiefern?«
Agnete überlegte kurz, was sie damit eigentlich sagen wollte.
»Sie hat uns gut versorgt, wenn wir krank wurden. Sie hat Hustensäfte selbst hergestellt, fiebersenkende Mittel, das meine ich damit. Da gab es zwar immer erst große Diskussionen zwischen ihr und meinem Vater, aber letztendlich hat sie sich immer durchgesetzt.«
»War sie denn Ärztin? Oder Apothekerin?«
Agnete verstummte.
»Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich denke nicht. Sie war immer da, also hat sie denke ich nicht gearbeitet. Aber sie hatte alle Kräuter, die sie brauchte, im Garten.«
»Eine Kräuterhexe also.«
Agnetes Blick wurde zornig. Niemand durfte etwas Böses über ihre Großmutter sagen. Und wenn er es doch tat … sie ballte erneut ihre Hände und hielt sie in die Luft.
»Ich warne dich, sag das nicht noch einmal!«
Der Mann hob beschwichtigend die Hände vor den Körper.
»Das meinte ich nicht als Beleidigung. Hexe ist vielleicht zu drastisch gewählt, also sie war einfach kräuterkundig. Und das ist wirklich fabelhaft, wenn man so jemanden kennt.«
Agnete presste ihre Lippen zusammen. Dann nickte sie ihrem Gegenüber zu und senkte wieder ihre Hände.
»Hat sie ihrem Sohn denn einige Fähigkeiten mitgegeben?«
»Meinem Vater?«
Agnete lachte schallend.
»Ganz und gar nicht. Die waren so gegensätzlich wie Nacht und Tag.«
»Verstehe. Aber du scheinst dann ja gewisse Talente vererbt bekommen zu haben. Wenn du so lange Klavier gespielt hast?«
»Oh ja. Ich habe es wie gesagt lange nicht mehr, aber ich könnte es sicher noch. Ich bin nicht nur stark, sondern habe auch ein gutes Erinnerungsvermögen. Klingt das für dich auch so, als wäre ich ein Elefant?«
»Wie ein Elefant? Nein, ich habe nur an eine starke Frau mit gutem Erinnerungsvermögen gedacht.«
Agnete ärgerte sich, dass ihr Witz wohl nicht verstanden worden war.
»Ach so. Ja, das bin ich. Natürlich bin ich kein Elefant. Obwohl, schau dir mal meine Haut an. Schrumpelig, runzelig, ohne fleischigen Inhalt, runterhängend. Und manchmal bin ich auch wie einer aufgetreten, wie der wortwörtliche Elefant im …«
»Agnete, du schweifst wieder ab.«
»… Porzellanladen. Unterbrich mich doch nicht ständig, das macht man nicht.«
Die letzten Wörter hatte Agnete aus ihrem Körper gepresst, aus ihrem hochroten Kopf hinausbefördert. Der Mann ließ den Ausruf kurz wirken. In manchen Situationen, so wie in dieser, wirkte Agnete auf ihn verändert. Launisch. Angriffslustig. Er wollte aber kein Öl ins Feuer gießen, sie musste ihm noch viel erzählen. Letztendlich hatte er eine Aufgabe zu erledigen.
»Tut mir leid. Wirklich. Von ganzem Herzen.«
»Ist in Ordnung. Ich schweife vielleicht ab, aber genau das ist mein Verständnis von Freiheit. Nichts tun müssen, nicht planen müssen, nicht auf jemanden achten müssen, nicht etwas machen müssen, nur weil andere es von einem erwarten.«
»Dann bist du definitiv frei. Lady Liberty sozusagen.«
Agnete kicherte. Eine Hand schnellte vor ihren Mund, um ihre aufblitzenden gelblichen Zähne zumindest etwas zu verdecken. Ihr schrumpeliger Mund zog sich wie eine Ziehharmonika in die Breite und für einen kurzen Moment glitzerten die eisgrünen Augen wie feingeschliffene Smaragde.
»Lady Liberty, das gefällt mir. Aber hör mal, du brauchst mir keine Statue bauen oder so.«
»Keine Sorge, eine Statue wirst du nicht bekommen. Warst du immer so frei?«
»Nein. Frei war ich nicht immer. Aber freiheitsliebend. Das haben meine Geschwister wie auch meine Eltern schnell gemerkt. Merken müssen. Ich bin Steinbock, das hatte ich bereits gesagt. Lady Liberty bin ich, aber auch Lady Widerspenstig. Lady Sturkopf. Lady lass mich. Und ich wurde zu oft in irgendeine Richtung geschoben. Habe mich schieben lassen. Und von den Dingen, auf die ich wirklich Lust hatte, zurückgehalten.«
»Was denn zum Beispiel?«
Agnete stellte ihre Kaffeetasse zur Seite und hob ihre Hände in die Höhe.
»Schau sie dir an, meine beiden Patscher. Nicht zu groß, nicht zu klein. Nicht zu filigran, aber dennoch keine Bauarbeiterhände. Ich wollte immer etwas mit meinen Händen machen. Zupacken, schneiden, hämmern.«
»Das hast du ja auch, oder?«
»Sicher, sicher. All das und noch viel mehr. Zwar nicht beruflich, aber dennoch. Ich habe damit auch getragen, geklopft und gebuddelt.«
»Aber?
»Nichts aber. Wenn ich zurückblicke, kann ich mit Fug und Recht sagen, dass ich meine Patscher ordentlich benutzt habe. Aber eben über Umwege. Ich wäre sicherlich eine gute Tischlerin oder Waldarbeiterin geworden. Oder Metzgerin. Nur wollte das mein Vater eben nicht.«
»Er wollte, dass du Hausfrau wirst? Mutter?«
»Nicht nur. Hausfrau und Mutter empfand er für mich schon als wichtige Rollen, so wie bei meiner Mutter. Da hätte ich gleich in ihre Fußstapfen treten können. Aber mein Vater wollte mehr. Er war recht modern, was das Thema anging. Familie. Frauen. Ich sollte also unbedingt studieren.«
»Bei einem Studium macht man aber nichts mit seinen Händen.«
Agnete hob ihre Hände erneut in die Höhe.
»Du sagst es. Außer vielleicht Bücher aus der Bibliothek holen und Seiten umblättern. Ich wusste schon vorab, dass mich das nicht erfüllen würde.«
»Aber du hast es dennoch gemacht?«
Agnetes Augen blitzten auf. Für einen Moment spiegelte sich in ihren Augen das kleine Boot an der bretonischen Küste, das von großen Wellen davongetragen wurde und dann an dem Felsen zerschellte.
»Aber natürlich. Wie sollte man sich denn kurz nach dem Krieg als junges Ding gegen seinen Vater auflehnen? Ich habe es geliebt, im Garten Steine und Baumstümpfe herauszuziehen oder zur Seite zu räumen. Schubkarren und Laster zu beladen. Ich habe jede einzelne Schwiele an der Hand geliebt. Aber irgendwann war alles aufgeräumt und er fing mit seinen Ideen an. Studium hier, Studium da. Irgendwas mit Finanzen, Zahlen, Statistiken. Betriebswirtschaftslehre also. Ich habe schon versucht, dagegen zu argumentieren. Ihn zu überzeugen, dass ich mich woanders sehe. Aber das hat nichts gebracht.«
»Und was hat deine Mutter dazu gesagt? Oder deine Großmutter?«
»Meine Großmutter war da schon tot. Die ist ein Jahr zuvor verstorben. Und meine Mutter war überhaupt keine Hilfe. Sie hat mich in keinster Weise unterstützt, sondern meinem Vater nach dem Mund geredet. Ich erinnere mich noch an einen Moment, es war Februar oder März, da war sie gerade am Wäsche waschen und ich wollte mit ihr noch einmal in Ruhe sprechen. “Kind”, sagte sie, “tu das, was dein Vater von dir verlangt. Er will nur das Beste für dich. Was willst du denn sonst machen? Auf den Bau gehen? Mach dich nicht lächerlich. Am Ende wirst du gar nichts machen, Kinder bekommen und dann so enden wie ich.” Das hatte gesessen, in dem Moment. Noch weniger als studieren wollte ich so werden wie meine Mutter. Mit Ambitionen, Wünschen, allesamt geheim, vielleicht nie laut ausgesprochen. Dazu verdammt, die Frau von irgendjemandem zu sein und für die Familie tagein, tagaus Wäsche zu waschen oder Suppe zu kochen.«
»Also hast du studiert.«
Agnete nickte leicht.
»Ja, widerwillig. Aber ich habe mich letztendlich eingeschrieben.«
»Haben deine Geschwister auch studiert oder durften sie etwas mit ihren Händen machen?«
»Meine Geschwister? Ich bin Einzelkind, neben mir gibt es niemanden.«
»Einzelkind? Das stimmt so ja nicht, Agnete. Du hast doch vorhin …«
»Es stimmt zumindest zum fraglichen Zeitpunkt. Da lebte keiner mehr von denen.«
»Sie sind alle gestorben?«
»Alle gestorben. Alle tot.«
»Du hast sie also alle überlebt.«
»Das stimmt. Um Längen.«
»Sind sie früh gestorben? Ich habe gar nichts von …«
»Die sind alle im Kindesalter gestorben. Einer nach dem anderen. Wie die Fliegen.«
»Das macht Sinn.«
»Inwiefern?«
»Naja, ich habe nichts über deine Geschwister gelesen. Zumindest nicht viel. Und das ist höchst selten.«
»Hm. Ja. Gelesen sagst du?«
Agnete musterte ihr Gegenüber genauer. Sie verstand nicht recht, was er hier eigentlich machte. Und wer oder was er war. Er trug ein karminrotes Hemd und einen schwarzen Wollmantel mit goldenen Knöpfen dran und wirkte damit wie ein alter Lord. Er musste sehr wohlhabend sein, denn er trug an seinen beringten Fingern die größten und schwersten Edelsteine, die Agnete je in ihrem Leben gesehen hatte. Und es waren auch sehr schöne Edelsteine, wie sie fand. Der Hut mit der breiten Krempe und die schweren, abgewetzten Lederstiefel mit klimperndem Firlefanz dran erinnerten sie aber eher an einen Piraten. Seine ruhige Art und das Wissen, das er ausströmte, sprachen wiederum dafür, dass er ein Gelehrter war. Ein exzentrischer Oberlehrer vielleicht? Oder saß vor ihr gar das Rumpelstilzchen aus dem Märchen, das sie als Kind immerzu gelesen hatte? Sie legte sich erst einmal auf den exzentrischen Lehrer fest. Agnetes Mundwinkel verzogen sich nicht. Sie schaute ihr Gegenüber neutral, aber dennoch mit fragendem Blick an.
»Wenn ich mich an sie zurückerinnere, fällt mir auf, dass sie etwas mit ihren Händen machen durften. Meine Geschwister, meine ich.«
»So?«
»Ja, so.«
Agnete verschränkte ihre Hände miteinander und zeigte sie ihrem Gegenüber. Dabei verzog sie immer noch nicht ihr Gesicht.
»Sie durften ihre Hände falten. Bevor sie ins Erdreich hinabgelassen wurden.«
Die Ziehharmonika in Agnetes Gesicht zog sich für einen kurzen Moment auseinander. Für ein paar Sekunden schien sich Agnete über den Tod ihrer Geschwister zu freuen. Als hätte sie nur einen Witz erzählt. Einen sehr trockenen Witz. Der Mann lachte nicht. Nicht, weil er dem Tod nicht auch etwas Lustiges, Aufregendes abgewinnen konnte. Sondern weil es für seine Aufgabe hilfreich gewesen wäre, mit mehr Menschen als nur Agnete zu sprechen. Sein Wunsch schien aber nicht in Erfüllung zu gehen. Die Gegend war menschenleer und die runzelige alte Dame vor ihm das einzige sprechende Lebewesen. Sie musste also liefern.
»Okay, der war gut. Du hast einen interessanten Humor. Gefällt mir. Aber dann … dann zurück zu dir, Einzelkind. Ich habe Zeit für dich, nicht für deine ganze Familie. Du hast dein Studium begonnen.«
»Korrekt.«
»Und dann?«
Agnetes Mundwinkel bogen sich nach unten. Sie strich ihren Rock wieder glatt, entfernte ein paar Schuppen und Haare von ihrer grauen Seidenbluse, setzte sich aufrechter in den Sessel und schaute zur Stelle über dem Klavier, an der einst das wunderschöne Familienportrait hing. Ihr faltiges, eben noch über den Witz lachendes Gesicht wirkte auf einmal bitterernst.
Vater Frostig
»Dann habe ich gemerkt, dass ich damit die Büchse der Pandora geöffnet habe. Ich habe das getan, was mein Vater wollte. Und das hat mich in eine Sackgasse geführt.«
»Wie meinst du das? Hast du keinen Job gefunden?«
Agnete schüttelte den Kopf.
»Das meine ich nicht. Ich rede von einem viel früheren Zeitpunkt. Noch während des Studiums. Ich durfte nicht ausziehen, nicht feiern gehen, kein gar nichts. Ich sollte nur lernen, nur gute Noten nach Hause bringen.«
»Das klingt aber nicht sehr nach Studentenleben. Wenn es das damals überhaupt gegeben hat. Es klingt zumindest nicht nach Leben.«
Agnete nickte. In ihren Augen stiegen erste Tränen auf. Es ging ihr nahe, über diese lange zurückliegende Zeit nachzudenken. Über diese Zeit, die sie tief in ihrem Innern begraben und lange verschlossen gehalten hatte. Und nun darüber zu sprechen. Sprechen zu müssen. Der Mann zwang sie zwar nicht dazu, aber dennoch kitzelte er es irgendwie aus ihr raus.
»In eine WG oder eine Wohnung zu ziehen hätte mich zu sehr vom Lernen abgelenkt. So zumindest die Meinung meines Vaters. Feiern gehen hätte mich vom Lernen abgehalten. Am Rande hätte ich dort noch einen Mann kennengelernt, den ich gemocht hätte. Und der hätte mich auch vom Lernen abgehalten.«
»Das ist aber schon etwas weit hergeholt, meinst du nicht?«
»In meinen Augen ja, ganz klar. Aber mein Vater finanzierte mein Studium, also hatte er ein gewichtiges Argument, dem ich mich fügen musste. In der ersten Zeit habe ich noch versucht, dagegen zu argumentieren. Ihn zu bitten, mir doch ein paar Freiheiten zu gewähren. Aber mit ihm war ab einem Zeitpunkt nicht mehr zu reden. Er trank zu der Zeit auch viel, war oft lange weg. Ich denke mal, dass das damit zusammenhing. Das war so, als wenn ein Schalter von hier auf gleich umgelegt worden war.«
»Wann war das ungefähr?«
Agnete musste kurz überlegen, es war nun wirklich lange her.
»1946 muss das gewesen sein. Da habe ich mit dem Studium begonnen.«
»1946 also. Der Krieg war somit schon ein Jahr vorbei.«
»Da hast du recht. Aber mit dem Krieg hatte das denke ich nicht zu tun. Wir haben zwar gelitten wie alle anderen auch, aber hier, fernab der großen Städte, lief das Leben auch im Krieg ruhiger ab.«
»Ein ruhiger Krieg, das ist ein interessantes Oxymoron.«
»Wie wahr. Natürlich wurde hier auch geschossen, bombardiert, in Schutt und Asche gelegt. Vergewaltigt. Aber eben nicht so viel wie in den Städten. Ich habe darüber im Studium mit Kommilitonen gesprochen, das war einfach nicht vergleichbar.«
»Klar, wenn du das mit …«
»Hinzu kommt, dass wir alle gegen den Krieg waren. Je näher also die Alliierten auf Deutschland zumarschierten, desto mehr freuten wir uns.«
»Hat dein Vater gedient?«
Agnete winkte ab.
»Nein nein, der war nicht einsatzfähig. Ich kann dir aber nicht mehr sagen, warum nicht. Falls dich das auch noch interessiert hätte.«
Er zeigte keinerlei Mimik, dazu war er zu sehr in seinen Gedanken versunken.
»Das war es also nicht, was den Schalter bei ihm umgelegt hat.«
»Nein, das war es sicher nicht.«
»1946 sagst du …«
»Ja, sogar eher in Richtung 47.«
»… und hier in der Nähe ist doch so eine kleine Seenplatte, nicht wahr?«
»Du meinst die Reinbacher Seen? Ja, die sind nicht allzu weit. Mit dem Auto ist man dort in so 20, 25 Minuten, schätze ich.«
»Und zu Fuß?«
»Zu Fuß dauert das ungefähr gleich lang, allerdings muss man dafür durch den Wald. Drei Stunden etwa, wenn man ihn umgeht.«
Agnete wäre die Erste gewesen, die ihn umgangen hätte. Doch das behielt sie für sich.
»Ja, dann ist das eine Möglichkeit.«
»Was genau? Was haben die Seen mit meinem Vater zu tun?«
»Du erwähntest, dass er oft länger weg war.«
»Das war er, ja. Ich denke mal, dass er lange arbeiten musste und dann noch mit seinen Freunden was trinken gegangen ist. Zumindest kam er oft wie benebelt nach Hause und meine Mutter musste ihn dann ins Bett schleppen.«
Das passt irgendwie zusammen, dachte sich der Mann.
Agnete schaute ihr Gegenüber an. Er reagierte nicht, schien sogar etwas abwesend zu sein.
»Kannst du mir folgen?«
Der Mann bewegte leicht den Kopf und nickte Agnete zu.
»Ich bin da, ja. Kannte dein Vater zufällig jemanden namens Ludwig Hausmann? Oder eine Wilhelmine Ehrlich? Oder …«
Agnetes Augen wurden größer.
»Wer sind diese Leute? Und was haben sie mit meinem Vater zu tun?«
»Ach, vergiss das wieder, ich denke gerade nur laut. Tut nichts zur Sache. Denke ich zumindest.«
Agnete musterte ihren Gast. Sein Gerede hatte sie neugierig gemacht, denn sie glaubte, die genannten Namen irgendwann schon mal gehört oder gelesen zu haben. Sie überlegte, woher er so ein Wissen nehmen konnte, wenn er gar nicht aus der Gegend kam. Vorhin hatte er davon gesprochen, über ihre Geschwister gar nichts oder nicht viel gelesen zu haben. Wo gelesen, was meinte er damit? Sie konnte ihn nicht lesen, er hatte ein echtes Poker Face. Er blickte sie ruhig und freundlich an, aber erwiderte weiter nichts. Tief in ihr drinnen wusste sie, dass sie jetzt nichts mehr von seinem Gedankengang erfahren würde. Jetzt nicht, vielleicht später. Vielleicht aber auch nie. Das ärgerte sie. Die letzten Jahrzehnte hatte sie die Spielregeln aufgestellt, und nun wurde sie durch jemanden herausgefordert. Sie musterte ihn weiter, fixierte seine dunkel umrandeten Augen. Er sah seltsam aus. Seine Kleidung, seine langen, glatten Haare, seine Gestiken, seine Aura, all das wirkte aus der Zeit gefallen. Oder einer anderen Welt. Und trotz seiner Fremdartigkeit strahlte er etwas aus, dass man ihm blind vertrauen konnte. Nicht jeder vielleicht, aber Agnete. Also vertraute sie ihm. Ein Teil von ihr zumindest.
»Zurück zum eigentlichen Thema, Liebes. Was hat deine Mutter dazu gesagt?«
»Zu meinem Vater?«
»Nein, zu dir. Zu deinen Freiheiten. Beziehungsweise Unfreiheiten, wenn man ganz korrekt sein will. «
Agnete presste ihre Lippen aufeinander und überlegte.
»Ach die … wie gesagt, sie war ja eher das scheue Reh, das sich nichts traute. Das meiste, was sie sagte, war „Ja, Alfred“ oder „Wie du möchtest, Alfred“.«
»Verstehe. Also hattest du nicht unbedingt die beste Zeit deines Lebens.«
»Ganz im Gegenteil, es war eine wirklich schreckliche Zeit.«
Draußen wurde es allmählich dunkel und die Sonne begann, sich hinter den Horizont zurückzuziehen. Agnete erhob sich aus ihrem Sessel, lief zur Tür und betätigte den Lichtschalter. Zwei Lampen an der Wand begannen, ihr warmes Licht zu verbreiten. Dann lief Agnete zur Kommode neben dem Klavier und schaltete die Stehlampe darauf an. In diesem Licht wirkte sie klein, traurig und verletzlich. Die laute, selbstbewusste Agnete war verschwunden.
»Inwiefern war es eine schreckliche Zeit?«
»Ich durfte nicht nur nicht ausziehen oder Freunde haben. Ich durfte auch keine Musik hören.«
»Wieso denn das?«
Die laute und selbstbewusste Agnete blitzte wieder hervor.
»Hörst du mir nicht zu? Ich sollte lernen und nicht Musik hören. Alles andere würde mich nur ablenken.«
»Aber Musik kann doch sogar beim Lernen helfen. Weißt du, es gibt da Studien, …«
»Wieso erzählst du mir das? Das hättest du vielleicht eher meinem Vater erzählen sollen. Ich weiß das, dass Musik nicht schlecht ist.«
»Aber er hat es dir verboten?«
»Ja. Und das Seltsame daran ist, dass wir davor ein recht musikalischer Haushalt waren. Bevor er so komisch geworden ist. Mein Vater konnte Geige spielen, ich Klavier. Und meine Mutter hatte eine ganz passable Stimme. Und meine Oma konnte sowieso alles. Als Kind haben wir oft zusammen Musik gemacht.«
»Und dann?«
»Meine Oma starb und das Haus wurde stiller. Die Geige verschwand, das Klavier wurde abgedeckt und in die Ecke dort hinten geschoben und meine Mutter sang nicht mehr. Nicht einmal beim Wäsche zusammenlegen, das hatte sie vorher immer gemacht. Es war, als hätte jemand eine Glocke über das Haus gestülpt. Alle Farben ausradiert. Das Ende aller Tage eingeläutet.«