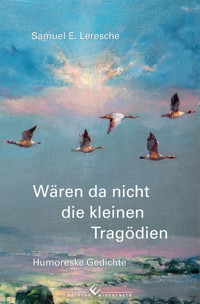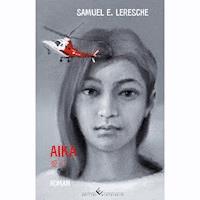
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: edition winterwork
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
1997. Maximilian von Bülow, ein bekennender Christ, arbeitet als Anästhesist im CHUV, dem waadtländischen Universitätsklinikum in Lausanne. Außerdem fliegt er als Notarzt in dem in Lausanne stationierten Rettungshubschrauber der Schweizer Rettungsflugwacht REGA. Eines Tages lernt er ein junges japanisches Mädchen kennen und verliebt sich in sie. Sein Glück scheint perfekt, wäre da nicht die geheimnisvolle Vergangenheit in Aikas Leben...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 412
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.
Nachdruck oder Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Verlages gestattet. Verwendung oder Verbreitung durch unautorisierte Dritte in allen gedruckten, audiovisuellen und akustischen Medien ist untersagt.
Die Text- und Titelrechte, die Rechte der Übersetzung in andere Sprachen und das Recht am Layout des Einbandes verbleiben beim Autor.
Impressum
Samuel E. Leresche, »Aika« www.edition-winterwork.de © 2018 edition winterwork
Alle Rechte vorbehalten. Lektorat:Dr. phil. Guido Erol Hesse-Öztanil, Hameln Dr. med Christopher Schnorr, Bückeburg
Satz: Samuel E. Leresche Umschlag: Gerhard Kosin, Hameln
Aika
Samuel E. Leresche
Pour mon fils Maximilian Samuel
et pour Amy, son épouse.
Vorwort
Ein jüngerer Bekannter, dem ich das Manuskript von „Aika“ als Erstem zur Durchsicht gegeben hatte, hat mir versichert, dass sich die Geschichte von Maximilian und Aika gut lesen würde. Er habe sie spannend gefunden, aber, so fragte er mich, ihm sei nicht klargeworden, was ich mit dem Roman eigentlich bezwecken wolle? Welches Ziel verfolgte ich mit einem christlichen Roman, der mit seiner ungeschminkten, befremdenden Erzählweise bei eher konservativ eingestellten Christen Widerwillen, vielleicht sogar Ekel auslösen mag?
Ich weiß nicht, ob ich mit diesem Roman ein ganz bestimmtes Ziel erreichen möchte. Aus eigener Erfahrung in meinem Leben jedoch weiß ich eines, nämlich, dass ein gläubiger Christ ebenso zu allem Versagen, aller Torheit und aller Sünde fähig ist, wie jeder andere Mensch auch. Eben diese „schwache“ Seite des Menschen, die schweren Seelenkonflikte, in die ein Christ geraten kann, rühren mich. Sie versuche ich zu beschreiben … und schaue dabei immer wieder selbst in einen Spiegel.
Samuel E. Leresche, im Februar 2017
Lausanne, Schweiz, 1997
Maximilian von Bülow kannte Lausanne wie keine andere Stadt. Keine Straße, keine Stiege, kein Haus war ihm fremd.
Seine Mutter war in Orbe aufgewachsen, einer geschichtsträchtigen waadtländischen Kleinstadt am Fuß des Schweizer Juras, gerade einmal dreißig Kilometer von der Kantonshauptstadt Lausanne entfernt. Bis zu seinem Abitur hatte er fast jedes Jahr die Sommerschulferien mit seinen Eltern und den beiden jüngeren Brüdern bei seinem Großvater verbracht. Zu den schon fast rituellen Gepflogenheiten gehörte anlässlich dieser Besuche der sonnabendliche Einkaufsbummel in Lausanne. Als Kind hatte Max diese Ausflüge als äußerst qualvoll empfunden. Nichts war ihm in seiner Kindheit öder erschienen, als stundenlang an der Hand eines Erwachsenen durch die Häuserschluchten gezogen zu werden. Immer wieder musste er bewegungslos vor den nicht enden wollenden Schuhregalen und Kleiderständern der unzähligen Geschäfte stehen bleiben. Dort wurde er eingehüllt von dem Muff der Stoffe, der Auslegeware, und Polsterstühle, während seine Mutter und seine Tante über Taillenweite, Schulterpolster, Rockstöße und andere – für ihn – belanglose Dinge diskutierten. In diesen Situationen blieb ihm als Zeitvertreib unter dem wachsamen Auge seines Vaters, dem nie anzusehen war, ob er diese Exkursionen spannend fand oder sich langweilte, nur, seinen Brüdern Fratzen zu schneiden. Wenn er seine Mutter zu den Umkleidekabinen begleiten musste, setzte er sich auf den Boden und vertrieb sich die Zeit damit, unter den Vorhängen nach fremden Frauenbeinen zu suchen.
Als Max älter wurde, bot ihm die Stadt mehr Anreize. Da waren die zwei Waffengeschäfte, in denen Gasdruckpistolen, Armeemesser, Armbrüste und diverse Säbel und Schwerter in den Schaufenstern ausgestellt waren. Seine Eltern erlaubten ihm nicht, diese Auslagen in Ruhe zu betrachten. So rannte Max, wenn er die Läden von weitem sah, stets vor, um ein bisschen Zeit herauszuschinden, bevor die Familie ihn eingeholt hatte und zum Weitergehen aufforderte. Anders verhielt es sich bei den Musik- und Bücherläden. Hier durfte er einen Augenblick verweilen und die Instrumente, Noten und Bücher ansehen, während die Eltern langsam weiterschlenderten. Besonders interessierte sich Max im vorpubertären Alter jedoch für die Schlösser und Burgen der Region, für die geheimnisvollen Geschichten von Raubrittern und vornehmen Schlossdamen. Einige Dinge waren Max in Erinnerung geblieben, wie zum Beispiel der Besuch des Château d‘Ouchy. Nach einem der traditionellen Sonnabendeinkäufe hatte die Familie am frühen Nachmittag das am Hafen errichtete Schloss, dessen Ursprung bis ins XII. Jahrhundert zurückging, besucht. Als sie in einem der Türme standen, hatte der Großvater ihn gefragt, ob Max sich vorstellen könne, zu welchem Zweck dieses Schloss einst erbaut worden sei. Natürlich hatte der Junge die Antwort sofort gewusst: zum Schutz des Hafens!
Mit neunzehn Jahren, nach einem glänzenden Abitur, war er aus Deutschland, wo seine Eltern lebten, zu seinem Großvater nach Orbe gezogen. Zuerst hatte er einen Sprachlehrgang für Französisch in Lausanne belegt, danach sein Medizinstudium an der dortigen Universität begonnen.
Warum mag ich diesen Bahnhof so?, fragte er sich, als er die Rue du Petit-Chêne hinunterlief und das imposante Bahnhofsgebäude auf der anderen Seite des Place de la Gare sah.Kommt es daher, dass ich so lange zwischen Orbe und Lausanne mit dem Zug hin- und hergependelt bin? Wie viele Jahre ist das nun schon her? Fünf? Zehn?
Der junge Mann blieb an einer roten Ampel stehen und sah zu dem langgestreckten Stationsgebäude hinüber. Schon 1899 hatte die Jura-Simplon-Bahn eine Gesamterweiterung der Bahnhofsanlage und des damaligen Aufnahmegebäudes geplant. Doch nach der Übernahme durch den Bund beschloss die damalige SBB-Generaldirektion, das Gebäude ganz neu zu errichten und schrieb im Februar 1908 einen landesweiten Wettbewerb „zur Erlangung von Fassadenentwürfen für das Dienst-, Empfangs- und Restaurationsgebäude” aus. Unter den einunddreißig eingegangenen Vorschlägen wurde der erste Preis an ein Lausanner Architektenbüro vergeben.
Als die Ampel auf Grün sprang, schlängelte sich Max an den vielen Touristen vorbei über den Bahnhofsplatz. Er entging knapp einem Taxi, das ihn übersehen hatte und blieb vor dem Fahrplan mit den Ankunftszeiten der Züge stehen. Ein Blick auf die Armbanduhr sagte ihm, dass er eine gute Viertelstunde zu früh dran war. Er entschied, sich noch eine Tageszeitung zu besorgen.
Der junge Mann ließ sich von der Menschenmenge, die in den Bahnhof hineinwollte, mittragen. Im Grundriss, erinnerte er sich, war die Ausführung des Haupteingangs und der breiten Schalterhalle nach dem eingereichten Wettbewerbsprojekt der dritten Preisträger vorgenommen worden. Die beiden seitlichen Rechteckfelder über dem Haupteingang, aus Haustein gefertigt, wie die ganze Fassade, waren mit vegetabilen Ornamenten ausgestattet. Ähnlich wurde auch die Wand der Schalterhalle über den Ausgängen und die Bögen über den Türen zu den Gleisen gefertigt.
Max stellte sich hinter einer Reihe Kanadier am Zeitungskiosk an. Das Québec-Französisch dieser Touristen war von einem starken Akzent geprägt. Hauptgesprächsthema war anscheinend die mögliche Weltmeisterschaft für ihren Formel-1-Fahrer Jacques Villeneuve. Max interessierte sich nicht besonders für Sport, schon gar nicht für Autorennen und so folgte er dem Gespräch der Touristen nicht. Er nahm sich eine Züricher Neue Zeitung, zahlte und ging in die Schalterhalle, wo er sich einen Augenblick auf eine Wartebank setzte. Die Dekoration der Halle war schlicht. Da war die Kassettendecke aus armiertem Gips, die Leuchter und je eine Männer- und Frauengestalt, die auf Konsolen über dem Kiosk saßen. Aber das war auch schon alles. Der Lausanner Bahnhof war sicher ein sehenswertes Gebäude, aber doch nur eines, wie es auch viele andere auf dieser Welt gab. Woher also kam seine Liebe zu diesem Bahnhof? Lag es vielleicht daran, dass er mit Acht einmal Lokomotivführer werden wollte? Er hatte von schnellen, starken, wunderschönen Diesel- und E-Loks geträumt und davon, wie er stolz darin sitzen und den Zug in Bewegung setzen würde. In Lüdinghausen, einer Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen, wohin sein Vater vor vielen Jahren versetzt worden war, hatte er stundenlang auf dem sanierungsbedürftigen Kleinstadtbahnhof gesessen und den wenigen ein- und ausfahrenden Zügen nachgesehen. Viele Eisenbahnen hielten in Lüdinghausen jedoch nicht. Oft hatte er dort einfach nur still gehockt und vor sich hin geträumt. Wann ihm dieser Berufswunsch verloren gegangen war, konnte er schon gar nicht mehr sagen. Viele andere hatten sich angeschlossen: Tierarzt, Masseur, Goldschmied und eine Menge mehr. Manche hatte er ernster ins Auge gefasst, andere schnell wieder verworfen. Aber das Interesse an Bahnhöfen und ihrer Entstehungsgeschichte war bis auf den heutigen Tag geblieben.
Lüdinghausen, im Sommer 1971
„Wo bist du so lange gewesen?“ Sein Vater stand in der Tür. „Deine Mutter hat sich Sorgen gemacht.“
„Ich war am Bahnhof, Papa.“ Max war klar, dass er zu spät nach Hause gekommen war.
„Was machst du schon wieder am Bahnhof?“
Max zuckte mit den Achseln. „Weiß nicht so recht. Den Zügen nachschauen.“
„Den Zügen nachschauen? Maximilian, welchen Sinn siehst du darin, Zügen nachzuschauen?“ Der Vater zog seinen Sohn in die Wohnung. Er hob den Finger. „Außerdem ist das noch lange kein Grund, zu spät nach Hause zu kommen. Kannst du dir vorstellen, welche Sorgen Eltern sich machen, wenn die Kinder nicht zur verabredeten Zeit wieder da sind?“
Max sah zur Seite. „Entschuldige. Ich hatte meine Armbanduhr vergessen und einfach nicht auf die Zeit geachtet.“
„Dabei hängt am Bahnhof eine wirklich große, gut sichtbare Uhr, Max. Man kann sie nicht übersehen! Sie geht darüber hinaus ziemlich genau!“
„Ich weiß, Papa. Es tut mir leid. Entschuldige bitte.“
Die Stimme des älteren von Bülow zitterte, als er fortfuhr: „Es tut mir leid, es tut mir leid. Das hören deine Mutter und ich fast jeden Tag von dir. Die schlechten Noten in der Schule tun mir leid. Es tut mir leid, dass ich die Hälfte des Einkaufs vergessen habe. Es tut mir leid, dass ich zu spät nach Hause gekommen bin. So geht das nicht weiter, Max!“ Seine Stimme schwoll an. „Du bist jetzt bald 11 Jahre alt. Können wir uns nicht allmählich auf dich verlassen?“
Max zog den Kopf zwischen die Schultern. Gleich würde der Vater ihn nach den Schularbeiten fragen. Er fragte immer nach den Schularbeiten, wenn er wütend war.
„Hast du deine Hausaufgaben anständig gemacht, bevor du rausgegangen bist?“
Max nickte. „Bis auf Physik. Die muss ich erst bis nächsten Donnerstag fertig haben.“ Er hatte den Satz noch nicht zu Ende gesprochen, da wurde ihm klar, dass er sich gerade noch tiefer hineingeritten hatte. Er wusste, dass seine Eltern ihm und seinen beiden Brüdern geboten hatten, zuerst alle Hausaufgaben zu machen und dann zum Spielen hinauszugehen. „Was erledigt ist, ist erledigt“, pflegte sein Vater immer wieder zu predigen. Er scharrte mit den Füßen und wagte nicht aufzusehen.
Er hörte, wie sein Vater die Luft schneidend einzog. Doch die erwartete Ohrfeige blieb aus. Stattdessen hörte er seinen Vater sagen: „Gottlose und ungerechte Menschen werden durch Ungehorsam gegenüber Eltern offenbar. Der Gedanke, dass du kein Kind Gottes sein könntest, macht mich sehr traurig. Geh jetzt in dein Zimmer, Max.“
Lausanne
Max rollte die Zeitung zusammen und stand auf. Es wurde Zeit auf den Bahnsteig 3 zu gehen. Er verließ die Schalterhalle und stieg die Treppen zum Fußgängertunnel hinab. Als er auf dem Bahnsteig stand, umgab ihn dieechte Atmosphäre eines Bahnhofes. Die Geräuschkulisse war typisch: das Bremsen einfahrender Züge, die Lautsprecherdurchsagen, das Wirrwarr der Stimmen, die sich in den verschiedensten Sprachen unterhielten, die Geräusche der elektrischen Motoren der kleinen Schlepper der Post, welche die Paketwagen auf den Bahnsteigen hin- und herfuhren. Warum bin ich eigentlich Arzt geworden?, dachte Max. Was hat mich eigentlich dazu bewegt, meinen Kindheitstraum nicht zu realisieren?Lächelnd schüttelte er den Kopf; so wie Gott die Dinge geführt hatte, war es schon gut.
Als der Zug aus Basel einfuhr, flatterten zwei oder drei Tauben auf, die vor ihm auf den Gleisen gesessen hatten. Mit kreischenden Bremsen kamen die Wagen zum Stehen. Mit seinen 1,75 Metern war Max nicht sehr groß. Er musste sich auf die Fußspitzen stellen, um über die Menschenmassen hinwegzusehen. So viele Touristen war er hier nicht gewohnt. Normalerweise hielt sich die Zahl der Reisenden im Bahnhof in Grenzen; die meisten kamen mit dem Auto. Letztendlich war man in der Schweiz: Hier war alles klein und überschaubar! Manche nannten das auch kleinkariert. Er musste bei diesem Gedanken grinsen. Wie unsachlich konnte der Mensch doch denken! Ihm gefiel es hier auf jeden Fall.
Als er Anton aussteigen sah, winkte er mit der Zeitung. Doch obgleich sich sein Bruder einen Augenblick umsah, konnte Max sich anscheinend nicht ausreichend bemerkbar machen. Anton nahm seinen Koffer auf, den er nach dem Aussteigen auf dem Bahnsteig abgesetzt hatte, und strebte der Treppe zu. Max steckte Zeige- und Mittelfinger der rechten Hand in den Mund und stieß einen lauten Pfiff aus. Erstaunt drehten sich etliche der Reisenden um. Einige runzelten missbilligend die Stirn. Doch jetzt hatte ihn Anton bemerkt und lief seinem Bruder entgegen.
Lachend fielen sich die beiden in den Arm und klopften sich auf die Schultern.
„Hast du eine gute Reise gehabt?”, wollte Max wissen.
„Na klar. Nur ein bisschen lang.”
„Wie bist du gefahren?”
„In Bremen bin ich in den CityNightLine gestiegen und von Basel dann direkt hierher.”
„Kannst du im Zug denn wirklich schlafen?”
Anton lachte. „Kein Problem. Wenn ich müde bin, schlafe ich überall. Außerdem sind die Betten in diesem Nachtzug gar nicht so schlecht, wie man meinen könnte.”
„Hast du schon gefrühstückt?” Max warf einen Blick auf die Armbanduhr. Es war kurz nach zehn.
„Ich habe ein mageres Frühstück nach dem Aufstehen bekommen. Der Kaffee war ganz gut, aber sonst war wirklich nicht viel dran. Lädst du mich zum Frühstück ein?”
„Das hatte ich eigentlich vor.”
„Aber nicht bei McDonald‘s!”
Max grinste. „Wo denkst du hin? Ich kenne da ein Lokal...”
„... das wahrscheinlich mitten in der Innenstadt liegt“, unterbrach ihn sein Bruder. „Ich bin ja nicht so häufig hier, aber ich habe doch lebhaft in Erinnerung, dass Lausanne am Hang gebaut wurde und vom tiefsten bis zum höchsten Punkt einen ziemlichen Höhenunterschied aufweist. Du wirst doch sicher nicht verlangen, dass ich den Koffer die ganze Zeit schleppe? Wo gibt es hier denn Schließfächer?”
„Ich habe eine bessere Idee: Mein Wagen steht in der Tiefgarage vom Place Montbenon. Wir gehen da vorbei und schließen den Koffer ein. Dann hast du die Hände frei und wir müssen nicht zurück zum Bahnhof.”
Anton war damit einverstanden. „Hauptsache ich werde das Ding los.”
Die Brüder gingen gemeinsam die Treppen hinunter. „Bei mir in der Wohnung ist es für uns beiden zu eng“, informierte Max Anton. „Wenn du da wohnen würdest, hättest du nicht viel von deinem Urlaub. Ich fürchte, wir würden uns schnell auf die Nerven gehen. Ich habe mit Tante Patricia besprochen, dass wir irgendwann im Laufe des Tages zu ihr nach Orbe kommen. Ich schlafe dann auch da.“
„Hast du die Woche über keinen Dienst?“
„Doch.“ Max machte eine wegwerfende Handbewegung. „Aber ich werde die Tage über einfach zwischen Orbe und Lausanne pendeln. Das habe ich früher ja auch gemacht. Das ist keine große Geschichte.“
Er legte seinem Bruder die Hand auf die Schulter und schob ihn in Richtung Ausgang.
Café du Milieu du Monde, Lausanne
Das Caféwar ein langgestreckter, in die Tiefe gehender Raum, dessen Rauputz an den Wänden schon lange nicht mehr gestrichen, geschweige denn erneuert worden war. An vielen Stellen durchliefen Risse den Putz. An manchen Stellen bröckelte er vor sich hin. Alte, aus der Mode gekommene Stillleben hingen über den Sitzgruppen.
Links neben der Eingangstür stand eine Art Tresen aus sehr altem, dunklem Holz. Die Tische und Stühle waren nicht minder betagt und dementsprechend unbequem. Die meisten wackelten. Sie standen in sechs Sitzgruppen hintereinander an der rechten Wand des Cafés. Schon der dritte Tisch wurde vom Tageslicht, das durch das einzige große Fenster fiel, kaum noch erreicht und bedurfte, wie alle noch tiefer im Raum stehenden Sitzgruppen, einer antiken Hängelampe, die etwas Helligkeit schenkte.
Die Unmenge Spirituosen, die hinter der Theke hingen und standen, täuschten: Das Lokal wurde überwiegend von alten Menschen besucht, die hier Kaffee oder Tee tranken, Patisserien oder einenTaillé aux greubons aßen, die Zeitung lasen, Domino spielten oder Patiencen legten und sich halblaut unterhielten.
Das Café war an diesem Vormittag nur mäßig besucht. Sie setzten sich an den drittletzten Tisch im Raum und bestellten ein Frühstück. Heiße Schokolade für Max, Kaffee für Anton, Croissants, Brötchen, Butter und Konfitüre.
Anton hatte die Windjacke ausgezogen und über eine Stuhllehne gehängt. Jetzt krempelte er sich die Ärmel seines karierten Hemdes etwas hoch.
Interessiert beobachtete ihn Max. „Manchmal komme ich mir in meinen Anzügen ganz schön bekloppt vor.”
„Warum sagt du das jetzt?”
„Ich weiß nicht. Das fällt mir gerade nur so ein, wenn ich dich so sehe. Warum kann ich nicht in Jeans herumlaufen, wie alle normalen Menschen?”
„Zählst du dich nicht zu den normalen Menschen?”
„Hör schon auf mit diesen psychologischen Rück- und Fangfragen. Welchen Komplex willst du mir heute andichten?”
„Hör mal, ich bin dein Bruder. Ich will dir gar nichts andichten. Ich frage dich doch nur, wie du auf einmal, so aus heiterem Himmel darauf kommst, dass Anzüge bekloppt sind.”
„Das habe ich so doch gar nicht gesagt. Ich wiederhole für einen begriffsstutzigen Finanzbeamten gerne das Gesagte: Manchmal komme ich mir in diesen Anzügen ganz schön bekloppt vor.”
Anton sah auf. „Jetzt mal ehrlich: Willst du auf diese Bemerkung überhaupt eine Antwort, Doktor? Du hast doch gar nicht immer einen Anzug an. Heute zum Beispiel trägst du eine graue Hose und ein Fischgräten-Jackett.”
„Stimmt. Aber immerhin von Boss.”
„Du musst das Firmenschild ja nicht draußen hängen lassen, sodass jeder es sehen kann.”
„Auch wahr. Hängt es noch?” Max verdrehte den Kopf und beäugte die Ärmel seiner Jacke.
„Quatsch. Sei doch mal ernst. Da komme ich dich schon mal in deinem Exil besuchen und du erzählst mir hier gleich in der ersten Stunde einen Stuss zusammen, dass mir die Ohren wegfliegen!”
Max lehnte sich etwas über den Tisch. „Was meinst du mit Exil? Ich habe hier einfach meine zweite Heimat gefunden.”
Sie verstummten kurz, als die Getränke kamen.
„Kann man denn überhaupt zwei Heimaten haben? Tante Gertruda meint nein.” Tante Gertruda war die ledige Schwester ihres Vaters, die in Köln lebte.
„Was Tante Gertruda meint, interessiert mich in diesem bestimmten Fall wenig. Sie ist halt eine gute, brave Deutsche, die immer in Köln gewohnt hat und immer dort wohnen bleibt. Wie soll sie mich da verstehen können?”
„Und du bist eher der rastlos Umherziehende?”
„Nein. Das weißt du ganz genau. Nicht umsonst wohne ich jetzt schon seit fünfzehn Jahren in Orbe beziehungsweise in Lausanne.” Max trank einen Schluck heißer Schokolade.
„Gibt es das Wort Heimat überhaupt in der Mehrzahl?”
Max zuckte mit den Schultern. „Keine Ahnung. Wenn der Plural nicht existiert, dann erschaffen wir ihn halt.”
Das Frühstück kam und in den nächsten zehn Minuten beschäftigten sich die beiden Brüder ausschließlich mit dem Essen. Es war still im Café. Eine große Fliege summte irgendwo im Raum.
„Ist Lausanne immer noch die Stadt mit den hübschesten Frauen dieser Welt?”, wollte Anton nach einer Weile wissen.
„Klar. Und der bestaussehendsten jungen Männer. Sieh dich doch hier im Café einmal um.”
Doch außer den Brüdern saß nur noch eine junge Asiatin vier Tische von ihnen entfernt und las in einem Taschenbuch. Vor ihr stand ein Teller mit zwei Croissants und eine Kanne Tee. Max warf ihr einen flüchtigen Blick zu.
„Außerdem bist du verlobt“, fuhr er fort. „Da sieht man sich nicht nach anderen Mädchen um! Vergiss nicht, dass geschrieben steht: Du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib!”
Anton hob drohend den Finger. „Stopp! Ich begehrte ja nicht. Ich genieße.”
„Die von mir eben zitierte Warnung steht sogar zweimal im Alten Testament!”, fuhr Max unbeirrt fort.
„Ja, ja, ich weiß. Aber wer hat das hier geschrieben: Wir Männer lustwandeln Tag für Tag in einem Garten voller Blumen. Gott hat uns in seinem vollkommenen Werk Augen geschenkt. Schauen wir uns daher die Blumen an, doch hüten wir uns davor, sie zu begehren, sie alle abzurupfen?”
Max grinste seinen Bruder an. „Wenigstens einer in der Familie, der sich am Rande mit meinen literarischen Versuchen beschäftigt hat. Aber diese tiefschürfenden Gedanken sind längst passé. Die habe ich schon 1980 zu Papier gebracht. Da war ich noch in der Schule! Ich kann mich auch daran erinnern, dass sie damals keiner von euch lesen wollte.”
Anton grinste zurück und biss in sein Croissant. „Da siehst du es wieder: Geschriebenes hat den Nachteil, dass man es immer wieder nachlesen kann. Gefährliche Sache!”
„Komm, lass uns nicht über Frauen reden.”
„Warum nicht? Ich bin gerade in eine verliebt. Liebe ist eine wunderbare Sache.”
„Dafür habe ich keine Zeit.”
Anton tippte sich an die Stirn. „Hör dir diesen Schwachsinn an!”
„Ich dachte, du seiest Beamter!”
„Na und?”
„Da hast du für Privatleben Zeit?”
„Ich weiß, was du meinst: Wir Beamten sind immer im Dienst. Das stimmt auch. Aber zurzeit denke ich gerade darüber nach, noch lauter kleine Finanzbeamte in die Welt zu setzen. Nachschub ist angesagt!”
Max schlug entsetzt die Hände zusammen.
Am anderen Tisch schaute die junge Frau erstaunt auf.
„Gott bewahre uns vor solch einem Übel!”
„Du sollst den Namen Jahwes, deines Gottes, nicht zu Eitlem aussprechen; denn Jahwe wird den nicht für schuldlos halten, der seinen Namen zu Eitlem ausspricht.”
„Du kennst Gottes Wort wirklich gut auswendig! Trotzdem passt das nicht ganz. Andere Übersetzer geben nämlich ‚Eitlem‘ mit ‚zur Lüge‘ wieder. Und gelogen habe ich nicht. Ich habe es sogar halb ernst gemeint.”
„Halbe Wahrheiten sind auch schon eine ganze Lüge. Erinnere dich an Mamas Worte! Aber genug der Bibelzitate.”
„Nicht, dass du mich falsch verstehst: Ich freue mich für dich und deine Verlobte!“
Die beiden jungen Männer beendeten ihr Frühstück schweigend. Schließlich bat Anton, der augenscheinlich nicht mehr ruhig sitzen konnte: „Lass uns austrinken, bezahlen und ein paar Schritte in der Innenstadt tun. Vielleicht finde ich ja gleich heute ein Mitbringsel für Tanja.”
Beim Verlassen des Lokals mussten die beiden jungen Männer an der asiatischen jungen Frau vorbei. Ohne Zweifel eine Studentin, überlegte Max. Gutaussehend. Sehr gutaussehend. Anton hatte recht: In Lausanne begegnete man wunderschönen Frauen aus der ganzen Welt. In anderen Großstädten war ihm das nie so aufgefallen. Das Mädchen trug ein dunkelrotes, mit blauen, weißen, rosa und gelben Punkten gemustertes Kleid mit Spaghetti-Trägern. Direkt unter dem ziemlich tiefen Ausschnitt saßen zwei perlmuttfarbene Knöpfe. Die Füße der jungen Frau steckten in braunen Sandaletten. Sie hatte dunkelbraunes, sehr langes Haar, das zu einem dicken Zopf geflochten war. Max hatte in seinem Beruf gelernt, das Äußere eines Menschen mit einem Blick zu erfassen. Krankenbeobachtung nannte man es da.
Als sich ihre Blicke trafen, schaute er in sanfte haselnussfarbene Augen. Wunderschön!, durchfuhr es ihn.
„Kann ich Ihnen helfen?”, wollte die junge Frau auf Französisch wissen.
„Entschuldigen Sie. Habe ich Sie angestarrt?” Max sah sich hilfesuchend nach seinem Bruder um, doch dieser hatte das Lokal bereits verlassen.
„Das muss man ganz nüchtern so sehen. Ja.”
„Das war wirklich nicht beabsichtigt. Ich bitte noch einmal um Entschuldigung.”
Ein undefinierbares Lächeln huschte über das Gesicht der jungen Frau. Dann nickte sie kurz und vertiefte sich wieder in ihr Buch.
Über dem Nachbartisch summte eine Fliege.
Das zu dem Thema ‚mit einem Blick erfassen‘, dachte Max mit glühenden Ohren und beeilte sich aus dem Café zu kommen.
Draußen hatte sich sein Bruder neben der Eingangstür gegen die Hauswand gelehnt und kicherte vor sich hin. „Alleine dein blödes Gesicht ist schon die Reise wert gewesen, Doktor!” Er hatte Tränen in den Augen. „Dein Umgang mit Frauen ist wirklich zum Schreien komisch. Oder einfach peinlich. Das kannst du dir aussuchen!”
„Hör schon auf“, brummte Max erbost. „Ich dachte, du wolltest in die City!”
Weinsberg, Bundesrepublik Deutschland, 1980
Die Zeit des Erwachsenwerdens war, was das Verhältnis von Max zu seinem Vater betraf, nicht ohne Probleme gewesen. Der Sohn hatte seinen Vater stets als äußerst autoritär empfunden. Besonders in der Pubertät litt er extrem darunter. Schmerzhaft empfand er, dass sein Vater ihn nicht verstand, auf seine Bedürfnisse nicht einging.
Der alte von Bülow war das Musterbild eines Verwaltungsbeamten. Er war stets pünktlich, besonders außerhalb seiner vier Wände korrekt in Wort und Tat, und aufrichtig bemüht, seine eigene, vermeintlich gute Erziehung an die drei Söhne weiterzugeben und der Familie wohl vorzustehen. Die unangenehme Seite an seinem Charakter war, dass er unflexibel, cholerisch und herrschsüchtig war. Was von Bülow senior anordnete, musste von den Jungen diskussionslos ausgeführt werden. Sofort. Mit zunehmendem Alter leisteten die heranwachsenden Brüder passiven Widerstand gegen die Autoritätsperson ihres Vaters. Offener Widerstand endete meistens mit einem Tobsuchtsanfall Karl-Gustavs und nicht selten mit Schlägen. Die Hände des Vaters waren so groß wie Untertassen. Oder noch größer. So kam es den drei Brüdern in jungen Jahren wenigstens vor. Da tat man schon gut daran, ihnen aus dem Weg zu gehen. Was seinen Vater betraf, war sich Max über seine Gefühle nicht recht klar. Wahrscheinlich handelte es sich um eine Art Hassliebe. Dass sein Vater aufrichtig bemüht war, seinen Söhnen christliche Tugenden beizubringen, wurde seinem Ältesten nicht deutlich.
Max und seine beiden jüngeren Brüder waren sich jedoch trotz der, wie sie meinten, ungerechten Härte ihres Vaters durchaus bewusst, dass dieser alles für sie tat, was in seinen Kräften stand. Das war die andere Seite Karl-Gustavs: Er kämpfte für seine Söhne. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn einer der Jungen hochfiebrig war, wachte der alte von Bülow nachts an dessen Bett. Morgens ging er dann trotz der durchwachten Nacht wie gewohnt ins Büro. Wenn es Ärger mit den Nachbarn gab, weil wieder einmal der Fußball in ein fremdes Blumenbeet gefallen war, stellte sich von Bülow senior schützend vor seine Sprösslinge. Die Brüder hätten unzählige Beispiele für den Einsatz ihres Vaters aufzählen können. Nur war ihnen das in der rebellischen Jugend nie so bewusstgeworden. Ihr eigenes jugendliches Unvermögen übrigens auch nicht.
Trotz allen Bemühungen brachte es Karl-Gustav von Bülow aber nicht fertig, der Ansprechpartner für seine Kinder zu werden, den diese sich im Vater zu finden erhofft hatten. Woran das genau lag, wusste keiner der vier. Sicher hatten alle ein Stück Schuld daran.
„So lange ihr eure Füße unter meinen Tisch streckt“, pflegte ihr Vater häufig zu sagen, „macht ihr genau, was ich sage! Gehorsam ist die Grundlage für das Leben eines Christen.”
Karl-Gustav von Bülow war eine schwierige Person, die mit sich selbst anscheinend nicht ins Reine gekommen war. Vielleicht hatte auch nur der 2. Weltkrieg, den er als Jugendlicher erleben musste, sein Wesen geprägt. Der Krieg hatte ihm die Kindheit geraubt.
Wenn man sie gefragt hätte, ob ihre Mutter in der Ehe unglücklich sei, hätten Max und seine Brüder keine Antwort geben können. Christine von Bülow war eine Meisterin der Diplomatie. Besonders in der Vermittlung zwischen den drei immer rebellischer werdenden Söhnen und ihrem jähzornigen Mann entwickelte sie im Laufe der Jahre ungeahnte Fähigkeiten.
Die von Bülows bewohnten seit einigen Jahren ein freistehendes Einfamilienhaus am Ortsrand von Weinsberg, nachdem der Landkreis Lüdinghausen anlässlich der deutschen Gebietsreform Anfang der 70er Jahre aufgelöst worden war. Das Haus war dank einer Erbschaft abbezahlt. Max, Anton und Robert hatten jeder ihr eigenes Zimmer, sodass kein akuter Bedarf bestand, das Elternhaus so bald wie möglich zu verlassen.
Während Anton und Robert in Weinsberg für das Abitur büffelten, hatte es Maximilian, kurz Max gerufen, nach Heilbronn auf ein altsprachliches Gymnasium verschlagen. Wie genau es dazu gekommen war, wusste keiner mehr so recht.
1980 stand er kurz vor seinem Abitur. Mehrmals hatte sein Vater die Sprache auf ein Studium oder auf eine geeignete Berufsausbildung gebracht, aber Max hatte sich noch immer nicht entschieden. Journalismus vielleicht oder Kriminalistik. Von Bülow senior konnte keinem dieser Studienzweige etwas abgewinnen und Christine unterbrach die Diskussionen immer schnell, bevor sich Vater und Sohn wieder einmal zerstritten.
Eines Abends war es erneut soweit.
„Wir müssen jetzt wirklich über deine Zukunft sprechen, Maximilian“, hob der Vater an.
„Ich stecke bis über beide Ohren in Klausuren und Hausarbeiten, Papa. Können wir das Gespräch nicht verschieben?” Max verspürte keinerlei Lust auf ein Grundsatzgespräch.
„Nein. Deine Mutter hat es in der Vergangenheit immer trefflich verstanden, davon abzulenken. Aber ich habe mit deiner Mutter eine Entscheidung getroffen.”
„Papa, ich bin volljährig!”
„Das interessiert mich überhaupt nicht, Max. Ich bin dein Vater! Das bleibe ich auch bis zu deinem oder meinem Tode!”
„Schon gut. Trotzdem werde ich selbst entscheiden, welchen Beruf ich ergreife.”
„Ich kann dich davon nicht abhalten. Aber du weißt, was du als Christ von Berufen wie Kripobeamter oder Reporter halten musst. Ein Polizist muss unter Umständen töten, ein Zeitungsfritze lügt, dass sich die Balken biegen. Du kennst meine Meinung zu diesen Berufen hinreichend. Meinen Segen bekommst du zu solchen Studiengängen nicht. Und mein Geld auch nicht.”
Max runzelte die Stirn. „Fängst du schon wieder mit dem Thema Geld an?”
Christine von Bülow legte ihrem Sohn die Hand auf den Arm. „Max! Bitte! Hör doch erst einmal, was Vater dir zu sagen hat.”
Max schluckte schwer und lehnte sich auf seinem Stuhl zurück. Die Hände legte er flach auf die Tischdecke. „Gut. Ich höre.”
„Du wirst nächstes Jahr 20 Jahre alt, Max“, fuhr Karl-Gustav unbeirrt fort. „Glaube mir: Du hast keine Zeit, dein Leben unnütz verstreichen zu lassen. Jedes Jahr, jeder Monat ist wichtig, da er dir von Gott gegeben wurde. Mutter und ich müssen zum Beispiel feststellen, dass du immer noch nicht deine Muttersprache sprichst.”
„Stimmt“, gab Max freimütig zu. „Dafür spreche ich aber meine Vatersprache, nämlich Deutsch. Außerdem noch relativ fließend Englisch und gar nicht einmal so schlecht Latein und Griechisch. Was wollt ihr mehr?”
„Genau das, was ich gerade angedeutet habe: nämlich, dass du Französisch lernst. Dein Großvater in Orbe hat sich bereit erklärt, dich für ein einjähriges Sprachstudium an einer Privatschule in Lausanne anzumelden. Du kannst bei ihm wohnen und hast gleichzeitig noch ein Jahr Zeit, über deine Berufswünsche nachzudenken.”
„Heißt das, dass ihr mich nächstes Jahr nach dem Abi in die Schweiz abschiebt?”
Auf der Stirn seines Vaters schwoll bedrohlich eine Ader. „So einen Unfug will ich hier nicht wieder hören, Max! Damit tust du mir und besonders deiner Mutter sehr weh! Von Abschieben kann gar keine Rede sein. Nach diesem Jahr kannst du wiederkommen und machen was du willst.”
Max sah hilfesuchend zu seiner Mutter. Doch diesmal fand er in ihr keine Verbündete. Sie nickte nur zustimmend zu dem, was ihr Mann sagte.
„Das muss ich mir aber noch gut überlegen“, protestierte Max schließlich schwach.
„Da gibt es nichts mehr zu diskutieren. Dein Großvater hat dich in der École Lémania schon eingeschrieben. Sei dankbar, dass er dir diese ausgezeichnete Ausbildung ermöglicht. Die Schule hat weltweit einen ausgezeichneten Ruf!”
„Wenn sie so einen ausgezeichneten Ruf hat, muss sie doch sehr teuer sein. Wer zahlt die Kurse denn?“
Max konnte beobachten, wie eine Ader über der linken Augenbraue seines Vaters stark anschwoll und sich dunkelrot färbte. „Das soll doch wohl nicht deine Sorge sein, Maximilian! Aber da du es so genau wissen willst: Dein Großvater kommt für diese zusätzliche Ausbildung auf! Dafür darfst du ihm ruhig ein wenig dankbar sein.“
„Und wenn ich überhaupt nicht wegwill?” Bevor er fertig war, wusste Max bereits, was jetzt von seinem Vater kommen würde.
Karl-Gustav von Bülow umklammerte mit eisernem Griff die beiden Holzknäufe, die an den Armlehnen seines Sessels angebracht waren. Seine Knöchel wurden ganz weiß. „Schluss mit der Diskussion. Solange du deine Füße...”
Max stand auf. „Schon gut“, unterbrach er seinen Vater. „Nichts für ungut, aber den Rest kenne ich schon auswendig.”
Zehn Monate später zog er mit Sack und Pack zu seinem Großvater nach Orbe ins Waadtland.
Orbe, Schweiz, 1981
Christine von Bülows Vater verkörperte genau die Art Mensch, die Maximilian nach seinem Abitur nötig hatte. Doch zu dieser Erkenntnis sollte er erst viele Jahre später kommen. Sein Großvater war tolerant und stets geduldig mit seinem Enkel. Er konnte zuhören und hatte die Angewohnheit Max einen Rat zu geben, ohne Druck auf ihn auszuüben.
Louis Duc hatte in den 40er Jahren in Orbe ein kleines Einfamilienhaus im Bungalowstil gebaut. Er hatte für den Bau einen für die damalige Zeit recht umfangreichen Kredit aufnehmen müssen. Seine Frau Lydie und auch die beiden Töchter Christine und Patricia hatten kräftig mit zufassen müssen.
Obgleich die von Bülows fast jedes Jahr den in der Zwischenzeit verwitweten Großvater besucht hatten, hatte Max weder dem Ort selbst noch dem Haus bislang besondere Beachtung geschenkt. Für ihn war Clos fleuri immer nur ein beliebiger Ferienort gewesen, genau wie jeder andere auch. Als er sich 1981 zwangsläufig mit seinem neuen Domizil anfreunden musste, fand er ein schneeweißes Haus mit dunkelroten Dachpfannen und Holzläden vor, das von Kletterrosen bewachsen war und inmitten eines tausendfünfhundert Meter großen Gartens mit alten Obstbäumen stand. Wenn man aus den beiden kleinen Küchenfenstern sah, konnte man den Suchet sehen, die höchste örtliche Erhebung des Juras.
Orbe selbst war eine Kleinstadt am Fuße dieses Mittelgebirges. Stadt durfte sie sich nicht aufgrund der Anzahl ihrer Bewohner nennen, sondern aufgrund für Max nicht nachvollziehbarer historischer Ansprüche. Vor vielen Jahrhunderten als das populäre römische Urba bekannt und damals deutlich größer als 1981, wie Ausgrabungen rund um die Stadt bewiesen, spiegelte Orbe Anfang der Achtziger das typische Bild einer verschlafenen Kleinstadt wieder: Abends ab 18 Uhr wurden die Bürgersteige hochgeklappt.
Max störte das nicht. Emsig beschäftigte er sich mit dem Französischstudium und wanderte in seiner Freizeit mit dem für sein Alter noch sehr rüstigen Louis. Schon bald waren die beiden Männer für ihre Ausflüge in den umliegenden Ortschaften bekannt. Anfangs hatte mancher Autofahrer noch mitleidig angehalten, wenn er die beiden wieder einmal auf glühend heißem Asphalt oder bei Nieselregen die Straßen entlangtrotten sah. Doch schon bald winkte man ihnen beim Vorbeifahrern nur noch freundlich zu, denn Max und Louis Duc stiegen nie ein. Wandern hieß nicht fahren.
Max kopierte schon recht bald unbewusst die Körperhaltung und die etwas gebeugte Gangart seines achtzigjährigen Großvaters. So wanderten beide mehrmals in der Woche über Straßen, Wege und Felder, die Arme hinter dem Rücken verschränkt, den Oberkörper etwas vorgebeugt. Wenn es sehr heiß wurde, hatte der alte Louis die Angewohnheit, sich ein großes Taschentuch, in dessen vier Ecken er Knoten band, auf den kahlen Schädel zu legen, um den Schweiß aufzufangen. Mit dieser Kopfbedeckung konnte Max sich allerdings nicht anfreunden. So unterschieden sie sich äußerlich zumindest im Hochsommer etwas.
In Clos fleuri wohnte außerdem Christines jüngere, ledige Schwester, Patricia. Max Tante arbeitete in der kantonalen Postdirektion in Lausanne und verließ das Haus meistens gegen sechs. In der Regel kam sie nicht vor fünf Uhr nachmittags nach Hause, sodass Max und sein Großvater viel Zeit füreinander hatten.
Die Gartenarbeit war Max von zuhause gewöhnt. Von Bülow senior hatte einen Acker hinter seinem Haus mit Beerenobst bepflanzt und zusätzlich zwei Grundstücke mit Apfel-, Birnen- und Pflaumenbäumen gepachtet. Für ihn war es ganz selbstverständlich, dass seine drei Söhne ihre Freizeit zu einem großen Teil bei der landschaftlichen Arbeit verbrachten. In Orbe wurde aus dem Muss ein Kann. Louis Duc zwang seinen Enkel zu nichts. Wenn Max einmal keine Lust hatte den Rasen zu mähen, holte sich sein Großvater selbst die Sense aus dem Schuppen.
Genau gegenüber von Max neuem Zuhause befand sich der Versammlungssaal ihrer Christengemeinde. Max war bereits die dritte Generation seiner Familie, welche die Zusammenkünfte dieser aus der Brüderbewegung entstandenen Freien Gemeinde regelmäßig besuchte. Als 15-Jähriger hatte er sich in Heilbronn, wo er mit seinen Eltern und Brüdern die Gottesdienste besuchte, taufen lassen. Er hatte die Taufe im vollen Bewusstsein dessen, was sie bedeutet, vornehmen lassen: Ein öffentliches Bekenntnis zu Jesus Christus, dem Sieger von Golgatha. Ja, er hatte damals beschlossen, seinem Heiland konsequent nachzufolgen, und dies der Welt auch bekanntzugeben. Doch in den Jahren bis zum Tode seines Großvaters lernte er, was es wirklich bedeutete, treu seinen Weg als Christ zu gehen. Louis Duc war ihm im Christenleben ein kostbares Vorbild.
Max schlief neben seinem Großvater im gleichen Zimmer. Oft diskutierten beide Männer bis spät in die Nacht hinein, bis Tante Patricia erbost mit der Faust gegen die Wand zu ihrem Zimmer schlug, weil sie nicht einschlafen konnte. „Willst du nur sonntags als Christ leben und in der restlichen Woche einen gottlosen und unbiblischen Weg gehen?”, hatte sein Großvater ihn einmal gefragt. „Niemand kann zwei Herren zur selben Zeit dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhangen und den anderen verachten. Das lehrt uns die Bibel. Wir können nicht Gott und dem Mammon gleichzeitig dienen.”
Louis Duc war das Beste, was Max geschehen konnte.
Lausanne, 1997
„So ein Samurai-Schwert ist schon eine feine Sache“, stellte Anton fest und blieb vor dem einen Waffengeschäft stehen, das Max schon als Kind so anziehend gefunden hatte. Im Schaufenster lagen neben den üblichen Taschen- und Jagdmessern auch Handfeuerwaffen und diverse Schwerter und Säbel.
„Schön anzusehen, aber trotzdem zum Töten hergestellt.” Max war schon lange von Waffen jeder Art nicht mehr so begeistert.
„Vielleicht damals, ja. Aber heute ist das doch ein Zierstück und keine Kampfwaffe mehr.”
„Na, ich weiß nicht!” Max schüttelte den Kopf. „Wenn du mal einen Verletzten mit Stichwunden gesehen hast, denkst du darüber gleich anders. Komm, lass uns weitergehen!”
„Nun warte doch noch einen Augenblick! Weißt du, wie man diese Klingen auf Japanisch nennt?”
„Nein.”
„Das Langschwert, das zum Kampf benutzt wurde, heißt Katana und das Kurzschwert Wakizashu.”
„Wie interessant.” Max wirkte alles andere als fasziniert von dem detailreich gestalteten Schwertpaaren im Schaufenster. „Die einzigen Klingen, die mich seit meinem Studium am Rande noch interessieren heißen auf Deutsch Skalpell.”
„Du bist wirklich ein Spielverderber, Max. Ich will die Dinger ja nicht kaufen, aber darüber unterhalten könnten wir uns doch wenigstens, oder? Du bist früher auch immer vor diesen Schaufenstern stehengeblieben.”
„Daran erinnerst du dich noch?“ Max zog seinen Bruder am Ärmel. „Wenn wir ein paar hundert Meter weitergehen, kommt da ein Teegeschäft. Dort gibt es japanischen Tee. Darüber können wir uns unterhalten.”
Anton lachte und ging weiter. „Du bist wirklich...”
„Keine bösen Wörter“, unterbrach sein Bruder ihn. „Im Ernst: Dort gibt es zum Beispiel japanischen Grüntee Tamyrokucha. Der wird jährlich im japanischen Shizuoka-Distrikt mit nur viertausend Kilo produziert. Der Tee wird leuchtend gelb und ist leicht trübe. Er schmeckt wunderbar aromatisch.”
Anton schaute Max von der Seite an. „Du bist wirklich gut informiert. Das ist einfach spannend, was du da erzählst. Wirklich. Umwerfend.”
„Genauso spannend und umwerfend wie deine Schwärmerei für diese Schwerter...”
„Hast du sonst noch interessante Informationen über unseren ehemaligen Kriegsverbündeten?”
„Wir könnten jetzt zum Beispiel über Sushi sprechen.”
„Bitte über was?”
„Das sind kleine Leckerbissen, die aus Reis, Gemüse und eingelegtem Fisch zubereitet werden.”
„Wo hast du denn diese Weisheiten her?”
„Mein Chef im CHUV hat uns Ärzte Weihnachten alle in ein japanisches Restaurant eingeladen.”
„Schmeckt das überhaupt?”
„Köstlich! Wirklich. Außerdem ist Sushi sehr gesund. Es hat einen hohen Gehalt an Vitaminen, Spurenelementen und Nährstoffen.”
„Das hört sich wirklich toll an!” Antons Gesichtsausdruck war zu entnehmen, dass er genau das Gegenteil dachte. „Mir fällt auf, dass du dich sehr mit Japan beschäftigst. Auch mit den Frauen dort?”
„Anton!” Max fand das gar nicht komisch. „Wenn jetzt wieder so eine dumme Anspielung auf diese peinliche Situation im Restaurant kommen soll, kannst du sie gleich abwürgen.”
„Du verstehst wirklich keinen Spaß.”
„Doch. Aber es steht auch geschrieben, dass kein verderbtes Wort aus unserem Munde ausgehen soll.”
„Jetzt mach aber mal halblang, ja. Was war denn an dem, was ich gesagt habe, verderbt?”
Max blieb ruckartig stehen. Fast wäre ein Passant, der hinter ihm ging, aufgelaufen. Mit einem bösen Blick ging er um den jungen Arzt herum. Bis Anton gemerkt hatte, dass sein Bruder ihm nicht mehr folgte, war er schon zehn Meter weiter. Erstaunt kam er zurück. „Was ist denn jetzt los?”
„Ich will dir sagen, was an deinen Anspielungen verderbt ist.”
„Nun mal sachte“, versuchte Anton einzulenken. „Wir sind dabei, in einen Streit zu geraten, wie früher, als wir klein waren. Doch nicht mitten auf der Straße.”
Aber Max war sauer. Er wollte die Dinge jetzt an den richtigen Platz rücken. Er zog seinen Bruder am Ärmel ein bisschen vom Bürgersteig weg in einen Hauseingang. „Jetzt hör mir mal zu: Deine Anspielungen kommen bei mir so an, als wenn du andeuten würdest, dass ich sexuell nicht richtig veranlagt bin.”
„Das habe ich mit keinem Wort angedeutet!” Anton protestierte heftig.
„So kommt es aber rüber. Da ist Maximilian von Bülow schon sechsunddreißig Jahre alt und noch immer ledig... Kannst du dir vielleicht denken, dass ich zuerst mein Medizinstudium abgeschlossen, dann meinen Facharzt gemacht habe? Ich kann dir versichern, dass ich die gleichen Gefühle, Wünsche und vielleicht auch Triebe habe, wie jeder normale Mann. Wenn du eine Frau von Gott für das Leben geschenkt bekommen hast, freue ich mich für dich. Ich noch nicht. Punkt.”
„Ich habe doch nur Spaß gemacht.”
„Der ist aber, wie du siehst, schlecht angekommen.”
Schweigend gingen die beiden Brüder weiter. Anton fand das erhoffte Geschenk für Tanja nicht. Aber er war auch nicht mehr konzentriert bei der Sache. Die Wiedersehensfreude der beiden war durch Maximilians Ausbruch etwas getrübt.
Schließlich unterbrach Anton das Schweigen. „Habe ich dich verletzt?”
„Ich glaube schon“, gab Max zu. Er grinste schief. „Vielleicht beneide ich dich ja auch nur.”
„Ach was. Der Herr Jesus wird auch dir eine Frau schenken.”
„Man kann ihm auch diktieren, was er zu tun und zu lassen hat. Ich bin nicht überzeugt, dass das der rechte Weg für einen Christen ist.”
„...”
„Ich war einmal in ein Mädchen verliebt.”
„Ja?”
„Ja. Es hieß Martine Aubert. Sie wohnte in Bretonnières.”
„Und?”
Und als Max schwieg: „Erzähl doch!“
„Nichts und. Das war noch zu Großvaters Zeiten. Ich war dreiundzwanzig und sie vielleicht fünfzehn oder so. Nach ein paar Monaten Liebeskummer habe ich mich an den Gedanken gewöhnt, dass nichts aus uns werden würde.”
„War sie gläubig?”
„Ich denke schon. Sie ging in eine Gemeinde in Vallorbe.”
„Und dann?”
„Da hört die Geschichte auf. Es gibt kein ‚und dann‘. Ich weiß nicht mal, ob sie noch bei ihren Eltern wohnt. Ich habe sie schlicht aus den Augen verloren.” Er deutete stadtabwärts. „Lass uns zum Auto gehen und zu Tante Patricia nach Hause fahren. Unterwegs können wir noch irgendwo zu Mittag essen.”
Bretonnières, Kanton Waadt, 1982
Als heranwachsender junger Mann hatte war es Max so vorgekommen, als würde Liebe ständig und untrennbar mit Leiden verbunden sein. Er war ein sehr impulsiver, emotionaler Mensch, der sich schon im Grundschulalter immer wieder mal schnell verliebt hatte: Mal in eine Schulkameradin, mal in die Lehrerin. Ähnlich erging es ihm in den Christengemeinden, die er mit seinen Eltern regelmäßig besuchte; wenn er dort ein nettes Mädchen sah, schlug sein Herz höher. Die Schönen des anderen Geschlechts waren jünger als er, älter, selten in derselben Altersgruppe. Bei alledem hatte Max eine ganz eigenwillige Art, Schönheit für sich zu definieren. Seine Auffassung von gutem Aussehen deckte sich erfahrungsgemäß selten mit den Vorstellungen seiner Schulkameraden oder Brüder. Wenn er ehrlich mit sich war, konnte er gar nicht sagen, was er nun eigentlich attraktiv und liebenswert fand und was nicht. Mal waren es die Augen, die es ihm angetan hatten, mal die Hände eines Mädchens, nicht selten die Stimme. Manche dieser Mädchen bezog er während dieser Phasen der platonischen Liebe in sein abendliches Gebet ein, aus unerfindlichen Gründen manchmal sogar mitsamt ihrer ganzen Familie.
Über seine Gefühle sprach Max jedoch mit niemandem. Wenigstens fast nie. Manchmal wurde unter den Kameraden etwas getuschelt. Max beteiligte sich dann nur selten an dieser Art Gerede. Alles in allem war er ... ein ganz normaler Junge.
Im Sommer dieses Jahres lernte er Martine kennen. Eigentlich war es reiner Zufall. Er war mit Etienne, einem gläubigen Freund, den er wie einen leiblichen Bruder liebte, in dessen gelben Renault 5 unterwegs. Die beiden fuhren abends häufiger mal raus, irgendwohin, häufig ohne festes Ziel, nur um zusammen zu sein und zu reden.
In diesem Sommer war Etienne gerade in Jannette verliebt. Jannette wohnte in Bretonnières, ungefähr sieben Kilometer von Orbe entfernt. Etienne erging es in mancherlei Beziehung wie Max; er konnte seine Gefühle nur schlecht in Worte fassen. Er wollte nicht, dass Jannette von seiner Liebe erfuhr. Eigentlich zweifelte er sogar daran, dass sie die gleichen Gefühle für ihn hegte.
„Lass uns nach Bretonnières fahren“, schlug er eines Abends vor.
„Was sollen wir denn in diesem Dorf?” Max war gar nicht begeistert.
„Ich will sehen, ob Jannette zuhause ist.”
„Willst du etwa mit ihr sprechen?”
„Quatsch. Ich will nur mal schauen, ob sie zuhause ist. Von weitem nur...”
Max grinste. „Ich würde mich auch nicht trauen, ein Mädchen anzusprechen. Wir beide leiden ganz schön an krankendem Selbstwertgefühl, was?”
Etienne fand das gar nicht komisch. Er war eins achtzig groß und sehr gutaussehend. Sein Selbstwertgefühl war schon ganz in Ordnung, fand er. Er würde seinem Freund Max gegenüber nicht zugeben, dass er vor allem Angst vor Jannettes Vater hatte. Der alte Aubert hütete seine drei Töchter wie seinen Augapfel. Von Jannette selbst konnte er sich im schlimmsten Fall einen Korb holen, einer Begegnung mit dem Vater würde er aber unter allen Umständen aus dem Weg zu gehen suchen. Wenn Janettes Vater auch nur der leiseste Verdacht hätte, dass ein junger Mann einer seiner Töchter nachstellte, würde er keine Ruhe geben, bevor er den Übeltäter nicht ermittelt und ins Gebet genommen hätte. Zum einen musste er dann mit einer Strafpredigt rechnen, eventuell sogar begleitet von einem Satz Ohrfeigen, zum anderen würde sich der alte Aubert mit seinem eigenen Vater in Verbindung setzen und dann ginge das Ganze zuhause noch einmal los. Weder Janettes, noch Etiennes Vater nahmen bei Fragen des Anstands und der Schicklichkeit Rücksicht auf Volljährigkeit oder moderne Sitten.
Dass Etiennes quittegelber Renault ziemlich auffällig war, fiel den jungen Männern in diesem Augenblick nicht ein. Max fuhr ohnehin nur mit, um seinem Freund einen Gefallen zu tun. Er konnte gut nachvollziehen, wie schlecht man sich fühlte, wenn man unglücklich verliebt war.
Am Dorfrand ließen sie den Wagen in einer Feldeinfahrt stehen und schlichen sich durch das Halbdunkel der Gassen. In einem Hof bellte ein Hund. Sonst war es zu dieser fortgeschrittenen Stunde recht still. Viele Landwirte blieben in dieser Jahreszeit mit ihren Traktoren und Mähern noch auf dem Feld, oft bis in die Nacht hinein.
Monsieur Aubert, Jannettes Vater, hatte keinen eigenen Landwirtschaftsbetrieb. Er betrieb die kleine Poststelle des Dorfes und half seinem Bruder, der den elterlichen Hof übernommen hatte.
An der Ecke der schmalen Gasse, in der die Auberts wohnten, stand die Benzin-Zapfsäule des Dorfes. Hierhin steuerte Etienne mit Max im Schlepptau.
„Das ist schon ein bisschen peinlich“, maulte Max. „Wenn man uns erwischt, wird es nicht leicht sein, zu erklären, warum wir uns verstecken. Wir benehmen uns wie Strauchdiebe. Davon abgesehen finde ich uns ein bisschen zu alt für diese Albernheiten.”
„Sei still“, schimpfte Etienne. Die Hoffnung, Jannette zu sehen, war ihm alle Torheiten der Welt wert. Nur kurz sehen, ob die Angebetete zuhause war, dann würden sie wieder fahren und der Abend war gerettet! „Stelle dich hinter die Zapfsäule.”
„Wie hoch stehen denn die Chancen, dass Jannette heute Abend noch einmal rauskommt?”
„Was weiß ich denn.” Etienne war gereizt. „Vielleicht kommt sie, vielleicht auch nicht!”
„Dafür dieser ganze Aufwand?”
Sein Freund antwortete nicht. Nun, keine Antwort war auch eine Antwort! Max war sich selten so albern vorgekommen, wie in dieser Situation.
Die Nacht brach schneller herein, als ihnen lieb war. Die Straße war nur spärlich beleuchtet. Max war das nur recht. Das Risiko gesehen zu werden, wurde mit dem schwindenden Tageslicht deutlich weniger.
Die Zeit verstrich, ohne dass sich in dem Haus der Auberts etwas getan hätte. Max trat von einem Fuß auf den anderen. Ein paar Mal warf er Etienne einen langen fragenden Blick zu, verbiss sich aber stoisch die Frage, wie lange sie sich noch lächerlich machen wollten. Er hatte von dem Herumstehen genug und sehnte sich nach seinem Bett.
Auf einmal ging die Eingangstür des Hauses auf, das sie nun seit fast einer Stunde beobachteten. Max sah aus den Augenwinkeln, wie sein Freund zusammenzuckte. „So sieht sie also aus?”, fragte er und beobachtete die Silhouette eines jungen Mädchens, das man im Laternenlicht nur schlecht sehen konnte.
„Das ist nicht Jannette“, meinte Etienne enttäuscht.
Das Mädchen drehte sich zum Haus um und knipste das Licht über der Tür an.
„Das ist Martine. Jannettes Schwester.” Er machte eine wegwerfende Handbewegung.
Das Mädchen war mindestens einen Kopf kleiner als Max, nicht ganz schlank, hatte offenes mittelblondes Haar und ein ... sehr anziehendes Gesicht. – Wenigstens soweit Max das bei dem schlechten Licht feststellen konnte. Er spürte es mit einem Mal: Es war wieder soweit. Er kam, sah und verliebte sich. ... Süßer Schmerz!
So schnell, wie sie gekommen war, verschwand Martine auch wieder im Haus.
Fast zeitgleich ging hinter den jungen Leuten ein starkes Licht an und eine männliche Stimme rief: „Könnt ihr mir mal sagen, was ihr die ganze Zeit hier tut? Ich beobachte euch schon eine ganze Weile!”
„Mist! Den kenne ich“, entfuhr es Etienne. „Der betreibt hier den Dieselverkauf!”
Max war sich im Nachhinein nicht sicher, wer schneller gelaufen war, er oder Etienne? Keine zwei Minuten später saßen sie im Auto und waren auf dem Heimweg nach Orbe.
Eine Woche später entschied Max endgültig, dass er in der Schweiz bleiben würde. Die Begegnung mit Martine war für diesen Entschluss nicht ohne Bedeutung.
Zweieinhalb Jahre später heiratete Martine einen jungen Landwirt aus der Nähe von Renens. Neun Monate später brachte sie ihren ersten Sohn zur Welt.
Tokio, Japan, im Frühling 1996
Der Produzent war ein stattlicher Mann. Wie alle Japaner legte er außerordentlichen Wert auf körperliche und geistige Ertüchtigung. Jeden Morgen stand er früh auf, fast immer kurz nach fünf Uhr, und schwamm in dem beheizten Swimmingpool genau dreißig Bahnen, was einer Distanz von anderthalb Kilometern entsprach. Sein Haus stand am Stadtrand von Tokio, Japans menschenüberfüllter Hauptstadt. Es lag inmitten eines großen Gartens voller wunderbarer Blumen, Büsche und Bäume. Das Grundstück war von einer zweieinhalb Meter hohen Mauer umgeben und von außen nicht einsehbar.