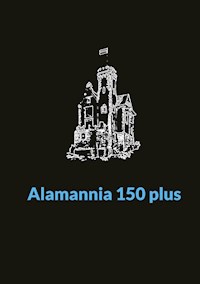
Alamannia 150 plus E-Book
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Festschrift zum 150. Stiftungsfest der Katholischen Studentenverbindung Alamannia Tübingen im KV.
Das E-Book Alamannia 150 plus wird angeboten von Books on Demand und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Studentenverbindung, katholisch, Tübingen, Kartellverband KV, Geschichte
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 310
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Zum Geleit.
Franz Ackermann
Grußworte.
Weihbischof Johannes Kreidler, Oberbürgermeister Boris Palmer, KV-Rat Markus Wittenberg, AKTV Andreas Strecke
O alte Burschenherrlichkeit:
„Der Forderer“
Jost Reischmann, Daniel Couzinet
Brüder reicht die Hand zum Bunde.
Die Pfeiler, auf denen wir stehen: die Prinzipen.
Johannes Kreidler, Jost Reischmann, Josef Nolte
Was den großen Ring bewohnet.
Alamannia und ihre Beziehung zum KV.
Sylvester Held
O Tübingen, du wunderschönes Nest.
Tübinger Verbindungen und Alamannia.
Stefan Sacharjew
Tübinger Korporationen.
Achim Haibt, Tim Rauland
Preisend mit viel schönen Reden.
Herkunft und Sinngehalt des Namens „Alamannia“
Josef Engelfried
Ubi sunt qui ante nos.
„Viri probati“.
Julian Aleker, Walter Puza, Christian Kurz
Heil den Edlen, die vor Jahren.
Von Philister-Senioren und sonstigen „patres Alamanniae“
Walter Wochner, Franz Ackermann, Helmut Kiener
Wenn uns droht auch schwarze Nacht
.
Alamannia und die 68er Bewegung
Franz Brendle
Gaudeamus igitur
.
Alamannia ist jetzt 100, jetzt 100 Jahre alt
Jost Reischmann
Vom hoh’n Olymp herab.
Die Alamannenblätter - Brücke und Gedächtnis.
Jost Reischmann
Fest zu unsrer Burg wir stehen
.
Sie ist uns lieb und teuer
Helmut Kiener
Gold und Silber lieb ich sehr
.
Der Club der 1000er für Alamannia
Helmut Kiener, Jost Reischmann
Sind wir über den Strudel gefahren
.
Alamannia, Tübingen und Stocherkähne.
Wolfgang Bitzer
Wo sind sie, die vom breiten Stein?
Die Ortszirkel im KV
Christoph Stehle
O jerum, jerum
.
Verbindung und Studieren unter Coronabedingungen
Joshua Ruopp, Peter Sellnow
Wo zur frohen Feierstunde
.
Die Stiftungsfestreden bei Alamannia seit 1949.
Jost Reischmann
Hier sind wir versammelt zu löblichem Tun.
Die Chargen 1948-2020
Konstantin Kiesel, Tim Rauland, Jost Reischmann
Zum Geleit
150 Jahre K.St.V. Alamannia – ein Jubiläum, das uns Alamannen mit Freude und Stolz erfüllt. In dieser Zeit ist in der Welt, in Deutschland, in Tübingen viel geschehen. Dabei gab es auch Phasen, in denen aufgrund der politischen Gegebenheiten die Existenz Alamanniae wie der korporierten Studentenschaft insgesamt in Frage stand. Aber wir haben diese Zeitläufte überstanden und sind nach wie vor eine lebendige Verbindung. Wie heißt es doch in unserer Farbenstrophe: „Fest wie unsre Burg wir stehen…“.
Glücklicherweise gab es immer wieder junge Männer, die über den Horizont ihres Studienfaches hinausschauten und für sich die Entscheidung trafen, Alamannia beizutreten. Viele waren und sind im Beruf erfolgreich geworden, manche gelangten bis in die höchsten Ämter unseres Staates. Die meisten dieser Alten Herren stellten rückblickend fest, wie entscheidend sie in ihrer aktiven Zeit geprägt wurden, wie wichtig das bundesbrüderliche Zusammenwirken innerhalb der Aktivitas und im Austausch mit den Alten Herren für die menschliche und berufliche Entwicklung war.
Und auch heute noch gibt es diese jungen Studenten, die Mitglied unserer Verbindung werden. Alamannia zeichnet sich seit Jahrzehnten nicht zuletzt durch interessante, abwechslungsreiche, von großer Themenvielfalt geprägte Semesterprogramme aus. Grundlage dieser Qualität ist das große Engagement, das die jungen Bundesbrüder für ihre Alamannia an den Tag legen. Dafür sind wir Alten Herren dankbar.
Ich wünsche mir, dass der Geist und die Haltung, aus denen Alamannia und viele andere Korporationen leben, in der Gesellschaft besser erkannt und anerkannt werden. Das würde es erleichtern, auch künftig junge Menschen für das Korporationswesen und für Alamannia zu interessieren und zu begeistern, damit Füxe und Aktive die Alamannenburg weiterhin mit Leben erfüllen.
Dr. Franz Ackermann, Philistersenior
Liebe Aktive und Alte Herren der Katholischen Studentenverbindung Alamannia,
die Diözese Rottenburg-Stuttgart freut sich mit euch über die Feier eueres 150. Stiftungsfestes. In diesem langen Zeitraum habt ihr als katholische Verbindung Höhen und Tiefen erlebt. Schon die Gründung fiel in eine Zeit des Kulturkampfes, in denen katholische Verbindungen viele Widrigkeiten zu bestehen hatten - in Leipzig konnte die Alamannia nicht gegründet werden, Tübingen wurde der Nutznießer. Der Modernistenstreit zu Beginn des 20. Jahrhunderts verlangte von einer katholischen Verbindung manchen Bekennermut. Und die Auflösung im 3. Reich schien das Ende der katholischen Gemeinschaft zu sein.
In fide firmitas - in Treue fest - habt ihr all diese Widrigkeiten überstanden. 150 Jahre lang bekannten sich eure Mitglieder zum Prinzip „Religio“. Dazu gehörten auch vielfältige Beziehungen zur Diözese Rottenburg Stuttgart: Die Alamannia hatte und hat viele Männer der Kirche als Mitglieder und Ehrenmitglieder, so den damaligen Weihbischof und späteren „Bekennerbischof“ Johann Baptist Sproll, der zum 50. Stiftungsfest 1922 Ehrenmitglied der Alamannia wurde. Gottesdienste zum Semesteranfang und Semesterende - auf eurer schönen Burg -, Vorträge zu religiösen Themen, und nicht zu vergessen eure Teilnahme an der Fronleichnamsprozession in Rottenburg zeigen eure Verbundenheit zu Kirche und Diözese. Dafür sind wir dankbar
„In fide firmitas“: das kann man auch übersetzen mit „Im Glauben fest!“. In diesem Sinne möchte ich mich im Namen unserer Diözese Rottenburg Stuttgart den Gratulanten anschließen: Gratulation zu dem, was ihr erreicht habt, und
Gottes reichen Segen für die Zukunft. Ad multos annos!
Dr. Johannes Kreidler
Weihbischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart
Ehrenmitglied der K.St.V. Alamannia zu Tübingen
Gratulation, K.St.V. Alamannia!
Als die Alamannia gegründet wurde, hatten studentische Zusammenschlüsse große Bedeutung im akademischen und politischen Leben der Stadt und in der Gesellschaft des jungen deutschen Kaiserreiches. Heute, nach wechselvoller Geschichte, haben Verbindungen, Korporationen, Burschenschaften ihre einstige Bedeutung weitgehend eingebüßt. Sie stehen in der Diskussion, gerade in einer meinungsfreudigen Stadt wie Tübingen. Aber mir scheint, dass das Verhältnis der Bürgerschaft, der Universität und auch der Studentenschaft zu den Verbindungen in den letzten Jahren etwas entspannter geworden ist, dass die Diskussionen – ich nenne nur das Maieinsingen – im Großen und Ganzen an Schärfe verloren haben. Ohnehin plädiere ich für den differenzierenden Blick und einen fairen Dialog: Denn bisweilen wird im pauschalen Urteil übersehen, dass akademische Gemeinschaften wie die Ihre heute eine gute Rolle spielen können. In unserer Zeit mit all ihren Umbrüchen und Konflikten – Klimakrise, Corona-Pandemie, ganz aktuell der Krieg in der Ukraine –, scheint es mir lohnenswert zu sehen, wie aus dem Geist akademischer Tradition und christlicher Wertorientierung heraus eine generationenübergreifende, lebenslange Gemeinschaft gepflegt wird, in der man das Gespräch und den fachliche Austausch sucht, wo man neugierig ist auf die Welt und versucht, sie mit den Mitteln der Wissenschaft, über Fakultätsgrenzen hinweg, zu verstehen und zu verbessern.
Für die jungen und nicht mehr ganz so jungen Mitglieder Ihres Bundes – warum, diese Frage sei mir dann doch erlaubt, eigentlich nur Männer? –, ist in diesen Tagen freilich anderes entscheidend: die Freude an gemeinschaftlich verbrachten Studentenjahren auf der Alamannenburg. Dieses gesellige Miteinander wird sicher im Mittelpunkt Ihrer Feierlichkeiten stehen. Ich begrüße daher alle Alamannen und ihre Gäste herzlich in Tübingen. Mögen Sie schöne Stunden verbringen und Ihre Erinnerungen mit denen teilen, die gegenwärtig ihr Studium in Tübingen verbringen und die Traditionen der Alamannia fortsetzen und hoffentlich auch weiterentwickeln.
Ich gratuliere herzlich zum 150. Geburtstag und wünsche ein fröhliches Stiftungsfest!
Boris Palmer
Oberbürgermeister der Universitätsstadt Tübingen
Liebe Kartellbrüder, verehrte Gäste,
mit der Katholischen Studentenverbindung Alamannia feiert einer der ältesten Vereine unseres KV sein 150jähriges Jubiläum, zu dem ich die herzlichsten Glückwünsche des KV-Rats, in besonderer Weise der gesamten Altherrenschaft des KV übermitteln darf.
Die Wurzeln der Alamannia reichen bis in den Januar 1864 zurück; die Wiedergründung des Lesevereins am 31. Januar 1871 bedeutete die Transformation in einen klar strukturierten Studentenverein, der sich den Namen Alamannia gab. Rasch erfolgte der Antrag auf Mitgliedschaft im KV, dessen Annahme am 9. Dezember 1871 offiziell mitgeteilt und im Februar 1872 feierlich vollzogen wurde.
Auch heute – 150 Jahre später - gelten die gleichen Grundprinzipien wie damals: sich dauerhaft für ein Ideal zu begeistern, sich nicht durch vorübergehende Schwierigkeiten entmutigen zu lassen, allen Widrigkeiten und Anfeindungen zum Trotz den eigenen Prinzipien treu zu bleiben, auf der Basis gemeinsamer Prinzipien Kontakte und Freundschaften zu ähnlich gesinnten Studenten zu pflegen und nicht, nur sich selbst zu genügen.
Alamannia verkörpert Grundsätze, mit denen Ihr Euren Wahlspruch „In fide firmitas“ mit Leben erfüllt. Engagiertes Einbringen in Kirche, Staat und Gesellschaft verkörpern herausragende Persönlichkeiten wie Dr. Gebhard Müller, Dr. Kurt-Georg Kiesinger oder Dr. Heiner Geißler. Aufgaben im KV hat sich Alamannia immer wieder gestellt, z.B. fünfmal als Vorort (1890/91, 1909/10, 1933-35, in neuerer Zeit 1956/57 mit VOP Dr. Gebhard Ziller und zuletzt 1984/85 mit VOP Dr. Rupert Felder) oder auch im Vorstand des Altherrenbunds und KV-Rat (Sylvester Held 2007 bzw. 2009 bis 2013).
Der Alamannia wünsche ich darum ein wunderbares gemeinschaftsstärkendes Jubelfest und noch viele weitere Jahre mit dem begeisternden Schwung, der sie seit ihrer Gründung auszeichnet und so schließe ich mit einem herzlichen
„Ad multos felices annos KStV Alamannia et KV“
Dr. Markus Wittenberg (Mk, Li, AR, Smn E Wk)
Vorsitzender des Vorstands des Altherrenbunds des KV,
Mitglied des KV-Rats
Verehrte Damen, sehr geehrte Herren, liebe Farbenbrüder,
Ob 1871, welch wichtiges Jahr für Deutschland, oder doch 1864, vielleicht 1872. Egal, wie man es anschauen will, mein Glückwunsch zu diesem hohen Fest ist deshalb in keiner Weise geteilt. Und diesen Glückwunsch vermittle ich gleichzeitig von allen Bünden im Arbeits Kreis Tübinger Verbindungen.
Alamannia und AKTV sind ja schon seit Anbeginn, seit fast 20 Jahren, miteinander verbunden. Über fast 9 Jahre war Ihr Bundesbruder Dr. Max Gögler der stellvertretende Vorsitzende im AKTV. Er war einer der ersten AHx, der die Notwendigkeit und Tragweite dieses Zusammenschlusses erkannte und seine Mitarbeit sofort einbrachte.
Ich erinnere mich gerne, wenn wir in der Vorstandssitzung darüber beraten wollten, wie man eine bestimmte Persönlichkeit im öffentlichen Leben ansprechen könnte, da kam so oft die trockene Bemerkung von ihm: „Des ist schon erledigt“. Wenige Tage später bekam der Vorsitzende dann die positive Rückmeldung. Das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden bleib auch nach dem Ausscheiden von Dr. Gögler aus dem Vorstand in Alamannen-Hand. Helmut Kiener sprang in die Bresche und führte dieses Amt für 3 Jahre.
IN TREUE FEST – Ihr Wahlspruch ist mehr als ein Motto eines Ordens aus dem 15. Jahrhundert. Es ist eine Einstellung, zu der Sie sich bekennen. Eine Einstellung, die von jedem Einzelnen viel verlangt. Dies gilt auch für den AKTV. Ihr Bund hat sich für die Mitgliedschaft entschieden. Auch wenn es immer wieder Stimmen gibt, dass man doch nicht noch einen zweiten Verband, ein neues – über die KV-Grenzen – reichendes Kartell, oder wie man es immer bezeichnen mag, brauche, so unterstützen Sie den AKTV – in Treue fest.
An dieser Stelle bleibt mir nur, noch einmal den Glückwunsch zu wiederholen und für die Zukunft der Alamannia ein
vivat – crescat – floreat – in aeternum
auszubringen.
Andreas Strecke Landsmannschaft Schottland im CC
Vorsitzender im ArbeitsKreis Tübinger Verbindungen
O alte Burschenherrlichkeit:
„Der Forderer“
Jost Reischmann1
„Der Forderer“, das bedeutete in meiner Aktivenzeit in den 1960/70er Jahren zweierlei:
Zunächst den schwarzen Band, den damals jeder von uns zur Burschung in die Hand gedrückt bekam. Zugegeben, von der „Geschichte Alamannias seit den Anfängen“ war ich damals nicht sonderlich beeindruckt. Ich wusste auch nicht so recht was ich damit anfangen sollte. Also landete „der Forderer“ zunächst irgendwo im Bücherschrank. Erst als ich mich bei Senioren-Reden genötigt sah, ein paar fundierte Sätze über Alamannia, ihre Geschichte und ihr Wesen zu sagen, erinnerte ich mich an diese Quelle – wurde auch immer fündig, und ließ damit meine Worte eindrucksvoll und historisch begründet erscheinen. Viele Jahre lang konnte ich feststellen, dass nachfolgende Senioren offenbar die gleiche Idee hatten; manche Ausführungen kamen mir sehr bekannt vor.
Welchen Schatz „der Forderer“ für Alamannia darstellt, wurde mir erst nach und nach bewusst. Solch ein Werk, hundert Jahre umfassend, sorgfältig auf Quellen gestützt und mit journalistischer Feder geschrieben, fand ich bei keiner anderen Verbindung. Auf diesen Band wird in diesem Beitrag später noch ausführlich eingegangen.
Zur publizistischen Leistung für Alamannia von Bb Josef Forderer gehört aber als zweites auch das Alamannenblatt. Als sich unsere Verbindung 1948 wieder neu zusammenfand, hat Bb Forderer die Herausgabe der Alamannenblätter übernommen. Seit der ersten Nummer 1948 ist er verantwortlicher Schriftleiter bis zur Nummer 21 (1959 - das Alamannenblatt wird in einem gesonderten Beitrag dieser Festschrift beschrieben). „Er hat mit dem von ihm gestalteten Alamannenblatt der Verbindung ein Mitteilungs- und Publikationsorgan gegeben, das für die Verbindung von bleibender Bedeutung sein wird, das seinesgleichen sucht und das weit über unsere Verbindung hinaus Beachtung gefunden hat. Mit seinen vielen aktuellen und geschichtlichen Beiträgen hat er dem Alamannenblatt ein hohes Niveau gegeben. Er hat es verstanden, in ihm immer wieder das Wesen unserer Verbindung, ihrer Bedeutung in ihrer Gesamtheit und in ihren Mitgliedern lebendig und zeitnah darzustellen“ - so wertet unser AHx Haile (Ala.bl. 51, 1974, S. 1). Eine Vielzahl von Berichten ist mit seinem Namen, oder einfach “F.“ unterzeichnet, oder auch gar nicht. Aber es ist klar: Er ist der Mann hinter dem sorgfältigen Dokumentieren von vielem im Leben von Alamannia und Generationen von Bundesbrüdern, was ohne ihn vergessen wäre. Aber mehr noch - was wir heute leicht übersehen: In diesen schwierigen Jahren nach 1948, nach jahrelangem Verbot der Verbindung, nach Krieg, Vertreibung, Kriegsgefangenschaft, Arbeitslosigkeit und weiteren Katastrophen, sah er mit dem Alamannenblatt ein Instrument, die verstreuten Bundesbrüder wieder zur Verbindung zurückzuführen. Zu seinem 70. Geburtstag wurde dies im Alamannenblatt (Nr. 17, Dezember 1957, S. 296) besonders herausgehoben: „Wenn er bei Übernahme seiner Arbeit die Aufgabe gestellt hat, mit diesem periodisch erscheinenden Schrifttum das Philisterium zu sammeln und wieder zu einer festgefügten Einheit zusammenzufassen, so kann man ihm bescheinigen, dass er dieses Ziel voll erreicht hat.“
Fux Josef Forderer 1906
Aber mit „der Forderer“ wurde natürlich auch der Mann bezeichnet, der vielmals bei Veranstaltungen auf dem Haus zu sehen war, immer präsent war. Manchmal konnte er einen auch erschrecken, wenn er plötzlich aus der immer verschlossenen Tür im Damensaal im ersten Stock auftauchte und ein Bier verlangte; er hatte Stunden mit Recherchearbeiten im Archiv verbracht, und niemand wusste, dass er sich dort aufhielt.
Josef Forderer wurde 1888 in Albersweiler, Kreis Biberach, geboren. Nach seinem Studium in Tübingen (mit Eintritt in die Alamannia 1906), München und Berlin widmete er sich dem Zeitungswesen. Mitten in diese seine Anfangsjahre fiel der Erste Weltkrieg, in dem er drei Mal verwundet wurde. Nach dem Krieg beginnt er bei der Osnabrücker Volkszeitung, bevor er dann 1920 Chefredakteur der „Tübinger Chronik“ wird. Noch im gleichen Jahr gründete er mit einigen andern Bundesbrüdern zusammen den Ortszirkel Tübingen. Von den Nazis 1933 wegen seiner demokratisch-republikanischen Einstellung seines Amtes enthoben, muss er sich jahrelang als Hilfsredakteur herumschlagen. 1939 wird er aus dem Offizierskorps wegen „gemeiner, niederträchtiger und gehässiger Bekämpfung der NSDAP“ ausgestoßen und unter Kontrolle der Gestapo gestellt, schließlich wegen des Verdachts verhaftet, ‚im Besitz einer Liste von Naziführern zu sein, die im Falle eines Näherrückens der Front umgelegt werden sollten‘" (Nölle, Ala.Bl. 17, 1957, S. 296).
Am 21. September 1945 erscheint die erste Nachkriegs-Ausgabe der neuen Zeitung „Schwäbisches Tagblatt“. Auf der ersten Seite findet sich - unbelastet von Nazi-Vergangenheit - als Chefredakteur „Dr. Josef Forderer“. Im Leitartikel „Vor neuen Aufgaben“ wird ausgeführt: „Vor uns liegt wahrlich eine schwere, aber auch dankbare Aufgabe. Furchtbar ist das Erbe, das uns die Nazis hinterlassen haben: das Reich aufgelöst, unsere Städte vielfach ein Trümmerhaufen, das weitverzweigte Verkehrswesen lahmgelegt, das Wirtschaftsleben erstickt, - wo man hinsieht: Hilflosigkeit, Not und Sorge.“ Und man kann den Geist Forderers im Kommentar herauslesen: „Darum ist unsere Aufgabe, … Aufklärung in die Massen zu tragen, ihnen immer wieder die furchtbare Jahre des Naziregimes und seine Folgen in Erinnerung zu bringen. Unsere Epoche gehört der Demokratie und ihren Formen.“ Seine Journalisten-Tätigkeit beendete er 1949 bis 1956 als Chefredakteur des Reutlinger General-Anzeigers.
Zu seinem 70. Geburtstag, am 11. März 1958, erreichten ihn Gratulationen von vielen hochgestellten Persönlichkeiten. Alamannia ehrte ihn in einer Feier auf dem Verbindungshaus, zu dessen Ende er die Anwesenden und die „Alamannenfamilie“ anredete: „Ihr seid meine Freunde, mein Stolz. In Nöten, in Ängsten, bei Misshandlungen, in den Gefängnissen, in Mühen, in Todesgefahren, bei Ehre und Schmach, bei übler Nachrede, bei Lob und bei allem, was immer mir in meinem wechselvollen Leben widerfahren ist, - stets habe ich in diesen Kreisen Freunde gehabt.“ (Ala.bl. 18, 1958, S. 316). Wenige Tage danach erhielt er das Verdienstkreuz 1. Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik, das der Bundespräsident ihm „in Anerkennung der um Staat und Volk erworbenen besonderen Verdienste“ verliehen hatte.
Nach dem Ruhestand gab es für Forderer keinen Ruhestand: Vielfältig sind auch seine historischen Arbeiten: Städtemonographien, kunstgeschichtliche Abhandlungen, Urkundenerschließung usw. Und seine vielbeachteten Städtemonographien über Tübingen, Tuttlingen, Reutlingen und Schramberg. Insgesamt hat Bb Forderer über 100 Abhandlungen über geschichtliche, kunstund rechtshistorische Fragen geschrieben.
Und dann kam 1962 das Buch, mit dem er Alamannia ihre Geschichte geschenkt hat (und das im Folgenden zusammengefasst werden soll). Mit Anhang umfasst es über 300 Seiten. Dass Forderer viele der Gründer und Männer der ersten Stunden noch persönlich gekannt hat, trägt zur Lebendigkeit und Präzision seiner Darstellung bei. Und als ein Rezensent nach einigem Lob auch einige kritisch Worte fallen ließ („Ein Außenstehender würde in vielen Fällen etwas mehr Kürze und Prägnanz wünschen, auch der Verzicht auf zahlreiche, kaum haltbare Verallgemeinerungen und ein unzeitgemäßes Pathos an manchen Stellen …“ da konnte man Forderer in seiner kämpferischen Form erleben. Er griff zur spitzen Feder und schrieb einen „offenen Brief“ an den Schriftleiter der Zeitschrift für Württembergische Landeskunde. Etwa siebenmal so lang wie die „böse“ Rezension. Siehe Ala.bl. 33, 1965, S. 551.
Am 19. Oktober 1974 verstarb er, 86jährig, in Tübingen. Zu der Trauerfeier kamen viele Bundesbrüder, unter ihnen befand sich der damalige Präsident des Bundesverfassungsgerichtes Gebhard Müller und Altbundeskanzler Kurt-Georg Kiesinger. Unser AHx Alfred Haile würdigte ihn als herausragenden Bundesbruder: „Die Verbindung hat Bb Forderer viel, sehr viel zu verdanken. Wir haben mit Bb Forderer einen aufrechten, treuen, stets einsatzbereiten, kämpferischen Bundesbruder verloren. Er hat sich um unsere Verbindung in hohem Maße verdient gemacht!“ (Ala.bl.51, 1974, S. 2)
Über viele Alamannenblätter hinweg hat Bb Forderer immer wieder Lobreden über hoch- und höchstrangigen Mitgliedern unsere Verbindung geschrieben - manchem erschien: immer wieder auch zu den gleichen - es hätte auch ein bisschen weniger sein können. Auch die vorliegende Festschrift widmet entsprechend Raum unseren „Großen“. Viel zu wenig in den Alamannenblättern - außer anlässlich runden Geburtstagen - erwähnt wird jedoch Bb Josef Forderer selbst. Dabei kann man ihn sehr wohl zu den „viri probati“ oder den „patres Alamanniae“ zählen, an den man sich bei Alamannia erinnern sollte. Seine unerschrockene politische Haltung, seine vorbildliche Prinzipientreue und sein immerwährender Einsatz für Alamannia rechtfertigen dies.
Alamannia verdankt Bb Forderer eine eigene Sicht auf die „alte Burschenherrlichkeit“. Ob diese „goldene“ Zeit immer so „froh und ungebunden“ war, wie das Lied nahelegt, ist sicherlich ein Stück weit zutreffend, aber doch auch eine romantisch-verklärte Erinnerung. Dennoch: Wir möchten sie nicht missen.
Geschichte der K.St.V. Alamannia
Daniel Couzinet Al!2
1. Einleitung
Gerade heute in einer Zeit voller Umbrüche und Orientierungslosigkeit ist die Rückbesinnung auf die Geschichte wichtig. Die Rückbesinnung auf die Geschichte ist freilich wie die Geschichtswissenschaft überhaupt kein Selbstzweck; vielmehr soll uns die Geschichte befähigen, die richtigen Lehren aus ihr zu ziehen und damit in die Lage versetzen, hier und heute die richtigen und notwendigen Entscheidungen zu treffen, ohne dabei mit bewährten Traditionen zu brechen.
Der Zugang zur Geschichte Alamanniae ist untrennbar mit dem Namen Forderer verknüpf und seiner exzellenten Geschichte Alamanniae:
Josef Forderer: Katholische Studentenverbindung Alamannia Tübingen. Von ihren Anfängen bis zur Gegenwart. Tübingen 1962.
Im folgenden Beitrag sollen die wichtigsten Stationen aus dem Forderer kurz zusammengefasst werden. Keinesfalls erhebt dieser Beitrag den Anspruch, den Forderer ersetzen zu können. Vielmehr soll jeder, der Interesse an der Geschichte Alamanniae hat, ermuntert werden, einen Blick in den Forderer zu werfen, wenn ihm etwas in diesem Beitrag zu knapp erscheint oder er einfach mehr Details wissen möchte.
2. Vorgeschichte (bis 1871)(Forderer S. 1-21)
Erste katholische Verbindungen in Tübingen waren mehrere von katholischen Theologen im Wilhelmsstift gegründete geographisch-landsmannschaftliche Verbindungen, z.B. Danubia, Guelfia u.a., die sich teilweise bis zur nationalsozialistischen Machtergreifung hielten. Zweck dieser Verbindungen war „Unterhaltung und Geselligkeit, Disziplin und Ordnung“.
Mitte des 19. Jahrhunderts nahm das katholische Leben in Deutschland einen neuen Aufschwung, der etwa mit dem Namen des katholischen Publizisten Görres verbunden ist. Dieser Aufschwung erfasste auch studentische Kreise, was 1853 in Berlin zur Gründung des ersten katholischen Lesevereins führte (ab 1881 als „Askania“ und „Burgundia“, Gründungsverein des KV). Hauptzweck dieses Vereins war nach Forderer weniger das „pompöse Auftreten“ als vielmehr die charakterliche Bildung der Mitglieder. 1856 bildete sich auch in Breslau ein katholischer Leseverein. Später traten diese beiden Vereine mit der KDStV Aenania zu München in Verbindung; dieses Korrespondenzverhältnis sieht der CV heute als seinen Ursprung an.
Auch in Tübingen wurde ein katholischer Leseverein nach Berliner Vorbild gegründet, und zwar am 14. Januar 1864. Dieses Datum wurde lange Zeit als das eigentliche Gründungsdatum Alamanniae gesehen (so vor allem in der Anfangszeit der Verbindung), bevor sich der 31. Januar 1871 als Gründungsdatum durchsetzen konnte (s.u.). Treibende Kraft hinter dieser Gründung waren die beiden württembergischen Theologen Camerer und Schott, die auch später in der Verbindungsgeschichte eine herausragende Rolle spielen sollten. Damalige Treffpunkte dieses Lesevereins waren die „Eberhardtei“, nachmals „Hades“ und das „Waldhorn“ in der Neckargasse, wo auch ein Lesezimmer eingerichtet wurde. Zweck dieses Lesevereins sollte sein, für alle katholischen Studierenden einen Vereinigungspunkt zu bilden und „insbesondere das Interesse für katholische Literatur (zu) erhalten und (zu) befördern“ (Forderer, S. 8). Dies geschah durch gemeinsame Vorträge, Kneipen und Versammlungen, aber auch durch soziale Veranstaltungen (so wurde etwa eine Armenkasse unterhalten). Die heute durchgeführten sozialen Veranstaltungen können also auf eine lange Tradition zurückblicken. Wichtig ist festzuhalten, dass dieser Leseverein noch keine Verbindung im heutigen Sinne darstellte und wohl auch nicht darstellen wollte; insbesondere besaß er nicht die straffe Organisation einer Verbindung. Doch ist ebenso festzuhalten, dass der Gründer des Lesevereins, Alfred Camerer, bereits damals über einen bloßen Leseverein hinausdachte und die Gründung einer Korporation im Auge hatte. Dass diese Unterscheidung zwischen Verbindung und Leseverein damals durchaus von Relevanz war, zeigt deutlich die Generalversammlung der katholischen Vereine 1865 zu Trier, auf der sich die farbentragenden Verbindungen (später CV) von den nichtfarbentragenden Vereinen bzw. den damaligen Lesevereinen (später KV) trennten.
Zusammenfassung der wichtigsten Daten von Kapitel 1.2.:
1803
Reichsdeputationshauptschluss (Beginn der Säkularisation)
1817
Verlegung der kath.-theol. Fakultät von Ellwangen nach Tübingen
1853
Gründung des ersten katholischen Lesevereins in Berlin
1864
Gründung des katholischen Lesevereins in Tübingen
1865
Generalversammlung der katholischen Vereine zu Trier
3. Gründungszeit bis zur Statutenrevision 1880 (1871-1880)(Forderer S. 23-56)
Einen wichtigen Punkt in der Verbindungsgeschichte Alamanniae stellt das Jahr 1871 dar. In diesem Jahr, genauer am 31. Januar 1871, erfolgte durch eine Änderung der Statuten des Lesevereins die Reorganisation desselbigen zum Studentenverein. Vorausgegangen war ein jahrelanger schwelender Konflikt mit Guestfalia, die den Anspruch erhoben hatten, die einzige katholische Verbindung in Tübingen zu sein und diese Stellung auch beibehalten wollten, so dass sie letztlich gegen die von Camerer geplante Statutenrevision waren und mit aller Kraft verhindern wollten, dass es zur Entstehung einer zweiten katholischen Verbindung komme. In der entscheidenden Sitzung am 31. Januar 1871 konnten sie sich jedoch nicht durchsetzen, worauf die Statutenänderung mit Zweidrittelmehrheit beschlossen wurde. Die Folge war, dass die Guestfalen geschlossen aus dem Leseverein austraten und sich so auch in Tübingen die Trennung zwischen farbentragenden und nichtfarbentragenden Verbänden, d.h. zwischen KV und CV verwirklichte. In dieser Statutenänderung wird heute zurecht die eigentliche Gründung Alamanniae, die freilich zu dieser Zeit diesen Namen noch nicht trug, gesehen. Gründungsort war „Prinz Karl“, die jetzige Mensa in der Altstadt.
Der Charakter dieses neugegründeten Studentenvereins kann mit folgenden Stichworten umschrieben werden:
Mit Schreiben vom 7. Februar 1872 wurde der Verein als 9. Kartellverein in den KV aufgenommen. Damit war gleichzeitig das Überleben Alamanniae gesichert, da der KV Studenten von anderen KV-Vereinen, insbesondere aus München, nach Tübingen schickte. Zu nennen ist hier etwa der aus München gekommene Hermann Mayerhausen. Ferner wurde 1872 der Fuxenstatus in den Statuten verankert.
Am 27. Mai 1873 legte sich der Verein den Namen „Alamannia“ zu. Dieser Name geht zurück auf die missglückte Gründung eines katholischen Studentenvereins in Leipzig und ist eng mit dem Namen Würminghausen verknüpft. Im Wintersemester 1872/73 spielte sich in Leipzig kurz zusammengefasst folgendes ab: Einem Appell des Vororts, auch in Leipzig einen katholischen Kartellverein zu errichten, folgend, fand sich eine Anzahl Kartellbrüder zusammen, die einen katholischen Kartellverein namens „Alamannia“ gründen wollten. Diese Gründung wurde jedoch aus fadenscheinigen Gründen, bei denen u.a. das Katholizitätsprinzip eine wichtige Rolle spielte, untersagt - man bedenke, man befand sich auch in Sachsen auf der Höhe des Kulturkampfes. Nach der formellen (endgültigen) Auflösung dieses Vereins verließen viele seiner Mitglieder Leipzig, so auch besagter Karl Würminghausen, der sich anschließend auf Camerers Werbung nach Tübingen begab und so den Namen „Alamannia“ und den ins Lateinische übersetzten Wahlspruch „In Treue fest“ („in fide firmitas“) nach Tübingen brachte, wo der Name „Alamannia“ einhellig Annahme fand und auch bald vom Universitätsgamt genehmigt wurde.
Im Sommersemester 1874 war auch das Problem der geringen Mitgliederzahl überwunden, da auf Werbung und Unterstützung des Verbandes aus fast allen größeren Kartellvereinen aus Nord und Süd Kartellbrüder zur personellen Unterstützung Alamanniae herbeieilten.
Zusammenfassung der wichtigsten Daten von Kapitel 1.3.:
1871
Reorganisation des Lesevereins zum katholischen Studentenverein
1872
Aufnahme als 9. Kartellverein in den KV
1873
Namensgebung durch Würminghausen
4. Statutenrevision bis Hausbau 1904 (1880-1904)(Forderer S. 57-92)
Eine weitere wichtige Etappe stellt die Statutenrevision und Reorganisation der Verbindung von 1880 dar, die zu einer strafferen Organisation und Ausrichtung am Typ der Korporation führte. Waren bis dato noch die Verwurzelung und die Herkunft aus dem katholischen Leseverein spürbar, so kann m.E. erst seit dieser Reorganisation von einer richtigen „Verbindung“ im heutigen Sinn gesprochen werden; Alamannia erhielt damals ihr im Wesentlichen heute noch gültiges Gesicht. Die Verbindung erhielt damals u.a. folgende Ordnung: Die Verbindung bestand aus ordentlichen Mitgliedern, zu denen Füchse und Burschen gehörten, dann aus Außerordentlichen, ferner aus Auswärtigen und endlich aus Philistern, wobei es erst zu einem späteren Zeitpunkt auch zu einer Organisation des Philisteriums kam (am 2. Februar 1892 Gründung des ersten Philistervereins für Württemberg in Stuttgart).
Diese Reorganisation (und weitere in der Folgezeit) wird in der Verbindungsgeschichte nicht nur positiv gesehen. So sieht etwa Forderer darin auch eine zunehmende Verflachung des Verbindungslebens. So schreibt er etwa (S. 64 f.): „Wesen und Wert einer Verbindung wurde mehr und mehr in äußerlicher Schneidigkeit, in einem möglichst flotten, pompösen Auftreten gesucht, eine Erscheinung, die auch auf die nichtfarbentragenden Verbände abfärbte“. Merkmal dieser Zeit sind etwa die damals eingeführten Spuzfahrten zu Pferde mit Landauern und Zweispänner anlässlich des über mehrere Tage hinweg gefeierten Stiftungsfestes, das nun endgültig in das Sommersemester verlegt worden war und das Patronatsfest ersetzte.
Damalige Treffpunkte waren der „Ochsen“, die „Schottei“ und „Marquardtei“ (letztere seit dem WS 1891/92).
Zu erwähnen ist aus dieser Zeit noch die Geschichte um den Vereinspudel Philo („ein ganz intelligentes Vieh mit klugen, schwarzen Augen und glänzend weißem Fell“ (Forderer, S. 69 f.)), den das Schicksal ereilte, eines Tages besoffen vom Zug überrollt zu werden.
Weiters zu erwähnen ist der in der Verbindung geführte Streit um das Gründungsdatum Alamanniae. Während einige dieses im 14. Januar 1864 (Gründung des katholischen Lesevereins) sahen, nahm insbesondere Mayerhausen das Jahr 1872 für sich in Anspruch, da er in diesem Jahr zu Alamannia gestoßen war. Erst sehr viel später nach der Einsetzung einer historischen Kommission durch den Philistervorstand 1962, die die Frage des wahren Gründungsdatums Alamanniae zu untersuchen hatte, hat sich als Gründungsdatum der 31. Januar 1871 endgültig durchgesetzt. In den Jahren 1890/91 hatte Alamannia erstmalig die Ehre, den KV als Vorort zu vertreten.
An weiteren wichtigen Daten aus dieser Zeit sind zu nennen: Gründung des Hausbauvereins (1901) und Gründung der Tochterverbindung Rheno-Nicaria (1903).
Zusammenfassung der wichtigsten Daten von Kapitel 1.4.:
1880
Statutenrevision (Ausrichtung am Typ der Korporation)
1890/91
Alamannia Vorort
1891/92
Zimmer in der Marquardtei
1892
Gründung des ersten Philistervereins für Württemberg in Stuttgart
1901
Gründung des Hausbauvereins
1903
Gründung der Tochterverbindung Rheno-Nicaria
5. Hausbau 1904 bis zur Machtergreifung Hitlers (1904-1933)(Forderer S. 92-153)
Einen weiteren wichtigen Markstein in der Verbindungsgeschichte stellt der Bau des Verbindungshauses 1904 in der Biesingerstraße dar. Diesem gingen umfangreiche Vorbereitungen voraus. So musste zunächst ein Grundstück erworben, das Geld für den Bau zusammengebracht und ein Baumeister für das Haus gefunden werden. Treibende Kraft hinter dem Hausbau waren Oberlandesgerichtsrat Schanz und Justizrat Jehle, denen es schließlich gelang, für 10.170 Mark einen Bauplatz in der Biesingerstraße zu erwerben. Zur Aufbringung des Geldes für den Bau diente in erster Linie der bereits erwähnte, 1901 gegründete Hausbauverein. Als Architekt konnte der Stuttgarter Bauinspektor Joseph Bayer gewonnen werden. Die Bauarbeiten am Haus, das im damals verbreiteten und dem Lebensgefühl der Studenten entsprechenden Stil der Neoromantik erbaut wurde, wurden im Frühjahr 1904 vollendet, so dass das Haus zu Beginn des Sommersemesters 1904 eingeweiht werden konnte. Der Bau des Alamannenhauses, dessen Gesamtkosten sich auf ca. 74.000 Mark beliefen, ist in Zusammenhang mit den Bauaktionen vieler anderer Verbindungen zu sehen. Im Jahre 1900 hatten bereits 15 Verbindungen Häuser gebaut, andere sollten noch folgen. Dass die meisten Verbindungshäuser gerade auf dem Schloß- und Österberg entstanden, hat seinen Grund nicht von ungefähr, sondern war vielmehr Ausdruck des damaligen studentischen Lebensgefühls: man wollte sich bewusst absondern und abheben vom „gemeinen Volk“, das da „drunten im Tale“ wohnen musste.
Ein kurzes und eher düsteres Zwischenspiel in der Entwicklung Alamanniae brachte der studentische akademische Kulturkampf 1904/05. Dieser ging von Jena aus, wo sich die dortigen katholischen Verbindungen den Angriffen schlagender Verbindungen, insbesondere der Burschenschaften ausgesetzt sahen. Der studentische Kulturkampf war gekennzeichnet durch das Bestreben der schlagenden Verbindungen, den Einfluss der katholischen Verbindungen in der Öffentlichkeit und in der Universität zurückzudrängen. In Tübingen ging der studentische Kulturkampf vom SC aus. So wurde etwa der Antrag gestellt, den drei damaligen katholischen Verbindungen Tübingens, Alamannia, Guestfalia und Cheruskia weder das Recht des Vorsitzes, noch Sitz und Stimme in der Studentenschaft (der damaligen Studentenvertretung) zu gewähren, weil sie einen „notorisch politischen, ultramontanen (= „jenseits der Alpen“; gemeint ist damit ein an Rom und dem Papst orientierter) Charakter“ hätten.
Diese Bewegung gegen die katholischen Verbindungen verlief schließlich jedoch im Sande und endete wie an allen anderen Orten, mit einem Sieg der katholischen Verbindungen: es zeigte sich somit, dass die katholischen Verbände mittlerweile zu groß und zu einflussreich geworden waren, um ihnen einfach die Lebensberechtigung aberkennen zu können.
Alamannia im modernen (1922) Stil
Einen Einschnitt in der Entwicklung Alamanniae brachte der Erste Weltkrieg. Hier hatte Alamannia über 40 Gefallene zu verzeichnen. Die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg war geprägt von der steigenden Inflation und den immer teurer werdenden Preisen. In dieser Situation sprang das Philisterium in die Bresche und sponserte ein gemeinsames Mittagessen auf dem Haus (auch das gemeinsame Abendessen hat also eine lange Tradition). Ab September 1926 gab Alamannia eine eigene Mitgliederzeitschrift heraus, die Alamannenblätter (1934 eingestellt). Am 18. Dezember 1927 wurde die Tochterverbindung K.St.V. Rechberg zu Tübingen gegründet.
Insgesamt war die Zeit der Weimarer Republik eine Blütezeit sowohl für Alamannia als auch für den gesamten KV.
Zusammenfassung der wichtigsten Daten von Kapitel 1.5.:
1904
Bau des Verbindungshauses - neues Wappen
1904/05
Studentischer Kulturkampf
1906
Alamannia nennt sich "Verbindung"
1910/11
Alamannia Vorort
1926
Herausgabe der Alamannenblätter
1927
Gründung der KStV Rechberg
Exkurs: Wappen Alamanniae:
Zeitlich eng verknüpft mit dem Bau des Hauses war die Wappenfrage. Das Aufkommen der Wappen im KV hängt eng zusammen mit dem Bekenntnis der Vereine zum Korporationsprinzip.
Das alte Wappen stand für die drei Prinzipien religio, scientia, amicitia (Kreuz als Glaubenssymbol, Anker als Symbol der Festigkeit im Glauben [beachte Wahlspruch: in fide firmitas, sowie der weiteren Übersetzungsmöglichkeit „im Glauben fest“], Schriftrolle und Eule als Symbol für Wissenschaft [Eule klassisches Weisheitssymbol seit der griechischen Antike, in der Athene mit einer Eule dargestellt wird], sich reichende „treue Hände“ für die Freundschaft).
Wappen (1877-1904; seit 2000)
Wappen 1904-2000
Das neue Wappen war ein Werk des Historikers Prof. Dr. Günter, dessen Gedanken sich vor allem im Bild des Altars niederschlugen, da er den schwäbischen Stammesverband „Alamannia“ nach der früheren, aber unmöglichen, mittlerweile widerlegten und abstrusen Deutung als „Altarmänner“ auffasste. Darüber hinaus sollte der Reichsadler die Treue zum Reich ausdrücken und das Stadtwappen Tübingen die Treue zu dieser Stadt. Seit dem SS 2000 verwendet Alamannia wieder das ursprüngliche Wappen.
6. Machtergreifung Hitlers bis zur Wiederbegründung 1933-1948(Forderer S. 154-217)
Einen tiefen Einschnitt in das Verbindungsleben sowohl Alamanniae als auch des gesamtem KV brachte das Dritte Reich. Als ideologischer Ausgangspunkt, der alle weiteren Entwicklungen unter dem Dritten Reich verständlich macht, muss der Totalitätsanspruch des Nationalsozialismus gesehen werden, der durch das Bestreben gekennzeichnet war, alle staatlichen und auch gesellschaftlichen Bereiche zu durchdringen und mit seiner Organisation zu erfassen. So lag es letztlich in der Konsequenz der nationalsozialistischen Ideologie, allen nicht-nationalsozialistischen Organisationen und Verbänden (und damit auch den katholischen Verbindungen) die Lebensberechtigung abzusprechen, und so versuchten die nationalsozialistischen Machthaber auch in der Tat, alle nicht-nationalsozialistische Organisationen und Verbände in nationalsozialistische Organisationen zu überführen. Ein besonderer Dorn im Auge waren den NS-Machthabern die konfessionellen, insbesondere die katholischen Verbände, da sich der christliche Glaube nicht mit der neuen, maßgeblich von Rosenberg geprägten arischen Weltanschauung vertrug und von den neuen Machthabern als Fremdkörper im Staate empfunden wurde. Anfangs versuchte Hitler freilich, diesen antichristlichen Zug seiner Herrschaft zu verdecken, um die Kirchen für die Mitarbeit an seiner Bewegung zu gewinnen. Einen großen Prestigegewinn unter den deutschen Katholiken brachte Hitler dabei vor allem das am 8. Juli 1933 mit Papst Pius X abgeschlossene Reichskonkordat, mit dem die katholische Kirche den Sieg Hitlers anerkannte und billigte.
Was soeben für die konfessionellen Verbände und Organisationen im Allgemeinen gesagt wurde, galt natürlich auch für die katholischen Verbindungen. Von Anfang an war ihr Untergang beschlossene Sache. Aufgrund ihrer gesellschaftlichen und sozialen Mächtigkeit und nicht zuletzt wegen der anfangs (scheinbar) so kirchenfreundlichen Politik Hitlers vollzog sich ihr Untergang allerdings nicht mit einem Male, sondern in mehreren Etappen, über die im Folgenden ein kurzer Überblick verschafft werden soll. Dabei soll auch die Entwicklung im KV betrachtet werden, da in dieser historischen Phase das Schicksal Alamanniae eng mit dem des KV verbunden war.
Die Herrschaft der Nationalsozialisten begann mit umfassenden Gleichschaltungsaktionen; diese umfassten zunächst nur den politisch-staatlichen Bereich, ergriffen bald aber auch den gesellschaftlichen Bereich und erreichten auch den KV: am 22. Juli 1933 wurde im KV das Führerprinzip eingeführt, zu einer Zeit, als Alamannia den Vorort unter dem damaligen VOP und späteren Philistersenior Konstantin Hank innehatte. Weiteres Ziel des NS-Regimes war es, den Verbändepartikularismus zu beseitigen; dazu diente etwa die Vereinigung von KV und Ring Katholischer Deutscher Burschenschaften (R.K.D.B.) zur „Katholischen Burschenschaft“ (KB). Des Weiteren wurde im KV das Konfessionsprinzip abgeschafft.
Der Nationalsozialismus hatte ein bestimmtes Idealbild eines Studenten. Forderer beschreibt dieses wie folgt: „Zu seinen Erziehungsgebieten gehörten Arbeitsdienst, SA-Dienst, politische Schulung und Wissenschaftsdienst. Der Arbeitsdienst war nunmehr als pflichtgemäßes Diensthalbjahr für jeden Studenten, der die Hochschule besuchen wollte, angesetzt. Die politische Erziehung wurde den Verbänden und Korporationen übertragen, gleichzeitig aber faktisch wieder entzogen und ... dem Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbund (NSDStB) […] übertragen“.
Am 20. November 1935 kam es dann schließlich unter dem Nachfolger von Konstantin Hank, Dr. Spahn zur Selbstauflösung des KV. Zur Begründung führte Dr. Spahn an, dass sich der KV durch seine Auflösung „zu seinem Teil dazu (bekenne), dass im deutschen Studententum neue Formen am Werden (seien) und dieses Werden durch keine alten Bindungen gehemmt und gestört werden (solle)“ (Forderer, S. 192). Von der Auflösung des KV waren mitbetroffen alle Organe des Verbandes, nicht dagegen die einzelnen Korporationen und die Philister-vereine. In der Folge schlossen sich viele Korporationen des KV dem Vorgehen des KV an und lösten sich auf.
Das gleiche Schicksal ereilte, wenn auch mit zeitlicher Verzögerung, Alamannia: Im Februar 1936 fasste die Aktivitas Alamanniae den Beschluss, sich selbst aufzulösen. Gleichzeitig wurde aber auf einer Tagung am 22. März 1936 einstimmig beschlossen, den Hausverein Alter Tübinger Alamannen zunächst fortzuführen, der zugleich Träger des gesamten Vermögens Alamanniae wurde.
Im Rückblick kann festgestellt werden, dass es mehrere Ursachen waren, die im Februar 1936 zur Selbstauflösung geführt haben. Hauptursache war sicherlich die Sorge der jungen Akademiker um ihre Zukunft, die es zu jener Zeit nicht förderlich erscheinen ließ, Mitglied einer katholischen Korporation zu sein. Zudem gab es innerhalb der Aktivitas eine starke Strömung, die eine „vorbehaltlose Haltung zum Nationalsozialismus“ verlangten (vgl. Forderer, S. 197) und daher auf Selbstauflösung drängten. Ein weiterer Grund für die Auflösung war die starke Konkurrenz durch den NSDStB, die es Alamannia fast unmöglich machte, noch neue Mitglieder zu bekommen.





























