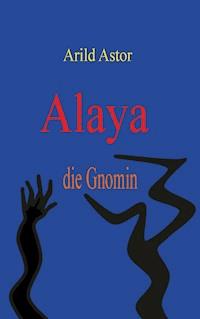
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Alaya glaubt, dass sie, wie auch alle anderen Gnomen ihres Dorfes, weiterhin ein gewöhnliches Leben an der Seite ihrer Mutter, der Dorfschamanin, genießen kann. Doch eines Tages erscheint eine böse Macht, die anscheinend nicht nur das Dorf bedroht. Alayas Kampf um das Leben beginnt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 702
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Meinen Eltern gewidmet und Klemens, der mich damals auf die Gnomin gebracht hat
Inhaltsverzeichnis
Ein Dorf in Angst
Die schwarze Wolke
Lange Zweibeiner
Sklaven
Unterricht
Das neue Leben
Die kleine Fee
Wiederkehr der schwarzen Wolke
Kalas Hunger
Auf der Flucht
Verlorene Heimat
Die schwarze Pforte
Der Sarkophag
Ein Dorf in Angst
Alaya schaute an diesem Morgen mit einer leichten Sorge, ob sich am Himmel etwas Schwarzes zeigen würde. Man wußte immer noch nicht, was bei den anderen Dörfern eigentlich geschehen war.
Einige Gnomen hatten nur in tiefer Nacht eine Schwärze am Horizont gesehen, die wirkte, als wenn sie alles, sogar den Himmel, verschluckt hätte.
Doch über der den Wipfeln des Waldes war nur strahlendes Blau und einige weiße Wolken zu sehen. Der Frühlingstag würde sicher sonnig und warm werden. Diese Aussicht verscheuchte die Furcht.
Während sie ihr Gesicht im Trog mit frischem Regenwasser wusch, spülte die kühle Feuchtigkeit die letzte Müdigkeit weg.
Wollmar saß neben ihr mit ausgestreckten Vorderbeinen und blickte ruhig in die Ferne. Auch wenn er äußerlich noch träge wirke, konnte sie einen kurzen Gedankenblitz von ihm erhaschen, der ihr zeigte, daß er bereits völlig wach war. Seine Wolfsgedanken waren viel einfacher als die der Gnomen, aber dafür für sie schwerer zu lesen, da er ein Tier war.
Ihre Mutter kam gerade von der Gasse in ihren Garten. Sie war – wie immer – schon seit der Dämmerung auf den Beinen.
„Guten Morgen, mein Kind!“ Alaya erwiderte den Gruß und Mutter und Tochter tauschten ihren kurzen, aber zärtlichen Morgenkuß aus.
„Morgen, Wollmar!“, sagte Donata auch zum Kletterwolf, der freudig mit dem Schwanz wedelnd die Mutter seiner jungen Herrin begrüßte.
„Hast du durch die Barriere erfahren, was da bei den anderen Dörfern passiert ist?“, fragte Alaya.
„Nein. Das war zu weit weg. Die Geister wissen anscheinend noch wenig darüber.“
Nach einer Pause fügte die Mutter hinzu: „Doch es scheint tatsächlich etwas Unangenehmes zu sein… Laß uns jetzt essen.“
Alaya wußte, daß es keinen Sinn machte, die Mutter weiter danach zu fragen. Während sie ins Haus gingen, war sie im Zweifel, ob sie jemals diese Ruhe und Geduld haben würde, wenn sie einmal die Schamanin des Dorfes wäre. Vor allen Dingen machte ihr Sorgen, ob sie je die Barriere würde richtig verstehen können: Jeder Dorfschamane mußte jeden Tag mit dem verflochtenen Netz der Geister von gestorbenen Gnomen, Tieren, Pflanzen und Elementen Zwiesprache halten. Sie spürte zwar immer deutlich etwas, aber die riesige Fülle an Eindrücken, die ihr im Kopf schwebten, konnte sie nie zu etwas Einheitlichem und Klarem verbinden.
Als sie sich an den Eßtisch im großen Raum des Erdgeschosses setzten, vergaß sie jedoch die trüben Gedanken, da sie still der Natur dankten, die sie auch an diesem Tag mit Essen versorgte.
Als Frühstück gab es heute Ziegenmilch und einen Muß von Sandelnüssen. Wollmar bekam die Haxe eines Streifenrehs. Er hatte es nicht selbst jagen müssen, da es ein Nachbar am Tag vorher erlegt und ihnen einen Teil geschenkt hatte.
Nach dem Essen sagte die Mutter: „Du solltest heute dein Zimmer kehren und wischen. Es ist schon ziemlich schmutzig. – Ich mache so lange hier unten ein bißchen sauber.“
Alaya wäre es oft lieber gewesen, wenn sie sich ihren Tagesablauf selbst eingeteilt hätte. Doch die Mutter hatte sie von klein auf zum Gehorchen erzogen. So ging sie ohne ein Wort die Treppe zu ihrem Zimmer hoch. Wollmar blieb noch unten und aß an seinem Rehbein.
Während sie den Boden wischte, schaute sie immer wieder durch das Fenster und betrachtete die Baumkronen. Sie konnte es kaum erwarten, bald mit anderen Kindern im Wald zu spielen.
Einige Augenblicke später kam ihr Wolf mit einem Knochen des Rehs, um bei ihr daran weiter zu nagen. Während sie mit dem feuchten Lappen am Besenstiel den Boden weiterwischte, schaute sie ihn an und dachte, daß er für sie wie ein Bruder war. Doch obwohl sie ihn sehr liebte, wünschte sie sich manchmal, daß sie noch einen echten Bruder oder Schwester hätte, wie fast alle Kinder des Dorfes. Und dann kamen ihr immer die Gedanken an ihren Vater, an den sie sich kaum erinnern konnte, weil er so früh gestorben war.
„Wenn du ein Gnom wärest, könntest du mir jetzt helfen“, sagte sie zu Wollmar, der sie nur kurz anblickte, während er genüßlich weiterkaute.
Im nächsten Moment hielt sie mit dem Wischen inne und zauberte das unechte Bild einer Blume in die Luft. Ihr Wolf ließ sich davon nicht beeindrucken, zu oft hatte er ihre Illusionen schon gesehen.
Es gelang ihr leicht, Objekte zu entwerfen, die unbeweglich waren, auch wenn sie sehr unwirklich aussahen. Doch Gnomen oder Tiere konnte sie gar nicht darstellen. Weil sie nicht die nötige Beherrschung der magischen Strahlen und des Lichts hatte, gelang es ihr nicht, ein annähernd ähnliches Abbild eines sich bewegenden Lebewesens zu machen.
Doch sie ließ jetzt von diesen Spielereien ab, da die Mutter sehr unzufrieden war, wenn sie sich nicht auf eine Arbeit ganz konzentrierte.
Nach einer Weile schien ihr das Zimmer sauber genug zu sein, und sie ging mit Wollmar hinunter. Doch ihre Hoffnung, jetzt rausgehen zu können, erfüllte sich nicht.
„Wie ich sehe, bist du fertig. Du kannst jetzt die Paste vom Stechwurz zubereiten“, sagte die Mutter ruhig.
Auch wenn sie im ersten Moment nicht begeistert war, versenkte sich Alaya schnell in die Arbeit. Während sie die Blätter der Pflanze zerkleinerte, dachte sie an deren Nutzen: Sie stillte bei Wunden die Blutungen und beschleunigte die Heilung. Immer wenn sie an das durch die Mutter Gelernte dachte, kam es ihr vor, als würde sie die jeweilige nützliche Substanz der Pflanze instinktiv spüren. Solange die Mutter nichts sagte, wußte sie, daß sie alles richtig tat.
Und auch wenn die sie nur selten lobte, war sie sich sicher, daß sie dennoch zumeist zufrieden mit dem Können ihrer Tochter war.
Doch in ihre Gedanken konnte Alaya nie eindringen. Im Gegensatz dazu hatte sie es schon erlebt, daß ihre Mutter vom Erdgeschoß aus wußte, was die Tochter in ihrem Zimmer tat… Auch heute konnten sie nicht lange ungestört sein, denn bald kam Danila, die Schneiderin herein.
Alaya bemerkte sofort die Weste, die sie um den Unterarm gefaltet hatte: Auf braunem Grund wand sich ein gelbrotes Muster von Girlanden.
„Guten Morgen, ihr beiden. Ich hoffe, daß ich euch nicht störe.“
„Du störst nie, Danila“, sagte Alayas Mutter mit ihrer ruhigen Stimme und hörte mit dem Kehren auf. „Setz dich. Wie geht es dir?“
„Ich will mich nicht groß beschweren. Doch meinen Bantz plagt immer noch der Rücken.“
„Er sitzt zu viel. Er müßte sich mehr bewegen, dann kommen die Knochen auch wieder in Schwung.“
„Das kann ich ihm nur schwer beibringen. Mit den Jahren wird man halt behäbiger. Und wenn er mal nicht arbeitet, sitzt er am liebsten vor dem Haus und plaudert mit den Nachbarn.
Doch ich bin deswegen gekommen: Ich habe hier eine Weste für die kälteren Tage gestrickt, aber sie ist fast für eine Riesin geraten, also müßte sie dir passen, Alaya.“
Alaya gefielen die Sachen der Schneiderin immer. Sie sagte: „Danke, Danila. Die ist sehr schön. Da werden mich die anderen Mädchen beneiden, wie schon so oft. Warum strickst du ihnen nie etwas umsonst?“
„Du weißt, daß ich das tun würde, aber ich habe nun mal nur zwei Hände. Und außerdem seid ihr zwei etwas Besonderes, weil ihr euch um unsere Gesundheit kümmert.“
„Jeder ist was Besonderes“, warf Alayas Mutter ein. „Wenn du nicht wärest, müßten die meisten von uns ihre Kleidung irgendwie selbst machen und kämen nicht zu dem, was sie besser können.“
„Auch mit Worten bist du immer heilkräftig, Donata“, lächelte die Schneiderin.
Nach einer kurzen Pause fuhr sie fort: „Donata, weißt du inzwischen, was das für schwarze Wolken in der Nacht waren, bei den anderen Dörfern?“
„Ich weiß es nicht. Wir müssen abwarten, was Lamin herausfinden wird, wenn er dort gewesen ist. Vorher sollten wir uns nicht zu große Sorgen machen. Vielleicht war alles nur harmlos. Und wir sollten nicht so oft daran denken, solange wir nicht wissen, um was es sich handelt. Das macht auf die Dauer auch nur trübsinnig und irgendwann sogar krank. Machen wir alle unsere Tagesgeschäfte.
Das ist immer noch die beste Medizin gegen Trübsinn.“
„Ich will es versuchen“, entgegnete Danila. Ihr verschrumpeltes, aber angenehmes Gesicht lächelte wieder: „Nun will ich euch aber nicht mehr stören. Macht’s gut ihr beiden.“
Nachdem sie sich von ihr verabschiedet hatten, wollte Alaya in ihr Zimmer gehen, um sich vor dem Spiegel mit der neuen Wese zu begutachten.
„Das hat bis später Zeit. Du bist noch nicht mit der Arbeit fertig“, sagte die Mutter ruhig, aber bestimmt. Widerwillig mußte die Tochter sich der Weisung fügen.
Sie versenkte sich aber bald wieder in das Zubereiten der Paste und versuchte die Heilkraft zu spüren. Ihre Mutter hatte sie von Anfang an gelehrt, daß es viel vom Denken abhing, ob die Krankheiten überwunden werden konnten.
Als Alaya schließlich fertig wurde und hörte, daß sie genug gearbeitet hätte, beschloß sie das Ausprobieren der Weste zu verschieben und gleich rauszugehen.
Sie und Wollmar begegneten auch schon kurz, nachdem sie das Haus verlassen hatten, dem kleinen, stämmigen Joldan und der blondgelockten Debra. Wie fast immer, wenn sich Kinder des Dorfes trafen, beschlossen sie, in den Wald zu gehen.
Alaya spürte, wie sie von den Bäumen und Pflanzen, die das Dorf umgaben, mit Wohlwollen geduldet wurden. Ihr Dorf war ein Teil des Waldes.
Joldan versuchte einen der hohen und dünnen Sanftbäume zu erklettern, kam jedoch nur bis zu den unteren, breiten Ästen.
„Komm herunter“, rief ihm Debra zu. „Du fällst noch und tust dir etwas.“
„Gar nicht. Ich will ja sowieso Schreiner werden, wie mein Vater.
Deshalb brauche ich Erfahrung mit den Bäumen. Außerdem flickt mich Alaya wieder zusammen, wenn mir etwas passiert.“
„Von wegen. Als Strafe für deinen Leichtsinn werde ich dir die Hände verkehrt anbinden, so daß du sie gar nicht mehr richtig benutzen kannst.“
„Dann nimm das!“ Er brach einen kleinen Zweig ab und warf ihn nach Alaya. Auch wenn sein Wurf Schwung hatte und genau war, wich sie ihm aus. Debra hob zur gleichen Zeit einen anderen kleinen Zweig auf und schleuderte ihn dem kleinen Gnom an den Kopf.
„Das wirst du büßen!“, rief er und kletterte geschickt vom Baum herunter. „Mal sehen, ob du wenigstens etwas schöner aussiehst, wenn du mit Erde beschmierst bist.“
Er lief der schreienden Debra hinterher, doch noch bevor er sie erreichen konnte, stoppte er plötzlich vor dem Balken, der aus dem Nichts im Wald erschien. Sofort drehte er sich zu Alaya um, denn er wußte, wer die Verursacherin dieser Illusion war: „Du schienst zu ihr zu halten. – Dann bekommst du selbst was ab!“ Er griff eine Handvoll der feuchten Erde des Waldbodens und lief zu Alaya hin. Sie hatte keine Lust sich beschmieren zu lassen, doch er war mit seinen zwar kurzen, aber kräftigen Beinen schneller als sie.
„Ich warne dich, Joldan, du Schuft!“, schrie sie. Doch er war schon bei ihr und sie fühlte den frischen und rauhen Geruch des Waldbodens im Gesicht.
„Du kleiner Wicht!“ Sie selbst nahm einen Erdklumpen und schleuderte ihn auf den Freund. Geschickt wich er aus, wurde aber von Debras Kugel am Hinterkopf getroffen, und die Schlacht zwischen ihm und den beiden Mädchen ging weiter. Wollmar hopste währenddessen nur knurrend und aufgeregt hin und her. Er genoß die Aufregung, obwohl er nicht in den spielerischen Kampf eingebunden war.
Nach einiger Zeit stellten sie fest, daß ihre Gesichter dunkelbraun waren, und alle drei brachen in Gelächter aus.
„Wir müssen uns wenigstens die Gesichter abwaschen, bevor wir wieder nach Hause gehen können“, meinte Debra.
In einem Wettlauf rannten sie zu dem nahen Bach. Auch wenn er der Kleinste war, blieb Joldan auch hier durch seine Kraft der Schnellste. Bevor er anfing, sich das Gesicht auszuspülen, bespritzte er die Mädchen.
„Du wirst nie erwachsen werden, Joldan“, sagte Debra mit ernster Miene. „Wenn du so weitermachst, wirst du später kein Mädchen finden.“
„Etwas Besseres als dich allemal. Selbst wenn du die einzige wärest, kämest du für mich nicht in Frage.“
„Ich käme auch nicht im Traum auf die Idee, so etwas wie dich zum Mann zu nehmen.“
Da bespritzten ihn beide Mädchen mit Wasser, worauf er rief:
„Hört auf. Ich ergebe mich. Wenn ihr mich von zwei Seiten angreift, ist das ungerecht.“
„Hab dich nicht so, du Schwächling. Doch weil du nachgegeben hast, will ich dir das Gesicht waschen“, sagte Debra.
Sie fingen dann an, sich gegenseitig so gut es ging die Erdreste aus den Gesichtern zu entfernen.
Plötzlich streckte Wollmar die Ohren, und nach kurzer Zeit erblickten sie den Dorfboten Lamin. Alaya hatte ihn noch nie so aufgeregt erlebt. Er schien lange gelaufen zu sein, da er keuchte:
„Kommt schnell ins Dorf, Kinder. Es ist etwas Gefährliches passiert. Die anderen Dörfer brennen und Menschen kommen vielleicht hierher.“
Alaya wußte nicht, worüber sie mehr erschrocken war: ob über das Feuer, das vielleicht auch zu ihnen kommen könnte, oder über herannahende Menschen, die sie noch nie gesehen, aber schlimme Dinge über sie gehört hatte.
Die Kinder hörten sofort auf, sich zu waschen, und folgten stumm dem Dorfboten. Sie merkte, daß die beiden genauso erschrocken waren wie sie selbst, und bekam wechselweise und abgehackt die Gedanken von allen dreien mit: ein ziemliches Durcheinander aus Angst, Aufregung und bei Lamin noch zusätzlich Erschöpfung.
Bis sie zu dem Haus des Dorfältesten kamen, hatte sich ihnen jeder angeschlossen, dem sie begegnet waren. Und am Horizont konnte man eine Rauchwolke sehen, die bewies, daß tatsächlich in weiter Ferne der Wald brannte. Doch viele sagten, daß das Feuer verlöschen würde, bevor es viel vom Wald vernichten konnte, da es immer mehrmals am Tag stark regnete, so daß es noch nie einen Brand gegeben hätte, der großen Schaden angerichtet hatte.
Als der winzige Dorfälteste Brabant und seine noch kleinere Frau aus dem Haus getreten waren, sagte er ernst zu Lamin: „Beruhige dich erst mal, und dann erzähle, was du gesehen hast.“
Der Dorfbote nahm zuerst einige Atemzüge unter seinem dicken Schnurbart, bevor er mit seinem Bericht anfing: „Ich war kurz vor dem ersten der drei Dörfer im Süden. Doch ich hatte schon ein merkwürdiges Gefühl. Noch bevor ich sehr nahe war, merke ich, daß es brannte… Ich lief schnell weg. Ich wußte schon, daß es irgendwann wieder anfängt so stark zu regnen, daß das Feuer sich nicht lange durch den Wald fressen kann. Doch das war nicht das Schlimmste. Als ich weit weg genug war, um etwas langsamer werden zu können, hörte ich etwas weiter weg von mir Stimmen, die eindeutig nicht von Gnomen stammten. Ich schlich mich näher heran und sah durch die Büsche und Bäume viele Menschen. Es waren alles Männer und sahen wie Kämpfer aus. Sie hatten sich in einer Lichtung einquartiert und schienen zu rasten. Es war, als ob sie wüßten, daß das Feuer sie dort nicht erreichen kann… Dann bin ich schnell hierhergekommen.“
Als er geendet hatte, schauten alle betroffen und stumm vor sich hin. Der Dorfälteste blickte zuerst auf die Erde und sagte dann:
„Das kann letztlich nur bedeuten, daß unsere drei Nachbardörfer wohl ausgebrannt sind. Hast du irgendwelche Gnomen gesehen?“
„Nein.“
„Das ist besorgniserregend.“
Der kleine Alte schwieg wieder und wandte sich dann an Alayas Mutter: „Was meinst du, Donata: War es möglich, daß die Menschen die Barrieren der Dörfer durchbrechen konnten?“
Alayas Mutter trat vor und sagte in ihrer beherrschten Art: „Wenn es gewöhnliche Menschen waren, glaube ich das nicht. Draban und Manlik sind beide sehr mit ihren Dörfern und dem umgebenden Wald verbunden. Wenn es, wie es scheint, etwas gegeben hat, daß ihre Barrieren überwinden konnte, war es etwas Stärkeres.“
Nach einer Pause fügte sie hinzu: „Auch unsere Barriere kann gemeistert werden, falls etwas Mächtigeres kommen sollte.“
Als sie das sagte, gab es ein ängstliches Raunen unter vielen. Auch Alaya verspürte Angst. Niemals war sie vorher in ihrem elfjährigen Leben auf die Idee gekommen, daß es etwas gab, das die Barriere ihrer Mutter überwinden konnte.
Der Steinmetz Jardan frage: „Was sollen wir nun tun?“
Donata und der alte Brabant schauen sich fragend an, dann sagte er zu ihr: „Donata, du bist unsere Schamanin. Was meinst du?“
„Wir wissen bisher leider immer noch fast nichts. Doch es scheint sich um etwas Gefährliches zu handeln. Unseren Nachbarn ist etwas Schlimmes zugestoßen, was auch uns treffen könnte.
Vielleicht ist irgend etwas aus dem Gleichgewicht geraten und die Gottheiten Himmel und Erde sind erzürnt und haben eine Strafe entsandt. – Doch wir können vorerst nur ausharren und wachsam sein. Nach meiner Meinung können wir im Moment nichts anderes tun.“
Da sagte Brabant: „Das scheint mir auch so…“ Sein kleines Gesicht verkrampfte sich unter dem dicken, gewundenen, weißen Schnurbart. „Also Leute, versucht ruhig zu bleiben und paßt auf. Solange es nicht klar ist, was da überhaupt zu uns kommt, können wir nur warten.“
Die meisten wußten wohl, daß er Recht hatte. Doch das Dorf war nicht mehr dasselbe wie vorher. Alaya spürte, daß die meisten Angst hatten, wie sie auch. Obwohl es gerade Mittag war, ging kaum einer die restlichen Stunden des Tages tiefer in den Wald. Es war noch nie passiert, daß Menschen jemals in die Nähe gekommen waren. Viele hatten wie auch Alaya noch nie welche gesehen. Man wußte, daß Menschen die Gnomen haßten und sie entweder töten oder versklaven wollten. Es sollte vor langer Zeit Dörfer gegeben haben, die sich in der Nähe von Menschensiedlungen befanden, doch diese Zweibeiner wurden immer mehr feindselig, so daß sich die Gnomen in die dichten, regnerischen Wälder oder einige Sippen sogar an Bergränder zurückgezogen hatten.
Sie hatten auch den Vorteil, daß es kaum Menschen gab, die gute Magier waren, so daß die Gnomschamanen noch sicherer ihre Barrieren im Einklang mit der Natur um die Dörfer errichten konnten.
Deshalb waren auch diese Neuigkeiten so beängstigend. Denn in den alten Chroniken, die der Dorfälteste hatte und nur er lesen konnte, stand, daß es noch niemals weder Menschen noch anderen Zweibeinern ihrer Welt gelungen war, in ein Gnomendorf einzudringen, weil die Barriere jeden Fremden sofort erkannte und entweder in die Irre führte oder gar auf besondere Weise in die Flucht schlug. Die dabei wirkende Macht hing jedoch auch von der Erfahrung, Stärke und Heimatverbundenheit des Schamanen ab.
Donata ging sofort nach der Versammlung beim Dorfältesten in den Wald, um wieder Zwiesprache mit der Barriere zu halten. Das tat sie zwar jeden Tag mindestens morgens und abends, doch es war klar, daß es diesmal länger dauern würde. Sie hatte Alaya mitgenommen und ihr gesagt, zu versuchen so lange wie möglich mit ihr auszuharren. Ihre Tochter hielt sie es nie lange durch. Diesmal jedoch wollte sie sich so viel Mühe wie möglich geben. Und als sie sich neben der Mutter in den Schneidersitz begeben hatte und die Augen schloß, konnte sie zwar wieder nach wenigen Augenblicken die Kraft spüren, die hier aus unzähligen Quellen floß. Sie hatte aber erneut keine richtigen Einsichten, was das alles zu bedeuten hatte, nur wie jedes Mal das Gefühl, daß es etwas Mächtiges war, das auf sie alle aufpaßte und eigentlich nicht zu besiegen war.
Als sie es nach einer Weile nicht mehr aushielt, merkte sie, daß die Mutter weiter in Versenkung saß.
Alaya erhob sich still, um sie nicht zu stören, und ging ins Dorf.
Wollmar, der die ganze Zeit ruhig neben ihnen gelegen hatte, ging ihr sofort nach.
Sie traf sich mit anderen Kindern und alle versuchten sich Mut zu machen, daß nichts Schlimmes geschehen konnte. Die Gnomen, die mit Pfeil und Bogen umgehen konnten und die, welche gut im Stabkampf waren, übten sich eifrig, obwohl der Dorfälteste gesagt hatte, daß sie im direkten Kampf gegen die viel größeren und stärkeren Menschen wahrscheinlich keine Siegesaussichten haben würden. Dabei traf Alaya auch ihre Freundin Ranadra, die zwar dünn und obwohl ein Jahr älter sogar zwei Fingerbreiten kleiner als sie war, es aber im Umgang mit dem Stab fast schon mit ihrem Vater aufnehmen konnte, der ihr und ihrem jüngeren Bruder diese Kunst von klein auf beigebracht hatte. Wie eine richtige Kriegerin schwenke sie konzentriert den Kampfstab, die langen Haare hinten zum Zopf gebunden.
Von Zeit zu Zeit ging Alaya in den Wald zurück und schaute nach der Mutter: Die saß weiterhin regungslos.
Erst als die Dämmerung anbrach, kam sie plötzlich ruhig die Gasse hinunter, wo Alaya bei ihren Freunden Ladia und deren Bruder Ramin im Garten von deren Haus auf einer Bank saß.
Alayas Mutter begrüßte die beiden.
„Tante Donata, werden die Menschen uns angreifen?“, fragte Ladia mit ihrer hellen Stimme.
„Ich hoffe nicht.“
„Du hast doch gerade mit der Barriere geredet. Wird sie uns beschützen?“, fragte ihr Bruder, der genauso zarte Gesichtszüge wie seine Schwester hatte.
Alaya schien es, als wenn ihre Mutter zunächst etwas anderes sagen wollte, weil sie erst nach einem Augenblick antwortete: „Ja. Sorgt euch nicht. Im Moment sind wir sicher. Denkt an etwas Angenehmes und nicht an schlimme Dinge.“ Sie wandte sich an ihre Tochter: „Für uns ist es Zeit, nach Hause zu gehen, Alaya.“ Dann senkte sie den Blick zu dem Kletterwolf, dessen Kopfscheitel ihr fast bis zum Hals reichte, und sagte sanft: „ Komm Wollmar.“ Und sie verabschiedeten sich von Ladia und Ramin.
„Mama, werden die Menschen uns wirklich nicht angreifen?“, fragte Alaya, als sie langsam zu ihrem Haus schritten.
„Ich weiß es nicht, Alaya“, kam langsam die Antwort. In dem Moment legte Donata ihren rechten Arm um ihre Tochter, während sie stumm weitergingen. Alaya schmiegte sich an die kleinere Mutter und glaubte, daß, je näher sie ihr wäre, der Schutz vor allem Bösen in der Welt stärker sein würde.
Als sie in ihrem Haus waren, vergrößerte sich die Sicherheit. Es schien ihr, daß alle ihre Ahnen unsichtbar auf sie niederblickten und es nicht zulassen würden, daß irgend etwas Böses hier eindringen konnte. Das Haus selbst war ein Verbündeter und niemand konnte das schwere, alte Holz und den steinharten Lehm dazwischen besiegen.
„Du brauchst heute deine Arbeit nicht zu machen. Es ist sicher nicht schlecht, wenn wir uns etwas zerstreuen“, sagte die Mutter. Sie setzten sich auf die Bank im großen Eingangszimmer des Erdgeschosses. Alaya schien es, als wenn sie ein solches Lächeln noch nie bei der Mutter gesehen hatte. Zu der ruhigen Sicherheit war plötzlich etwas Junges, geradezu Kindliches gekommen.
„Ich habe mich gerade erinnert, wie wir hier mit Vater saßen, als du noch klein warst, noch nicht gehen und sprechen konntest. Du warst in deine Decke gewickelt, und wir beide saßen neben dir auf dem Boden. Wenn er sich entspannen wollte, hat er sich nie auf einen Stuhl gesetzt, sondern immer nur auf den Boden. Er sagte, daß er auf seinen Wanderungen durch die Natur während der Rast auch nie einen Stuhl hätte. Ich habe es ihm dann gleichgetan, auch wenn es in unserer Familie immer Sitte war, Stühle und Bänke zu benutzen.“
Alaya hörte dem schwärmenden Erzählen ihrer Mutter genau zu. Sie hatte kein richtiges Bild ihres Vaters behalten, nur einen angenehmen Umriß seines runden Kopfes, der von schwarzem Haar umgeben war. Doch immer wenn sie daran dachte, schoß ihr ein Strahl von Wärme um das Herz. Sie sagte das auch an diesem Abend der Mutter.
Die sagte darauf: „Auch wenn er nicht mehr da ist, ist das eine Art, wie er in dir immer weiterlebt. So kann jeder Gnom, jeder Verwandte, jemand, den man liebt, bei einem bleiben, auch wenn er tot ist.“
Alaya meinte, daß auch Wollmar immer zu ihr gehören würde.
„Natürlich“, antwortete ihre Mutter und wandte sich an den Kletterwolf: „Nicht wahr, Wollmar? Du bist wie ein Bruder zu meiner Alaya. Ich weiß das.“
Wollmar lag ausgestreckt am Boden und schaute klug mit seinen glänzenden, grauen Augen auf seine ältere Herrin und drehte den Kopf.
„Er versteht dich“, lächelte Alaya.
„Etwas kann er verstehen, doch die ganze Vielfalt der Sprache wird er nie lernen können“, entgegnete die Mutter.
„Doch ich kann manchmal kurze Gedanken von ihm erblicken, seine Bilder und Gefühle.“
„Ich weiß, daß du das kannst“. Ihre Mutter umarmte sie fest. „Du kannst vieles. Und ich bin sehr stolz auf dich. Aber du mußt lernen, damit umzugehen und es zu entwickeln. Das ist immer das Schwerste.“
Alaya wurde es warm ums Herz, denn so ein richtiges Lob gab es selten von der Mutter. Sie sagte ihr manchmal, daß man sonst zu überheblich werden konnte.
Die beide hatten wenig Appetit an diesem Abend, und sogar Wollmar verdrückte nicht die komplette Streifenwachtel. Auch wenn er noch manchmal selbst jagen konnte, gaben ihm die Nachbarn oft überschüssige Nahrung.
Allmählich senkte sich die Nacht über das Dorf. Donata ging noch einmal hinaus. Alaya folgte ihr, mit Wollmar am Fuße. Es war alles still, von den Bäumen hörte man noch die Tropfen des letzten Regens fallen. Man hatte schon nachmittags am Horizont gesehen, daß die Brände verloschen waren, lange bevor sie sich diesem Teil des Waldes hatten nähern können.
Die runden Köpfe von Talma und ihrem Mann Dandar lugten aus dem Nachbarhaus zu ihnen: „Donata, wird etwas passieren?“, fragte die Frau besorgt.
„Ich hoffe nicht. Versucht an etwas anderes zu denken.“
„Wenn das so einfach wäre“, fügte Dandar hinzu.
Dann schaute die Schamanin noch einige Augenblicke in die Ferne und sagte anschließend zu ihrer Tochter: „Wir sollten bald zu Bett gehen. Es war kein leichter Tag.“
Sie wünschten dem Nachbarspaar eine gute Nacht und gingen in das Haus zurück.
Als Alaya in ihrem Zimmer war, fühlte sie sich plötzlich sehr müde und wollte nur noch schlafen. Sie hatte sich vorher noch ein Bad in der Wanne im Waschraum gemacht, um auch die letzte Verunreinigung vom Spielen am Mittag wegzubekommen. Durch die Kräuter, die sie dem Wasser zugegeben hatte, war ihr Körper angenehm entspannt.
Nachdem sie sich ihr Nachthemd angezogen hatte, umarmte sie Wollmar, der bereits vor ihrem Bett lag. Dann legte sie sich hin, schlief schnell ein und bannte dadurch jede Angst.
Die schwarze Wolke
Als Alaya plötzlich aufwachte, mußte es tiefste Nacht gewesen sein. Sie wußte sofort, daß sie nicht mehr im Bett bleiben durfte. Ein Gefühl, daß etwas Gefährliches in der Nähe war, hatte sie ergriffen. Wollmar war ebenfalls unruhig und winselte leise. Als sie aus ihrem Zimmer auf die Galerie trat, sah sie, daß die Mutter unten im Schein der Öllampe stand und sie anblickte. Sie war völlig angezogen. Womöglich war sie überhaupt nicht ins Bett gegangen.
„Spürst du es auch?“, fragte sie.
„Ja, ich habe solche Angst, Mama. Ich glaube, etwas kommt hierher, aber ich weiß nicht was.“
„Laß uns schnell rausgehen!“
Als sie alle drei in die Nacht hinaustraten, war Alaya zunächst wie gelähmt: Der ganze Himmel im Süden und der größte Teil des Waldes waren verschwunden. Statt dessen war da eine solche Schwärze, als wenn jemand eine Riesendecke über alles gebreitet und dadurch in völlige Dunkelheit getaucht hätte. Gleichzeitig waren Geräusche und Töne zu hören, die sie noch nie vernommen hatte: teilweise ein tiefes Brummen, dessen Schwingungen noch am Körper zu spüren waren, und dann ein wirres Geflecht von unzähligen Geräuschen. Dazwischen schien es, als würde in weiter Ferne eine Frauenstimme zuerst lieblich und zart, dann wieder ganz tief und mit rauhem Ton singen, wehmutsvoll.
Zuerst blieben Mutter und Tochter stehen, als könnten sie nicht anders und müßten erwarten, was da auf sie zukommt. Ein Gefühl der Willenlosigkeit und Stumpfheit schien sich ihrer bemächtigen zu wollen: einfach stehenbleiben und sehen, was passieren wird.
Da drehte sich die Mutter plötzlich ruckartig zur Tochter um und schrie sie an, was die noch nie bei ihr erlebt hatte: „Alaya, lauf sofort in die andere Richtung in den Wald und lauf, so lange du kannst!“
Die Tochter schaute sie zunächst nur an, doch die Mutter packte sie an den Schultern und schrie noch lauter: „Nun mach schon, du dummes Ding! Du wirst sonst sterben! Ich muß mich um das Dorf kümmern!“
Alaya verspürte zuerst noch den Wunsch, bei ihrer Mutter zu bleiben, doch deren Befehl und die wieder einsetzende Angst vor der Gefahr waren stärker.
Sie fing an zu rennen, Wollmar neben ihr. Kurz vorher hatte sie sich noch umgedreht und gesehen, wie die Mutter in die Richtung der Schwärze gelaufen war und laut die Formel für den Segen der Barriere gerufen hatte:
„Wala, Wala, Walata Walatena Bonur Swada“
Alaya hetzte durch die Gassen zum nördlichen Waldrand. Sie wagte sich nicht mehr umzudrehen und dachte immer wieder daran, daß ihr die Mutter gesagt hatte, sie müßte so weit wie möglich rennen, so lange sie nur konnte.
Niemand aus dem Dorf war draußen. Keiner schien was zu merken. Vielleicht waren sie auch durch einen Zauber gelähmt.
Wollmar sprang bereits weit vor ihr her. Er schien ebenfalls die Gefahr zu spüren. Irgendwann war es ihm anscheinend auch nicht wichtig, ob er in Alayas Nähe blieb, denn er verschwand im Dunkeln des Dickichts. Sie selbst hatte auch in diesem Moment nur den einen Wunsch, unversehrt zu bleiben, weiterzuleben.
Sie konnte zwar nichts sehen, kannte jedoch die Umgebung des Dorfes blind. – Und doch war es nicht mehr dasselbe: Etwas Fremdes war eingedrungen und jagte mit einer großen Schnelligkeit hinter ihr her. Sie fürchtete, daß es sie bald packen würde, und versuchte noch schneller zu laufen… Doch ihre Ausdauer war am Ende. Als sie halt machen mußte, um Luft zu holen, fühlte sie, wie sie etwas umfing. Es war nichts Festes. Und sie sah durch das schwache Mondlicht, das in diesem Teil des Waldes noch durch die Baumkronen schien, daß es Ausläufer dieser riesigen, schwarzen Wolke waren. Sie umhüllten sie. Sie wollte sich befreien, hatte aber keine Kraft. Alles um sie herum wurde völlig schwarz. Und die Schwärze wollte auch in sie eindringen. Es war nicht einfach nur Dunkelheit, sondern ein völlig schwarzer Rauch. Sie fühlte, wie er sie aufsaugen wollte, ganz verschwinden lassen.
Schließlich konnte sie nicht mehr dagegen ankämpfen und gab sich dem Unausweichlichen hin. Das Atmen fiel ihr schwer und sie verlor das Bewußtsein…
Irgendwann schien ihr plötzlich, als wenn sie alles deutlich sehen und hören konnte. Sie lag benommen auf dem Boden und diese schwarzen Schwaden umfingen sie weiterhin und wollten sie irgendwohin tragen. Doch zugleich kam unglaublich vieles herbei, daß ihr anscheinend helfen wollte: unzählige unbekannte Gnomen, die sich mutig um sie stellten und untereinander riefen, wobei sie keine Worte verstand. Dann gab es unendlich viele Tiere, die dichtgedrängt standen, riesige Bäume daneben, ja sogar kleine Pilze auf der Erde und die Walderde selbst umfingen sie, sogar ein Schwall frischer Luft. Sie alle ließen es nicht zu, daß die Wolke sie wegtrug. Die Schwärze versuchte es zwar verbissen, doch noch nicht einmal in die Luft konnte sie Alaya heben, da dort Bäume und Sträucher ihre Äste dicht ausgebreitet hatten und rundherum viele Vögel und unzählige Insekten flatterten.
Allmählich wurde die Kraft der Wolke schwächer. Sie umhüllte zwar noch Alaya, doch wie gewöhnliche Wolken am Himmel sich verändern und allmählich verschwinden, geschah es auch mit dieser. Die junge Gnomin konnte sich zwar immer noch nicht rühren, doch sie merkte, daß diese Gefahr keine Macht mehr über sie hatte. Die schwarzen Schwaden wurden immer dünner, bis sie plötzlich ganz verschwunden waren. Dann fiel sie in einen traumlosen Schlaf…
Als sie wieder die Augen aufmachte, lag sie immer noch in ihrem Nachthemd auf der Erde, und die Strahlen des Morgens lugten durch das hohe Blätterdach des Waldes. Sie richtete sich auf und merkte mit Freude, daß Wollmar neben ihr lag und sie ruhig beobachtete.
„Wollmar, du bist wieder da! Dann ist den anderen sicher auch nichts passiert. Laß uns schnell zum Dorf zurückkehren. Da ist etwas Böses gekommen, aber es konnte uns doch nichts anhaben.
Mama und die Barriere haben es vertrieben!“
Sie umarmte ihn glücklich, während er sie liebevoll ableckte.
Als sie sich aufrichtete, merkte sie, wie weit sie vom Dorf entfernt war. In der Nacht war es ihr vorgekommen, als wäre sie lediglich eine kurze Strecke in den Waldrand gelaufen.
Sie konnte kein Blut an sich entdecken. Ihr Nachthemd war lediglich durch das Liegen auf der Erde schmutzig braun geworden.
Als sie sich mit Wollmar langsam auf den Weg zum Dorf machte, merkte sie an den schweren Beinen, daß sie gestern so viel und so schnell gelaufen war, wie noch nie in ihrem Leben. Doch das war ihr unwichtig, denn je näher sie dem Dorf kamen, desto größer wurde ihre Aufregung.
Sie sagte sich, daß nichts Unangenehmes geschehen war. Bald würde sie die ersten Gnomen entdecken und feststellen, daß das Böse auch ihnen nichts hatte anhaben können.
Die ersten Häuser, die sie durch die Bäume sehen konnte, sahen auch alle völlig unbeschädigt aus. Ihre Schritte wurden langsamer. Sie glaubte, gleich die ersten Stimmen zu hören.
Doch es war alles still. Noch nicht einmal die Laute der Ziegen und Hühner hörte sie.
Aber das war sicher wegen dem überstandenen Schrecken der Nacht. Irgendwo hatten sich alle versammelt und redeten erfreut darüber, wie alles glücklich vorübergegangen war.
Sie und Wollmar kamen nun an den Dorfrand. Sie blieb stehen und schaute zuerst auf die naheliegenden Häuser. Alle sahen wie immer aus. Wollmar war ruhig. Wenn etwas Fremdes in der Nähe gewesen wäre, hätte er es gewittert und geknurrt. Doch diese schreckliche Stille machte ihr Angst. Sie tat einige Schritte in die erste Gasse und blickte umher. Um die Zeit waren sonst immer alle auf den Beinen.
Sie machte sich wieder Mut und war sicher, daß sich alle mit ihrer Mutter am südlichen Waldrand versammelt hatten, wo auch ihr Haus stand, und dem Wald und der Barriere dankten, daß die Gefahr vorübergegangen war. So schnell wie möglich ging sie dahin.
Doch als sie einige Schritte neben den scheinbar leeren Häusern gegangen war, merkte sie plötzlich, wie der dicke Tondra vor seiner Haustür stand und sie verstört anblickte: „Alaya, wo sind alle geblieben? Meine Lenja ist weg und auch die Nachbarn sind alle weg.“
Da spürte Alaya wieder die Angst.
„Ich dachte, ihr wäret alle bei meiner Mutter und sie würde das Dankritual durchführen, weil diese schwarze Wolke uns nichts anhaben konnte.“
„Schwarze Wolke? Ich kann mich nur erinnern, daß ich und Lenja gestern abend ins Bett gegangen waren. Und heute morgen wache ich auf, und sie ist nicht mehr da. Und niemand außer dir und deinem Wolf ist mehr da. Außerdem fühle ich mich, als wenn ich todkrank wäre.“
„Onkel Tondra, laß uns schnell zu meiner Mutter gehen. Wir finden sie bestimmt alle dort. Auch deine Frau.“
Er machte schweigend einige Schritte zu ihr hin und sie merkte, daß er unsicher war, als wenn er betrunken wäre. Sie wäre am liebsten gelaufen, doch aus Rücksicht auf ihn ging sie langsam.
„Du wirst sehen, die sind sicher alle am südlichen Waldrand“, wiederholte sie, auch um sich selber Mut zu machen.
Als sie am Haus vorbeikamen, wo Danim und sein Bruder Tobus wohnten, lugte der Kopf des kleinen Tobus aus dem Fenster im ersten Stock und mit seiner hellen Knabenstimme rief er: „Alaya, wo sind meine Eltern und mein Bruder?“
„Tobus, komm her zu uns. Irgend etwas ist in der Nacht passiert.
Wir gehen zu meiner Mutter. Vielleich sind alle dort.“
„Wartet. Ich zieh mich nur schnell an.“
Alaya mußte trotz aller Angst in dem Moment lächeln, daß er nicht im Nachthemd gehen wollte. Es war ihr jetzt sogar peinlich, da sie selbst in ihrem schmutzigen Schlafanzug schlimm aussehen mußte.
Tondra hatte sich auch nur notdürftig angezogen. Er starrte immer noch verwirrt durch die Gegend.
Als Tobus herauskam, fragte Alaya: „Hast du irgend etwas in der Nacht gemerkt?“
„Nein. Wir beide sind eingeschlafen. Und am Morgen habe ich gesehen, daß Danim nicht da ist. Und als ich aus unserem Zimmer gegangen bin, habe ich die Eltern auch nicht gefunden.“
Nach einer Pause fügte er langsam hinzu: „Mir ist auch etwas schlecht. In der Nacht habe ich unangenehm geträumt.“
„Was hast du geträumt?“, fragte Alaya.
„Wie ich und Danim schlafen und plötzlich kommt etwas ganz Schwarzes und hüllt uns beide ein. Und ich kann nichts mehr sehen und habe Angst, daß ich keine Luft mehr bekomme.“
„Ich glaube, du hast das nicht geträumt, sondern es ist passiert. Ich und meine Mutter haben diese Wolke gesehen. Sie kam vom Wald bei unserem Haus.“
Weil er ihr so klein und jung leid tat, versuchte Alaya besonders sicher zu wirken: „Doch jetzt ist alles vorbei. Dein Bruder und deine Eltern sind vielleicht mit den meisten anderen unseres Dorfes bei meiner Mutter. Sie hat die Wolke verscheucht.“
„Dann gehen wir zu ihnen. Vielleicht kann mir deine Mutter auch was gegen meine Übelkeit geben.“
Als sie sich das durch den Kopf gehenließ, was Tobus über die Wolke gesagt hatte, war sich Alaya nun nicht mehr so sicher, ob wirklich alle bei ihrer Mutter wären. Doch sie redete es sich weiter ein. Sie mußten nur noch um das Haus von Bäckermeister Rodan gehen, dann konnte man auch schon ihr Dach sehen.
Doch noch bevor das geschah, hörte sie plötzlich Ranadras Stimme. Die Freundin kam ihnen aufgeregt entgegen: „Alaya! Wo sind alle anderen?“
„Ich glaube, die sind vor unserem Haus oder am Waldrand. Irgend etwas ist in der Nacht geschehen.“
„Aber ich war bei euch. Da ist niemand. Und am Waldrand auch nicht.“
Alaya traf es wie ein Stich. Mit verzweifeltem Trotz erwiderte sie:
„Aber das kann nicht sein. Meine Mutter ist gestern dieser schwarzen Wolke entgegengetreten. Und mich hat sie mit Hilfe der Barriere gerettet… und andere sicher auch, wie auch euch drei.“
„Ich sage dir, bei euch ist niemand. Ich habe auch andere Häuser durchsucht. Ihr drei seid die einzigen, die ich gefunden habe“, sagte Ranadra mit erregter Stimme.
„Was ist mit dir passiert?“, fragte Tondra.
„Ich weiß es nicht. Ich bin mit meinem Bruder zu Bett gegangen, und am Morgen war er nicht mehr da und die Eltern auch nicht. Ich war ganz verzweifelt, weil auch niemand mehr im Dorf war. Zum Glück habe ich jetzt euch getroffen.“
„Hast du nichts gemerkt in der Nacht?“, fragte Alaya.
„Ich hatte einen merkwürdigen Traum: Als ich schlief, wäre etwas Schwarzes gekommen und wollte mich mitnehmen, doch dann hat es mich wieder fallengelassen.
Das ist alles… Ich fühle mich aber, als wenn wirklich jemand an mir herumgezerrt hätte.“
Tondra und Tobus sagten ihr auch, daß sie dieses Unwohlsein verspüren würden.
Alaya wollte jetzt aber nur so schnell wie möglich in ihr Haus gehen. Sie redete sich weiterhin ein, daß ihre Mutter und andere doch plötzlich auftauchen würden. Ohne auf die drei zu warten, die immer noch etwas benommen waren, ging sie so schnell wie möglich mit Wollmar zu ihrem Heim.
Als sie den großen Raum im Erdgeschoß betrat, wirke zwar alles an seinem Platz, und doch war es so schrecklich leer. Sie reif mehrfach vergeblich „Mama“ und suchte alle Räume ab: die Küche, den Keller darunter; sie lief die Treppe zum Obergeschoß hoch und schaute in das Zimmer der Eltern, das Gästezimmer, das Zimmer, das als Arbeitsraum benutzt wurde, und schließlich ihr Zimmer.
Wollmar merkte ihre Aufgeregtheit und folgte ihr auf Schritt und Tritt.
Schließlich sah sie ein, daß das Haus leer war. Sie lief daraufhin schnell in den Wald, und die anderen folgten ihr. Doch je tiefer sie laut rufend kamen, um so deutlicher war es, daß sie auch dort niemanden finden würden. Alaya kamen die Tränen hoch, und während sie ihnen ihren Lauf ließ, wurde sie von Ranadra umarmt, die ebenfalls zu weinen angefangen hatte. Tobus kam auch zu ihnen, und so klein er auch war, legte er die kurzen Ärmchen um sie beide und sagte schluchzend: „Vielleicht kommen sie bald wieder. Vielleicht sind sie gefangen und können sich befreien.“
Onkel Tondra rannen ebenfalls die Tränen die Wangen herunter und er sagte mit bebender Stimme: „Es ist etwas Schreckliches und Unerklärliches passiert, Kinder. Wir müssen jetzt zusammenhalten.
Wenn ihr euch etwas beruhigt habt, gehen wir zu mir. Ihr seid jung und müßt etwas essen. Danach sehen wir weiter.“
Sie gingen aus dem Wald. Nachdem sich Alaya zunächst bei sich ihre Tageskleidung angezogen hatte, waren sie auf dem Weg zu Tondras Haus. Niemand sprach etwas. Es schien, als wenn sie tatsächlich die einzigen Übriggebliebenen waren.
Während sie später in Onkel Tondras Wohnstube still und ohne großen Appetit aßen, hörten sie plötzlich Stimmen. Es waren rauhe, männliche, die in einer fremden Sprache redeten. Ohne daß sie hätte lange nachdenken müssen, wußte Alaya, daß Menschen ins Dorf eingedrungen waren. Also hatten sie die Barriere passieren können.
Sie waren aber noch nicht bei Tondras Haus. Der Alte und die drei Kinder gingen sofort ans Fenster und lugten vorsichtig heraus: Sie sahen viele Gestalten. Zielstrebig, aber dennoch vorsichtig bewegten sie sich voran. Furchterregend waren sie in ihrer schrecklichen Größe, Rüstung und den vollen Bärten. An ihnen waren lange, unheimliche Gegenstände, die sicher diese Waffen sein mußten, von denen die Gnomen gehört hatten: Schwerter und Lanzen.
Die Eindringlinge teilten sich in Gruppen und gingen in jeweils gegenüberliegende Häuser, um sie abzusuchen. Einige blieben währenddessen auf der Gasse stehen und warteten. Das gab den Gnomen einen kleinen Zeitvorsprung, denn die Menschen waren von Tondras Heim noch einige Häuser entfernt.
„Was sollen wir tun?“, fragte Ranadra, auf Tondra blickend. Der überlegte kurz mit angstvollem Gesicht und sagte dann: „Wir können nicht weglaufen, sondern müssen uns verstecken… Aber wo? Sie werden sicher überall suchen.“
„Wir können in deinen Keller gehen“, schoß es aus Alaya heraus.
„Auch da werden sie uns finden.“
„Wir können einen Teppich auf die Bodentür legen. Sie ist flach.
Vielleicht kommen sie nicht auf die Idee, daß unter dem Teppich eine Tür ist“, warf Ranadra ein.
„Aber jemand müßte draußen bleiben, um den Teppich darüberzulegen“, erwiderte der Alte.
Mit stockender Stimme fügte er dann hinzu: „Ich muß es tun.
Sollen sie mich fangen, wenn ihr nur hoffentlich am Leben bleibt.“
„Nein, ich werde es tun. Ich bleibe draußen und zaubere eine Illusion vor mich, eine Wand.“ Die anderen schauten Alaya an, doch sie wurde ungeduldig: „Nun macht schnell, sonst sind wir alle verloren!“
Alle waren von ihrer Entschlußkraft beeindruckt und fügten sich stumm. Sie gingen in die Küche, wo sich wie auch in Alayas Haus die Tür zum Keller befand. Die drei Gnomen gingen die kurze Holztreppe hinunter, und Alaya sagte mit strenger Stimme zu Wollmar, daß er hier unten auf sie warten mußte. Er gehorchte, wenn auch nicht begeistert.
Sie schloß hinter ihnen die Tür und zog einen grauen Teppich aus dem Wohnzimmer nebenan hinüber. Als sie darauf schaute, hoffte sie, daß kein Fremder auf die Idee käme, daß sich darunter ein Raum befand.
Doch nun mußte sie an sich denken. Am einfachsten war es, wenn sie sich in eine Ecke stellen und die Illusion einer Hauswand vor sich zaubern könnte. Schnell wußte sie, wo das am besten zu machen war: Auf der Rückseite des Fußes der Treppe, die zu Tondras Obergeschoß führte, war es niedrig und relativ dunkel, so daß das Trugbild nicht sehr auffallen konnte.
Als sie schnell dorthin ging, hörte sie schon, daß die tiefen Laute der fremden Sprache bedrohlich nahe gekommen waren.
Sie kauerte sich in den Winkel zwischen dem Hausboden und der Unterseite der Treppe, mit dem Rücken an die Hauswand. Aus ihren nach außen gebreiteten Handflächen entstand eine scheinbare Wand, von der sie hoffte, daß sie echt aussah. Mit pochendem Herzen achtete sie darauf, daß die Illusion an jeder Seite keine Lücke aufwies. Es mußte so aussehen, als wenn sie ein Teil des Hauses war und nichts dahinter sei. Alaya versuchte, so ruhig wie möglich zu sein und die Hände reglos verharren zu lassen, sonst würde das Bild flimmern oder gar verschwinden.
Und der Überlebenstrieb ließ sie ruhig werden.
Nach einigen Augenblicken hörte sie, wie die Eindringlinge ins Haus kamen. Die schweren Schritte verteilten sich in verschiedene Richtungen. Daß sie die Wilden nicht sehen konnte, war ein gutes Zeichen, denn das hieß, daß das Trugbild für das Licht so undurchlässig war, daß auch sie nicht gesehen werden konnte. Sie versuchte sich möglichst auf das Aufrechterhalten der Illusion zu konzentrieren, denn nur das konnte ihre Rettung sein. Nebenbei achtete sie aber auch auf die Schritte. Sie hörte, daß einer direkt über ihr die Treppe hochging. Es war deutlich, daß es nur ein Paar Füße war. Ein anderer schritt das Erdgeschoß ab. Die beiden Menschen waren still, suchten offenbar nur aufmerksam nach Überlebenden oder bestimmten Gegenständen, denn sie hörte, wie Türen von Schränken und Schubladen geöffnet wurden und es schepperte. Aus der Küche gab es keine verdächtigen Geräusche, so daß sie weiter hoffen konnte, daß diese Gestalten nicht auf die Idee gekommen waren, daß unter dem Teppich der Kellereingang war.
Auch Alayas Tarnung war anscheinend perfekt, denn obwohl einer der beiden in nächster Nähe vorbeigegangen war, wie sie hören konnte, bemerkte er sie nicht. Das machte sie sicherer und sie wußte, daß sie es noch eine Weile so aushalten konnte. Diese Sicherheit brachte gleichzeitig die Neugier mit, und obwohl es hätte ihr Untergang gewesen sein können, schwächte sie die Illusion bewußt ab, um die Widerlinge sehen zu können. Zu ihrem Glück war derjenige, der das Erdgeschoß absuchte, gerade mit dem Rükken zu ihr gewandt und mehrere Schritte entfernt. Sie sah eine große Gestalt, in schwarzen Stiefeln, brauner Hose und einem grünen Wams gekleidet. Das dunkle Haar fiel bis zum Kragen.
Um ihr Schicksal nicht noch mehr herauszufordern, ließ sie die Wand schnell wieder lichtundurchlässig werden. Der Mann hatte sie nicht bemerkt.
Doch dann hörte sie, wie ein dritter etwas rief. Sie bekam einen Schrecken, ob nicht ihre Freunde entdeckt worden waren. Doch der, welcher in ihrer Nähe war, gab nur eine kurze, ruhige Antwort.
Anscheinend war die Katastrophe nicht geschehen, da es dann wieder still wurde. Nach einigen Augenblicken hörte sie über sich Schritte herunterkommen.
Kurze Zeit danach hatten die drei anscheinend genug von der Durchsuchung, da Alaya hören konnte, wie sie das Haus verließen.
Sie ließ die Illusion noch einen Augenblick bestehen, dann schwächte sie das Bild ab. Und als sie durch ihre nun fast völlig durchsichtige Wand sehen konnte, daß die Gefahr tatsächlich vorerst vorüber war, stieß sie einen Seufzer aus und lehnte sich erschöpft an die richtige Wand, als wenn sie nach dem Holen von zehn Eimern Wasser aus dem Bach Luft schnappen mußte. Noch einige Augenblicke lag sie so an die Wand gelehnt, ehe sie den Mut faßte, aufzustehen und vorsichtig an die Tür zu gehen. Sie spannte ihr Gehör an, doch es war tatsächlich so, daß die Stimmen und Geräusche von draußen in deutlicher Entfernung erklangen.
Nachdem sie aus dem Fenster neben der von den Eindringlingen offen gelassenen Eingangstür gelugt hatte, war sie sicher, daß die Männer vorerst nicht mehr in Tondras Haus gehen würden. Sie kroch dann schnell zur Küche, aus Vorsicht, daß sie nicht einer von draußen sehen würde, wäre sie aufrecht gegangen. Sie kauerte sich neben den Teppich, schob ihn zur Seite, machte die Tür auf und flüsterte: „Sie sind weg.“ Als erstes kam ihr Wollmars haarige Schnauze entgegen, der es kaum erwarten konnte, wieder zu seiner Gefährtin zu kommen. Danach tauchten auch die anderen auf.
„Das ist noch mal gut gegangen“, seufzte Tondra.
„Wie hast du dich versteckt?“, fragte Ranadra.
„Ich habe mich unter die Treppe gehockt und vor mir eine Wand gezaubert, die wie die Hauswand aussah.“
„Du bist eine würdige Tochter deiner Mutter, Alaya“, bemerkte Tondra anerkennend. „Doch was nun?“, fügte er mit wieder besorgtem Gesichtsausdruck hinzu.
„Wir müssen so lange hierbleiben, bis sie endlich verschwinden“, meinte Alaya.
„Hoffentlich tun sie das bald“, erklang es nicht gerade sicher aus Tondras Mund. Tobus stand die ganze Zeit schweigend dabei und sagte nichts. Trotzdem wirkte er ruhig, und ihm schien die Nähe der anderen eine kleine Sicherheit zu geben. Alaya war so angespannt, daß sie nichts von den Gedanken der anderen mitbekommen konnte.
Sie beschlossen, möglichst gebückt auf dem Boden zu bleiben und zu horchen. Falls sich die Meute erneut aus irgendwelchen Gründen in Tondras Haus begeben sollte, wollten die vier sich wieder in dem Keller verstecken und Alaya sich mit Hilfe der Illusion schützen.
Doch anscheinend hatten die Eindringlinge nicht vor, noch einmal in sein Haus zu gehen. Gleichwohl blieben sie im Dorf, wie die Gnomen von Zeit zu Zeit an entfernten Stimmen entnehmen konnten.
„Hoffentlich wollen sie sich nicht bei uns einnisten“, sagte Ranadra.
„Dann müßten wir fliehen“, bemerkte Alaya.
Sie hatten vorerst ihr Leben gerettet, doch die nun folgenden Stunden waren nicht minder anspannend. Immer mußten sie auf der Hut sein, daß nicht plötzlich einer der Menschen vor den Fenstern auftauchte und sie sah. Eine Gefahr war insbesondere der Toilettengang nach draußen. Doch auch da hatte jeder Glück und kein Feind war in der Nähe.
Alaya mußte Wollmar immer wieder mit Befehlston sagen, daß er nicht umherspazieren durfte, was er zwar befolgte, aber trotzdem verwundert war.
Zu essen hatten sie noch genug. Die Räuber hatten nichts mitgenommen, da sie anscheinend schon genug Proviant besaßen. Aber sie hatten mehrere von Tondras kunstvoll gefertigten Töpfen und Behältern gestohlen. Er war auch verbittert, daß sie alles gierig durchwühlt und durcheinandergeworfen hatten.
Die Dunkelheit war schon eingebrochen, und die Menschen hatten sich vor seinem Haus nicht mehr gezeigt. Die Gnomen hofften, daß sie die Durchsuchung des Dorfes beendet hatten und bald weggingen. Doch an vereinzelten Stimmen hörte man, daß sie noch da waren.
„Sie werden sicher die Nacht hierbleiben. Vielleicht gehen sie dann morgen“, sagte Tondra.
Tobus meldete sich hoffnungsvoll: „Ich kann kaum erwarten, daß wir uns nicht mehr verstecken müssen.“
Die anderen lächelten still auf seine Worte. Diese kurze Entspannung gab Alaya den Mut, in die Dunkelheit hinauszuschauen, doch sowohl links wie auch rechts war zum Glück von den Wilden nichts zu sehen. Die anderen hatten sich hinter sie gesellt und blickten ebenfalls umher. Sie flüsterte: „Wir müssen bis morgen warten und hoffen, daß sie dann endlich verschwinden.“
Sie machten daraufhin die Tür vorsichtig zu und kurze Zeit danach fiel jeder von ihnen in tiefen Schlaf, auch wenn ihnen nur den nackte Boden zur Verfügung stand, denn Kissen und Decken zu nehmen wagten sie nicht, da die Menschen bei einem erneuten Erscheinen eine Veränderung womöglich bemerkt hätten… Doch sie mußten sich keine Sorgen mehr machen, daß die Unholde wieder in das Haus kämen. Kurze Zeit nach Morgengrauen hörten sie ihre Laute und gleichzeitig war da noch etwas Unheilverkündendes dabei.
Und einige Zeit später sahen sie durch das Fenster wie hinter dem Haus der Eldert-Familie, das Tondra gegenüberlag, Rauch aufstieg.
Die Menschen hatten begonnen, das Dorf abzubrennen! Stimmen und Schritte kamen näher. Die Gnomen versteckten sich wie am Tag davor, auch wenn Alaya ahnte, daß das Haus nicht mehr durchsucht werden würde.
Tatsächlich hätten sie sich nur im obersten Stockwerk verstecken können, denn der Wilde, der vor der Haustür erschien, warf eine Fackel hinein. Alaya löste sofort ihre Illusion auf und holte die anderen aus ihrem Versteck. Im Innenbereich vor der Tür brannte schon das Holz. Als wenn der Mensch hatte verhindern wollen, daß noch etwas Lebendiges aus dem Haus flüchten konnte.
Sie rannten alle in den oberen Stock. Es blieb ihnen keine Wahl, als durch ein Fenster dort ins Freie zu springen. Dadurch liefen sie zwar Gefahr, von den Eindringlingen gesehen zu werden, doch die andere Möglichkeit war nur, in den Flammen elend zu verbrennen.
Tondras Haus schaute an einer Seite in den Garten der Nachbarn, so daß sie dort herunterspringen konnten. Wollmar als Kletterwolf mußte man nicht klarmachen, was zu tun war. Mit einem sicheren Sprung flog er auf den Rasen des Gartens, der noch feuerfrei war.
Auch Alaya und die anderen zwei Kinder konnten recht geschickt herunterspringen, nachdem sie sich zuerst vom Fenstersims herunterhängen ließen, um die Höhe zu vermindern. Onkel Tondra hatte jedoch seine Jahre, in denen er im Wald auf Bäume kletterte, schon lange hinter sich, und sein Übergewicht machte die Sache noch schlimmer. Wie eine überreife, dicke Frucht plumpste er ins Gras, so daß Alaya verwundert war, daß er nicht platzte. Doch er blieb zum Glück am Leben und ächzend stemmte er sich wieder auf die Beine.
Die Flammen hatten inzwischen schon viele Häuser ergriffen.
Alaya rief: „Wir müssen in den Wald laufen!“
Der kürzeste Weg zum Waldrand führte durch zwei weitere Gassen. Jeder rannte so schnell er konnte. Wollmar war natürlich allen voran, doch obwohl sein Überlebenstrieb die Oberhand gewinnen wollte, verlangsamte er immer wieder und schaute sich nach Alaya um.
Sie und Ranadra waren ebenfalls rasch zwischen den brennenden und qualmenden Häusern durchgelaufen, mußten sich jedoch auf die langsame Geschwindigkeit des kleinen Tobus und vor allem Tondras einstellen, der sich beim Sturz wohl verletzt hatte und hinkend vorwärtstorkelte. Es schien zuerst, als hätten die Menschen das Dorf schon verlassen, doch kaum waren die Flüchtenden am Waldrand, als sie ein lautes Geschrei vernahmen. Alaya drehte sich um und blickte in ein mehrere Schritte entferntes, bärtiges Gesicht, das nur Feindseligkeit ausdrückte. Er rief wohl nach seinen Kumpanen, stürmte aber gleichzeitig zu den Gnomen.
„Schnell, in den Wald!“, rief Alaya den anderen zu. Hier war der Waldsaum ganz dicht, und ausgetretene Wege gab es nicht.
Als jeder von ihnen versuchte, so gut es ging sich durch das Dikkicht zu schlagen, hatte sie der Mensch schon mit seinen langen Beinen eingeholt. Er war schon im Begriff mit seinem Schwert Tondra niederzustrecken, als das geschah, womit Alaya nicht mehr gerechnet hatte: Sie wurde plötzlich an eine andere Stelle getragen und erkannte, daß sie eine lange Wegstrecke vom vorherigen Platz entfernt war. Das konnte nur bedeuten, daß die Barriere gewirkt hatte. Es war das erste Mal, daß sie selbst so einen Schutzeingriff erlebt hatte. Anscheinend war die Macht der Barriere doch noch übriggeblieben.
Alaya wußte nicht, wo im Moment die anderen und die Menschen waren. Aufgeregt ging sie zwischen den Bäumen und Büschen und hatte Angst, daß sie plötzlich vor einem der Widerlinge stehen würde. Sie sah am Rauch, der vom Dorf kam, daß deren abscheuliches Werk gedieh. Nach den Freunden zu rufen, getraute sie sich nicht, da sie einer der Unholde hätte hören können.
In dem Moment spürte sie, wie etwas an ihr herumtastete. Obwohl sie erschrocken war, überkam sie sich dennoch schnell die Sicherheit, daß es etwas von der Barriere war. Auch ein Gemisch von Lauten und Stimmen hörte sie plötzlich ganz leise, als wenn viele verschiedene Wesen entfernt versuchten, ihr etwas zu sagen.
Auf einmal stand sie vor dem Menschen, der sie im Dorf gesehen hatte. Er war zuerst genauso überrascht, stürzte sich dann aber auf sie. Im letzten Augenblick konnte sie seinem starken Griff entgehen und floh in dichtes Untergehölz. Die Äste peitschten ihr entgegen. Er konnte aufgrund seiner Größe nicht sofort hinterher, sondern fing an, mit seinem Schwert das Gestrüpp wegzuschlagen.
In dem Moment wurde Alayas Empfindung, daß hier das Wirken der magischen Barriere vonstatten ging, wieder stärker: Sie sah gerade noch, wie der Mann, von unsichtbaren Kräften gepackt, geradezu weggesogen wurde. Er stieß nur ein Grunzen aus und dann sah sie ihn nicht mehr.
Nun traute sie sich, nach den anderen zu rufen. Es gab zwar keine Antwort, aber dafür stürmte Wollmar zu ihr. Glücklich umarmte sie ihn.
„Los, mein Liebster, wir müssen Ranadra, Tobus und Tondra suchen.“
Er schnüffelte eine Weile und hatte anscheinend bald eine Spur gefunden.
Nach kurzer Zeit tauchten plötzlich hinter einem Baum Ranadra und Tondra auf. Die beiden Freundinnen stießen gleichzeitig einen Seufzer der Freude aus und umarmten sich. Doch Tondra sah mitgenommener aus als vorher.
„Ich glaube, die Barriere hat noch Wirkung“, sagte Alaya.
Ranadra erwiderte: „Ich wurde plötzlich weggeschleudert. Zuerst habe ich mich nicht zurechtgefunden, dann stieß ich auf Onkel Tondra.“
Der seufzte: „Wir können von Glück reden, wenn wir das überleben, Kinder.“
Gerade diese gefährliche Lage gab Alaya einen trotzigen Willen, so lange es ging, um das Leben zu kämpfen: „Noch leben wir. – Und wir müssen Tobus suchen.“
Doch als sie einige Schritte machten, spürten sie mit allen Sinnen, daß das Feuer kam. Die Flammen des Dorfes hatten auch den Wald erfaßt. Diese Menschen mußten böse Zauberer sein, daß sie ohne Angst um sich so etwas tun konnten. Im Nu breitete sich das fressende Element überall aus.
„Zum Bach!“, rief Alaya.
Um sein Leben zu retten, holte auch Tondra an Kraft heraus, was noch in ihm steckte, auch wenn er durch den Sprung weiter humpelte.
Sie wußten, daß die Menschen ihnen jetzt nicht gefährlich werden konnten, so daß sie, ohne auf anderes achten zu müssen, den Bach erreichten.
„Wir müssen uns flach ins Wasser legen“, keuchte Alaya. Sie hatte zwar noch nie eine Feuersbrunst erlebt, glaubte aber, daß das am besten wäre.
Sie legten sich alle drei in den Bach. Wollmar war vorher mit schnellen Schritten geflohen, was Alaya als kleine Erleichterung empfand, da er vielleicht der Todesgefahr entrinnen konnte. Zudem wußte sie, daß er, wenn das Feuer vorüber war, sofort wiederkommen würde.
Kurze Zeit danach war die Brunst auf beiden Seiten des nahen Ufers am Toben. Schaurig schlängelten sich die Flammen des zerstörerischen Elements und versuchten über das enge Wasserbett nach ihnen zu greifen. Alaya tauchte völlig ins Wasser und hielt gerade noch das Gesicht zum Atmen heraus. Sie wußte nicht, was die anderen zwei taten.
Das wütende Feuer verstärkte seine Anstrengungen, die Gnomen zu erfassen. Die brennenden Arme wurden länger, unterstützt durch giftigen Rauch, der die Lungen Alayas bereits erreicht hatte und versuchte, den Atem zu rauben.
Da rief sie verzweifelt und so laut sie noch konnte: „Himmel und Erde! Unsere liebe Barriere: Du bist unser Schutz, und unser Dorf war immer ein Teil von dir. Wir haben nichts Schlimmes getan, daß wir so schrecklich sterben müssen! Laßt uns nicht sterben und sagt dem Feuer, daß wir es nicht waren, die es erzürnt haben!“ Es schien endlose Augenblicke, daß ihr Hilferuf umsonst war. Der Rauch raubte ihr die Atemluft immer mehr, auch wenn sie die Feuerarme im Wasser nicht erfassen konnten, so sehr sie es auch versuchten.
Doch plötzlich bekam der Bach die Unterstützung des Himmels: Einer der gewöhnlichen, reichen Frühlingsregen ergoß sich über den Wald und nahm der Feuersbrunst sofort ihre Kraft. Da wußte Alaya, daß sie überleben würde. Die Flammen erstarben allmählich und irgendwann erhob sie sich, hustend und schwach. Mit Freude sah sie schnell, daß auch Ranadra und Tondra überlebt hatten, auch wenn sie ebenfalls mitgenommen aussahen und stark husteten.
Nur noch vereinzelte, kleine Feuerherde züngelten hier und da, die zahme Nachhut der verschlingenden Horde. Sie verloschen bald. Doch die Landschaft war schauerlich verändert: Überall war alles verkohlt, versengt. Vorher herrschten sattes Grün und tiefes Braun, jetzt waren es die Farben Grau und Schwarz.
Und dennoch war nicht alles vernichtet: Zwischen den abgetöteten Pflanzen blieben immer unsichtbare Keime, welche die Erneuerung in sich trugen. Alaya erinnerte sich jetzt, wie ihr die Mutter das oft erklärt hatte.
Als sie sich langsam und triefend vor Nässe aufgerichtet hatten, warfen sich alle drei auf die Knie und Alaya sagte heiser und hüstelnd: „Dank dir Himmel, dank dir Erde und dank dir, unser Wald. Wir sind eure Geschöpfe und stehen in eurer Schuld… Auch dir sei Dank, Feuer, daß du uns doch verschont hast.“
Etliche Momente danach fragte schließlich Ranadra: „Ob die Menschen noch im Dorf sind?“
Alaya drehte sich in die Richtung des Dorfes. Durch die plötzlich entstandenen, schwarzen Baumgerippe, die vor kurzem noch üppige, grüne Kronen hatten, konnte man die verkohlten Überreste der Häuser sehen.
„Ich glaube nicht, daß sie das überlebt hätten“, erwiderte sie, obwohl sie noch eine kleine Befürchtung hatte, daß diese Ungeheuer vielleicht auch so etwas irgendwie meistern würden. Langsam schritten die drei über die verbrannte Erde, inmitten verkohlter Pflanzen, die noch kurze Zeit vorher einen üppigen Wald bildeten. Hier und da schlängelten sich noch kleine Flämmchen, die aber schwach waren und keine Nahrung mehr finden konnten, um zu wachsen. Alaya erinnerte sich an die Worte ihrer Mutter, daß auch das Feuer ein Wesen war und daß es nur deshalb irgendwo wütete, weil etwas nicht mehr im Gleichgewicht und es provoziert worden war. Bei ihnen hatten es diese schrecklichen Menschen beschworen.
„Was wohl mit Tobus passiert ist?“, sagte Ranadra. Die anderen zwei gaben keine Antwort. Alaya wollte lieber nicht daran denken, wie es ihm ergangen war.
Als sie wenige Schritte vom Dorf entfernt waren, blieben sie stehen und schauten gespannt auf die gespenstischen Überreste ihrer vernichteten Heimat. Sie lauschten, ob sie verdächtige Geräusche hören konnten. Doch nur das verbrannte Holz gab ein unangenehmes Knacken und Knistern von sich.
Sie faßten sich ein Herz und schritten langsam ins Dorf.





























