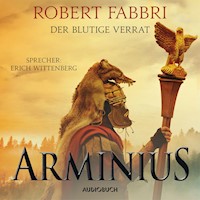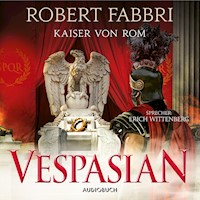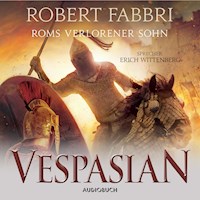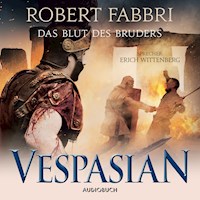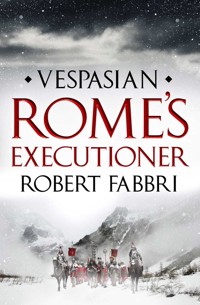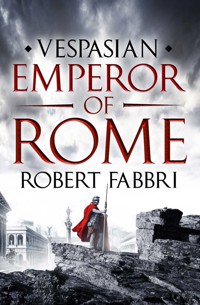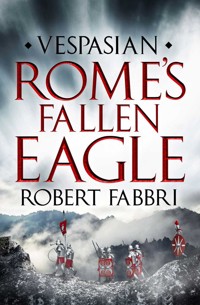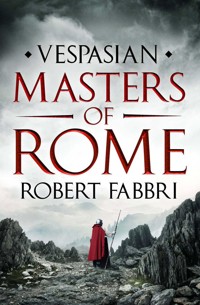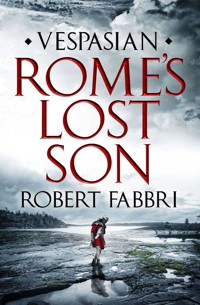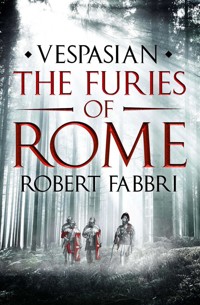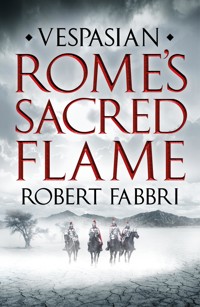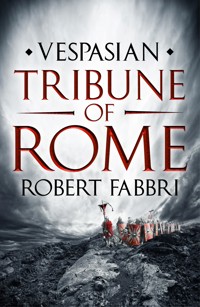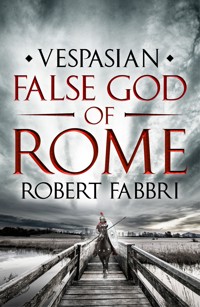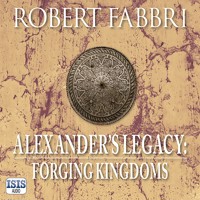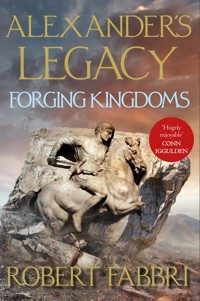Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: AUDIOBUCH
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Das Ende des Alexanderreichs
- Sprache: Deutsch
Wer tritt Alexanders Erbe an? Ein packendes Breitwand-Panorama: «Game of Thrones» im makedonischen Königreich – von Bestsellerautor Robert Fabbri! LASST DIE KÄMPFE BEGINNEN! Babylon, 323 v. Chr. Alexander der Große ist tot. Er hinterlässt das mächtigste Imperium, das die Welt je gekannt hat. Die Kunde vom unerwarteten Tod des Herrschers jagt durch das Land, und ein skrupelloser Kampf um den Thron beginnt. Ein gefährliches Netz aus Intrigen und Lügen breitet sich aus. Allianzen werden geknüpft und gebrochen. Jeder Rivale verfolgt sein eigenes Ziel. Wer übernimmt nun die Macht, ohne einen rechtmäßigen Erben? Wer wird siegreich aus diesem Kampf mit ungleichen Mitteln hervorgehen? Am Ende wird nur ein Mann – oder eine Frau – übrig bleiben …
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Robert Fabbri
Alexanders Erbe: Die Macht dem Stärksten
Historischer Roman
Über dieses Buch
LASST DIE KÄMPFE BEGINNEN!
Babylon, 323 v. Chr.
Alexander der Große ist tot. Er hinterlässt das mächtigste Imperium, das die Welt je gekannt hat. Die Kunde vom unerwarteten Tod des Herrschers jagt durch das Land, und ein skrupelloser Kampf um den Thron beginnt. Ein gefährliches Netz aus Intrigen und Lügen breitet sich aus. Allianzen werden geknüpft und gebrochen. Jeder Rivale verfolgt sein eigenes Ziel.
Wer übernimmt nun die Macht, ohne einen rechtmäßigen Erben? Wer wird siegreich aus diesem Kampf mit ungleichen Mitteln hervorgehen? Am Ende wird nur ein Mann – oder eine Frau – übrig bleiben …
«Eine hervorragende neue Serie vom durchweg brillanten Robert Fabbri.» Sunday Sport
Vita
Robert Fabbri, geboren 1961, lebt in London und Berlin. Er arbeitete nach seinem Studium an der University of London 25 Jahre lang als Regieassistent und war an so unterschiedlichen Filmen beteiligt wie «Die Stunde der Patrioten», «Hellraiser», «Hornblower» und «Billy Elliot – I Will Dance». Aus Leidenschaft für antike Geschichte bemalte er 3500 mazedonische, thrakische, galatische, römische und viele andere Zinnsoldaten – und begann schließlich zu schreiben. Mit seiner epischen historischen Romanserie «Vespasian» über das Leben des römischen Kaisers wurde Robert Fabbri Bestsellerautor.
Mehr zum Autor und zu seinen Büchern: www.robertfabbri.com
Anja Schünemann studierte Literaturwissenschaft und Anglistik in Wuppertal. Seit 2000 arbeitet sie als freiberufliche Übersetzerin der verschiedensten Genres und hat seitdem große Romanprojekte und Serien von namhaften Autorinnen und Autoren wie Philippa Gregory, David Gilman sowie Robert Fabbri aus dem Englischen ins Deutsche übertragen. Historische Romane sind eines ihrer Spezialgebiete: Von der Antike bis zum Mittelalter, in die frühe Neuzeit sowie bis ins 20. Jahrhundert verfügt sie über einen reichen Wissensschatz, der ihre Übersetzungen zu einem gelungenen Leseerlebnis macht.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel «Alexander’s Legacy: To the Strongest» bei Corvus/Atlantic Books Ltd., London.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Dezember 2021
Copyright © 2021 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
«Alexander's Legacy: To the Strongest» Copyright © 2020 by Robert Fabbri
Redaktion Tobias Schumacher-Hernández
Karte und Illustration Anja Müller
Covergestaltung Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich,
nach der Originalausgabe von Atlantic Books Ltd.
Coverabbildung Larry Rostant
ISBN 978-3-644-00957-8
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für meinen Agenten Ian Drury, mit dem ich eine Leidenschaft für diese historische Epoche teile.
Prolog
Babylon, Sommer 323 v. Chr.
«Dem Stärksten.»
Der große Ring von Makedonien verschwamm in Alexanders sich trübender Sicht; seine Hand zitterte von der Anstrengung, ihn hochzuhalten und dabei zu sprechen. Dieser Ring mit der sechzehnstrahligen Sonne repräsentierte die Macht über das größte Reich, das in der bekannten Welt jemals erobert worden war – ein Reich, das er so früh, zu früh vererben musste. Denn er, Alexander, der dritte König von Makedonien, der diesen Namen trug, hatte nun die endgültige Gewissheit: Er lag im Sterben.
In ihm brodelte Wut auf die launischen Götter, die so vieles gewährten, jedoch einen solch hohen Preis forderten. Sterben zu müssen, obwohl sein Ehrgeiz erst zur Hälfte befriedigt war – diese Ungerechtigkeit vergällte ihm seine Errungenschaften und machte den Geschmack des Todes, der in seiner Kehle aufstieg, umso bitterer. Bislang hatte er lediglich den Osten unter seine Herrschaft gebracht; der Westen hätte erst noch Zeuge seiner Ruhmestaten werden sollen. Und doch – war er nicht gewarnt worden? Hatte nicht der Gott Amun ihn ermahnt, nicht der Hybris zu verfallen, als er vor bald zehn Jahren das Orakel der Gottheit in der Oase Siwa weit draußen in der ägyptischen Wüste befragt hatte? War dies nun seine Strafe dafür, dass er den Rat Amuns missachtet und mehr gewagt hatte als je ein Sterblicher vor ihm? Hätte er noch die Kraft aufgebracht, dann hätte Alexander geweint, um sich selbst und um den Ruhm, der ihm nun durch die Finger glitt.
Er hinterließ keinen natürlichen Erben, wem also würde er erlauben, seine Nachfolge anzutreten? Wem würde er die Gelegenheit geben, in die Höhen aufzusteigen, die er bereits erreicht hatte? Die Liebe seines Lebens, Hephaistion, der einzige Mensch, den er als Gleichgestellten behandelt hatte, sowohl auf dem Schlachtfeld als auch im gemeinsamen Bett, war ihm vor weniger als einem Jahr entrissen worden; nur Hephaistion, der schöne und stolze Hephaistion, wäre würdig gewesen, weiter zu vergrößern, was er, Alexander, bislang erschaffen hatte. Doch Hephaistion war nicht mehr.
Alexander hielt den Ring dem Mann hin, der am nächsten bei ihm stand, rechts von seinem Bett. Er war der ranghöchste seiner sieben Leibwächter, die ihn umringten, begierig zu erfahren, wie er in diesen seinen letzten Augenblicken entscheiden würde. Alle standen reglos lauschend in dem Gemach mit Gewölbedecke, das mit glasierten Fliesen in Tiefblau, Karminrot und Gold dekoriert war, im großen Palast des Nebukadnezar im Herzen Babylons. Hier in der Düsternis, im schwachen Schein weniger Öllampen – denn durch die hohen Fenster drang kaum Licht vom bedeckten frühabendlichen Himmel herein –, warteten sie darauf, ihr Schicksal zu erfahren.
Perdikkas, der Befehlshaber der Hetairenreiterei, der zum Chiliarchen aufgestiegen war, bislang dem makedonischen Königshaus der Argeaden treu, jedoch von persönlichem Ehrgeiz erfüllt und skrupellos, nahm das Symbol der höchsten Macht vom Zeigefinger seines Königs. Zum zweiten Mal stellte er hörbar angespannt die Frage: «Wem von uns hinterlässt du deinen Ring, Alexander?» Er schaute rasch in die Runde, dann richtete er den Blick wieder auf seinen sterbenden König und fügte hinzu: «Mir?»
Alexander machte keine Anstalten zu antworten. Er betrachtete das Halbrund der Männer, die ihm am nächsten standen, allesamt herausragende Feldherren mit der Fähigkeit, eigenständig zu handeln, und alle von der menschlichen Begierde nach Macht erfüllt: Leonnatos, hochgewachsen und eitel, trug sein langes, blondes Haar genau wie sein König, äffte dessen Äußeres nach, jedoch war er ihm so treu ergeben, dass er ihn mit seinem eigenen Körper gedeckt hatte, als Alexander im fernen Indien verwundet worden war. Peukestas neben ihm begann sich in seiner Kleidung bereits den einheimischen Sitten anzupassen – er hatte auch als Einziger unter den Leibwächtern Persisch gelernt. Lysimachos, der Kühnste von allen, zeichnete sich durch eine Tapferkeit aus, mit der er nicht selten seine eigenen Kameraden in Gefahr brachte. Peithon, mürrisch, aber unerschütterlich, führte selbst die grausamsten Befehle aus, ohne sie zu hinterfragen, wo andere sich gescheut hätten. Dann waren da noch die beiden Älteren: Aristonous, einst der Leibwächter von Alexanders Vater Philipp, dem Zweiten dieses Namens; der einzige Überlebende des alten Regimes, aus dessen Rat die Weisheit eines erfahrenen alten Kriegers sprach. Und schließlich Ptolemaios – was war von Ptolemaios zu halten, dessen Aussehen darauf hindeutete, dass er ein Bastard war, ein unehelicher Halbbruder? Einerseits milde und nachsichtig, andererseits jedoch zu skrupellosem und geschicktem politischem Handeln fähig, wenn jemand diese Seite seines Wesens ausnutzte. Auf militärischem Gebiet weniger fähig als die anderen, würde er politisch auf lange Sicht wohl am erfolgreichsten sein.
Als Perdikkas die Frage ein drittes Mal stellte, richtete Alexander den Blick an den sieben vorbei auf die Männer dahinter, Männer, die ihn auf seinem zehnjährigen Eroberungszug begleitet, die Gefahren und Triumphe mit ihm geteilt hatten. Nun standen sie schweigend in den Schatten und lauschten angespannt auf seine Antwort. Sein matter Blick glitt über das runde Dutzend vertrauter Gesichter, bis er an Kassandros hängenblieb, der neben seinem jüngeren Halbbruder Iolaos stand. Alexander glaubte in seinen Augen Triumph zu erkennen. Seine Krankheit hatte begonnen, einen Tag nachdem Kassandros als Bote seines Vaters Antipatros aus Makedonien eingetroffen war. Hatte Antipatros, der Mann, der in den vergangenen zehn Jahren als Regent im Mutterland geherrscht hatte, seinen ältesten Sohn mit Gift, der Waffe der Frauen, zu seiner Ermordung ausgesandt, statt selbst Alexanders Ruf zu folgen? Iolaos als sein Mundschenk hätte ihm das Gift leicht zuführen können. Alexander verfluchte Kassandros im Stillen – er hatte den rotblonden, pockennarbigen Musterknaben schon immer verabscheut, und dieser erwiderte die Abneigung, erst recht, da er die Schmach empfand, all die Jahre übergangen worden zu sein. Alexanders Gedanken kehrten zu Antipatros zurück, hundert Tagesreisen entfernt in Pella, der Hauptstadt von Makedonien, und zu dessen andauernder Fehde mit seiner, Alexanders, Mutter Olympias, die in ihrer Heimat Molossien im Königreich Epirus brütete und Ränke schmiedete. Wie würde das ausgehen, wenn er nicht mehr da war und die beiden gegeneinander ausspielte? Wer würde wen töten?
Doch dann erblickte Alexander am hinteren Ende des Sterbegemachs, halb hinter einer Säule verborgen, eine Frau, eine schwangere Frau: seine baktrische Ehefrau Roxane, die drei Monate vor der Niederkunft stand. Welche Aussichten hätte ein Kind aus zwei Welten? Nicht viele teilten seinen Traum, die Völker des Ostens und des Westens zu einen; nur wenige Makedonen würden sich hinter ein Neugeborenes stellen, dessen Mutter eine asiatische Wildkatze war.
Alexander schloss die Augen in der Gewissheit, dass auf sein Dahinscheiden Unruhen und Kämpfe folgen würden, sowohl in Makedonien als auch hier in Babylon und dann überall in den unterworfenen griechischen Stadtstaaten sowie unter denjenigen seiner Satrapen, die sich in dem riesigen von ihm geschaffenen Reich Herrschaftsgebiete zu eigen gemacht hatten; Männern wie Antigonos dem Einäugigen, dem Satrapen von Phrygien, und Menandros, dem Satrapen von Lydien, dem letzten von Philipps Generälen.
Dann war da noch Harpalos, sein Schatzmeister, dem er bereits einmal seine Untreue verziehen und der sich, um sich Alexanders Zorn nicht ein zweites Mal stellen zu müssen, mit achthundert Talenten in Gold und Silber abgesetzt hatte, genug, um eine gewaltige Streitmacht aufzustellen oder den Rest seiner Tage im Überfluss zu leben – welches von beidem würde er wählen?
Und was würde Krateros tun? Krateros, der Liebling der Armee, als Feldherr einzig von Alexander selbst übertroffen? Gerade befand er sich irgendwo zwischen Babylon und Makedonien, mit zehntausend Veteranen auf dem Weg in die Heimat. Würde er finden, er hätte zu Alexanders Nachfolger ernannt werden sollen? Doch Alexander, der nun seine Kräfte schwinden fühlte, hatte seine Entscheidung getroffen, und als Perdikkas die Frage erneut stellte, schüttelte er den Kopf – weshalb sollte er verschenken, was er errungen hatte? Weshalb sollte er einem anderen die Gelegenheit verschaffen, sich mit ihm auf eine Stufe zu stellen oder ihn gar noch zu übertreffen? Weshalb sollte er nicht für alle Zeiten der Einzige sein, den man unter dem Beinamen «der Große» kannte? Nein, er würde es nicht tun; er würde den Stärksten nicht benennen; er würde ihnen keine Hilfestellung geben.
Sollten sie es unter sich ausmachen.
Zum letzten Mal schlug er die Augen auf, blickte zur Decke empor, und sein Atem wurde schwächer.
Alle sieben, die um das Bett herumstanden, beugten sich vor, jeder in der Hoffnung, seinen Namen zu hören.
Alexanders Mundwinkel verzogen sich zu einem letzten Lächeln. «Ich sehe gewaltige Leichenspiele voraus.» Er seufzte, dann schlossen sich seine Augen, die in dieser Welt mehr Wunder geschaut hatten als die irgendeines anderen Menschen zuvor.
Und sie sahen nichts mehr.
Perdikkas der Halberwählte
Der Ring lag schwer in seiner Hand, als Perdikkas die Finger darum schloss; es war nicht das Gewicht des Goldes, aus dem er geschmiedet war, sondern das der Macht, die in ihm lag. Perdikkas schaute auf Alexanders regloses Gesicht hinunter, im Tode ebenso schön wie im Leben, und er fühlte, wie seine Welt ins Wanken geriet, sodass er sich mit der freien Hand am Kopfteil des Bettes festhalten musste. In das alte Eichenholz waren lebendig wirkende Tiergestalten geschnitzt.
Er atmete tief durch, dann richtete er den Blick auf seine Gefährten, die anderen sechs Leibwächter, die auf Leben und Tod auf den nunmehr verstorbenen König eingeschworen waren. Ihre Mienen zeugten von der Bedeutungsschwere des Augenblicks: Leonnatos und Peukestas liefen die Tränen, und ihre Brust bebte von Schluchzern. Ptolemaios’ Gesicht war erstarrt, die Augen geschlossen, als sei er tief in Gedanken versunken. Lysimachos spannte immer wieder die Kiefermuskeln an und ballte die Fäuste so fest, dass seine Fingerknöchel weiß wurden. Aristonous rang nach Atem, dann vergaß er seine Würde, sank in die Hocke und stützte sich mit einer Hand am Boden ab. Peithon starrte Alexander mit großen, ausdruckslosen Augen an.
Perdikkas öffnete seine Hand und schaute auf den Ring hinunter. Dies war sein Moment – sollte er es wagen, ihn für sich zu beanspruchen? Immerhin hatte Alexander ihn dazu erwählt, den Ring zu empfangen.
Und er hat klug gewählt, denn von allen hier in diesem Raum bin ich seiner am meisten würdig, ich bin sein wahrer Erbe.
Er nahm den Ring zwischen Daumen und Zeigefinger und betrachtete ihn eingehend: so klein, so mächtig. Kann ich ihn beanspruchen? Würden die anderen es zulassen? Die Antwort kam schnell, unliebsam und wenig überraschend. In der zweiten Gruppe abseits des Bettes stand sein jüngerer Bruder Alketas zwischen Eumenes, dem listigen kleinen griechischen Sekretär, und dem ergrauten Veteranen Meleagros. Alketas fing seinen Blick auf und schüttelte langsam den Kopf; er hatte Perdikkas’ Gedanken gelesen. Überhaupt hatten alle im Raum seine Gedanken gelesen, denn nun ruhten alle Blicke auf ihm.
«Er hat ihn mir gegeben», betonte Perdikkas, und aus seiner Stimme klang die Autorität des Symbols, das er vor sich hielt. «Er hat mich erwählt.»
Aristonous richtete sich auf und erwiderte mit matter Stimme: «Aber er hat dich nicht benannt, Perdikkas, auch wenn ich wünschte, er hätte es getan.»
«Dennoch halte ich den Ring in Händen.»
Ptolemaios deutete ein verwirrtes Lächeln an und zuckte die Schultern. «Es ist wahrhaftig ein Jammer, aber er hat dich halb erwählt, und ein halberwählter König ist nur ein halber König. Wo ist die andere Hälfte?»
«Ob er jemanden erwählt hat oder nicht», dröhnte eine Stimme, rau vom Kommandieren auf dem Schlachtfeld, «die Heeresversammlung entscheidet darüber, wer König von Makedonien wird. So ist es von jeher gewesen.» Meleagros trat vor, eine Hand am Griff seines Schwertes. Ein grauer Vollbart dominierte sein wettergegerbtes Gesicht. «Freie Makedonen haben zu bestimmen, wer auf dem makedonischen Thron sitzt, und freie Makedonen haben das Recht, den Leichnam des toten Königs zu sehen.»
Zwei dunkle Augen starrten Perdikkas an, forderten ihn heraus, sich den alten Sitten zu widersetzen; Augen, die voller Groll waren, das wusste Perdikkas nur zu gut, denn Meleagros war fast doppelt so alt wie er und doch nicht über den Rang eines Infanteriekommandeurs hinausgekommen – Alexander hatte ihn nie in höhere Ämter erhoben. Doch dass er nicht weiter aufstieg, war nicht mangelnder Fähigkeit geschuldet, sondern gerade seinen Qualitäten als Führer einer Phalanx. Es bedurfte großen Geschicks, die sechzehn Mann breite und tiefe makedonische Phalanx zu befehligen; noch größeren Sachverstand erforderte es, vierzig dieser zweihundertsechsundfünfzig Mann starken Einheiten, Syntagmata genannt, im Verbund zu befehligen, und Meleagros war der beste Mann für diese Aufgabe – möglicherweise mit Ausnahme von Antigonos dem Einäugigen, räumte Perdikkas ein. Stets das richtige Tempo zu halten, während die Einheit in wechselndem Gelände manövrierte, sodass jeder Mann mit seiner sechzehn Fuß langen Sarissa, der Lanze, seinen Platz in der Formation behielt, das konnte man nicht in einer Feldzugsaison erlernen. Die Stärke der Phalanx bestand in ihrer Fähigkeit, auf jeden Mann in der Frontreihe fünf Lanzen zum Einsatz zu bringen. Armeen waren daran zerbrochen, seit Alexanders Vater diese Formation eingeführt hatte, aber nur weil Männer wie Meleagros es verstanden, die Reihen geordnet zu halten. Nur so konnten die fünf vordersten Reihen ihre Waffen einsetzen, während die hinteren Reihen die ihren dazu nutzten, Wurfgeschosse abzulenken, die von oben auf sie niedergingen. Meleagros sorgte für die Sicherheit seiner Männer, und sie liebten ihn dafür, und sie waren zahlreich. Meleagros durfte man nicht unterschätzen.
Perdikkas wusste, dass er geschlagen war, wenigstens vorerst; um sein Streben zu verwirklichen, brauchte er die Armee auf seiner Seite, sowohl die Infanterie als auch die Kavallerie, und Meleagros vertrat die Infanterie. Götter, wie ich die Infanterie hasse, und ich hasse diesen Hurensohn dafür, dass er mir im Wege steht – einstweilen. Er lächelte. «Du hast natürlich recht, Meleagros. Wir stehen hier und diskutieren miteinander, was zu tun ist, und dabei vergessen wir unsere Pflicht gegenüber unseren Männern. Wir sollten die Armee versammeln und ihr die Kunde mitteilen. Alexanders Leichnam sollte in den Thronsaal gebracht werden, damit die Männer daran vorbeidefilieren und ihm die letzte Ehre erweisen können. Sind wir uns wenigstens darüber alle einig?» Er schaute sich um und sah keine Anzeichen von Widerspruch. «Gut. Meleagros, rufe du die Infanterie zusammen, ich werde indessen die Kavallerie versammeln. Außerdem werde ich Boten in alle Satrapien entsenden, um die Nachricht zu überbringen. Und lasst uns stets daran denken, dass wir alle Alexanders Brüder sind.» Er schwieg kurz, um seine Worte wirken zu lassen, dann nickte er den anderen zu und ging zur Tür. Er brauchte ein wenig Zeit für sich, um seine Position zu überdenken.
Doch es war ihm nicht vergönnt. Während bei Alexanders Leichnam ein Dutzend Gespräche einsetzten, die in dem hohen Raum widerhallten, fühlte Perdikkas, wie jemand neben ihm in Gleichschritt fiel.
«Du brauchst meine Hilfe», sagte Eumenes, ohne zu ihm aufzublicken, als sie durch die Tür in den zentralen Hauptkorridor des Palastes hinaustraten.
Perdikkas schaute auf den Griechen hinunter, der einen ganzen Kopf kleiner war als er, und fragte sich, weshalb Alexander ihm eigentlich das militärische Kommando übertragen hatte, das frei geworden war, als er, Perdikkas, Hephaistions Nachfolge angetreten hatte. Es hatte erheblichen Unmut verursacht, als Alexander Eumenes zum ersten nicht makedonischen Befehlshaber der Hetairenreiterei ernannt hatte, zum Lohn für seine jahrelangen Dienste als Sekretär Philipps und später, nach dessen Ermordung, als Alexanders eigener Sekretär. «Was könntest du denn schon tun?»
«Ich wurde dazu erzogen, höflich zu Leuten zu sein, die Unterstützung anbieten – in Kardia gilt das als gutes Benehmen. Aber ich räume ein, dass wir uns in vielerlei Hinsicht von den Makedonen unterscheiden, beispielsweise haben wir von jeher eine Vorliebe dafür, unsere Schafe zu essen.»
«Und wir haben von jeher eine Vorliebe dafür, Griechen zu töten.»
«Nicht so viele, wie von ihren eigenen Landsleuten getötet werden. Aber wie dem auch sei, du brauchst meine Hilfe.»
Perdikkas erwiderte eine Weile lang nichts, während sie nun zügig den Korridor entlanggingen. Er war hoch und breit, vom Alter muffig, und das feuchte Klima Babylons hatte den geometrischen Mustern an den Wänden zugesetzt – die Farben waren verblasst und blätterten ab. «Also gut, du hast mich neugierig gemacht.»
«Eine vorzügliche Verfassung – nur durch Neugier können wir Gewissheit erlangen, denn sie treibt uns dazu, ein Thema von allen Seiten zu betrachten.»
«Ja, ja, das ist bestimmt alles sehr weise, aber …»
«Aber du bist nur ein stumpfsinniger Soldat und hast keinen Sinn für Weisheit?»
«Weißt du, Eumenes, einer der Gründe, weshalb die Leute dich nicht leiden können, ist …»
«Dass ich ihnen immerfort ins Wort falle und ihre Sätze beende?»
«Genau!»
«Dabei dachte ich, es läge nur daran, dass ich ein schmieriger Grieche bin. Nun, mir scheint, man lernt mit dem Alter unweigerlich dazu, es sei denn natürlich, man wäre Peithon.» Ein listiges Funkeln trat in seine Augen, und er blickte zu Perdikkas auf. «Oder Arrhidaios.»
Perdikkas machte eine wegwerfende Handbewegung. «Arrhidaios hat in seinen dreißig Jahren nicht mehr gelernt, als sich zu bemühen, nicht aus beiden Mundwinkeln gleichzeitig zu sabbern. Wahrscheinlich weiß er nicht einmal, wer sein Vater ist.»
«Er mag nicht wissen, dass er Philipps Sohn ist, aber wir alle wissen es. Und die Armee ebenfalls.»
Perdikkas blieb stehen und wandte sich dem Griechen zu. «Was soll das heißen?»
«Siehst du, ich sagte doch, du brauchst meine Hilfe. Du hast es selbst ausgesprochen: Er ist Philipps Sohn. Somit ist er Alexanders Halbbruder und als solcher sein legitimer Erbe.»
«Aber er ist geistesschwach.»
«Und? Die einzigen anderen direkten Erben sind Herakles, Barsines vierjähriger Bastard, und was immer die asiatische Hure Roxane im Bauch trägt. Nun, Perdikkas, hinter wen wird sich die Armee stellen, wenn sie zwischen diesen dreien wählen muss?»
Perdikkas knurrte und wandte sich ab. «Niemand würde sich für einen Schwachkopf entscheiden.»
«Wenn du das glaubst, schließt du zugleich dich selbst aus.»
«Schere dich fort, du griechischer Schwächling, und lass mich in Ruhe. Du kannst dich nützlich machen, indem du deine Kavallerie versammelst.»
Doch während Perdikkas davonging, war er sicher, Eumenes murmeln zu hören: «Du brauchst meine Hilfe wirklich dringend, und du wirst sie bekommen, ob es dir passt oder nicht.»
Antigonos der Einäugige
Götter, wie ich die Kavallerie hasse. Antigonos, der makedonische Statthalter von Phrygien, murmelte eine Reihe Kraftausdrücke vor sich hin, während er zusah, wie die lanzenbewehrte, schildlose schwere Reiterei auf seinem linken Flügel versuchte, sich im unebenen Gelände zu formieren. Die Reiter waren viel weiter von der linken Flanke seiner Phalanx entfernt, als er es befohlen hatte. Durch diesen Fehler entstand eine so große Lücke, dass seine Peltasten sie nicht würden schließen können, nachdem sie die Plänkler von dem Buschland vertrieben hatten, das die gegenüberliegende Flanke des Feindes schützte. Außerdem wurden so seine mit Wurfspeeren bewaffneten leichten Reiter, thrakische Söldner, zu weit nach außen gedrängt, um schnell auf seine Signale zu reagieren. Dennoch hoffte er, mit einem einzigen gewaltigen Schlag seiner zwölftausendachthundert Mann starken Phalanx das Werk dieses Tages zu vollenden. Schon sein ganzes Erwachsenenleben lang war Antigonos Infanteriekommandeur. Er stand als Anführer selbst mit einer Sarissa bewehrt in vorderster Front, äußerlich nicht von seinen Männern unterscheidbar, während er dem Signalgeber sechs Reihen weiter hinten Kommandos zurief. Mit seinen neunundfünfzig Jahren erfreute er sich noch immer an der Kraft der Kriegsmaschine, die sein alter Freund König Philipp eingeführt hatte. Er kannte auch den Wert der Kavallerie, welche die schwerfälligen Flanken der Phalanx vor feindlicher Reiterei schützte – doch gerade deshalb empfand er solche Abneigung gegen sie, denn diese Leute brüsteten sich immerfort damit, dass die Infanterie ohne sie tot wäre. Ärgerlicherweise entsprach das der Wahrheit.
«Reite dort hinüber», bellte Antigonos einem jungen Untergebenen zu, «und richte meinem Schwachkopf von einem Sohn aus, wenn ich fünfzig Schritt sage, meine ich nicht hundertfünfzig. Ich mag nur ein Auge haben, aber blind bin ich nicht. Und sage ihm, er soll sich beeilen, in einer Stunde wird es dunkel.» Er kratzte sich in seinem grauen Bart, der buschig und lang gewachsen war, dann biss er von der Zwiebel ab, die sein Abendessen darstellte. Trotz seiner Jugend zeigte sein Sohn vielversprechende Ansätze, das musste Antigonos einräumen, auch wenn Demetrios sich – entsprechend seinem Hang zur Großspurigkeit – zur Kavallerie hingezogen fühlte. Antigonos wünschte nur, sein Sohn möge Befehle gewissenhafter befolgen und sich mehr Gedanken um mögliche Folgen machen, wenn er tat, was ihm beliebte. Der Junge brauchte eine Lektion in Disziplin, sinnierte Antigonos, doch dabei kam ihm stets seine Frau Stratonike in die Quere, die ganz vernarrt in ihren Sohn war und alles guthieß, was er tat. Um Demetrios von ihrem Rockzipfel loszureißen, hatte Antigonos den Fünfzehnjährigen auf seinen ersten Feldzug mitgenommen und ihm den Befehl über die Hetairenreiterei übertragen.
Antigonos kaute seine Zwiebel und überblickte von seinem Kommandoposten auf einem Hügel mittig hinter seiner Armee den Rest der Formation. Er schluckte und spülte den Bissen mit starkem geharztem Wein hinunter. Mit einem lauten Rülpser gab er den Weinschlauch einem bereitstehenden Sklaven, dann atmete er tief die warme Spätnachmittagsluft ein. Er mochte dieses Land mit seinen zerklüfteten Bergen und schnell strömenden Flüssen, den Felsen und dem Gestrüpp. Es war eine unwirtliche Landschaft, die ihn an seine Heimat im makedonischen Hochland erinnerte. Ein Land, das einen Mann wie mit dem Meißel zurechthaute, statt ihn mit sanften Händen zu formen. Doch so gut die Landschaft auch geeignet sein mochte, den Charakter eines Mannes zu bilden, sie gefährdete den reibungslosen Ablauf militärischer Operationen.
Diese Betrachtungen gingen Antigonos im Kopf herum, während er die Armee des Satrapen von Kappadokien überblickte, die ihm gegenüber in Stellung gegangen war. In ihrem Rücken verlief ein hundert Schritt breiter Fluss, von einer steinernen Brücke mit drei Bogen überspannt. Antigonos ließ den Blick über die Reihen der Stammeskrieger in ihren bunten Gewändern wandern, deren Farben in der sinkenden Sonne leuchteten. Sie waren um ein paar tausend Mann regulärer persischer Infanterie gruppiert, die mittig vor der Brücke im Schutz ihrer aufrecht gestellten Langschilde die Sehnen auf ihre Bogen spannten. Die Männer trugen bestickte Hosen, lange Hemdgewänder in leuchtendem Orange und Tiefblau und ein dunkelgelbes Stirnband. Dies war die ursprüngliche Garnisonstruppe der Satrapie, mit deren Hilfe der von Dareios ernannte Ariarathes sich den makedonischen Eroberern zehn Jahre lang erfolgreich widersetzt hatte, seit Alexander nach einem kurzen Vorstoß bis nach Gordion seine Armee über die Küstenroute an Zentralanatolien vorbei gen Süden geführt hatte.
Doch nun hatte Antigonos diesen Kriegsfürsten des Binnenlandes in die Enge getrieben, der immer wieder seine Nachschublinien überfallen und viele seiner Männer überall im Land einen qualvollen Tod auf Pfählen hatte erleiden lassen. Oder wenigstens hatte er seine Armee in die Enge getrieben, denn Antigonos zweifelte nicht daran, dass Ariarathes selbst entkommen würde, wie auch immer die bevorstehende Schlacht ausgehen mochte. Es war eine Schande nach der Anstrengung des Gewaltmarsches von Ankyra über die Königsstraße, das mächtige Bauwerk, das die großen Städte des Perserreiches mit dem Mittelmeer verband. Dank seiner Schnelligkeit hatte er Ariarathes’ Armee überrumpelt, während diese gerade versuchte, sich nach ihrem jüngsten Raubzug auf der schmalen Brücke über den Fluss Halys nach Kappadokien zurückzuziehen. In diesem Flaschenhals gefangen, hatte Ariarathes keine andere Wahl gehabt, als zum Gegner herumzuschwenken und sich dem Kampf zu stellen, während er versuchte, möglichst viele seiner Männer aus der prekären Lage in Sicherheit zu bringen. Nur der Sonnenuntergang konnte ihn retten. Antigonos sah zu, wie viele Dutzend der Rebellen über die Brücke strömten, und er zweifelte nicht daran, dass Ariarathes sie als Erster überquert hatte. Aber heute werde ich ihm die Flügel stutzen, mag er selbst auch überleben. Er schaute sich nach der sinkenden Sonne um. Allerdings muss ich es jetzt gleich tun und schnell. Mit einem raschen Blick nach links stellte er fest, dass Demetrios endlich wie vorgesehen in Stellung war. Zufrieden, dass alles bereit war, stopfte Antigonos sich den Rest der Zwiebel in den Mund, trottete im Laufschritt den Hügel hinunter und marschierte durch die Phalanx zu seiner Position in der vordersten Reihe. Dabei rieb er sich die Hände und kicherte bei der Aussicht auf einen anständigen Kampf.
«Danke, Philotas», sagte er und nahm von einem etwa gleichaltrigen Mann seine Sarissa entgegen. «Zeit, dass wir möglichst viele dieser Ratten ersäufen», fügte er grinsend hinzu. Er nahm seinen runden Schild, den er am Riemen über der Schulter getragen hatte, und schob seinen linken Arm durch die Schlaufe. So konnte er seine Lanze mit beiden Händen fassen und hatte dennoch einen gewissen Schutz, auch wenn er den Schild nicht so einsetzen konnte wie ein Hoplit sein größeres Hoplon. Ohne sich umzuschauen, rief er dem Signalgeber zu: «Phalanx vorwärts, Angriffstempo.»
Drei langgezogene Töne erschollen und wurden überall entlang der gut vier Stadien breiten Front der Phalanx wiederholt. Als das letzte Signal in der Ferne ertönte, holte der erste Hornbläser tief Luft und blies einen langen, schrillen Ton. Fast wie ein Mann machte die Frontreihe einen Schritt nach vorn, gefolgt von der nächsten. Glied um Glied setzte sich in Marsch, sodass die Bewegung durch das Heer lief wie eine Welle; wie Wogen, die ans Ufer branden, strömte Antigonos’ Armee dem Feind entgegen.
Antigonos marschierte vorwärts, erfüllt von dem Stolz, den er stets empfand, wenn er im Herzen einer Phalanx vorrückte, die mächtige Lanze aufrecht haltend, sodass er einen möglichst großen Teil seines Körpers mit dem Schild decken konnte, während sie sich dem Feind näherten. Götter, ich könnte ewig so weitermachen. Er hatte in der Phalanx gekämpft, seit diese Formation eingeführt worden war, zuerst in Philipps Kriegen gegen den Stadtstaat Byzanz und die thrakischen Stämme, um seine Grenzen nach Osten und Norden abzusichern. Dort hatten die Stammeskrieger sich an dem Wald eiserner Spitzen aufgespießt, die aus der Formation ragten. Nur ganz wenige waren überhaupt nah genug herangekommen, um den Kampf Mann gegen Mann zu beginnen, der ihre Stärke war. Doch ihre eigentliche Bewährungsprobe hatte die neue, tiefere Formation in Griechenland bestanden: Philipp dehnte seine Macht allmählich nach Süden aus, bis die griechischen Städte unter makedonischer Oberherrschaft standen. Vorbei waren die Tage, da Makedonen öffentlich verspottet wurden und als kaum zivilisierte Provinzler von fragwürdigem hellenischem Blut galten – derlei Ansichten äußerte man heute nur noch hinter vorgehaltener Hand. Die schwerere Phalanx hatte die Formationen der Hopliten vernichtet, und die lanzenbewehrte makedonische Kavallerie hatte ihre mit Wurfspeeren bewaffneten Gegner vom Schlachtfeld gefegt. Antigonos hatte jeden Augenblick genossen – nie war er glücklicher als im Herzen einer Schlacht.
Allerdings hatte Alexander ihn zurückgelassen, bald nachdem er nach Asien weitergezogen war und in Gaugamela die Armee geschlagen hatte, die Dareios gegen ihn ins Feld schickte. Doch es war keine unehrenhafte Entlassung gewesen: Alexander hatte Antigonos dazu auserkoren, ihn als Satrap in Phrygien zu vertreten, gerade weil Antigonos solche Freude am Krieg fand. Der junge König hatte es vertrauensvoll ihm überlassen, die Belagerung der phrygischen Hauptstadt Kelainai zum Abschluss zu bringen und dann die Eroberung des anatolischen Binnenlands zu vollenden, während er selbst nach Süden und Osten zog, um sich ein Großreich zu eigen zu machen.
Ariarathes war der letzte persische Satrap, der in Anatolien noch immer Widerstand leistete, und Antigonos dankte den Göttern dafür, denn ohne ihn hätte er nichts mehr weiter zu tun, als Steuern einzutreiben und Appellationen anzuhören. Manchmal fragte er sich selbst, ob er absichtlich zugelassen hatte, dass Ariarathes so lange durchhielt, nur um jederzeit einen guten Vorwand für einen Feldzug zu haben. Doch nun hatte ihn die Nachricht erreicht, Alexander sei aus dem Osten zurückgekehrt und kürzlich in Babylon eingetroffen. Antigonos hatte daher entschieden, einen sehr ernsthaften Versuch zu unternehmen, diesen Teil des Reiches vom letzten rebellischen Satrapen zu befreien – er wollte dem jungen König nicht zum ersten Mal seit fast zehn Jahren gegenübertreten, ohne die Aufgabe, mit der er betraut worden war, bewältigt zu haben.
Zwölftausend Paar Füße donnerten im Gleichschritt auf den harten Boden, als die Phalanx vorrückte, und Antigonos ging das Herz über. Zu seiner Linken konnte er die Peltasten ausmachen, so benannt nach der Pelte, ihrem halbmondförmigen, aus Zweigen geflochtenen und mit Fell überzogenen Schild. Sie vertrieben die Bogenschützen, die diese Flanke bedrohten, aus dem Buschland, das sie als Deckung nutzten. Blut war geflossen, und das Leben war gut. Die Peltasten schickten den im Rückzug befindlichen Plänklern noch eine letzte Salve Wurfspeere hinterher, dann sammelten sie sich wieder und zogen sich auf ihre Position zwischen der Phalanx und der schützenden Kavallerie zurück. Diese rückte wie befohlen im gleichen Tempo wie die Infanterie vor. Götter, wie ich das liebe. Antigonos’ Bart zuckte, als er lächelte; sein gutes Auge leuchtete vor Begeisterung, und die wulstige Narbe in der linken Augenhöhle, die ihm ein furchterregendes Aussehen verlieh, weinte blutige Tränen. Noch hundert Schritt. Götter, das wird gut.
Im Schutz ihrer Langschilde zielten die persischen Fußsoldaten mit ihren Bogen hoch. Eine Wolke aus zweitausend Pfeilen stieg in den Himmel auf, und Antigonos’ Lächeln wurde breiter. «Macht euch bereit, Jungs!» Dann hagelten die Pfeile herab, doch der schwankende Wald aufrecht gehaltener Lanzen bremste ihren Schwung, und so richteten sie nur wenig Schaden an. Da und dort ertönte ein Schrei, gefolgt von Flüchen, wenn die Kameraden des Gefallenen über ihn hinwegsteigen mussten und dabei Mühe hatten, nicht über seine Lanze zu stolpern. Stellenweise würden sich Lücken auftun, das wusste Antigonos, doch die Reihenschließer würden sie bald wieder füllen, indem sie die nachfolgenden Männer nach vorn schoben. Er brauchte sich nicht einmal umzuschauen, um sich zu vergewissern, dass ebendas geschah.
Der nächste Hagelschauer eiserner Pfeilspitzen ging vom Himmel nieder, und wieder wurde er von dem Wald über den Köpfen der Phalanx nahezu unschädlich gemacht. Die Schäfte fielen zu Boden wie im Sturm abgebrochene Zweige. Noch fünfzig Schritt. «Lanzen!» Ein neues Signal ertönte und wurde entlang der Linie wiederholt, doch diesmal brauchte das Manöver nicht gleichzeitig ausgeführt zu werden; in einer Bewegung, die in der Mitte begann und sich wie eine Welle nach rechts und links fortsetzte, wurden Lanzen gesenkt, die der ersten fünf Reihen waagerecht, die der hinteren schräg über die Köpfe der Vordermänner, um sie weiter vor dem anhaltenden Pfeilhagel zu schützen.
Antigonos lief mit vorgebeugtem Oberkörper und zählte voller Ungeduld seine stetigen Schritte, während der Feind näher kam. Jetzt lösten die Perser ihre Pfeile in flacherer Flugbahn, sodass sie in die Schilde der Frontlinie einschlugen. Diese gaben unter den Einschlägen nach und schwankten heftig, da die Männer sie nicht fest in der Faust hielten, sondern die Schlaufe nur lose über den Arm gestreift hatten. Nun gab es mehr Tote und Verletzte – ungeschützte Gesichter und Beine wurden getroffen, die Schmerzensschreie mehrten sich, wenn Eisenspitzen in Fleisch drangen und zitternd in Knochen stecken blieben. Schaft um Schaft zischte durch die Luft, und Antigonos lächelte noch immer; er selbst hatte keinen Pfeil mehr abbekommen, seit einer sein Auge durchbohrt hatte. Es war in der Schlacht von Chaironeia gewesen, wo Philipp die vereinigte Streitmacht von Athen und Theben besiegt hatte. Seit damals war Antigonos vom Kriegsgott Ares gesegnet und empfand keine Furcht, wenn er in ein Unwetter aus Pfeilen hineinmarschierte. Nun konnte er bereits die Augen der Perser sehen, während sie mit ihren Bogen zielten. Instinktiv duckte er sich, und ein Pfeil prallte von seinem Bronzehelm ab, dass ihm die Ohren klingelten. Er hob das Gesicht und lachte den Feinden entgegen, denn sie würden sterben.
Die Perser nahmen nun ihre Langschilde auf, um sie wie gewöhnliche Schilde zu gebrauchen, steckten ihre Bogen zurück in die Hüllen, die sie an der Hüfte trugen, und zogen ihre langen Stichspeere aus dem Boden. Schulter an Schulter standen sie da und starrten mit dunklen Augen der von tödlichen Eisenspitzen starrenden Phalanx entgegen, die auf sie zukam. Antigonos’ Lachen steigerte sich zu Gebrüll, als er die letzten paar Schritte lief. Seine Armmuskeln schmerzten von der Anstrengung, die Lanze gerade zu halten. Seine Männer stimmten in das Gebrüll ein, die natürliche Angst fiel von ihnen ab, und an ihre Stelle trat Kampflust.
Und dann war er da, und nun konnte er töten. Von seiner eigenen Kraft beglückt, stieß Antigonos mit seiner Lanze nach dem Gesicht des Persers vor ihm, dessen Bart mit Henna gefärbt war. Jeder Soldat in der Frontlinie passte selbständig den richtigen Zeitpunkt für den tödlichen Stoß ab. Der Perser wich der Lanzenspitze aus, packte den Schaft und versuchte, ihn Antigonos zu entreißen. Doch der stürmte gemeinsam mit seinen Männern weiter vorwärts, sodass beim übernächsten Schritt die Sarissen der zweiten Reihe in Bauchhöhe unter denen der ersten zum Einsatz kamen. Schritt um Schritt rückten sie unter Einsatz ihrer Waffen weiter vor, noch immer sicher außerhalb der Reichweite der Gegner, die zunehmend in Bedrängnis gerieten, da nun auch die Lanzenspitzen der dritten Reihe sie erreichten.
Zwei besonders kühne Perser schlüpften zwischen den hölzernen Schäften hindurch, die Speere auf Schulterhöhe, und stürmten Antigonos entgegen, dessen Lanzenspitze nun nicht mehr zu sehen war. Blindlings stieß er weiter zu, während die Perser nah genug herankamen, um ihre Waffen zu gebrauchen. Doch Antigonos wich nicht zurück, denn er kannte die Männer hinter sich. Aus dem Augenwinkel sah er, wie ein Soldat im vierten Glied seine Lanze hob, dann schnellte die Waffe vor. Ein Perser krümmte sich mit einem Aufschrei und umklammerte mit beiden Händen die Lanze, die in seinem Unterleib steckte. Indessen erledigte ein anderer Kamerad hinter Antigonos mit einem kraftvollen Stoß den zweiten Mann. Und noch immer rückten sie vor. Der Druck wurde mit jedem Schritt stärker, doch gerade die Masse der Phalanx machte es so schwer, ihr zu widerstehen. Überall entlang der Linie gab die gegnerische Front an zahlreichen Stellen nach und wurde zurückgedrängt. Die Ersten, die den Rückzug antraten, waren die kappadokischen Stammeskrieger zu beiden Seiten der Perser, zähe Männer aus dem gebirgigen Binnenland. Nur mit Wurfspeeren und Schwertern bewaffnet, konnten sie es nicht mit der makedonischen Kriegsmaschine aufnehmen, und so machten sie kehrt und rannten zu Tausenden zum Fluss, denn sie wussten, dass eine makedonische Phalanx nicht zu einer schnellen Verfolgungsjagd fähig war.
Voller Stolz schaute Antigonos nach links und sah genau das, was er erhofft hatte: Sein Sohn führte den Angriff der Kavallerie an. Mit wehendem weißem, purpurverbrämtem Mantel ritt er an der Spitze des Keils, der bevorzugten Formation der makedonischen Hetairenreiterei. Diese Reiter würden erledigen, was die Phalanx nicht vermochte. Schnell und wütend stießen sie in die zerrissenen Reihen der Kappadokier vor, und der Druck wurde stärker, je tiefer der Keil eindrang. Männer wurden beiseitegestoßen, viele gerieten unter die Hufe der Pferde, während Lanzen die Fliehenden im Rücken trafen und ihnen schändliche Verletzungen beibrachten. Dann kam die Kavallerie von der rechten Flanke dazu und schnitt der geschlagenen Armee den Rückweg ab. Nun wussten die Perser, dass für sie keine Hoffnung mehr bestand, sich über die Brücke in Sicherheit zu bringen, und auch sie ergriffen die Flucht.
Antigonos reckte die Faust in die Luft; wieder ertönte ein Hornsignal. Die Phalanx hatte ihr Werk vollbracht und hielt nun inne, um auszuruhen, während vor ihren Augen die jungen Helden der Kavallerie den leichten Teil der Arbeit übernahmen: die Wehrlosen abzuschlachten.
Die schwere Reiterei griff von beiden Flanken an und trieb alle vor sich zusammen. Weiter außen zogen Patrouillen leichter Reiter ihre Kreise und brachten die wenigen zur Strecke, denen es gelungen war zu entkommen. Antigonos hatte vor der Schlacht erklärt, er sei nicht an Gefangenen interessiert, es sei denn, es handelte sich um Ariarathes selbst, denn für diesen Rebellen hielt er einen besonders dicken Pfahl bereit. Nur der feindlichen Kavallerie gelang die Flucht – ihre Pferde schwammen ans andere Flussufer hinüber.
Die Phalanx machte jedes Entkommen nach Westen unmöglich, und so war die Brücke bald mit panisch Fliehenden verstopft. Diejenigen, die nicht darauf gelangen konnten, hatten nur noch die Wahl zwischen dem sicheren Tod durch die Lanzen der Kavallerie und dem Fluss. Und so brodelte der Halys von Ertrinkenden, von denen jeder versuchte, auf Kosten der anderen das eigene Leben zu retten, während die Strömung sie davonriss und in die Tiefe zog. Manche, denen ihre Götter hold waren, konnten sich an einem der zwei mächtigen steinernen Pfeiler festhalten, die in das Flussbett gesenkt waren, doch viele von ihnen wurden von anderen mitgerissen, die sich im Vorbeitreiben an sie klammerten. Einigen wenigen gelang es, bis zur Brüstung hinaufzuklettern, doch keiner schaffte es bis in den Menschenstrom, der sich oben drängte. Sie wurden zurück in den Fluss gestoßen, denn jeder fürchtete, eine Person mehr auf der Brücke werde die eigenen Überlebenschancen schmälern.
Lachend sah Antigonos zu, wie Demetrios und seine Kameraden fliehende persische Fußsoldaten aufspießten, die versuchten, sich auf die Brücke zu drängen. Ihre böotischen Helme, weiß bemalt und mit einem goldfarbenen Kranz verziert, glänzten warm in den Strahlen der untergehenden Sonne. Gelassen saßen die Reiter auf ihren Rossen. Ihre Füße hingen frei herab, und sie lenkten die Tiere mit dem Druck ihrer Schenkel, geschickt, wie es nur Männer vermochten, die ihr halbes Leben auf dem Pferderücken verbracht hatten. Sie trugen wadenlange Lederstiefel, Muskelpanzer aus Leder oder Bronze, darunter lederne Pteryges zum Schutz der Weichteile sowie Chitone und Mäntel in unterschiedlichen Farben – Rot, Weiß und diverse Gelb- und Brauntöne. Ein prächtiger Anblick, das musste Antigonos einräumen. Und als sie metzelnd durch das Gedränge derer ritten, die zur Brücke strömten, versuchten nur wenige, sich ihnen zu widersetzen, denn die meisten hatten auf der Flucht ihre Waffen weggeworfen.
Antigonos schlug Philotas auf die Schulter, als Demetrios’ Lanze brach und er sie umdrehte, um mit der Spitze am anderen Ende zuzustoßen. «Der Junge genießt es. Mir scheint, er findet Geschmack an asiatischem Blut. Das wurde auch Zeit: Alexander war etwa in seinem Alter, als er zum ersten Mal Krieger in die Schlacht führte.»
Philotas grinste, als Demetrios’ Nebenmann einem Perser die Hand abschlug, da dieser versuchte, den Jüngling vom Pferd zu zerren. «Kaunos gibt auf ihn acht, also wird er wohl nicht zu Schaden kommen. Du musst ihm nur nachdrücklich erklären, dass es nicht immer ganz so leicht geht.»
«Das wird er noch früh genug lernen.»
Demetrios’ Einheit, eine Ile aus einhundertachtundzwanzig Mann, hatte nun die Brücke erreicht. Die vorderen sechs hieben und stachen den Weg frei. Die Schar der Besiegten war inzwischen ausgedünnt, sodass sie auf ihrer Flucht schneller vorankamen; und noch immer töteten Demetrios’ Reiter, und noch immer flohen Männer vor ihnen. Immer weiter ritten sie, und nun erstarb das Lächeln auf Antigonos’ Gesicht. Der kleine Schwachkopf. Er wandte sich zu dem Signalgeber um. «Zum Rückzug blasen!»
Das Horn brachte eine ansteigende Tonfolge hervor, die sich durch die Formation fortsetzte, doch Demetrios führte seine Männer weiter, bis es auf der Brücke niemanden mehr zu töten gab und die Reiter das östliche Ufer erreichten. Im letzten Tageslicht schlachteten sie dort alle ab, die sie finden konnten.
«Falls ihn nicht ein Kappadokier umbringt», murmelte Antigonos, «dann tue ich es, wenn er zurückkommt.»
«Nein, alter Freund, das wirst du nicht tun. Du wirst ihn ohrfeigen und dann in die Arme schließen, weil er ein Schwachkopf ist, aber ein kühner.»
«Von wegen. Durch solches törichte Verhalten kommen Männer unnötig zu Tode. Er muss entweder Disziplin lernen oder sich damit abfinden, nicht alt zu werden.»
«Nach meiner Erfahrung sind es nicht immer die Törichten selbst, die unter den Folgen ihres Handelns leiden.»
Antigonos’ Miene verdüsterte sich. «Wenn mein Sohn das jemals wieder tut, Philotas, dann bete ich zu Ares, dass du recht behältst und er sich nicht selbst umbringt.»
Roxane die Wildkatze
Das Kind in ihr trat. Roxane legte beide Hände auf ihren Leib. Sie saß verschleiert im offenen Fenster ihrer Gemächer im zweiten Stockwerk des Palastes zu Babylon. Unter ihr lag der riesige Innenhof des Komplexes, von lodernden Fackeln erhellt, da die Sonne am bedeckten Himmel unterging. Dort unten trat gerade wieder einmal die makedonische Armee zu einer Versammlung an.
Das war eine dieser sonderbaren Eigenheiten der Makedonen, die sie noch nie recht hatte begreifen können: Weshalb gestanden sie all ihren Bürgern ein Mitspracherecht zu? Bevor Alexander ihren Vater Oxyartes besiegt und anschließend zum Satrapen von Paropamisaden ernannt hatte, war in ihrer Heimat Baktrien jeder gepfählt worden, der seinen Willen in Frage stellte. Alexander hingegen, ein Mann, von dem sie zugeben musste, dass er weit mächtiger war, als ihr Vater je sein würde, hörte sich tatsächlich die Ansichten gemeiner Soldaten an. Auf seinem Eroberungszug nach Indien hatte es sogar beinahe eine Meuterei gegeben, sodass er hatte umkehren müssen. Sie schüttelte den Kopf über die Gesetzlosigkeit eines Systems, in dem der Konsens regierte, und sie schwor sich, der Sohn, mit dem sie schwanger war, sollte sich nicht mit solchen Widrigkeiten herumschlagen müssen, wenn er einmal den Thron bestieg.
Dieser Gedanke lenkte ihre Aufmerksamkeit wieder auf die Frage, die sie während Alexanders Krankheit am meisten beschäftigt hatte und die seit seinem Tod vor zwei Stunden zum dringenden Problem geworden war: wie sie sicherstellen konnte, dass der Knabe an die Herrschaft gelangen würde, denn sie wusste, dass ihr Leben davon abhing.
Wieder versetzte das Ungeborene ihr einen kräftigen Tritt, und Roxane verfluchte ihren verstorbenen Mann dafür, dass er sie gerade jetzt im Stich gelassen hatte, da sie ihn am nötigsten brauchte. Gerade als sie im Begriff war, zu triumphieren und als Erste einen Sohn zur Welt zu bringen, vor seinen anderen beiden Frauen – den persischen Huren, die Alexander bei der Massenhochzeit von Susa geheiratet hatte, als alle seine Offiziere auf sein Geheiß Perserinnen ehelichen mussten; gerade als sie im Begriff war, der wichtigste Mensch in Alexanders Leben zu werden, nun, da ihr ärgster Rivale Hephaistion nicht mehr war.
Sie schnippte mit den Fingern und schaute sich nach den drei jungen Sklavinnen um, die mit gesenkten Köpfen kniend in der hinteren Ecke des Raumes warteten, wie Roxane es gernhatte. Ein Mädchen stand auf und durchquerte, noch immer mit gesenktem Kopf, das Zimmer, das mit allerlei Teppichen in unterschiedlichen Farben und Mustern ausgelegt war, wie man sie im Osten bevorzugte. Die Sklavin blieb so dicht bei ihrer Herrin stehen, dass Roxane nicht die Stimme zu erheben brauchte, denn das erforderte Anstrengung, und Roxane fand, eine Königin sollte sich nicht unnötig anstrengen müssen. Sie sollte ihre Kräfte für ihren König aufsparen.
Roxane beachtete das Mädchen nicht weiter, sondern richtete ihre Aufmerksamkeit wieder auf das Geschehen unten im Hof. Hornsignale ertönten, und die fünfzehntausend makedonischen Bürger, die der babylonischen Armee angehörten und nun in ihren Einheiten angetreten waren, verstummten. Sieben Männer stiegen auf das Podium in der Mitte des Hofes.
«Welcher?», murmelte Roxane vor sich hin, während sie Alexanders Leibwächter aufmerksam beobachtete. «Welcher wird es sein?» Sie kannte sie alle, manche besser als andere. Seit ihrer Heirat vor drei Jahren – sie war damals fünfzehn gewesen – hatte sie mit ihnen allen gewetteifert, um ihren Stand in der Männergesellschaft zu behaupten, die Alexanders Armee war.
Es war Perdikkas, der in voller Uniform – Helm, Brustpanzer, Lederschurz, Beinschienen und tiefroter Mantel – vortrat, um das Wort an die Versammelten zu richten. Roxane hatte schon damit gerechnet, dass er derjenige sein würde, da sie mit angesehen hatte, wie er den Ring von Alexander empfing. Dennoch verfluchte sie ihr Pech: Leonnatos wäre aufgrund seiner Eitelkeit weit formbarer gewesen; Peukestas, der den Genuss und die Schönheit liebte, wäre leicht in ihr Bett zu locken, und bei Aristonous hätte sie an sein ausgeprägtes Pflichtgefühl gegenüber dem makedonischen Königshaus der Argeaden appellieren können. Aber Perdikkas? Wie würde sie ihn dazu bringen, sich ihrem Willen zu beugen?
«Soldaten von Makedonien», hob Perdikkas mit heller Stimme an, die im Halbdunkel über die riesige Heerschar trug; der Fackelschein spiegelte sich auf seinem Bronzehelm, dessen roter Rosshaarbusch sich im leichten Wind bewegte. «Ich nehme an, ihr alle habt von dem schweren Schicksalsschlag gehört, der uns getroffen hat, denn schlechte Nachrichten verbreiten sich schneller als gute. Alexander, der Dritte seines Namens, der Löwe von Makedonien, ist tot. Und wir, seine Soldaten, werden ihn nach makedonischer Sitte betrauern. Der Feldzug nach Arabien wird daher verschoben, damit in den kommenden Tagen Leichenspiele mit reichlichen Siegespreisen gehalten werden können. Aber zuerst werden wir tun, was sich geziemt: Wir werden unserem König die letzte Ehre erweisen, jeder Einzelne von uns. Sein Leichnam wurde in den Thronsaal gebracht. Die Einheiten werden nacheinander vorbeidefilieren, die Kavallerie macht den Anfang. Wenn alle mit eigenen Augen gesehen haben, dass er tot ist, dann und erst dann werden wir eine Versammlung abhalten, um einen neuen König zu ernennen. Dies soll in zwei Tagen geschehen.»
Während Perdikkas seine Ansprache fortsetzte, schnippte Roxane mit den Fingern und richtete das Wort an die Sklavin, die wartend hinter ihr stand. «Hole Orestes her, ich muss einen Brief schreiben.»
Wenige Augenblicke nachdem das Mädchen den Raum verlassen hatte, war der Sekretär zur Stelle, als habe er auf ihren Ruf gewartet – vielleicht hatte er das tatsächlich, überlegte Roxane. Er war überaus aufmerksam, seit sie den kleinen Finger seiner linken Hand hatte abschneiden lassen, weil er sie zu lange warten ließ, nachdem sie ihn gerufen hatte. Alexander hatte sie dafür gescholten, dass sie einen freigeborenen Griechen derart bestrafte, und verlangt, sie solle den Mann entschädigen. Doch sie hatte ihn ausgelacht und erklärt, eine Königin dürfe man niemals warten lassen. Außerdem sei es nun einmal geschehen, und keine Entschädigung könne den Finger nachwachsen lassen. Töricht, wie er war, hatte Alexander Orestes daraufhin aus seiner eigenen Kasse entschädigt. «An Perdikkas», sagte sie nun, ohne sich umzuschauen, ob der Sekretär bereit war. «Königin Roxane von Makedonien grüßt dich.» Sie hörte den Griffel kratzen, während sie sich im Kopf die nächsten Worte zurechtlegte. Dabei wandte sie den Blick nicht von ihrer Beute ab, die unten im Hof noch immer zu den Soldaten sprach. «Ich wünsche dich zu sehen, um die Regentschaft und andere Themen in beiderseitigem Interesse zu erörtern.»
«Ist das alles, Hoheit?», fragte Orestes, als sein Griffel ruhte.
«Natürlich ist das alles! Wäre da noch mehr, dann hätte ich es gesagt! Jetzt geh und schreibe es ins Reine und dann bringe es mir, damit ich eine meiner Dienerinnen losschicken kann, es zu überbringen.» Roxane lächelte in sich hinein, während sie hörte, wie Orestes hastig seine Utensilien zusammenraffte und den Raum verließ. Griechen – wie ich sie verabscheue, erst recht solche, die schreiben können. Wer weiß, welche Geheimnisse und Zauberbanne sie verbergen? Unten im Hof hatte Perdikkas indessen seine Rede beendet, und Ptolemaios hatte seinen Platz auf der Rednerbühne eingenommen, um seine Trauer zu bekunden. Roxane fragte sich, ob die Männer das Los gezogen hatten, doch es hatte nicht den Anschein – was sie hier sah, entsprach der Rangfolge, welche die Leibwächter unter sich ausgemacht hatten.
Bis sie ihren Brief losgeschickt hatte, war bereits Peukestas als Letzter an der Reihe, nach Lysimachos, Leonnatos und Aristonous. Peithon, der nicht viele Worte machte und vorzugsweise solche mit wenigen Silben, hatte erst gar keine Anstalten gemacht zu sprechen. Als die Versammlung sich auflöste und das große Defilee begann, bestellte Roxane einen Krug süßen Wein und befahl ihren Dienerinnen, ihr das Haar zu richten und ihre Schminke aufzufrischen, während sie ihren Besucher erwartete.
Sie hätten sie dreimal neu frisieren können, so viel Zeit verging, ehe ihr Hofmeister Perdikkas ankündigte.
«Du hast mich warten lassen», stellte Roxane mit leiser Stimme fest, als der hochgewachsene Makedone in ihr Gemach trat. Sie nahm ihren Schleier ab und starrte ihn aus ihren mandelförmigen Augen an, wobei sie ganz leicht mit den Lidern klimperte.
«Du hast Glück, dass ich überhaupt Zeit hatte zu kommen. Es galt, Boten zu entsenden und vieles zu organisieren», entgegnete Perdikkas und setzte sich, ohne um Erlaubnis zu bitten oder eine Bemerkung über ihr unverhülltes Gesicht zu machen. «Willst du mir für meine Säumigkeit etwa zur Warnung einen Finger abschneiden? Ich schlage vor, das nächste Mal suchst du mich auf.»
Roxanes Augen funkelten vor Zorn. Sie gab ihren Sklavinnen einen Wink, den Raum zu verlassen. «Ich bin deine Königin, ich kann dich rufen, wann immer ich es wünsche.»
Perdikkas starrte sie gleichmütig an. Der forschende Blick seiner meerwassergrauen Augen behagte ihr nicht, doch sie hielt ihm stand. Perdikkas war glatt rasiert wie viele Männer aus Alexanders engerem Kreis, er hatte ein hageres Gesicht mit hohen Wangenknochen und schmaler Nase und trug sein schwarzes Haar kurz geschnitten. Es war ein angenehmes Gesicht, das musste sie einräumen, eines, das sie nicht ungern näher an sich heranlassen würde, falls es nötig werden sollte. Sie warf einen Blick auf seine Hände – er trug den Ring nicht.
«Du bist nicht meine Königin, Roxane», sagte Perdikkas nach kurzem Schweigen, «und du bist es nie gewesen. Für mich und den Rest der Armee bist du nichts als eine Barbarin, eine Wilde, die Alexander als Trophäe aus dem Osten mitgebracht hat. Und du tätest gut daran, dich in den kommenden Tagen darauf zu besinnen.»
«Wie kannst du es wagen, so mit mir zu reden? Ich –»
«Du bist jetzt nichts weiter als ein Gefäß, Roxane», fuhr Perdikkas ihr heftig über den Mund und zeigte auf ihren schwangeren Leib. «Ein nützliches Gefäß, das wohl, aber doch nur ein Gefäß. Was du in dir trägst, ist von Wert, du selbst bist es nicht. Bleibt nur die Frage: Wie wertvoll ist es? Nicht sehr, falls sich herausstellen sollte, dass es weiblich ist.»
Roxane legte eine Hand auf ihren Bauch und spannte die Kiefermuskeln an. «Es ist ein Junge», zischte sie mit zusammengebissenen Zähnen, «ich weiß es.»
«Wie kannst du sicher sein?»
«Eine Frau weiß so etwas. Er liegt tief in mir und tritt sehr kräftig.»
Perdikkas tat ihre Behauptung mit wegwerfender Geste ab. «Glaube, was du willst – in drei Monaten werden wir Gewissheit haben. Bis dahin rate ich dir, dich nicht öffentlich zu zeigen, damit die Männer nicht ständig daran erinnert werden, dass Alexanders Erbe eine Asiatin zur Mutter hat.»
«Sie lieben mich.»
Perdikkas seufzte und schüttelte den Kopf, sein Ton wurde milder. «In seinem letzten Lebensjahr hat Alexander angefangen, Männer aus dem Osten nach makedonischer Art auszubilden, um Phalangiten aus ihnen zu machen. Als er Krateros mit zehntausend Veteranen heimschickte, hat er sie nicht durch Makedonen ersetzt, sondern durch diese neuen Pseudomakedonen, und das gefällt den Männern nicht. Wenn dein Kind ein Junge ist, wird nicht leicht durchzusetzen sein, dass er von allen Makedonen akzeptiert wird.»
«Das ist der Grund, weshalb ich dich herbefohlen habe.»
Perdikkas bedachte sie mit einem ungeduldigen Blick. «Roxane, ich will keine Spiele mit dir spielen – ich bin im Besitz von Alexanders Ring, ich lasse mir von niemandem befehlen. Ich bin gekommen, weil ich es vorziehe, dich hier zu treffen, wo wir einigermaßen vertraulich miteinander sprechen können. Also, was wolltest du mir sagen?»
Roxane erkannte, dass sie Perdikkas nur noch mehr verärgern würde, wenn sie versuchte, ihre rechtmäßige Stellung zu behaupten. Sie entschied sich deshalb dagegen, ihre Überlegenheit noch nachdrücklicher zu betonen. «Du brauchst mich, Perdikkas.» Bestürzt sah sie seinen plötzlichen Heiterkeitsausbruch. «Du lachst mich aus? Weshalb?»
«Du bist schon die zweite Person, die das heute Abend zu mir sagt.»
«Wer war die erste?»
«Das brauchst du nicht zu wissen.»
Doch, allerdings, ich muss dringend wissen, wer sonst noch um seine Aufmerksamkeit buhlt. «Ich bin sicher, der andere kann nicht annähernd so nützlich sein wie ich.»
«Mag sein, dass er das nicht kann.»
Gut, es ist also keine Frau. «Du bist im Besitz des Ringes, und deine sechs Kollegen von der Leibwache haben sich dir offensichtlich untergeordnet, da du heute Abend als Erster zur Armee gesprochen hast. Nun lass uns praktisch denken: Du würdest gern an Alexanders Stelle herrschen, aber das werden die anderen nicht zulassen – täten sie es, dann würdest du den Ring jetzt tragen, aber du trägst ihn nicht. Ich kann dir die Regentschaft für meinen Sohn anbieten, bis er in vierzehn Jahren das Mannesalter erreicht.»
«Ich könnte die Regentschaft einfach beanspruchen, ich brauche sie nicht aus deiner Hand zu empfangen.»
Roxane lächelte. Sie wusste, dass dieses Lächeln ihr einen ganz besonderen Reiz verlieh, deshalb zeigte sie es selten, was die Wirkung noch steigerte. «Um als Regent erfolgreich zu sein, musst du über ein geeintes Reich herrschen, und alle deine Untertanen müssen dich als Regenten akzeptieren. Wenn ich mich hinter dich stelle, könnte das durchaus gelingen. Aber stell dir nur vor, ich würde dieses Angebot beispielsweise Leonnatos machen – kann es zwei Regenten geben? Ich glaube kaum. Und meinst du, Leonnatos würde sich die Chance auf solche Macht entgehen lassen? Denke daran, welch hohe Meinung er von sich selbst hat. Und was glaubst du, wen Ptolemaios unterstützen würde, wenn er zwischen dir und Leonnatos wählen müsste?»
«Das würdest du nicht tun.»
Ihr Lächeln erstarb, und ihr Blick verhärtete sich. «Ich würde, und du weißt, dass ich es könnte.»
Perdikkas überdachte die Situation.
Ich glaube, jetzt habe ich ihn.
«Was willst du?», fragte Perdikkas schließlich.
Ich habe ihn, jetzt muss ich ihm nur noch Manieren beibringen. «Stabilität für meinen Sohn. Es kann nur einen wahren Erben geben.»
«Du willst Herakles’ Tod?»
«Herakles? Nein, der Bastard ist keine Bedrohung für mich. Alexander hat Barsine nie anerkannt, somit hat ihr Sohn keinen Vorrang vor meinem. Es geht um die beiden Huren in Susa.»
«Stateira und Parysatis? Sie können deine Position nicht anfechten.»
«Sie sind schwanger, beide.»
«Das ist unmöglich, Alexander hat sie nicht mehr gesehen, seit vor neun Monaten Hephaistions Leichenzug durch Susa kam. Wenn er sie damals geschwängert hätte, würden wir es inzwischen wissen.»
«Trotzdem, ich will ihren Tod, und ich will, dass du sie für mich tötest.»
«Frauen töten? Das tue ich nicht, erst recht nicht, wenn es sich um Alexanders Ehefrauen handelt.»
«Dann beauftrage jemanden, es zu tun, sonst gehe ich zu Leonnatos.»
«Glaubst du wirklich, Leonnatos würde sich dazu herablassen, Frauen zu ermorden, da er doch eine so hohe Meinung von sich hat?» Nun war es an Perdikkas, zu lächeln. «Oder sonst irgendeiner von den Leibwächtern.»
Roxane verfluchte den Mann im Stillen, dann versuchte sie es auf andere Weise. «Sollten Alexanders Frauen nicht alle in Babylon sein, um ihn zu betrauern? Stateira und Parysatis hätten doch gewiss gern Gelegenheit, bei seinem Leichnam zu weinen?»
Perdikkas lächelte düster, als er begriff, worauf Roxane hinauswollte. «Ich wäre für ihre Sicherheit verantwortlich, wenn sie einmal hier wären.»
«Aber nicht, solange sie unterwegs wären – wie auch?»
Wieder schaute er sie lange eindringlich an, und Roxane sah in seinen Augen, dass sie triumphieren würde.
Perdikkas erhob sich. «Also gut, Roxane, ich werde Stateira und Parysatis nach Babylon rufen, und du wirst mich als Regenten unterstützen. Sofern es tunlich erscheint, werde ich die ranghöchsten Befehlshaber der Armee von deiner Entscheidung in Kenntnis setzen, wenn wir übermorgen vor der Heeresversammlung zusammenkommen.»
«Du hast mein Einverständnis», sagte Roxane gnädig und schenkte ihm abermals ihr seltenes Lächeln. Noch immer lächelnd sah sie zu, wie er sich abwandte und den Raum verließ. Nun, Stateira und Parysatis, ihr werdet bald erfahren, wie es meinen Rivalen ergeht – ebenso wie Hephaistion.
Ptolemaios der Bastard
Geschickt, äußerst geschickt, dachte Ptolemaios, während er sich im Thronsaal umschaute, in dem er und seine Kollegen sich zwei Tage nach Alexanders Tod versammelten. Er gestand es nur äußerst ungern ein, aber Perdikkas – so wenig er den Mann leiden konnte – hatte die Szene trefflich arrangiert. Nun, Ptolemaios fand von jeher, dass Feindschaft und Bewunderung sich nicht zwingend gegenseitig ausschlossen.
Am hinteren Ende des Saals defilierten gerade die letzten Infanterieeinheiten der Armee von Babylon am Leichnam ihres Königs vorbei, der in seiner prächtigsten Uniform aufgebahrt lag: mit purpurrotem Mantel und Chiton, einem vergoldeten Brustpanzer, der mit Edelsteinen besetzt und mit Abbildungen von Göttern, Pferden und der sechzehnstrahligen Sonne von Makedonien verziert war, sowie kniehohen Stiefeln aus weichem Kalbsleder. In der rechten Armbeuge lag sein Paradehelm. Doch was Ptolemaios beeindruckte, war nicht die Tatsache, dass diese Zusammenkunft vor den Augen der letzten Soldaten begann, die Alexander die Ehre erwiesen. Vielmehr galt seine Aufmerksamkeit dem, was Perdikkas aus dem anderen Ende des Raumes gemacht hatte: Auf dem mächtigen steinernen Thron Nebukadnezars waren Alexanders Gewänder drapiert. Vor dem Thron lag der lederne Brustpanzer, den er am liebsten in der Schlacht getragen hatte, verziert mit einer Einlegearbeit in Gestalt zweier sich aufbäumender Pferde auf beiden Seiten der Brust, und dazu sein Zeremonienschwert. Doch der Meisterstreich war in Ptolemaios’ Augen, dass auf der Sitzfläche Alexanders Diadem lag und darin der Herrscherring von Makedonien.
Er hat die Zusammenkunft so arrangiert, als sei Alexander selbst anwesend, dachte Ptolemaios, während er sich unter den versammelten ranghohen Befehlshabern umschaute: Die anderen sechs Leibwächter waren anwesend, außerdem Alketas, Meleagros, Eumenes und der große, stämmige Seleukos, nunmehr der Taxiarch – der Kommandeur – der Hypaspisten, einer der zwei Eliteeinheiten der Infanterie. Er hatte sich vor drei Jahren einen Namen gemacht, als er die neu gebildete Elefantentruppe befehligte. Wie viele von ihnen werden Perdikkas unterstützen?, fragte sich Ptolemaios, während er die Gesichter der Anwesenden studierte. Eumenes gewiss, denn als Grieche braucht er einen makedonischen Gönner, um überhaupt eine Aussicht auf Belohnung zu haben. Dann wurde seine Aufmerksamkeit von einem älteren Mann angezogen, der den Raum betrat, wettergegerbt und die Augen vom jahrelangen Blinzeln in die Sonne zu Schlitzen verengt. Nearchos, interessant. Er hat das gleiche Problem wie Eumenes, allerdings wäre unser großartiger kretischer Flottenführer ein Gewinn für jeden, den er zu unterstützen beschließt – ein Jammer, dass ich nichts habe, womit ich ihn locken könnte.
Es überraschte Ptolemaios nicht, dass Kassandros als Letzter erschien. Den muss man im Auge behalten – wie Antipatros solch einen arroganten Widerling zeugen konnte, werde ich nie begreifen. Allerdings habe ich gehört, die jüngsten Töchter des alten Mannes seien hübsch gediehen. Kassandros als Schwager? Nun, das wäre eine Überlegung wert. Und tatsächlich brachte die Idee Ptolemaios zum Nachdenken – nach den entbehrungsreichen Jahren auf Feldzug sehnte er sich nach einem Leben in Wohlstand und Müßiggang in einer Machtposition, und jeder Weg dorthin war es wert, in Betracht gezogen zu werden. Denn da niemand anders Ptolemaios solchermaßen belohnen würde, war er entschlossen, es selbst zu tun. Angeblich ein Bastard König Philipps, war er stets mit unterschwelliger Verachtung behandelt worden. Einzig Alexander hatte ihm Respekt gezollt, ihn in den Kreis seiner Leibwächter aufgenommen, zur kaum verhohlenen Verwunderung derer von edlerer Geburt. Nachdem er von jeher mit dem Makel gelebt hatte, als Bastard zu gelten, lag es allein an ihm, sein Glück zu ergreifen, und er gedachte, es in den kommenden Monaten fest am Schopfe zu packen.
Als der Letzte eingetroffen war, bat Perdikkas die Versammelten um Ruhe. Alle waren wie zur Schlacht gekleidet, um die Dringlichkeit der Situation zu unterstreichen.