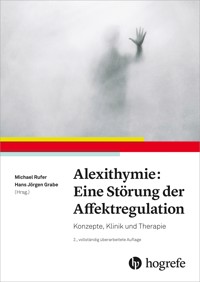
Alexithymie: Eine Störung der Affektregulation E-Book
39,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe, vorm. Verlag Hans Huber
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Unvermögen, Gefühle angemessen wahrzunehmen und zu beschreiben Wenn Menschen nicht zwischen körperlichen Empfindungen und Gefühlsregungen unterscheiden können, Gefühle häufig nur als diffuse Spannungs- oder Erregungszustände wahrgenommen werden und keine bewusste Verarbeitung von Gefühlen stattfindet, spricht man von Alexithymie. Da Betroffene auch emotionale Bedürfnisse von Mitmenschen nicht ausreichend erkennen und berücksichtigen können, kommt es zu Unverständnis und Beziehungskonflikten. Die Alexithymie beschreibt somit individuelle Störungen der Affektwahrnehmung, -verarbeitung und -regulation. Die Alexithymie ist häufig - mehr als 10 Prozent aller Männer und Frauen und mehr als 25 Prozent aller Patientinnen und Patienten in psychotherapeutisch-psychiatrischen Therapien sind betroffen. In diesem Buch stellen Expertinnen und Experten die wissenschaftliche Entwicklung des Alexithymie-Konstrukts dar, die entwicklungspsychologischen Hintergründe und die pathopsychologischen Prozesse, die zu dem Störungsbild führen. Mit aktuellen Befunden wird dargestellt, wie sehr die Alexithymie in unbewusste Verarbeitungsprozesse des Gehirns eingreift und diese verändert. Einen besonderen Schwerpunkt stellt die Frage dar, wie sehr alexithyme Persönlichkeitsstörungen den Verlauf von Therapien beeinflussen bzw. mit welchen Verfahren die Affektwahrnehmung, -differenzierung und -verarbeitung spezifisch gefördert werden können. Für die zweite Auflage wurden alle Kapitel grundlegend überarbeitet. Neu dazugekommen sind die Kapitel "Genetik und Endokrinologie der Alexithymie", "Bindung und Alexithymie" sowie "Selbstmanagement-Training bei Alexithymie: Das Zürcher Ressourcen Modell".
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 627
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Michael Rufer
Hans Jörgen Grabe
(Hrsg.)
Alexithymie: Eine Störung der Affektregulation
Konzepte, Klinik und Therapie
2., vollständig überarbeitete Auflage
unter Mitarbeit von
Matthias Franz
Harald Gündel
Frank Leweke
Hagen Maxeiner
Ralf Schäfer
Carl Eduard Scheidt
Thomas Suslow
Jan Terock
Elisabeth Waller
Julia Weber
Alexithymie: Eine Störung der Affektregulation
Michael Rufer, Hans Jörgen Grabe (Hrsg.)
Wissenschaftlicher Beirat Programmbereich Psychologie:
Prof. Dr. Guy Bodenmann, Zürich; Prof. Dr. Lutz Jäncke, Zürich; Prof. Dr. Astrid Schütz, Bamberg; Prof. Dr. Markus Wirtz, Freiburg i. Br.; Prof. Dr. Martina Zemp, Wien
Prof. Dr. med. Michael Rufer (Hrsg.)
Triaplus AG
Klinik Zugersee
Zentrum für Psychiatrie und Psychotherapie
Widenstr. 55
6317 Oberwil-Zug
Schweiz
E-Mail: [email protected]
Prof. Dr. med. Hans Jörgen Grabe (Hrsg.)
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie
Universitätsmedizin Greifswald
Ellernholzstr. 1–2
17489 Greifswald
Deutschland
E-Mail: [email protected]
Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt. Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Copyright-Hinweis:
Das E-Book einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.
Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Anregungen und Zuschriften bitte an:
Hogrefe AG
Lektorat Psychologie
Länggass-Strasse 76
3012 Bern
Schweiz
Tel. +41 31 300 45 00
www.hogrefe.ch
Lektorat: Dr. Susanne Lauri
Bearbeitung: Mihrican Özdem, Landau
Herstellung: Daniel Berger
Umschlagabbildung: francescoch, GettyImages
Umschlag: Claude Borer, Riehen
Satz: punktgenau GmbH, Bühl
Format: EPUB
2., vollständig überarbeitete Auflage 2022
© 2009 Verlag Hans Huber, Hogrefe AG, Bern
© 2022 Hogrefe Verlag, Bern
(E-Book-ISBN_PDF 978-3-456-96037-1)
(E-Book-ISBN_EPUB 978-3-456-76037-7)
ISBN 978-3-456-86037-4
https://doi.org/10.1024/86037-000
Nutzungsbedingungen:
Der Erwerber erhält ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das ihn zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.
Der Inhalt dieses E-Books darf von dem Kunden vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere darf er Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernen.
Der Nutzer ist nicht berechtigt, das E-Book – auch nicht auszugsweise – anderen Personen zugänglich zu machen, insbesondere es weiterzuleiten, zu verleihen oder zu vermieten.
Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.
Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden. Davon ausgenommen sind Materialien, die eindeutig als Vervielfältigungsvorlage vorgesehen sind (z. B. Fragebögen, Arbeitsmaterialien).
Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.
Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Download-Materialien.
Zitierfähigkeit: Dieses EPUB beinhaltet Seitenzahlen zwischen senkrechten Strichen (Beispiel: |1|), die den Seitenzahlen der gedruckten Ausgabe und des E-Books im PDF-Format entsprechen.
Für Johann
und für Susanne, Leon, Pauline und Luisa
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Vorwort zur zweiten Auflage
Vorwort zur ersten Auflage
1 Einführung: Das Alexithymie-Konstrukt und seine psychometrische ErfassungHans J. Grabe und Carl Eduard Scheidt
1.1 Beschreibung und Begriffsbestimmung
1.2 Operationalisierung der Alexithymie
1.3 Epidemiologie und Ätiologie der Alexithymie
1.4 Psychometrische Erfassung der Alexithymie
1.4.1 Fremdbeurteilungsverfahren
1.4.2 Selbstbeurteilungsverfahren
1.4.3 Projektive Testverfahren
1.4.4 Andere Instrumente mit einer Nähe zur Alexithymie
1.5 Fazit
Literatur
2 Die historische Entwicklung des Alexithymie-Konzepts – eine KontroverseHans J. Grabe
Literatur
3 Vom Affekt zum Gefühl zum Mitgefühl: entwicklungspsychologische und neurowissenschaftliche Aspekte der AlexithymieMatthias Franz und Ralf Schäfer
3.1 Einführung
3.2 Die Bedeutung der Basisaffekte
3.3 Die Bedeutung der teilnehmenden Spiegelung für die Entwicklung emotionaler Kompetenzen
3.4 Das Gesicht als zentrales „Interface“ emotionalen Lernens
3.5 Ausblick
Literatur
4 Neurobiologie der AlexithymieHans J. Grabe, Michael Rufer und Jan Terock
4.1 Einführung
4.2 Neuroanatomische Konzepte
4.3 Strukturelle Befunde der MRT-Bildgebung
4.4 Funktionelle Bildgebungsstudien
4.5 Funktionelle Konnektivität
4.6 Hirnstrukturelle Veränderungen bei Alexithymie
4.7 Fazit
Literatur
5 Ätiologische Aspekte – Psychophysiologie und InformationsverarbeitungRalf Schäfer und Matthias Franz
5.1 Einführung
5.2 Liegt bei alexithymen Menschen eine veränderte psychophysiologische Reagibilität vor?
5.3 Liegen bei alexithymen Menschen Konnektions- und Interaktionsstörungen von kortikalen Netzwerkstrukturen vor, die an der Wahrnehmung und Verarbeitung affektiver Informationen beteiligt sind?
5.4 Einführung in die EEG-Technik und Beispiele für EEG-Untersuchungen zur Alexithymie
5.5 Empfinden und verarbeiten alexithyme Menschen Emotionen stärker, schwächer oder gar nicht, und welche Auswirkungen hat dies auf den sozialen Austausch?
5.6 Fazit
Literatur
6 Genetik und Endokrinologie der AlexithymieJan Terock und Hans J. Grabe
6.1 Einleitung
6.2 Familiarität und Genetik
6.2.1 Familien- und Zwillingsstudien
6.2.2 Kandidatengenstudien und Gen-Umwelt-Interaktionen
6.2.3 Genomweite Assoziationsstudien (GWAS)
6.3 Endokrinologie
6.3.1 Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse (HHN-Achse)
6.3.2 Renin-Angiotensin-Aldosteron-System
6.3.3 Oxytocin
6.3.4 Vitamin D
6.4 Fazit und Ausblick
Literatur
7 Bindung und AlexithymieElisabeth Waller und Carl Eduard Scheidt
7.1 Selbstbezug und interpersonelle Aspekte der Alexithymie
7.2 Die Bindungstheorie als theoretischer Referenzrahmen für das Verständnis der Alexithymie
7.2.1 Die funktionale Beziehung zwischen Bindungsverhalten und Affektregulation
7.2.2 Zusammenhänge zwischen Bindung und Affektregulation auf der Ebene von Repräsentationsprozessen
7.2.2.1 Kognitiv orientierte bindungstheoretische Ansätze
7.2.2.2 Psychodynamisch orientierte bindungstheoretische Ansätze
7.3 Empirische Zusammenhänge zwischen Alexithymie und Bindung: eine Frage der Konzeptbestimmung und Operationalisierung
7.4 Empirische Befunde zu den Zusammenhängen zwischen Bindung und Alexithymie
7.4.1 Zusammenhänge zwischen Alexithymie und der sprachlichen Verarbeitung von Bindungserfahrungen in AAI-Studien
7.4.2 Zusammenhänge zwischen Alexithymie und selbst eingeschätzten Bindungsstilen in aktuellen nahen Beziehungen
7.5 Diskussion
7.6 Fazit
Literatur
8 Alexithymie und Wahrnehmung emotionaler ReizeThomas Suslow
8.1 Einführung
8.2 Wahrnehmung und Verarbeitung emotionaler Reize
8.3 Automatische und kontrollierte Informationsverarbeitung
8.4 Alexithymie und kontrollierte Verarbeitung emotionaler Informationen
8.4.1 Kontrollierte Verarbeitung emotionalen Gesichtsausdrucks
8.4.2 Kontrollierte Verarbeitung lexikaler emotionaler Reize
8.4.3 Kontrollierte Verarbeitung akustischer emotionaler Informationen
8.4.4 Kontrollierte Verarbeitung olfaktorischer und taktiler emotionaler Informationen
8.5 Alexithymie und automatische Verarbeitung visueller emotionaler Informationen
8.5.1 Automatische Verarbeitung emotionalen Gesichtsausdrucks: Performanz in sequenziellen Verarbeitungsaufgaben
8.5.2 Automatische Verarbeitung emotionalen Gesichtsausdrucks: Wahrnehmung chimärischer Gesichter
8.5.3 Automatische Verarbeitung emotionalen Gesichtsausdrucks: Performanz in Aufgaben zum visuellen Remapping von Berührung
8.5.4 Automatische Verarbeitung lexikaler emotionaler Reize: Performanz in emotionalen Stroop-Aufgaben
8.5.5 Automatische Verarbeitung lexikaler emotionaler Reize: Performanz in affektiven Primingaufgaben
8.6 Fazit
Literatur
9 Zusammenhänge der Alexithymie mit somatischen, psychosomatischen und psychischen ErkrankungenFrank Leweke und Hagen Maxeiner
9.1 Einleitung
9.2 Krebserkrankungen
9.3 Essenzielle Hypertonie
9.4 Substanzmissbrauch/Abhängigkeit
9.5 Depressive Störungen
9.6 Angststörungen
9.7 Essstörungen
9.8 Traumafolgestörungen
9.9 Somatoforme Störungen
9.10 Schmerz
9.11 Fazit
Literatur
10 Alexithymie und SomatisierungElisabeth Waller und Carl Eduard Scheidt
10.1 Das Konzept der Somatisierung
10.2 Die Bedeutung von Affekten in psychodynamischen Ansätzen der Somatisierung
10.3 Aktuelle Theorien zur Affektregulation und Somatisierung
10.3.1 Kognitions- und neurowissenschaftliche Ansätze der Emotionsverarbeitung
10.3.1.1 Die Multiple-Code-Theorie der emotionalen Informationsverarbeitung
10.3.1.2 Die verkörperlichte und situierte neurowissenschaftliche Kognitionsforschung
10.3.2 Entwicklungspsychologische Ansätze zur Affektregulation
10.3.2.1 Affektmentalisierung nach Fonagy
10.3.2.2 Die Theorie der Levels of Emotional Awareness (LEA)
10.4 Empirische Befunde zum Zusammenhang zwischen Alexithymie und Somatisierung
10.5 Fazit
Literatur
11 Alexithymie und Psychotherapie – Forschungsstand und Konsequenzen für die PraxisMichael Rufer und Hans J. Grabe
11.1 Einführung
11.2 Theoretischer Hintergrund
11.3 Empirische Datenlage
11.3.1 Psychodynamische Therapieverfahren
11.3.2 Kognitiv-verhaltenstherapeutische Verfahren
11.3.3 Nichtpsychotherapeutische Behandlungsverfahren
11.4 Veränderbarkeit der Alexithymie durch eine Psychotherapie
11.5 Konsequenzen für Forschung und Praxis
11.6 Fazit
Literatur
12 Selbstmanagement-Training bei Alexithymie: Das Zürcher Ressourcen ModellJulia Weber
12.1 Das Zürcher Ressourcen Modell (ZRM)
12.1.1 Allgemeines
12.1.2 Zwei Systeme: der Verstand und das Unbewusste
12.2 Methoden
12.2.1 Somatische-Marker-Training
12.2.2 Affektbilanz und Ideenkorb
12.2.3 Motto-Ziele
12.3 Fazit
Literatur
13 Falldarstellung: Alexithymie – soziale Interaktion und Gegenübertragung in der therapeutischen BeziehungHarald Gündel und Michael Rufer
13.1 Einführung
13.2 Fallbeispiel
13.3 Therapieverlauf
13.4 Diskussion
13.5 Fazit
Literatur
14 Falldarstellung: Kognitiv-verhaltenstherapeutische Einzel- und Gruppentherapie bei chronischem Schwindel und AlexithymieMichael Rufer
14.1 Vor Therapiebeginn
14.2 Erstgespräch
14.3 Relevantes aus der Lebensgeschichte
14.4 Therapiebeginn und -planung
14.5 Gruppentherapie
14.6 Einzelsitzungen und Paargespräche
14.7 Nachsorgesitzungen
14.8 Diskussion
14.9 Fazit
Literatur
Autorinnen und Autoren
Sachwortverzeichnis
|13|Vorwort zur zweiten Auflage
Gut zehn Jahre nach dem Erscheinen der ersten Auflage dieses Buches haben wir als Herausgeber den Entschluss gefasst, es zusammen mit fast allen bisherigen sowie einigen neuen Autorinnen und Autoren gründlich zu überarbeiten und zu ergänzen. Hierfür gab es vor allem zwei Gründe. Zum einen ist die 2009 erschienene erste Auflage auf ein erfreulich breites Interesse gestoßen. Wir haben viele positive Kommentare und Rückmeldungen erhalten und zugleich auch wertvolle Hinweise auf Verbesserungsmöglichkeiten, die wir gerne aufnehmen wollten. Zum anderen sind die neuen Erkenntnisse hinsichtlich der Alexithymie als Affektregulationsstörung in den letzten Jahren schlichtweg überwältigend gewesen und das Alexithymie-Konzept hat nichts von dem außergewöhnlich großen Interesse von Wissenschaftlern und Klinikerinnen eingebüßt. Auch die neueren, methodisch ausgereiften Studien belegen einen relevanten Einfluss der Alexithymie als dimensionales Persönlichkeitsmerkmal auf verschiedene psychische und körperliche Funktionen sowie Morbidität und Mortalität.
Den aktuellen Entwicklungen wollten wir mit einer neuen Auflage Rechnung tragen, um weiterhin ein zeitgemäßes Standardwerk über die Alexithymie zur Verfügung stellen zu können. Wir hoffen, dass uns dies gelungen ist, indem nicht nur alle Kapitel von den jeweiligen Autorinnen und Autoren sorgfältig aktualisiert und erweitert wurden, sondern auch neue Kapitel zu aktuellen Themen hinzugenommen wurden.
Zu diesem Zweck wurde in die neue Auflage ein eigenes Kapitel zur Bindung und Alexithymie aufgenommen, da die Bindungsforschung in den letzten Jahren differenzierte Annahmen zur engen Verbindung zwischen Affektregulation und Bindung formuliert hat und dazu zahlreiche Forschungsarbeiten publiziert wurden. Ebenso hat sich das Wissen zu den genetischen Grundlagen der Alexithymie sowie den endokrinologischen Aspekten seit der letzten Auflage erheblich erweitert, sodass diesen Zusammenhängen ein zusätzliches Kapitel gewidmet wurde. Darüber hinaus sind in den letzten Jahren viele Arbeiten zur Umsetzung der vielfältigen Forschungsergebnisse in die therapeutische Praxis erschienen, weshalb auch zu diesem Thema ein neues Kapitel ergänzt wurde.
Das bewährte Grundkonzept des Buches wurde beibehalten, indem die ersten Kapitel Hintergrundinformationen zum Alexithymie-Konzept vermitteln, im nachfolgenden mittleren Teil zentrale ätiologische, neurobiologische, psychophysiologische und psychosomatische Aspekte dargestellt werden und im letzten Teil der Bezug zur Therapie im Vordergrund steht.
Für diese Neuauflage wünschen wir uns, dass sie die äußerst lebendige und innovative Auseinandersetzung von Wissenschaftlerinnen und Klinikern mit dem Thema Affektregulation und Alexithymie bereichert und dass daraus |14|neue Impulse für die Praxis entstehen. Über Kommentare, Anregungen und Kritik zu diesem Buch würden wir uns sehr freuen.
Oberwil (Schweiz) und Greifswald (Deutschland), im Januar 2022
Michael Rufer und Hans J. Grabe
|15|Vorwort zur ersten Auflage
Erfahrenen Klinikern ist das Phänomen der Alexithymie geläufig, auch wenn sie es je nach Therapieschule vielleicht anders bezeichnen: Der Patient erlebt seelische Symptome als hauptsächlich somatisches Geschehen, beispielsweise im Rahmen von somatoformen Störungen, Depressionen oder Angsterkrankungen. Der Affekt erscheint wie abgespalten, die Sprache ist faktenorientiert, und Emotionen können schlecht von somatischen Sensationen differenziert werden. Therapeutische Fragen zum emotionalen Erleben führen zu hilflosem Schweigen oder wenig differenzierten Antworten wie der, dass alles eben „normal“ sei. Diese charakteristischen Kennzeichen der Alexithymie sind nicht nur in klinischen Stichproben, sondern auch in der Allgemeinbevölkerung häufig zu finden: Etwa 10 % der Bevölkerung in Deutschland und über 25 % der Patienten in psychiatrischen, psychotherapeutischen und psychosomatischen Einrichtungen weisen erhebliche Ausprägungen alexithymer Merkmale auf.
Die Geschichte der Alexithymie-Forschung ist von lebendigen Kontroversen geprägt. Von einigen Fachleuten wurde die Alexithymie als Modell für die Entstehung aller psychosomatischen Störungen überschätzt, andere lehnten das Konstrukt der Alexithymie grundsätzlich ab und bezweifelten dessen Existenz. In den letzten Jahren erfährt das Konzept der Alexithymie eine beeindruckende Neubelebung, nicht zuletzt auch im Zuge der rasanten Entwicklungen der Neurowissenschaften. Heute gilt die Alexithymie als ein vielversprechendes und zeitgemäßes Modell für einen interdisziplinären Zugang zum Verständnis von Störungen der Emotionsregulation bei psychischen Erkrankungen.
Trotz der schon früh erkannten klinischen Relevanz der Alexithymie war die operationalisierte Diagnostik über lange Zeit sehr unbefriedigend. Eine Übersicht über die Entwicklung der unterschiedlichen diagnostischen Ansätze geben Hans J. Grabe und Carl E. Scheidt in ihrem Einführungskapitel „Das Alexithymiekonstrukt und seine psychometrische Erfassung“. In den 1970er- und 1980er-Jahren gab es in der Alexithymie-Forschung noch kaum valide Erfassungsinstrumente. Dies hat sich erst durch die Entwicklung der Toronto-Alexithymie-Skala geändert, durch die Entwicklung und Etablierung der 20-Item-Version (TAS-20) begann ab 1994 eine international vergleichbare Forschung auf diesem Gebiet. Seitdem sind über 1000 wissenschaftliche Publikationen erschienen, und viele der kontrovers diskutierten Ätiologiemodelle, die von Michael von Rad und Hans J. Grabe in dem Kapitel „Die Historische Entwicklung des Alexithymie-Konzepts – eine Kontroverse“ erläutert werden, sind inzwischen empirisch untersucht worden.
Nach wie vor stehen heute die Ätiologiemodelle der Alexithymie im Mittelpunkt zahlreicher Untersuchungen, es werden insbesondere entwicklungspsychologische und neurobiologische Modellvorstellungen geprüft. In diesem Buch werden den verschiedenen Modellen und |16|Befunden zur Ätiopathogenese der Alexithymie mehrere Kapitel gewidmet. Moderne entwicklungspsychologische Befunde und Theorien werden von Matthias Franz und Ralf Schäfer („Affekt ohne Gefühl: Entwicklungspsychologische und neurowissenschaftliche Aspekte der Alexithymie“) dargestellt und mit neurobiologischen Daten untermauert. Hans J. Grabe und Michael Rufer stellen in ihrem Kapitel über die „Neurobiologie und Genetik der Alexithymie“ vor allem Konzepte und Befunde zur funktionellen Anatomie sowie die Ergebnisse von Familien- und Zwillingsstudien zur Alexithymie vor. Elektro- und psychophysiologische Untersuchungen werden von Ralf Schäfer und Matthias Franz in ihrem Kapitel „Ätiologische Aspekte – Psychophysiologie und Informationsverarbeitung“ bezüglich ihrer klinischen Relevanz und ihres Beitrags zum Konzeptverständnis der Alexithymie diskutiert. Der Einfluss alexithymer Affektverarbeitungsmodi auf experimentelle Paradigmen der bewussten und unbewussten (automatischen) Emotions- und Affektverarbeitung wird von Thomas Suslow („Alexithymie und die Wahrnehmung emotionaler Reize“) erläutert. Die Texte der Autoren machen deutlich, wie groß der empirische Wissenszuwachs seit der wegweisenden, aber sehr theoriedominierten 11. European Conference on Psychosomatic Research 1976 in Heidelberg ist. Sie zeigen aber auch, wie schwierig es immer noch ist, psychologische Phänomene zusammen mit ihren biologischen Korrelaten widerspruchsfrei zu erfassen und zu verstehen.
Die konzeptuellen Wurzeln der neueren Alexithymieforschung liegen in der psychosomatischen Medizin und ihrem traditionell psychotherapeutisch geprägten Behandlungsansatz. Allerdings hat die empirische Forschung der letzten zwei Jahrzehnte eindeutig gezeigt, dass die klassischen psychosomatischen Erkrankungen oder Somatisierungsstörungen keinesfalls die Voraussetzung für das Vorliegen alexithymer Affektverarbeitungsmodi sind; eine verstärkte Ausprägung alexithymer Merkmale findet sich ebenfalls bei vielen Patienten mit anderen psychischen und auch somatischen Erkrankungen. Diese Tatsache wird von Frank Leweke und Sandra Bausch in ihrem Kapitel „Alexithymie und Krankheit – Zusammenhänge mit somatischen, psychosomatischen und psychischen Erkrankungen“ differenziert aufgegriffen. Die konzeptuell und klinisch wichtige Schnittmenge zwischen der Alexithymie und somatoformen Störungen wird von Elisabeth Waller und Carl E. Scheidt („Alexithymie und Somatisierung“) aufgezeigt.
Die Alexithymie ist, neben den intrapsychischen Phänomenen, immer auch mit einer veränderten sozialen Interaktion assoziiert, in der die Wahrnehmung der affektiven Aspekte des Interaktionspartners durch den Betroffenen mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden ist. Über die interaktionellen Folgen der Alexithymie gibt es erstaunlich wenige empirische Befunde. Diese werden von Harald Gündel in dem Kapitel „Alexithymie – soziale Interaktion und Gegenübertragung in der therapeutischen Beziehung“ zusammengefasst und anhand eines klinischen Falles exemplarisch dargestellt und bewertet.
Der ausdrückliche Bezug zur Praxis ist ein wichtiges Anliegen dieses Buches. Dabei geht es insbesondere um die Relevanz alexithymer Patientenmerkmale für psychotherapeutische Behandlungen. Dass der häufig geäußerte Therapiepessimismus in Bezug auf alexithyme Patienten nicht gerechtfertigt ist, zeigen – auf der Basis der Ergebnisse empirischer Studien – Michael Rufer und Hans J. Grabe in ihrem Kapitel „Alexithymie und Psychotherapie – Forschungsstand und Konsequenzen für die Praxis“. Zwei ausführliche Fallbeispiele von David Garcia und Josef Jenewein („Alexithymie und psychoanalytische Psychotherapie“) sowie Michael Rufer („Falldarstellung: Kognitive Verhaltenstherapie – chronischer Schwindel und Alexithymie“) erweitern diese Erkenntnisse um die konkrete Praxissituation.
Wir hoffen, dass die Lektüre dieses Buches die Aufmerksamkeit von Klinikern und Wissen|17|schaftlern für die Alexithymie fördert und diejenigen, die sich schon damit beschäftigen, zu neuen Ideen anregt. Zweifelsohne wird dieses Buch nicht alle Fragen beantworten können und viele neue Fragen aufwerfen. Wenn dies zu einer fruchtbaren Auseinandersetzung mit dem Thema beiträgt, hätten wir als Herausgeber unser Ziel erreicht.
Hans J. Grabe und Michael Rufer
|19|1 Einführung: Das Alexithymie-Konstrukt und seine psychometrische Erfassung
Hans J. Grabe und Carl Eduard Scheidt
Zusammenfassung: Kernmerkmale der Alexithymie sind Schwierigkeiten in der Wahrnehmung und Kommunikation von Gefühlen und ein stereotyper, an äußeren Ereignissen orientierter Denkstil. In diesem Kapitel wird der wissenschaftliche Diskurs zur konkreten Entwicklung und Abgrenzung des Alexithymie-Konstrukts nachvollzogen. Dies betrifft auch die Entwicklung geeigneter Fragebogen- und Interviewinstrumente zur operationalisierten Erfassung der Alexithymie. Es werden die grundlegenden Ätiologiemodelle der Alexithymie vorgestellt.
1.1 Beschreibung und Begriffsbestimmung
Der Begriff der Alexithymie umschreibt in seiner heute gebräuchlichen Definition eine affektiv-kognitive Störung, die im Bereich der Affektivität mit Schwierigkeiten in der Wahrnehmung und Kommunikation von Gefühlen und im kognitiven Bereich mit einem stereotypen, an äußeren Ereignissen orientierten Denkstil verbunden ist (Bagby & Taylor, 1997). Zudem neigen alexithyme Patienten oft zur Fantasiearmut und weisen eine besonders konkrete, flache und vereinfachte Sprache auf. Gerade bei alexithymen Menschen mit einer psychosomatischen Störung können körperliche Beschwerden wie Schmerzen und Muskelzucken herausragende Themen während der Therapie sein. Ein ausschließlicher Bezug auf Ereignisse in der Gegenwart und eine ausgeprägt external bezogene Sicht auf die Realität sind ebenso auffällig wie die chronologische Darlegung von Fakten. Marty und de M’Uzan (1963) beschrieben diese Art der Sprache als operationales Denken. Die Unfähigkeit alexithymer Menschen, zu träumen, Tagträume zu erleben und zu fantasieren, wurde von verschiedenen Autorinnen als Symptom des fehlenden Zugangs zum Unterbewusstsein und zu eigenen Gefühlen und somit auch als ein Zeichen eines gestörten interpersonellen Verhältnisses interpretiert (Krystal 1982; de M’Uzan, 1974; Marty & de M’Uzan, 1963).
Wenn alexithyme Patienten versuchen, Ursachen für ihre klinischen Beschwerden zu finden, sind innere Einstellungen, Gefühle, Wünsche oder Beweggründe fast nie eine Möglichkeit, die sie in ihre Überlegungen einbeziehen würden. Krystal (1988) beschreibt eindrucksvoll eine Undifferenziertheit der Gefühle alexithymer Menschen. Beispielsweise kann es ihnen schwerfallen, zu unterscheiden, ob sie traurig, müde, hungrig oder krank sind.
Der zu Beginn der 1970er-Jahre von Sifneos (1973) neu eingeführte Terminus „Alexithymie“ stammt aus dem Griechischen und lässt sich folgendermaßen übersetzen: „Es fehlen die Worte für Gefühle“ (a = Fehlen, lexis = Wort, thymos = Emotion). Werden Wörter zur Bezeichnung eines Gefühls verwendet, symbolisieren sie keine inneren Zustände, d. h., sie ent|20|behren jeglicher psychologischen Bedeutung. In der neueren Alexithymie-Forschung wird Alexithymie als eine Störung im somatopsychischen Verarbeiten oder Regulieren von Emotionen aufgefasst, es besteht somit ein Defizit in der kognitiven Verarbeitung von Affekten (Taylor & Bagby, 1997).
Es ist wichtig, zu berücksichtigen, dass es sich bei der Alexithymie um ein psychologisches Konstrukt handelt. Die Grundlage dieses Konstrukts stellen die genauen Beobachtungen von typischen Patienten dar. Das beobachtbare Verhalten in Interaktionen und therapeutischen Prozessen, ihr reduzierter bewusster Umgang mit emotionalen Inhalten und Gefühlen und weitere kognitive Merkmale stellen die Grundlage der Konstruktentwicklung dar. Was nun im engeren Sinne zu einem psychologischen Konstrukt, in diesem Falle zur Alexithymie, dazugehört, ist tatsächlich Gegenstand der empirischen Forschung und der Konstruktvalidierung. Dies kann durchaus zu Veränderungen der Theoriebildung und zu der Frage führen, wie breit oder eng die Alexithymie denn nun zu fassen ist.
In der wissenschaftlichen Literatur wird häufig zwischen „Emotion“ und „Gefühl“ (feelings) unterschieden. Hierbei bezieht sich der Begriff „Emotion“ auf physiologische Erregungen und die Wahrnehmung körperlich empfundener Sensationen, die die Grundlage eines „Gefühls“ mit subjektiver und psychologischer (kognitiver) Bedeutung darstellen. Eine Komponente der emotionalen Reaktion und des emotionalen Erlebens ist somit die neurophysiologische Erregung des autonomen Nervensystems und des Neuroendokrinums (z. B. Ausschüttung von Stresshormonen), die andere Komponente ist eine motorische oder behavioral-expressive Komponente (z. B. Veränderung des Gesichtsausdrucks, Weinen, Körperhaltung, Stimmlage). Die dritte Komponente ist das kognitive Erleben (subjektives Bewusstsein und sprachliche Kommunikation des Gefühlszustandes) (Dodge & Garber, 1991; Frijda, 1986).
Es ist zu beachten, dass die ersten beiden Emotionskomponenten einen starken biologisch-behavioralen Anteil haben, diese Prozesse sind bei allen Völkern und Kulturen stabil repräsentiert und laufen zum Teil autonom ab. Auch im Tierreich lassen sich diese ersten beiden Systeme klar nachweisen. Diese Verhaltens- und Steuerungssysteme haben eine große Bedeutung für das Überleben der Spezies (z. B. Fluchtverhalten, Aufzucht von Nachkommen, nonverbale Kommunikation) und besitzen somit eine hohe evolutionäre Stabilität (Darwin, 1872/1965). Im Tierreich können diese Prozesse auch weitgehend ohne neokortikale Verarbeitung ablaufen. Beim Menschen gehört die dritte psychologische Komponente, das kognitive Erleben, zum emotionalen Erleben dazu. So erst kann ein subjektives Bewusstsein über den eigenen emotionalen Zustand entstehen, das gerade Erlebte in den persönlichen Erfahrungskontext eingeordnet und eine zielgerichtete Handlungsintentionalität entfaltet werden. Der Begriff „Gefühl“ bezieht sich auf diese dritte Komponente des emotionalen Erlebens, das kognitive Erleben.
Das Gefühl entsteht also erst in einer komplexen kognitiven Verarbeitung dieser emotionalen Grundprozesse. Hierbei werden der persönliche Situationskontext, die eigenen Vorerfahrungen (z. B. emotional prägende Erlebnisse, Beziehungserfahrungen) und auch zukünftige Handlungsabsichten und Ziele mit diesen sensorischen „Emotionen“ verknüpft. Somit können z. B. aus einer zunächst wahrgenommenen ängstlichen Anspannung und Verkrampfung verschiedene Gefühle, z. B. Wut, Ärger, Neid, Scham, kognitiv differenziert werden, die dann spezifisch handlungsleitend wirksam werden können. Es muss betont werden, dass die Begriffe Emotion und Gefühle in der Literatur nicht konsistent definiert und voneinander abgegrenzt werden. Hinzu kommt, dass der Begriff des „Affekts“ eine weite Verwendung erfährt. Unter Affekt wird im Allgemeinen die gesamte physiologische, behavioral-motorische und kognitive Reaktion des Individuums auf einen emotionsstimulierenden Reiz bzw. auf eine emotionsstimulierende |21|Situation verstanden. Somit fällt auch die subjektive Repräsentation eines Gefühls vor dem Hintergrund persönlicher Erfahrungen und Erinnerungen unter den Begriff des Affekts. Die Störung der Affektverarbeitung bei der Alexithymie bezieht sich somit auf Defizite der bewussten, reflexiven, subjektiv-individuellen Komponenten der Emotions- und Situationsverarbeitung und auf ein geringes Verständnis der emotionalen Reaktion vor dem persönlichen Erfahrungs- und Erlebenshorizont.
Historisch wurzelt die Neueinführung des Alexithymie-Begriffs in den klinischen Eindrücken und systematischen Beobachtungen mehrerer Autoren aus ganz unterschiedlichen Fachgebieten, die in ihren Befunden unabhängig voneinander gemeinsame klinische Charakteristika bei Menschen mit einer psychosomatischen Erkrankung festgestellt haben. Beispielsweise beschrieb Ferenczi schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine auffallende Fantasie- und Emotionsarmut bei Patienten mit unterschiedlichsten Diagnosen (Ferenczi & Rank, 1924). Fenichel spricht bereits 1945 von einem „emotionally frigide type“ im Zusammenhang mit der Unfähigkeit, Affekte wahrzunehmen und auszudrücken infolge eines starken Abwehrvorganges, der zu Organschädigungen und somatischen Reizungen führen soll (Fenichel, 1945).
Zunächst wurde die Symptomatik im Sinne der Freud’schen Konfliktpathologie interpretiert und somit ein intrapsychischer Konflikt postuliert, der durch die Aufdeckung unbewusster Konflikte therapiert werden könne. 1948 beschrieb Ruesch Störungen des verbalen und symbolischen Ausdrucks bei Patientinnen mit einer „klassischen“ psychosomatischen und auch chronischen Erkrankung. Er attribuierte diese mit einem Stillstand in der Persönlichkeitsentwicklung und spricht von einer „infantilen Persönlichkeit“, die er als „Kernproblem in der psychosomatischen Medizin“ betrachtet (Ruesch, 1948; Taylor, Bagby & Parker, 1991).
McLean brachte 1949 einen zusätzlichen neurophysiologischen Aspekt in die Diskussion ein. Nach seinem Modell des „dreieinigen Gehirns“ formulierte er die These, dass bei diesen Patienten die Emotionen weniger über den Neokortex in Form von Wörtern, sondern vielmehr direkt über autonome Strukturen Ausdruck gewinnen und über physiologische Veränderungen zu physischen Erkrankungen führen können (McLean, 1949).
Kelman und Horney machten zu Beginn der 1950er-Jahre einen Mangel an emotionalem Bewusstsein und innerer Wahrnehmung für die nur geringe Ansprechbarkeit einiger Patientinnen auf eine Psychotherapie verantwortlich. Zudem fanden sie bei ihnen ein nur geringes Interesse an Träumen, ein sehr konkretes Denken und eine external orientierte Lebensweise. Sie diskutierten die Möglichkeit, dass dies eine Folge eines massiven Widerstandes gegen unbewusste Konflikte sein könnte. Diese Patienten zeigten auch ein gehäuftes Auftreten psychosomatischer Symptome, und zwar oft in Verbindung mit einer Essstörung, Alkoholmissbrauch und einer anderen zwanghaften Verhaltensstörung (Horney, 1952; Kelman, 1952; Taylor et al., 1991).
Etwa 10 Jahre später führten Marty und de M’Uzan 1963 den Begriff des „pensée operatoire“ ein, der die operational ausgerichtete Denkweise und Fantasielosigkeit der von ihnen beobachteten somatisch kranken Patienten beschreibt. Diese seien hauptsächlich mit ihren körperlichen Symptomen und dem minutiös detaillierten Ablauf externer Ereignisse beschäftigt und hätten unzureichende Fähigkeiten, Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen. Die Autoren führten diese Eigenschaften eher auf eine Störung der Persönlichkeitsorganisation als auf die bisher postulierten neurotischen Widerstände zurück (de M’Uzan, 1974; Marty & de M’Uzan, 1963, Taylor et al., 1991). Zusätzlich wurde der Begriff „vie operatoire“ eingeführt, um den mit den prägenden Eigenschaften einhergehenden Lebensstil alexithymer Menschen zu beschreiben (Marty & DeBray, 1989).
Die vergleichbaren klinischen Beobachtungen dieser Forschenden über psychologische |22|Merkmale von Patienten mit psychosomatischen Erkrankungen führten zu der Annahme einer spezifischen „psychosomatischen Struktur“, die in Abgrenzung von der psychoneurotischen Struktur unter anderem durch eine basale Störung im Bereich der Symbolisierung und damit einhergehend durch einen Mangel an intrapsychischer Konfliktfähigkeit (Stephanos, 1973) gekennzeichnet ist.
Es wurde ein Zusammenhang zwischen einer hohen Ausprägung alexithymer Merkmale und sozialer Konformität, einer Tendenz zu konfliktvermeidendem Verhalten, einer eingeschränkten Erinnerung an Träume, einer steifen bis hölzernen Körperhaltung und einer eingeschränkten Mimik gefunden (Sifneos, Apfel-Savitz & Frankel, 1977).
Nach Ansicht mehrerer Autoren ist das Alexithymie-Syndrom als eine Kombination von kognitiven und affektiven Störungen sowie von Störung der inter- und intrapersonellen Beziehungen anzusehen (Krystal, 1988; Lolas & van Rad, 1989; McDougall, 1982a). In ihren Studien werden die Störungen entweder vom Interviewer oder von den Patienten selbst beschrieben.
Nach der Beobachtung mehrerer Autoren (Apfel & Sifneos, 1979; McDougall, 1982b; Nemiah, Freyberger & Sifneos, 1976) werden alexithyme Menschen durch ein ausdrucksloses Gesicht und eine minimale Körpersprache charakterisiert. Gering ausgeprägte Bewegungen und Gesten, eine reduzierte Mimik und eine mechanistische Anpassung an die Realität können im Familien- oder Freundeskreis, aber auch beim Therapeuten Frustration und Langeweile hervorrufen.
1.2 Operationalisierung der Alexithymie
Ein Überblick über die Literatur zeigt, dass dem Begriff seit seiner Einführung trotz gemeinsamer Kernmerkmale Probleme der definitorischen Heterogenität und Bedeutungsverschwommenheit anhaften (Laireiter, 1989). Die hieraus folgenden Schwierigkeiten für eine wissenschaftliche Operationalisierung des Konstrukts lagen auf der Hand. Zu den zentralen Merkmalen der Symbolisierungsstörung wurden von den oben genannten Forschenden Defizite in der Mitteilungs- und Erlebensfähigkeit, eine bestimmte Art von konkretistischem Denken (operatives Denken) und ein Mangel an Fantasie subsumiert. Abgesehen von diesen Phänomenen fanden sich in den Darstellungen jedoch nur wenige Übereinstimmungen; vielmehr wurden unterschiedlich viele und zum Teil verschiedene Einzelmerkmale dem Begriff der Alexithymie zugeordnet (Zusammenfassung bei Laireiter, 1989).
In einer umfassenden Bestandsaufnahme zur Alexithymie schlug Laireiter (1989) vor, zwischen einer klassischen, singulären Bedeutung und einer erweiterten Bedeutung des Alexithymie-Begriffs zu unterscheiden. Alexithymie im singulären Sinne bezieht sich demnach auf die Bedeutung, die der Begriff in den ersten Publikationen der amerikanischen Autoren Nemiah (1977) und Sifneos (1973) besaß, nämlich Probleme in der Mitteilung von subjektivem Erleben und Gefühlen. Alexithymie im weiteren Sinne bezieht sich auf Explikationen anderer Autoren und auf spätere Publikationen von Nemiah und Sifneos. Auf der Grundlage seiner theoretischen Analysen fasste Laireiter insgesamt sechs Aspekte des Alexithymie-Begriffs zusammen:
Probleme in der Mitteilung von subjektivem Erleben und Gefühlen (Alexithymie im engeren Sinn),
eingeschränkter Denkstil im Sinne des operativen Denkens,
Fantasiemangel,
Reduplikation,
Handlungsorientiertheit,
spezifisches Verhalten in klinischen Interviews.
Eine theoretisch und empirisch gewonnene Klärung der diagnostischen Kernbestandteile des Konstrukts erfolgte durch die Forschungsgruppe um Taylor und Bagby (1997). Die theoretischen Analysen der Autoren zum Alexithymie-Kon|23|strukt ergaben fünf Dimensionen, von denen vier mit den von Lairaiter aufgezeigten Kernmerkmalen übereinstimmen (siehe Tab. 1-1). Folgt man den faktoriellen Analysen in Zusammenhang mit der Konstruktion der Toronto-Alexithymie-Skala (TAS), so umfasst das Alexithymie-Konstrukt in seiner jetzigen Operationalisierung (TAS-20) (Bagby, Parker & Taylor, 1994; Bagby, Taylor & Parker, 1994) folgende drei Faktoren:
Schwierigkeiten bei der Identifizierung von Gefühlen,
Schwierigkeiten bei der verbalen Beschreibung von Gefühlen,
ein external orientierter Denkstil.
Tabelle 1-1: Kernmerkmale des Alexithymie-Konstrukts auf der Grundlage theoretischer Analysen von Lairaiter (1989) und Taylor und Mitarbeitern (1985) sowie auf der Grundlage einer empirischen Fundierung durch die Konstruktion der Toronto-Alexithymie-Skala (TAS) und des Toronto Structured Interview for Alexithymia (TSIA) (Bagby et al., 2006)
Laireiter (1989)
Taylor et al. (1985)
TAS-26
TAS-20
TSIA
Alexithymie im engeren Sinn
Emotionales Erlebens- und Differenzierungsproblem
Schwierigkeiten, Gefühle zu identifizieren
x
x
x
Defizite in der Mitteilungs- und Kommunikationsfähigkeit
Schwierigkeiten bei der verbalen Beschreibung von Gefühlen
x
x
x
Operatives Denken
Defizite in der Introspektionsfähigkeit
x
x
x
Fantasiemangel
Eingeschränkte oder fehlende kognitive Tätigkeit im Bereich der Fantasie, der Vorstellung, des Tagträumens sowie des Nachtträumens. Ebenso bestehen Einschränkungen im Bereich der Kreativität und der Assoziationstätigkeit.
Fantasiemangel
x
x
Reduplikation
Wahrnehmungsweise, bei der der Patient den anderen stereotyp, vage und ohne Wahrnehmung seiner lebendigen Besonderheit erlebt
–
Handlungsorientiertheit
Defizite im Bereich der Belastungsbewältigung und –verarbeitung
–
Spezifisches Verhalten in klinischen Interviews
Defizite v. a. im Bereich des non- und paraverbalen sowie prosodischen Emotionsausdrucks und der nonverbalen Kommunikation
–
–
Soziale Orientiertheit
Defizite im Bereich der Fantasie- und Vorstellungsfähigkeit und eine mangelnde Erinnerung an Träume wurden als zentrale Merkmale des |24|ursprünglichen Alexithymie-Begriffs nur in der ersten Version der TAS (TAS-26) (Taylor, Ryan & Bagby, 1985), nicht jedoch in der TAS-20 berücksichtigt. Dort wurde die Dimension der Fantasie- und Vorstellungsfähigkeit aufgrund psychometrischer Analysen nicht mehr mit integriert (siehe unten). Aufgrund der prinzipiellen Bedeutung der reduzierten Fantasie- und Vorstellungsfähigkeit für das Konstrukt der Alexithymie wurde diese erneut in das Toronto Structured Interview for Alexithymia (TSIA) (Bagby, Taylor, Parker & Dickens, 2006) aufgenommen.
Wie aus Tabelle 1-1ersichtlich wird, überlappen sich theoretische und empirische Analysen zu den Fragen nach den Kernbestandteilen der Alexithymie in den beiden Konzepten zur Alexithymie im engeren Sinne (Probleme in der Mitteilung von subjektivem Erleben und Gefühlen) und dem operativen Denken. Die Ergebnisse der empirischen Analysen legen nahe, dass der Bereich der Alexithymie im engeren Sinne zwei voneinander zu trennende, aber hoch miteinander korrelierte Aspekte (Differenzierung/Erleben und Verbalisierung/Mitteilung) umfasst.
Zur besseren Handhabung der Symptome und ergänzend zu aktuell klinisch angewandten Klassifikationssystemen (ICD-10, DSM-IV) wurden von Fava, Mangelli und Ruini (2001) Kriterien erarbeitet, von denen mindestens drei erfüllt sein müssen, um bei einer Patientin das Vorliegen von Alexithymie zu diagnostizieren:
Unfähigkeit, Gefühle adäquat zu verbalisieren,
Neigung, Details eines Ereignisses anstelle von Gefühlen zu beschreiben,
Mangel an Fantasie,
Denkinhalt wird eher von äußeren Geschehnissen als von Gefühlen bestimmt,
somatische Symptome werden nicht mit Reaktionen auf das Gefühlsleben in Zusammenhang gebracht,
gehäuftes Auftreten heftiger oder inadäquater affektiver Ausbrüche.
1.3 Epidemiologie und Ätiologie der Alexithymie
Die Angaben zur Häufigkeit der Alexithymie in der Allgemeinbevölkerung oder in bestimmten Behandlungsstichproben beziehen sich alle auf den TAS-20 und den Cut-off-Wert von TAS-20 > 61 für Alexithymie. Aktuelle Daten aus Deutschland zeigen, dass insgesamt mehr als 10 % der Menschen (11,1 % der Männer und 8,9 % der Frauen) aus der Allgemeinbevölkerung (n = 1859, Alter 20 bis 69 Jahre) TAS-20-Werte über 60 aufweisen und somit mit hoher Wahrscheinlichkeit als alexithym zu klassifizieren sind (Franz et al., 2008). Geschiedene, Alleinlebende und Menschen mit einem niedrigen sozialen Status wiesen häufiger alexithyme Persönlichkeitszüge auf.
In einer früheren Studie aus Finnland wurde bei 1 285 Menschen aus der Allgemeinbevölkerung eine Prävalenz der Alexithymie (TAS-20 > 61) von insgesamt 13 % ermittelt. Männer waren mit 17 % fast doppelt so häufig betroffen wie Frauen (10 %). Auch hier zeigten sich Assoziationen mit niedrigem sozioökonomischen Status, geringer Bildung und höherem Lebensalter (Salminen, Saarijarvi, Aarela, Toikka & Kauhanen, 1999).
In einer großen Studie (Northern Finland Birth Cohort 1986 Study) aus Finnland wurden erstmals Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren (n = 9 432) bezüglich ihrer TAS-20-Werte untersucht. 10 % der Mädchen und 7 % der Jungen wiesen TAS-20-Werte von über 60 auf. Eine schlechte schulische Ausbildung der Mutter, eine „broken home“-Situation und das Leben in einer ländlichen Gegend waren mit erhöhten TAS-20-Werten assoziiert (Joukamaa et al., 2007).
Das Alexithymie-Konstrukt hat innerhalb der biopsychosozialen Medizin ein breites Interesse gefunden und viele Diskussionen angeregt, aber auch Kontroversen ausgelöst. Kennzeichnend für die Alexithymie-Forschung der 1970er-Jahre war eine vorrangige und möglicherweise vorschnelle Beschäftigung mit ätio|25|logischen Zuordnungen. 1976 war die Theorie der Alexithymie eines der Hauptthemen der 11. European Conference on Psychosomatic Research in Heidelberg (Bräutigam & von Rad, 1977). Die dort geführte Ätiologiedebatte zentrierte sich im Wesentlichen um fünf verschiedene Positionen:
die Hypothese einer hirnorganischen Lokalisierung (Nemiah, 1977),
die Annahme einer genetischen Disposition (Heiberg & Heiberg, 1977),
die Hypothese einer traumabedingten Genese (Freyberger, 1977),
die Annahme einer psychodynamischen Genese (Nemiah & Sifneos, 1970; Stephanos, 1973),
die Hypothese einer reaktiven alexithymen Reaktion auf die Untersuchungssituation (Cremerius, 1977; Wolff, 1977).
Heute zentrieren sich die Ätiologieannahmen im Wesentlichen um einen interaktions- bzw. psychodynamischen und neuropsychologischen Erklärungsansatz.
Interaktionsdynamische Ätiologievorstellungen zur Alexithymie lassen sich noch einmal unterteilen in die beiden Grundannahmen (1) eines intrapsychischen Abwehrvorganges (Bogutyn, Kokoszka, Palczynski & Holas, 1999) und (2) einer affektiven Entwicklungsstörung (Bagby & Taylor, 1997; Krystal, 1988). In der letztgenannten Ätiologieannahme wird die Alexithymie als Folge einer Störung der emotional-kognitiven Entwicklung bzw. der Entwicklung der Mentalisierungsfähigkeit aufgefasst (Lane & Schwartz, 1987). Im Zusammenhang mit dieser Sichtweise werden Fragen nach dem Einfluss infantiler Traumatisierungen oder von Defiziten in den frühen affektiven Bindungserfahrungen auf die Entwicklung der Affektmentalisierung untersucht.
Aktuelle Überlegungen zu neurophysiologischen Störungen als ätiologische Determinante alexithymen Verhaltens beziehen sich auf Störungen auf der Ebene interhemisphärischer Verbindungen, auf rechtshemisphärische Dysfunktionen sowie auf Dysbalancen auf der Ebene frontal-subkortikaler neuronaler Schaltkreise. Zunehmend rücken auch wieder familiär-genetische Aspekte der Alexithymie in den Vordergrund des Interesses.
Die skizzierten Ätiologiemodelle werden in den folgenden Kapiteln des Buches wesentlich vertieft.
1.4 Psychometrische Erfassung der Alexithymie
Die valide und reliable psychometrische Erfassung des Alexithymie-Konstrukts ist eine entscheidende Voraussetzung zur international vergleichbaren Erforschung der Alexithymie. So klinisch bedeutsam die Alexithymie auch sein mag, so viele eigene Patienten der erfahrene Kliniker und Therapeut auch als alexithym bezeichnen würde, so schwierig gestaltet sich doch die operationalisierte Erfassung der Alexithymie. Hier sollen die bislang wichtigsten Instrumente zur Alexithymie-Erfassung kurz vorgestellt und diskutiert werden (siehe Tab. 1-2 am Ende dieses Unterkapitels).
1.4.1 Fremdbeurteilungsverfahren
Das Beth Israel Hospital Psychosomatic Questionnaire (BIQ) wurde von Sifneos (1973) als Interview mit 17 Items entwickelt. Zunächst wurde eine freie Exploration durchgeführt, danach wurde gezielt die Fähigkeit der Patientin exploriert, Gefühle zu beschreiben und Fantasien und Träume zu berichten. Der BIQ enthält acht Items, die im engeren Sinne alexithyme Persönlichkeitszüge abbilden. Auf diesen beruht auch der „Alexithymie-Score“ des BIQ. Verschiedene Studien haben nachfolgend die Interrater-Reliabilität und die Test-Retest-Reliabilität des BIQ untersucht. Insgesamt zeigte sich ein recht heterogenes und eher unbefriedigendes Bild der BIQ-Originalversion mit zum Teil sehr niedrigen Interrater- und Test-Retest-Korrelationen (Keltikangas-Jarvinen, 1987; |26|Lolas , de la Parra, Aronsohn & Collin, 1980). Verschiedene Arbeitsgruppen entwickelten modifizierte Versionen des BIQ, um bessere psychometrische Eigenschaften zu erhalten (Bagby, Parker & Taylor, 1994).
Ein weiteres Interview ist der Alexithymia Provoked Response Questionnaire (APRQ) von Krystal, Giller und Cicchetti (1986). Die 17 Fragen des APRQ basieren auf einer Selbstbeurteilungsversion der BIQ. Der Proband wird danach beurteilt, wie differenziert er Gefühle sprachlich ausdrücken kann, während er sich in eine Reihe von standardisierten Stresssituationen hineinversetzt. Zwei Studien beschreiben eine hohe Interrater-Reliabilität des APRQ, aber jedoch eine sehr niedrige Übereinstimmung mit Selbstbeurteilungsinstrumenten zur Alexithymie-Erfassung (Krystal et al., 1986; Pierce, Faryna, Davidson, Markart & Krystal, 1989). Obwohl der APRQ von den Probanden verlangt, dass sie sich in emotionale Situationen hineinversetzten, also die Vorstellungskraft von differenzieller Bedeutung ist, wird lediglich die sprachliche Ausdrucksfähigkeit als Beurteilungskriterium verwendet. Insgesamt wird der APRQ nicht zur Verwendung empfohlen (Taylor et al., 1997).
DieObserver Alexithymia Scale (OAS) (Haviland, Warren & Riggs, 2000) ist als Rating-Instrument für Angehörige und Freunde der Patienten oder Probanden gedacht, die diese beurteilen sollen. Auf 33 Items werden alltagsbezogene Verhaltensweisen erfasst. Die Items wurden aus den 100 Items des California Q-set Alexithymia Prototype (CAQ-AP) ausgewählt (Haviland, 1998; Haviland & Reise, 1996). Es ergeben sich faktoranalytisch fünf Dimensionen: Distanz, mangelnde Einsichtsfähigkeit, Somatisierung, Humorlosigkeit, Rigidität. Die interne Konsistenz und die 2-Wochen-Test-Retest-Reliabilität waren gut. Es liegen inzwischen validierte Übersetzungen der Skala aus Frankreich (Berthoz, Haviland, Riggs, Perdereau & Bungener, 2005) und China (Yao, Yi, Zhu & Haviland, 2005) vor. Die OAS-Fremdratings korrelieren signifikant und positiv mit der TAS-20-Selbsteinschätzung (Berthoz, Perdereau, Godart, Corcos & Haviland, 2007) und mit dem BIQ (Haviland, Warren, Riggs & Nitch, 2002).
Die neueste Entwicklung im Bereich der Fremdbeurteilungsverfahren stellt das Toronto Structured Interview for Alexithymia (TSIA) dar, das von der Arbeitsgruppe um Bagby und Taylor aus Toronto entwickelt wurde (Bagby et al., 2006). In einem aufwendigen statistischen Selektionsprozess wurden 24 Items ausgewählt, die die Dimensionen „difficulty identifying feelings“ (DIF), „difficulty describing feelings“ (DDF), „externally oriented thinking“ (EOT) und „imaginal processes“ (IMP) abbilden. In Clusteranalysen bildeten die Dimensionen DIF und DDF eine höhere Hauptskala, die „affect awareness“ (AA) genannt wurde. EOT und IMP bildeten gemeinsam die zweite Hauptskala, die „operative thinking“ (OT) genannt wurde.
Alle 24 Items werden strukturiert im Interview erfragt und zielen direkt auf die bezeichneten Fähigkeiten ab. Der Proband wird aufgefordert, bei allen Antworten Beispiele von entsprechenden Situationen aus seinem Leben zu benennen. Dies ermöglicht anhand eines ausführlichen Codierungskataloges die dreistufige Beurteilung der Alexithymie-Ausprägung pro Item. In den ersten Validierungsstudien an ambulanten Patienten und Probanden aus der Allgemeinbevölkerung zeigte das TSIA gute psychometrische Eigenschaften und eine gute Interrater- und Retest-Reliabilität.
Inzwischen ist eine deutschsprachige Version des TSIA entwickelt worden. Durch drei Übersetzungs-Rückübersetzungs-Zyklen der deutschsprachigen Version ins Englische mit jeweiliger Optimierung wurde die inhaltliche Übereinstimmung mit der Originalversion sichergestellt. Die Validierungsstudie wurde an 237 Patienten aus Deutschland und der Schweiz durchgeführt. Die gute Konstruktvalidität zeigte sich durch hohe Korrelationen mit der TAS-20, auch wurde eine zufriedenstellende Interrater- und Retest-Reliabilität erzielt (Grabe et al., 2009). Weitere Übersetzungen (Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch) und ent|27|sprechende Validierungen des TSIA sind derzeit international in der Entwicklung.
1.4.2 Selbstbeurteilungsverfahren
Eine früher sehr häufig eingesetzte Skala zur Alexithymie-Erfassung ist die Minnesota Multiphasic Personality Inventory Alexithymia Scale (MMPI-A), die aus 22 Items besteht (Kleiger & Kinsman, 1980). Die Items aus dem Gesamtinventar (566 Items), die am stärksten in einer Patientengruppe (n = 100) mit einer chronischen Lungenerkrankung zwischen alexithymen und nichtalexithymen Patientinnen, klassifiziert anhand des BIQ (Sifneos, 1973), trennten, wurden zu der MMPI-A Skala zusammengefasst. Diese atheoretische Methode der Itemselektion ist durchaus problematisch, da die zugrunde liegenden Ergebnisse sehr stark von den Charakteristika der ursprünglichen Patientengruppe abhängen. So verwundert es auch nicht, dass in nachfolgenden Validierungsstudien an verschiedenen Patientengruppen bis auf eine Ausnahme ausschließlich nichtsignifikante Korrelationen zu dem BIQ und APRQ (Krystal et al., 1986) ermittelt wurden. Zusätzlich zeigten mehrfache Faktoranalysen der MMPI-A-Skala keine sinnvollen Subdimensionen. Aufgrund dieser Schwächen wird heute von der Verwendung dieser Skala abgeraten (Taylor et al., 1997).
Eine weitere, früher sehr weit verbreitete Skala ist die 20-Item Schalling-Sifneos Personality Scale (SSPS) (Apfel & Sifneos, 1979). Die Items ähneln stark den Items des BIQ. Allerdings wurde der Itempool vor der empirisch-klinischen Verwendung nicht einer sorgfältigen Itemanalyse oder einer Konsistenzprüfung unterzogen. Einige Studien zeigten eine zufriedenstellende Test-Retest-Reliabilität der SSPS (Bagby, Taylor & Atkinson, 1988). Allerdings offenbarten spätere Studien erhebliche Schwächen der SSPS in der internen Konsistenz und schlechte Item-Gesamtwert-Korrelationen (Bagby, Taylor & Ryan, 1986; Bagby et al., 1988). Zusätzlich ergab sich eine instabile Faktorstruktur, die sich von Stichprobe zu Stichprobe deutlich unterschiedlich zeigte. Die Konstruktvalidität zeigte lediglich schwache Korrelationen zur TAS und nichtsignifikante Korrelationen zum BIQ auf (Bagby et al., 1988; Kleiger & Kinsman, 1980). Auch dieses Instrument kann nicht mehr zur klinisch-empirischen Forschung empfohlen werden.
Ein weiteres neueres Instrument ist der Bermond-Vorst Alexithymia Questionnaire (BVAQ) (Vorst & Bermond, 2001). Bermond sieht in der Dimension „Unfähigkeit, Emotionen zu erleben“ eine weitere Facette des Alexithymie-Konstrukts. Die Dimension „Schwierigkeiten, Gefühle zu identifizieren“ geht ja durchaus davon aus, dass es bei alexithymen Personen primäre emotionale Korrelate von Gefühlen gibt, die aber nicht differenziert weiterverarbeitet werden und somit eine Identifizierung in verschiedene Gefühle, z. B. Wut, Ärger, Neid, Scham, nicht gut gelingt. Somit konzeptualisiert Bermond wirklich die Abwesenheit einer Emotionswahrnehmung im Sinne einer reduzierten Wahrnehmung eines physiologisch-vegetativen Arousals. Neben den klassischen drei Dimensionen der TAS-20 (Schwierigkeiten, Gefühle zu identifizieren und zu kommunizieren, sowie extern orientiertes Denken) deckt der BVAQ auf 40 Items zusätzlich eine reduzierte Fantasiefähigkeit und die reduzierte Emotionswahrnehmung ab. Somit ergeben sich die fünf Subskalen des BVAQ: Emotionalisierung, Fantasieren, Identifizieren, Analysieren und Verbalisieren. Bermond hat darüber hinaus drei Alexithymie-Typen charakterisiert. Typ-1-Alexithyme haben demzufolge eine reduzierte Wahrnehmung des emotionalen Arousals und wenige emotionsassoziierte Kognitionen. Typ-2-Alexithyme sollen hingegen ein normales oder sogar gesteigertes Wahrnehmungsniveau des emotionalen Arousals, jedoch wiederum wenige emotionsassoziierte Kognitionen besitzen. Typ-3-Alexithyme sollen normale emotionsassoziierte Kognitionen aufweisen, aber ein deutlich reduziertes Emotionserleben. Sind beide Fähigkeiten gut ausgeprägt, so spricht |28|Bermond von Lexithymia, der Abwesenheit von Alexithymie (Moormann et al., 2008).
Bezüglich der Validität dieser Typisierung wurde erhebliche Kritik geäußert. Insbesondere haben Taylor und Bagby (2021) die Subskala Emotionalisierung als nicht zum Kern des Alexithymie-Konstrukts zugehörig identifiziert und somit die Existenz der Subtypen der Alexithymie nach Bermond infrage gestellt. Für die Subtypen 2 und 3 werden keine prototypischen Patientenfälle berichtet, sodass es sich offenbar, so die Kritik von Taylor und Bagby (2021), um eine rein statistische Subtypisierung und nicht um klinisch existierende Formen der Alexithymie handelt.
Die Entwicklung der 20-Item-Toronto-Alexithymie-Skala (TAS-20) von der Arbeitsgruppe um Bagby und Taylor (Bagby, Parker & Taylor, 1994, Bagby, Taylor & Parker, 1994) hat die internationale Alexithymie-Forschung extrem stimuliert und hat in den folgenden Jahren zu einer Vielzahl von wissenschaftlichen Arbeiten zur Alexithymie geführt. Die hohen psychometrischen Qualitäten der Skala und die Übersetzung und Validierung der TAS-20 in viele Sprachen (z. B. Chinesisch, Deutsch, Französisch, Finnisch, Griechisch, Hebräisch, Holländisch, Indisch [Hindu], Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Spanisch und Schwedisch) hat die internationale Alexithymie-Forschung auf ein reliables und vergleichbares Niveau gehoben.
Ausgehend von einer präzisen Evaluation der damals vorliegenden Instrumente zur Alexithymie-Erfassung und der Berücksichtigung der wesentlichen psychometrischen Probleme dieser Instrumente wurde zunächst die TAS-26 entwickelt. Es wurden aufgrund theoretischer Überlegungen zum Konstrukt der Alexithymie und aufgrund damaliger empirischer Befunde 41 Items definiert, die zu folgenden Dimensionen führten:
Schwierigkeiten, Gefühle zu beschreiben,
Schwierigkeiten, zwischen Gefühlen und körperlichen Sensationen zu unterscheiden, die Zustände eines emotionalen Arousals begleiten,
fehlende Introspektionsfähigkeit,
soziale Konformität
ein verarmtes Fantasieerleben und eine geringe Fähigkeit, sich an Träume zu erinnern.
Diese Items wurden so formuliert, dass sie auf einer 5-Punkte-Likert-Skala als Selbstbeurteilungsfragen zu beantworten waren. Die erste empirische Untersuchung dieses Itempools wurde an 542 Studierenden durchgeführt. Als Ergebnis eines aufwendigen Itemselektionsprozesses auf der Basis von Itemanalysen und Faktoranalysen entstand die TAS-26 (Taylor et al., 1985), die neben den drei Faktoren der späteren TAS-20 auch noch einen vierten Faktor (vermindertes Tagträumen) als Dimension eines reduzierten Fantasieerlebens beinhaltete. Soziale Konformität bestätigte sich in Faktoranalysen nicht als ein eigenständiger Faktor. Fragen über die Fähigkeit, sich an Träume zu erinnern, zeigten eine zu geringe Korrelation zur Gesamtskala und zu den anderen Items. Die interne Reliabilität sowie die 5-Wochen-Test-Retest-Stabilität waren sehr gut (Taylor et al., 1985; Bagby, Taylor, Parker & Loiselle, 1990). Zahlreiche Studien lieferten wichtige Belege für die konvergente und diskriminante Validität der TAS-26. Es zeigten sich z. B. negative Korrelationen zur Psychological Mindedness Scale des California Psychological Inventory (CPI) sowie zur Anger-Expression Scale und positive Korrelationen zur Poor Attentional Control Subscale des Short Imaginal Process Inventory (Taylor & Bagby, 1997).
Aufgrund weiterer empirischer Daten entschlossen sich die Autoren der TAS-26 zu einer Überarbeitung der Skala. Besonders der Faktor des verminderten Tagträumens als Dimension eines reduzierten Fantasieerlebens zeigte eine relative geringe Korrelation zu den anderen Items der Skala, es ergaben sich sogar negative Korrelationen zwischen diesem Faktor und dem Faktor 1 (Schwierigkeiten, Gefühle zu identifizieren). Auch weitere Analysen legten die Schlussfolgerung nahe, dass dieser Faktor des verminderten Tagträumens eine geringe theo|29|retische Kohärenz zu den übrigen Faktoren des Alexithymie-Konstrukts hatte. Im Rahmen der Überarbeitung der TAS-26 wurden 17 neue Items entwickelt, die dann gemeinsam mit den 26 Items der TAS-26 einen Itempool von 43 Items ergaben. Neu entwickelt wurden vor allem Items zum extern orientierten Denken, zur Fantasiefähigkeit und zur Kommunikation von Gefühlen. Über die Entwicklung der TAS-R-Skala mit 23 Items und einer unbefriedigenden 2-Faktoren-Struktur entstand schließlich nach erneuter Itemselektion die TAS-20 mit der 3-Faktoren-Struktur, die das theoretische Konstrukt besser abbildete.
Die TAS-20 zeigte in allen bisherigen Untersuchungen eine hohe interne Konsistenz, die 3-Faktoren-Struktur ließ sich ebenfalls in den meisten Studien replizieren. Die Test-Retest-Reliabilität der TAS-20 zeigte sich in 3-Wochen-Intervallen (r = 0.77), 3-Monats-Intervallen (r = 0.83) und sogar in 5-Jahres-Intervallen in der Allgemeinbevölkerung (n = 1200) mit r = 0.7 als sehr stabil (Bagby, Parker & Taylor, 1994; Bagby, Taylor & Parker, 1994, Pandey et al., 1996; Salminen, Saarijarvi, Toikka, Kauhanen & Aarela, 2006). Verlaufsmessung der TAS-20 über therapeutische Interventionen hinweg zeigten oftmals eine hohe Stabilität der TAS-20-Werte an (Rufer et al., 2004). In einem Teil der Studien ist es wahrscheinlich therapiebedingt zu einem Absinken der TAS-20-Werte, also zu einer Reduktion alexithymer Verarbeitungsprozesse gekommen (Grabe et al., 2008; Honkalampi, Hintikka, Saarinen, Lehtonen & Viinamaki, 2000). Manche Autorinnen stellten sogar die Alexithymie als Persönlichkeitsmerkmal infrage (Honkalampi et al., 2001). Dies hat zur Debatte einer absoluten versus relativen Stabilität der individuellen TAS-20-Werte geführt. Die absolute Stabilität bedeutet, dass keine signifikanten Mittelwertsunterschiede im Prä- und Postvergleich auftreten. Die relative Stabilität fordert, dass die Prä- und Postwerte signifikant miteinander korreliert sind (Luminet, Bagby & Taylor, 2001). Alle Studien konnten auch bei verschiedenen Patientengruppen mindestens eine signifikante relative Stabilität der TAS-20-Werte nachweisen (Grabe et al., 2008; Honkalampi et al., 2007; Rufer et al., 2004; Taylor & Bagby, 2004), auch über mehrjährige Follow-up-Intervalle (Rufer et al., 2006). So konnte auch die ursprünglich sehr kritisch eingestellte Arbeitsgruppe um Honkalampi in ihrem 6-Jahre-Follow-up depressiver Patienten klar zeigen, dass hohe Alexithymie-Werte langfristig zu schlechten Remissionen und Rezidiven depressiver Erkrankungen führten und dass nicht die Alexithymie ein bloßes Korrelat der depressiven Psychopathologie war (Honkalampi et al., 2007).
Die TAS-20 weist hohe Korrelationen zum BIQ auf (Taylor & Bagby, 1997). Die Korrelationsstruktur zu Persönlichkeitsinventaren wie dem NEO (Costa und McCrae) und dem TCI (Temperament-und-Charakter-Inventar von Cloninger) zeigen stabile und sinnvolle Muster (Grabe et al., 2001; Grabe et al., 2004; Luminet et al., 1999). So war die Alexithymie mit folgenden TCI-Subdimensionen assoziiert (Grabe et al., 2001):
interpersonelle Kontaktstörungen (Detachment),
geringe Bewältigungsressourcen,
niedrigem Verantwortungsgefühl,
Beschuldigungen anderer
Schüchternheit im Umgang mit Fremden.
Generell ist zu betonen, dass es sich bei der Alexithymie um ein normalverteiltes Konstrukt handelt, das als dimensionale Persönlichkeitsvariable keinen natürlichen Schwellenwert im Sinne eines Cut-offs besitzt. Die zum Teil übliche Definition der Alexithymie ab einem TAS-20 oberhalb von 60 (nichtalexithym: < 51) ist an einer kleinen Stichprobe preliminär errechnet worden und besitzt keine generalisierbare Gültigkeit. Dennoch scheint dieser Cut-off eine gewisse Nützlichkeit zu besitzen: Menschen mit TAS-20 > 61 haben zweifelsohne derart hohe Merkmalsausprägungen, dass eine Alexithymie klinisch sehr wahrscheinlich ist.
|30|1.4.3 Projektive Testverfahren
Der Einsatz von projektiven Testverfahren begann mit Ruesch (1948). Er beobachtete, dass Patienten mit einer „infantilen Persönlichkeit“ nur stereotype und wenig fantasievolle Antworten auf den Rohrschach-Test und den Thematic Apperception Test (TAT) gaben. In der Folgezeit versuchten verschiedene Arbeitsgruppen, anhand standardisierter Indices die Reliabilität projektiver Testverfahren zu erhöhen, um den hohen Inter-Rater-Bias zu reduzieren (Acklin & Bernat, 1987). Die wenigen Vergleichsstudien, die neben projektiven Verfahren auch andere Erhebungsinstrumente eingesetzt haben, fanden keine stabilen Korrelationen zum TAS-20 oder BIQ (Taylor & Bagby, 1997).
Ein weiterer projektiver Ansatz wurde mit dem Scored Archetypal Test (SAT9) verfolgt (Cohen, Auld, Demers & Catchlove, 1985). Die Probandin soll neun mythische Items (z. B. Wasserfall, Schwert, Feuer, Monster) zu einem gezeichneten Bild verbinden. Danach soll sie eine kurze Geschichte schreiben, die das Bild erklärt. Zur Beurteilung wurden verschiedene Kriterien erarbeitet. Nichtalexithyme Probanden sollen demnach kreative Zeichnungen erstellen und eine poetische Geschichte erzählen können, alexithyme Probanden hingegen hätten Schwierigkeiten, die unterschiedlichen Symbole in einer Geschichte sinnvoll zu verbinden und den symbolischen Gehalt inhaltlich auszugestalten. Einige Studien berichten über eine gute Interrater-Reliabilität, allerdings wurden zum Teil unterschiedliche Scoringprozeduren verwendet (Taylor & Bagby, 1997). Es zeigte sich eine gute Korrelation zum BIQ, aber nicht zu Selbstbeurteilungsinstrumenten einschließlich der TAS-20 und TAS-26. Kritischerweise muss angemerkt werden, dass der SAT9 zu wesentlichen Teilen die Fantasiefähigkeit („imaginal activity“) erfasst, aber die anderen Dimensionen des Alexithymie-Konstrukts nur indirekt beinhaltet. Von daher sollte dieser Test nicht zur Erfassung der Alexithymie im eigentlichen Sinne herangezogen werden.
1.4.4 Andere Instrumente mit einer Nähe zur Alexithymie
DieLevels of Emotional Awareness Scale (LEAS) von Lane, Quinlan, Schwartz, Walker und Zeitlin (1990) ist als Performancetest konzipiert. In 20 kurzen Fallvignetten werden emotionsprovozierende soziale Situationen geschildert. Der Proband soll in freier Form schriftlich äußern, wie er sich selbst anstelle des Protagonisten fühlen würde und wie sich die anderen an der Szene beteiligten Personen wohl fühlen würden. Mithilfe eines Glossars, Auswertbeispielen und standardisierten Auswertregeln erfolgt die Bewertung. Der LEAS soll die strukturelle Fähigkeit messen, sich seines emotionalen Beteiligtseins bewusst zu werden und dieses auch auszudrücken. Operationalisiert wird dies als Identifikations- und Einfühlungsfähigkeit. In einer Studie an 240 Patienten korrelierten LEAS und TAS-20 nicht miteinander (Subic-Wrana et al., 2002). Dies spricht neben theoretischen Überlegungen dafür, dass der LEAS wirklich ein anderes Konstrukt, wie z. B. Empathiefähigkeit, und weniger die Alexithymie erfasst.
Tabelle 1-2 fasst die psychometrischen Verfahren zur Erfassung von Alexithymie zusammen.
1.5 Fazit
Trotz der hohen klinischen Bedeutung alexithymer Affektverarbeitungsstörungen besteht erst seit der Entwicklung der TAS-20 die Möglichkeit, mit hoher Validität und Reliabilität das Konstrukt der Alexithymie psychometrisch abzubilden. Erst dadurch ist eine international vergleichbare Alexithymie-Forschung möglich geworden. Neuere Entwicklungen im Bereich der Interviewdiagnostik in Form des TSIA machen deutlich, dass internationale Forschergruppen aktiv die weitere Optimierung der Alexithymie-Erfassung vorantreiben. Die empirischen Arbeiten zur Klärung und Validie|31|rung der psychometrischen Grenzen und der Faktorenstruktur des Alexithymie-Konstrukts sind für die weiteren klinischen und neurobiologischen Fragestellungen von entscheidender Bedeutung.
Tabelle 1-2: Psychometrische Testverfahren zur Erfassung von Alexithymie
Verfahren
Test
Fremdbeurteilung
BIQ, Beth Israel Psychosomatic Questionaire
APRQ, Alexithymia Provoked Response Questionaire
OAS, Observer Alexithymia Scale
TSIA, Toronto Structured Interview for Alexithymia
Projizierende Verfahren
Rorschach-Test
TAT, Thematic Apperception Test
SAT9, Scored Archetypal Test
Selbstbeurteilung
SSPS, Schalling Sifneos Personality Scale
MMPI-A, Minnesota Multiphasic Personality Inventory Alexithymia Scale
BVAQ, Bermond-Vorst Alexithymia Questionnaire
TAS-20, Toronto Alexithymia Scale
Selbst-oder-Fremdbeurteilung
CAQ, California Q-Set
Literatur
Acklin, M. W. & Bernat, E. (1987). Depression, alexithymia, and pain prone disorder: A Rorschach study. Journal of Personality Assessment, 51 (3), 462–479. Crossref
Apfel, R. J. & Sifneos, P. E. (1979). Alexithymia: Concept and measurement. Psychotherapy and Psychosomatics, 32 (1–4), 180–190. Crossref
Bagby, R. M., Parker, J. D. & Taylor, G. J. (1994). The Twenty-item Toronto Alexithymia Scale–I. Item selection and cross-validation of the factor structure. Journal of Psychosomatic Research, 38 (1), 23–32.
Bagby, M. & Taylor, G. (1997). Affect dysregulation and alexithymia. In B. R.Taylor &G. J.Parker (Eds.), Disorders of affect regulation: Alexithymia in medical and psychiatric illness (pp. 26–46). Cambridge: Cambridge University Press.
Bagby, R. M., Taylor, G. J. & Atkinson, L. (1988). Alexithymia: A comparative study of three self-report measures. Journal of Psychosomatic Research, 32 (1), 107–116. Crossref
Bagby, R. M., Taylor, G. J. & Parker, J. D. (1994). The Twenty-item Toronto Alexithymia Scale–II. Convergent, discriminant, and concurrent validity. Journal of Psychosomatic Research, 38 (1), 33–40.
Bagby, R. M., Taylor, G. J., Parker, J. D. & Dickens, S. E. (2006). The development of the Toronto Structured Interview for Alexithymia: Item selection, factor structure, reliability and concurrent validity. Psychotherapy and Psychosomatics, 75 (1), 25–39. Crossref
Bagby, R. M., Taylor, G. J., Parker, J. D. & Loiselle, C. (1990). Cross-validation of the factor structure of the Toronto Alexithymia Scale. Journal of Psychosomatic Research, 34 (1), 47–51. Crossref
Bagby, R. M., Taylor, G. J. & Ryan, D. P. (1986). The measurement of alexithymia: Psychometric properties of the Schalling-Sifneos Personality Scale. Comprehensive Psychiatry, 27 (4), 287–294. Crossref
Berthoz, S., Haviland, M. G., Riggs, M. L., Perdereau, F. & Bungener, C. (2005). Assessing alexithymia in French-speaking samples: Psychometric properties of the Observer Alexithymia Scale-French translation. European Psychiatry, 20 (7), 497–502. Crossref
Berthoz, S., Perdereau, F., Godart, N., Corcos, M. & Haviland, M. G. (2007). Observer- and self-rated alexithymia in eating disorder patients: Levels and correspondence among three measures. Journal of Psychosomatic Research, 62 (3), 341–347. Crossref
|32|Bogutyn, T., Kokoszka, A., Palczynski, J. & Holas, P. (1999). Defense mechanisms in alexithymia. Psychological Reports, 84 (1), 183–187. Crossref
Bräutigam, W. & von Rad, M. (1977). Towards a theory of Psychosomatic disorders: Alexithymia, Pensée opératoire, psychosomatsiches Phänomen (Proceedings of the 11th European Conference on Psychosomatic Research). Basel: Karger.
Cohen, K., Auld, F., Demers, L. & Catchlove, R. (1985). Alexithymia. The development of a valid and reliable projective measure (the objectively scored Archetypal9 Test). Journal of Nervous and Mental Disease, 173 (10), 621–627.
Cremerius, J. (1977). Ist die „psychosomatische Struktur“ der französischen Schule krankheitsspezifisch?Psyche, 31, 295–317.
Darwin, C. (1872/1965). The expression of the emotions in man and animals. Chicago: University of Chicago Press. Crossref
de M’Uzan, M. (1974). Psychodynamic mechanisms in psychosomatic symptom formation. Psychotherapy and Psychosomatics, 23, 103–110. Crossref
Dodge, K. A. & Garber, J. (1991). Domains of emotion regulation. The development of emotion regulation and dysregulation. In K. A.Dodge &J.Garber (Eds.), The development of emotion regulation and dysregulation (pp. 3–11). Cambridge: Cambridge University Press. Crossref
Fava, G. A., Mangelli, L. & Ruini, C. (2001). Assessment of psychological distress in the setting of medical disease. Psychotherapy and Psychosomatics, 70 (4), 171–175. Crossref
Fenichel, O. (1945). The psychoanalytic theory of neurosis. New York, NY: W. W. Norton (dt. hg. u. übers. v. Klaus Laermann: Psychoanalytische Neurosenlehre, 3 Bände, 2005, Gießen: Psychosozial-Verlag).
Ferenczi, S. & Rank, O. (1924). Entwicklungsziele der Psychoanalyse: zur Wechselbeziehung von Theorie und Praxis. Wien: Internationaler Psychoanalytischer Verlag (Neuauflage: Turia + Kant, Wien 1995, Nachdruck 2009).
Franz, M., Popp, K., Schaefer, R., Sitte, W., Schneider, C., Hardt, J.et al. (2008). Alexithymia in the German general population. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 4 (1), 54–62. Crossref
Freyberger, H. (1977). Supportive psychotherapeutic techniques in primary and secondary alexithymia. Psychotherapy and Psychosomatics, 28, 337–342 Crossref
Frijda, N. H. (1986). The emotions. Cambridge: Cambridge University Press.
Grabe, H. J., Frommer, J., Ankerhold, A., Ulrich, C., Gröger, R., Franke, G. H.et al. (2008). Alexithymia and outcome in Psychotherapy. Psychotherapy and Psychosomatics, 7 (3), 189–194. Crossref
Grabe, H. J., Lobel, S., Dittrich, D., Bagby, R. M., Taylor, G. J., Quilty, L. C.et al. (2009). The German version of the Toronto Structured Interview for Alexithymia: Factor structure, reliability, and concurrent validity in a psychiatric patient sample. Comprehensive Psychiatry, 5 (5), 424–430. Crossref
Grabe, H. J., Spitzer, C. & Freyberger, H. J. (2001). Alexithymia and the temperament and character model of personality. Psychotherapy and Psychosomatics, 7 (5), 261–267. Crossref
Grabe, H. J., Spitzer, C. & Freyberger, H. J. (2004). Alexithymia and personality in relation to dimensions of psychopathology. American Journal of Psychiatry, 16 (7), 1299–1301. Crossref
Haviland, M. G. (1998). The validity of the California Q-set Alexithymia Prototype. Psychosomatics, 3 (6), 536–539. Crossref
Haviland, M. G. & Reise, S. P. (1996). A California Q-set alexithymia prototype and its relationship to ego-control and ego-resiliency. Journal of Psychosomatic Research, 4 (6), 597–607. Crossref
Haviland, M. G., Warren, W. L. & Riggs, M. L. (2000). An observer scale to measure alexithymia. Psychosomatics, 4 (5), 385–392Crossref
Haviland, M. G., Warren, W. L., Riggs, M. L. & Nitch, S. R. (2002). Concurrent validity of two observer-rated alexithymia measures. Psychosomatics, 4 (6), 472–477. Crossref
Heiberg, A. & Heiberg, A. (1977). Alexithymia – an inherited trait?Psychotherapy and Psychosomatics, 2 (1–4), 221–225. Crossref
Honkalampi, K., Hintikka, J., Koivumaa-Honkanen, H., Antikainen, R., Haatainen, K. & Viinamaki, |33|H. (2007). Long-term alexithymic features indicate poor recovery from depression and psychopathology. A six-year follow-up. Psychotherapy and Psychosomatics, 7 (5), 312–314. Crossref
Honkalampi, K., Hintikka, J., Saarinen, P., Lehtonen, J. & Viinamaki, H. (2000). Is alexithymia a permanent feature in depressed patients? Results from a 6-month follow-up study. Psychotherapy and Psychosomatics, 6 (6), 303–308. Crossref
Honkalampi, K., Koivumaa-Honkanen, H., Tanskanen, A., Hintikka, J., Lehtonen, J. & Viinamaki, H. (2001). Why do alexithymic features appear to be stable? A 12-month follow-up study of a general population. Psychotherapy and Psychosomatics, 7 (5), 247–253. Crossref
Horney, K. (1952). The paucity of inner experiences. American Journal of Psychoanalysis, 12, 3–9. Crossref
Joukamaa, M., Taanila, A., Miettunen, J., Karvonen, J. T., Koskinen, M. & Veijola, J. (2007). Epidemiology of alexithymia among adolescents. Journal of Psychosomatic Research, 6 (4), 373–376. Crossref
Kelman, N. (1952). Clinical aspects of externalized living. American Journal of Psychoanalysis, 12, 15–23. Crossref
Keltikangas-Jarvinen, L. (1987). Concept of alexithymia. II. The consistency of alexithymia. Psychotherapy and Psychosomatics, 4 (2), 113–120 Crossref
Kleiger, J. H. & Kinsman, R. A. (1980). The development of an MMPI alexithymia scale. Psychotherapy and Psychosomatics, 3 (1), 17–24. Crossref
Krystal, H. (1982). Alexithymia and the effectiveness of psychoanalytic treatment. International Journal of Psychoanalytic Psychotherapy, 9, 354–378.
Krystal, H. (1988). Integration and self healing: Affect, trauma, and alexithymia. Hillsdale, NJ: Analytic Press.
Krystal, J. H., Giller, E. L., Jr. & Cicchetti, D. V. (1986). Assessment of alexithymia in posttraumatic stress disorder and somatic illness: Introduction of a reliable measure. Psychosomatic Medicine, 4 (1–2), 84–94. Crossref
Laireiter, A. R. (1989). Alexithymie. Zur theoretischen und methodologischen Kritik eines Arbeitsmodells zur psychoanalytisch-psychosomatischen Medizin und Ansätze einer alternativen theoretischen Grundlegung im Rahmen der wissenschaftlichen Psychologie (Inaugural-Dissertation). Universität Salzburg.
Lane, R. D., Quinlan, D. M., Schwartz, G. E., Walker, P. A. & Zeitlin, S. B. (1990). The levels of Emotional Awareness Scale: A cognitive-developmental measure of emotion. Journal of Personality Assessment, 5 (1–2), 124–134. Crossref
Lane, R. D. & Schwartz, G. E. (1987). Levels of emotional awareness: A cognitive developmental theory and its application to psychopathology. American Journal of Psychiatry, 144, 133–143.
Lolas, F., de la Parra, G., Aronsohn, S. & Collin, C. (1980). On the measurement of alexithymic behavior. Psychotherapy and Psychosomatics, 3 (3), 139–146. Crossref
Lolas, F. & van Rad, M. (1989). Alexithymia. In S.Cheren (Ed.), Psychosomatic medicine: Theory, physiology and praxis (pp. 189–237). Madison, CT: International University Press.
Luminet, O., Bagby, R. M. & Taylor, G. J. (2001). An evaluation of the absolute and relative stability of alexithymia in patients with major depression. Psychotherapy and Psychosomatics, 7 (5), 254–260. Crossref
Luminet, O., Bagby, R. M., Wagner, H., Taylor, G. J. & Parker, J. D. (1999). Relation between alexithymia and the five-factor model of personality: A facet-level analysis. Journal of Personality Assessment, 7 (3), 345–358. Crossref
Marty, P. & DeBray, R. (1989). Current concepts of character disturbance. In S.Cheren (Ed.), Psychosomatic medicine: Theory, physiology, and practice (pp. 159–184, Vol. 1.). Madison, CT: International Universities Press.
Marty, P. & de M’Uzan, M. (1963). La „penseé operatoire“. Revue Francaise de Psychoanalyse, 27, 1345–1356.
McDougall, J. (1982a). Alexithymia, psychosomatics and psychosis. International Journal of Psychoanalytic Psychotherapy, 9, 379–388.
McDougall, J. (1982b). Alexithymia: A psychoanalytic viewpoint. Psychotherapy and Psychosomatics, 38, 81–90. Crossref
McLean, P. D. (1949). Psychosomatic disease and „visceral brain“: Recent developments bearing on the Papez theory of emotion. Psychosomatic Medicine, 2, 338–353. Crossref
|34|Moormann, P. P., Bermond, B., Vorst, H. C., Bloemendaal, A. F., Teijn, S. M. & Rood, L. (2008). New avenues in alexithymia research: The creation of alexithymia types. In A.Vingerhoets, I.Nyklíček, J.Denollet (Eds.), Emotion regulation: Conceptual and clinical issues (pp. 27–42). New York, NY: Springer. Crossref
Nemiah, J. C. (1977). Alexithymia. Theoretical considerations. Psychotherapy and Psychosomatics, 2 (1–4), 199–206. Crossref
Nemiah, J. C., Freyberger, H. J. & Sifneos, P. E. (1976). Alexithymia: A view of the psychosomatic process. Modern Trends in Psychosomatic Medicine, 3, 403–409.
Nemiah, J. C. & Sifneos, P. (1970). Affect and fantasy in patients with psychosomatic disorders. Modern Trends in Psychosomatic Medicine, 2, 26–34.
Pandey, R., Mandal, M. K., Taylor, G. J. & Parker, J. D. (1996). Cross-cultural alexithymia: Development and validation of a Hindi translation of the 20-Item Toronto Alexithymia Scale. Journal of Clinical Psychology, 5 (2), 173–176. Crossref
Pierce, M. J., Faryna, A., Davidson, A., Markart, R. & Krystal, J. H. (1989). A comparison of interview and self-report alexithymia measurements (abstract). Psychosomatic Medicine, 51, 244.
Ruesch, J. (1948). The infantile personality. Psychosomatic Medicine, 10, 134–144. Crossref
Rufer, M., Hand, I., Braatz, A., Alsleben, H., Fricke, S. & Peter, H. (2004). A prospective study of alexithymia in obsessive-compulsive patients treated with multimodal cognitive-behavioral therapy. Psychotherapy and Psychosomatics, 7 (2), 101–106. Crossref
Rufer, M., Ziegler, A., Alsleben, H., Fricke, S., Ortmann, J., Bruckner, E.et al. (2006). A prospective long-term follow-up study of alexithymia in obsessive-compulsive disorder. Comprehensive Psychiatry, 4 (5), 394–398. Crossref
Salminen, J. K., Saarijärvi, S., Äärelä, E., Toikka, T. & Kauhanen, J. (1999). Prevalence of alexithymia and its association with sociodemografic variables in the general population of Finland. Journal of Psychosomatic Research, 4 (1), 75–82. Crossref
Salminen, J. K., Saarijärvi, S., Toikka, T., Kauhanen, J. & Äärelä, E. (2006). Alexithymia behaves as a personality trait over a 5-year period in Finnish general population. Journal of Psychosomatic Research, 6 (2), 275–278. Crossref
Sifneos, P. E. (1973). The prevalence of „alexithymic“ characteristics in psychosomatic patients. Psychotherapy and Psychosomatics, 2 (2), 255–262. Crossref
Sifneos, P., Apfel-Savitz, R. & Frankel, F. H. (1977). The phenomenon of „alexithymia“. Observations in neurotic and psychosomatic patients. Psychotherapy and Psychosomatics, 40, 47–57. Crossref
Stephanos, S. (1973). Analytisch-psychosomatische Therapie. Stuttgart: Huber.
Subic-Wrana, C., Bruder, S., Thomas, W., Gaus, E., Merkle, W. & Köhle, K. (2002). Distribution of alexithymia as a personality-trait in psychosomatically ill in-patients--measured with TAS 20 and LEAS. Psychotherapie, Psychosomatik, medizinische Psychologie, 5 (11), 454–460.
Taylor, G. J. & Bagby, R. M. (1997). Measurement and validation of the alexithymia construct. In G. J.Taylor, R. M.Bagby &J. D.Parker (Eds.), Disorders of affect regulation (pp. 46–66). Cambridge: Cambridge University Press.
Taylor, G. J. & Bagby, R. M. (2004). New trends in alexithymia research. Psychotherapy and Psychosomatics, 7 (2), 68–77. Crossref
Taylor, G. J. & Bagby, R. M. (2021). Examining proposed changes to the conceptualization of the alexithymia construct: The way forward tilts to the past. Psychotherapy and Psychosomatics, 9 (3), 145–155. Crossref
Taylor, G. J., Bagby, R. M. & Parker, J. D. (1991). The Alexithymia construct. A potential paradigm for psychosomatic medicine. Psychosomatics, 32, 153–164
Taylor, G. J., Ryan, D. & Bagby, R. M. (1985). Toward the development of a new self-report alexithymia scale. Psychotherapy and Psychosomatics, 4 (4), 191–199. Crossref
Vorst, H. C. M. & Bermond, B. (2001). Validity and reliability of the Bermond-Vorst Alexithymia Questionnaire. Personality and Individual Differences, (30), 413–434. Crossref
Wolff, H. H. (1977). The contribution of the interview situation to the restriction of fantasy life and emotional experience in psychosomatic patients. Psychotherapy and Psychosomatics, 2 (1–4), 58–67. Crossref
|35|Yao, S., Yi, J., Zhu, X. & Haviland, M. G. (2005). Reliability and factorial validity of the Observer Alexithymia Scale-Chinese translation. Psychiatry Research, 13 (1), 93–100. Crossref





























