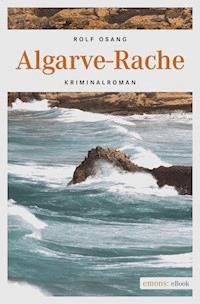
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: emons: Sehnsuchts Orte
- Sprache: Deutsch
Ein packender Kriminalroman vor der wunderschönen Kulisse Portugals – Urlaubsfeeling garantiert! Lisa hat ihren Traum verwirklicht und eine Kunstgalerie in Lagos eröffnet. Als ihr eine reiche Witwe einen gut bezahlten Auftrag erteilt, ahnt sie nicht, worauf sie sich einlässt. Eigentlich soll sie im pittoresken Castelo von Ferragudo eine Ausstellung mit sieben Fotokunstwerken organisieren. Doch die Männer, die auf den Bildern gezeigt werden, vereint ein dunkles Geheimnis. Und sie alle schweben in Lebensgefahr …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 452
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Der Schwarzwälder Rolf Osang studierte Werbung und Marketing in München, dann Philosophie in Zürich und finanzierte sein erstes Kulturmagazin im Saarland mit der Herausgabe einer Bundesliga-Stadionzeitung – zusammen mit Felix Magath. Er hat schon fünfzehn Bücher über Portugal verfasst, darunter Reiseführer, Bildbände und Kurzgeschichten. Sein erster Algarve Krimi »Süßer Mord« erschien 2015 bei Emons.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2017 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: were/photocase.de
Umschlaggestaltung: Tobias Doetsch
Lektorat: Susann Säuberlich, Neubiberg
eBook-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-188-8
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Für meine Söhne Andreas, Joscha und Tomás
1
Liebster Diniz, als ich heute Morgen deine Papiere wegen der Versicherung durchsehen musste, entdeckte ich zufällig diesen merkwürdigen Ordner. Warum um alles in der Welt hast du nie mit mir darüber gesprochen? Wir hatten doch nie Geheimnisse voreinander – das dachte ich zumindest. Vielleicht, weil du mich lieber nicht mit diesem heiklen Thema konfrontieren wolltest? Ich will mich mit dieser Erklärung zufriedengeben. Denn so habe ich dich immer erlebt: rücksichtsvoll, fürsorglich, vorausschauend.
Diana unterbrach ihr Tippen in den Laptop und ließ ihren Blick durch das altmodische Kaffeehaus in der Altstadt von Loulé schweifen. Immer wenn sie Ablenkung suchte und unter Menschen sein wollte, die sie nicht kannte, besuchte sie diesen gemütlichen Zufluchtsort. Oft schrieb sie dann in ihr Tagebuch, so wie heute einen Brief an Diniz, oder beobachtete die Gäste an den Tischen oder die Passanten draußen auf der Rua 5 de Outubro, einer Hauptschlagader der Fußgängerzone nahe der sarazenischen Burganlage, und dachte sich gern zu Menschen, die ihr Interesse weckten, Geschichten aus. Wo kamen sie her, wo gingen sie hin, was machten sie beruflich, wie sah ihr Privatleben aus?
Aber heute fehlte ihr dazu die innere Gelassenheit. Sie war in Aufruhr. Die Tatsache, dass Diniz ihr diesen Ordner und damit seine Pläne vorenthalten hatte, ärgerte sie. Sie musste weiterschreiben. Sie musste eine Lösung finden, wie sie die neuen Fakten verarbeiten konnte. Sie nahm das Tippen wieder auf:
Natürlich habe ich mich sofort gefragt, warum du diesen Ordner angelegt hast. Hattest du vor, einen Artikel oder vielleicht sogar ein Buch zu schreiben? Oder wolltest du die darin gesammelten Prozesse noch einmal aufrollen, was mir wahrscheinlicher erscheint, weil es dir einfach widerstreben musste, diese Halunken ungestraft davonkommen zu lassen? Womöglich hast du auch schon Schritte dazu in die Wege geleitet, und sie haben davon Wind bekommen? Seit diesem Fund bin ich mir sicher, dass einer von denen dein Mörder ist. Deshalb werde ich dein Projekt aufgreifen und es für dich und mich und um unserer Liebe willen zu Ende führen.
Diniz, ich werde mich an diesen Männern rächen. Ich weiß noch nicht, wie. Aber diese Rache soll so konzipiert sein, dass sie sich nur dir und mir erschließt. Und was besonders wichtig ist: Sie muss ohne jede Gewalt auskommen, weil jede Gewalt nur neue Gewalt erzeugt. Einverstanden? Schön, dann fahre ich jetzt ans Meer. Vielleicht kommt mir dort die zündende Idee, wie ich diese Rache realisieren kann. Fühle dich, trotz meiner leichten Erzürnung, lieb umarmt und geküsst.
Diana Marques lehnte sich erleichtert zurück und las die Zeilen noch einmal durch. Zufrieden nickend sicherte sie mit einem Mausklick den Text, klappte den Laptop zu, zahlte ihren Espresso und verließ das Kaffeehaus.
Um zu ihrem Landhaus zu kommen, musste sie etwa fünfzehn Minuten lang fahren. Sie wollte nur rasch ihre Kamera abholen und anschließend Fotos schießen, in der Hoffnung, dass ihr bei der Jagd nach schönen Motiven die richtige Idee für ihre Art von Rache einfiele.
Zu Hause angekommen, blieb sie für einen kurzen Moment in ihrem riesig großen Wohnzimmer stehen. Vom parkähnlichen Garten her fiel grelles Sonnenlicht durch die sich im Wind wiegenden Palmenblätter. Das Schattenspiel verwandelte die Wände in bebende Riesenbilder. Wie ein Ruhepol hing an der Westwand eine impressionistisch anmutende Fotografie eines französischen Künstlers. Ihr Lieblingsbild.
Ihre Augen trübten sich. Wenig später spürte sie, wie eine Träne an ihrem Nasenflügel entlangkullerte. Sie musste schleunigst raus aus diesem Haus. Sie musste in die Natur, nur dort würde sie sich gleich wieder besser fühlen. Sie wusste genau, wohin sie fahren wollte, um sich inspirieren zu lassen: an die wilde Westküste, die Costa Vicentina.
Sie hängte die Kameratasche um, obwohl sie inzwischen viel lieber mit ihrem neuen Smartphone fotografierte. Außerdem brachte sie ihr Tablet, das ebenfalls über eine brauchbare Kamera verfügte, in einem gepolsterten Seitenfach unter. Derart gut ausgerüstet betrat sie die geräumige Doppelgarage durch den direkten Zugang vom Haus aus. Das breite Tor war geöffnet.
In der mit weißem Kies bedeckten Auffahrt stand ihr Halbbruder Hugo, der nun schon seit Monaten bei ihr lebte, neben einem Mann, den Diana nicht kannte. Sie ging auf die beiden zu, grüßte von Weitem und gab durch kurzes Kopfschütteln zu verstehen, dass sie es eilig hatte. Doch bevor sie sich einem Gespräch entziehen konnte, ergriff Hugo das Wort.
»Hallo Diana, darf ich dir Senhor José vorstellen? Alle nennen ihn Zé. Zé, das ist meine Schwester Diana …«
»Halbschwester«, korrigierte Diana.
»Diana ist die Hausherrin. Sie hat hier das Sagen. Natürlich bestimmt sie auch, wie der Garten zu pflegen ist. Diana, ich habe Zé gebeten, vorbeizukommen, da du sicher Ersatz für deinen alten Gärtner suchst, der neulich in Rente gegangen ist. Und Zé ist ein ausgezeichneter Gärtner.«
»Sehr freundlich, dass Sie gekommen sind, Senhor Zé, vielen Dank. Hugo, es wäre wirklich ratsam, solche Dinge vorher mit mir abzusprechen, denn ich habe jetzt leider keine Zeit. Ich fahre an die Westküste«, sagte Diana vorwurfsvoll. »Senhor Zé, trauen Sie sich denn zu, ein über zwanzigtausend Quadratmeter großes Grundstück in Schuss zu halten? Modernste Maschinen und ein perfektes automatisches Bewässerungssystem erleichtern Ihnen zwar die Arbeit, aber trotzdem kommen jede Menge Aufgaben auf Sie zu. Hier in der Algarve wächst ja alles wie in einem Treibhaus.«
Zé war ein schlanker Mann. Unübersehbar war seine zähe Kraft. Die Muskeln unter seiner braunen, vom Wetter gegerbten Haut sprachen Bände von jahrelanger Arbeit in der freien Natur. Auch seine schwieligen muskulösen Hände bewiesen, dass er zulangen konnte. Seine Erscheinung schuf bei Diana auf der Stelle Vertrauen – und die Gewissheit, dass der Mann der Aufgabe gewachsen war. Sie wartete seine Antwort gar nicht erst ab.
»Meinetwegen können wir eine Probezeit von vier Wochen vereinbaren. Einverstanden? Dann können Sie gleich nächsten Montag beginnen, Senhor Zé. Zusätzlich zum Mindestgehalt zahle ich pro Monat dreihundert Euro in bar. Samstags und sonntags sowie an allen Feiertagen haben Sie selbstverständlich frei.« Diana beobachtete den Mann genau und stellte fest, dass ihm der Zusatzverdienst mehr als willkommen war.
»Das hört sich gut an«, meinte er gelassen.
»Hugo, dann zeige Senhor Zé doch bitte das Anwesen und den Maschinenpark. Ich bin erst am Abend wieder zurück. Senhor Zé, es freut mich, dass Sie in wenigen Tagen schon anfangen können. Bis dann …«
***
In der Garage glänzte neben einem alten Jeep ein weinroter Mercedes 220 d, Baujahr 1959. Diana liebte das elegante Fahrzeug. Mit dem Oldtimer durch die Gegend zu gondeln war ihr liebster Zeitvertreib. Sie stieg in den Wagen, startete den Motor und verließ das Grundstück.
Als sie bei Boliqueime auf den Algarve-Highway N 125 stieß, kurbelte sie das Seitenfenster herunter. Der Fahrtwind umstrich ihre Stirn und ließ ihre halblangen schwarzen Haare flattern, die sie mit einem zusammengerollten feuerroten Kopftuch wenigstens zum Teil zu bändigen versuchte. Ihr linker Ellenbogen ragte aus dem Fenster. Mit der rechten Hand hielt sie das elfenbeinfarbene Lenkrad umschlossen.
Sie genoss den lauen Wind, der sie umschmeichelte und ihr Dekolleté umwehte. Sie lächelte vor Freude – für einen kurzen Moment waren ihre Gedanken frei. Doch schon kurz darauf mündeten sie, wie so oft, in den stets gleichen unseligen Erinnerungen, den Eckpfeilern ihrer Vergangenheit:
Den alten Mercedes hatte sie von ihrem leiblichen Vater geerbt. Geerbt, weil ihr Ehemann Diniz den Alten per Gerichtsbeschluss gezwungen hatte, sie als Tochter und damit als Erbin seines beträchtlichen Vermögens anzuerkennen.
Sie hatte ihren Vater nur selten zu Gesicht bekommen, und wenn, dann durch Zufall, mal auf der Straße, mal in einem der Geschäfte. Quarteira war keine große Stadt, da konnte man sich kaum dauerhaft aus dem Weg gehen. Wenn ihre Mutter diese seltenen Gelegenheiten nutzte, ihn um Alimente anzugehen, verbat er sich das vehement, wurde laut und unflätig, bis die Mutter resigniert in Tränen ausbrach und sich mit ihr und dem zwei Jahre älteren Sohn Hugo an der Hand wie ein geprügelter Hund davonschlich. Ihr fehlte das Geld, eine Vaterschaftsklage einzureichen, und auch der Mut, gegen den reichen, mächtigen Mann gerichtlich vorzugehen.
Aber eines Tages war Einschneidendes geschehen: Ihre Mutter kündigte an, zusammen mit ihr, Diana, zu seiner Villa im Hinterland zu fahren. Auf dem Hinweg in einem rostfleckigen Renault Clio hielten sie vor einem billigen Chinaladen an, um Diana etwas Schöneres zum Anziehen zu kaufen. Ihre Mutter drängte ihr ein rotes Minikleidchen auf, das Diana gleich anbehalten sollte.
Eine halbe Stunde später erreichten sie das stattliche Landhaus ihres Vaters, die Quinta da Figueira. Diana fühlte sich unwohl in dem roten Fähnchen. Sie selbst hätte sich ein solches Kleid niemals ausgesucht. Außerdem verstand sie nicht, warum sie so herausgeputzt werden musste.
Sie blieb im Auto sitzen, während ihre Mutter die Klingel neben dem hohen Eingangstor drückte. Eine krächzende Stimme in der Gegensprechanlage fragte, was sie wolle.
»Post, Eilpost für Sie«, log ihre Mutter ungeniert.
Momente später rollte das Eisentor zur Seite. Sie fuhren die Auffahrt hoch und hielten vor der Haustür an. Ihre Mutter stieg erneut aus, blickte um sich und zog an dem Glockenstrang neben der geschnitzten Holztür. Als niemand öffnete, schlug sie mit der Faust gegen die Tür. Sie schrie und bettelte, dass er endlich Unterhalt für seine fast dreizehnjährige Tochter zahlen solle, wenigstens das gesetzlich festgelegte Minimum, ein Klacks für ihn, denn er war ein wohlhabender Mann, hatte diesen pompösen Landsitz und vier Pferde im Stall, hatte mehrere Autos in der Garage und Personal, eine Frau für die Küche, einen Mann für den Garten, und erhielt jeden Monat eine fette Apanage aus dem niemals versiegenden Pott seiner Familie, einer der legendären reichen Portweinfamilien.
Vom Auto aus konnte Diana sehen, dass der hagere, hoch aufgeschossene Mann schon eine ganze Weile hinter der gerafften Gardine eines Fensters im ersten Stock gestanden und dem Schauspiel ungerührt zugesehen hatte. Die wenigen Male, die sie ihn bisher zu Gesicht bekommen hatte, war er ihr immer unheimlich vorgekommen in seiner überheblichen Unnahbarkeit. Niemals hatte sie ihn lächeln sehen. Auch an jenem Tag hatte er angsteinflößend ausgesehen.
Als ihre Mutter ihn ebenfalls erspäht hatte, rief sie: »Diana, komm her. Jetzt komm schon!«
Zögernd stieg Diana aus und bewegte sich langsam auf ihre Mutter zu. Die packte sie an den Schultern, schüttelte sie, präsentierte sie und schrie in Richtung Fenster: »Schau her, du Halunke, ist sie nicht bildhübsch, deine Tochter? Dieses Prachtstück hier – dein Fleisch und Blut!«
Es war schrecklich für Diana gewesen, den abschätzigen Blicken dieses Mannes ausgesetzt zu sein. Trotzig warf sie ihre schwarze Lockenmähne nach hinten und fixierte den Mann, der die Gardine sofort fallen ließ.
»Steig ein!«, hatte ihre Mutter sie bald darauf angeherrscht. Dann startete sie den Motor und fuhr so rasant los, dass der Kies wegspritzte.
Zwei Wochen später war der Nachmittag gekommen, an dem ihr Vater sie völlig unerwartet von daheim abgeholt hatte. Er parkte seinen Mercedes vor der Eingangstür, suchte den richtigen Namen unter achtzig Schildern an der Klingeltafel des verwahrlosten Hochhauses und drückte den Knopf. Dann trat er zwei, drei Schritte zurück und spähte nach oben.
Im fünften Stock wurde das Küchenfenster geöffnet. Ihre Mutter streckte ihren Kopf heraus. Sie schien überhaupt nicht überrascht. »Einen Moment, deine Kleine kommt gleich runter«, rief sie ihm zu. »Hier, zieh das an«, befahl sie Diana, die widerstrebend das neue rote Kleid überzog.
Das Ergebnis schien ihrer Mutter zu gefallen. Mit ihren zwölf Jahren war Diana gertenschlank und schon ein paar Zentimeter größer als ihre Mutter, die mit den Jahren etwas pummelig geworden war.
»Du hast es doch gut …«, versuchte sie, ihre Tochter aufzumuntern. »Du wirst ein paar ganz tolle Stunden bei deinem Vater verbringen. Benimm dich nur, hörst du? Sicher lässt er dich dann auch auf einem seiner edlen Pferde reiten. Das wär doch was, oder? Vielleicht bekommst du sogar was ganz Feines zu essen. Ein dreigängiges Menü … Das soll bei den reichen Leuten so üblich sein. Sei also lieb zu ihm.«
Diana hatte sich auf die Rückbank des weinroten Mercedes gesetzt. Ihre Mutter hatte in der Haustür gestanden und zum Abschied gewinkt, als der Wagen losfuhr. Diana hatte sich in das Polster der Rückbank gedrückt, hatte das Leder und den Wohlstand gerochen, hatte sich wie eine Prinzessin gefühlt.
Als sie auf der Quinta ihres Vaters ankamen, rollte das Garagentor wie von Geisterhand zur Seite. Der Mercedes glitt in den dunklen Raum, und schon schloss sich dahinter das Tor. Sie war daheim bei ihm. Ihr wurde ganz komisch zumute. Ihre Bauchmuskeln zogen sich zusammen. Sie traute sich kaum, nach links oder rechts zu gucken. Aus Marmor der Boden. Im Haus kein Personal. Opernmusik von irgendwoher.
Im riesigen Wohnzimmer angelangt, zog der Mann die dunkelblauen Gardinen zu. »So, Dianchen, du kannst dich jetzt frei entscheiden: Entweder bist du lieb zu mir – dann kriegt deine Mutter jeden Monat eine Menge Geld, dann kann sie dir auch kaufen, was dein Herz begehrt. Oder du bist nicht lieb zu mir – dann kriegt ihr nichts. Gar nichts. So ist das Leben, merk dir das! Geben und nehmen. Haben oder nicht haben. Gut oder schlecht. Oben oder unten. Man muss sich rechtzeitig entscheiden, wo man im Leben stehen will. Hast du das kapiert?«
Da hatte sie geahnt, was er von ihr wollte, und schüttelte angewidert den Kopf. Vor lauter Schreck und Angst bekam sie keinen Ton heraus. Wie gelähmt stand sie da. Schloss die Augen. Wollte diesen Widerling und diese dreckige Welt nicht länger sehen.
Während er über sie herfiel, krallte sie die Finger in ihre Handballen, bis er endlich fertig war. Sie öffnete die Lider. Ihre Augen nagelten den Vergewaltiger ans Kreuz. Ihren eigenen Vater. Und ihre Augen schworen Rache. Ewige Rache.
Er brachte sie zurück nach Quarteira. Enge Straßen, hohe Wände, überall Beton. Sie schleppte sich die Treppen zur Wohnung im fünften Stock hinauf. Alles schmerzte. Der Unterleib, der Bauch, der Kopf, die Schultern.
Als die Mutter fragend auf das zerrissene rote Kleid zeigte, sagte Diana, sie habe nicht aufgepasst, sei an der Autotür hängen geblieben. Es täte ihr leid.
Ihr Halbbruder Hugo stand auch im Flur und starrte sie entsetzt an. Er schien die Situation zu durchschauen. »Hat er an dir rumgegrabscht?«, fragte er aufgebracht.
Ihre Mutter stieß ihn zur Seite, dann stand sie vor ihrer Tochter und verpasste ihr die nächste Ohrfeige.
Schlagartig war Diana in diesem Moment klar geworden, welchen Plan ihre Mutter verfolgt hatte, als sie sie diesem Widerling stundenweise überlassen hatte. Aus Not, aus Verzweiflung? Ganz egal. Ihr Plan war nicht aufgegangen, der Geldregen würde weiterhin ausbleiben. Sie verabscheute die beiden Menschen, denen sie ihr Leben verdankte, gleichermaßen.
Sie stürzte in ihr winziges Zimmer, schloss ab und taumelte in eine grenzenlose Einsamkeit, aus der sie lange nicht mehr herausfand.
Die Bilder von damals stiegen immer und immer wieder in Diana hoch. Selbst beim gemütlichen Dahinrollen durch die herrliche Landschaft der Algarve. Sie schüttelte sich. Konzentriere dich!, verlangte sie von sich selbst und lächelte sich im Rückspiegel aufmunternd zu. Lass neue Ideen aufblitzen – keine alten Erinnerungen!
In diesem Moment erreichte sie die Kreuzung im Städtchen Vila do Bispo, an der sie immer in Richtung Aljezur abbog. Auf dieser Strecke gelangte man zu zahlreichen Stränden der Westküste. Einer schöner als der andere.
Eine Strecke, die Diana schon zigmal gefahren war und die ihr jedes Mal aufs Neue bewusst machte, von welch grandioser Natur sie umgeben war. Eine Welt aus Wasser und Wellen, weiten Buchten und senkrecht aufragenden Klippen. Schroffes und Gefährliches neben Wiesen und Wäldern. In dieser Welt der Kontraste fühlte sie sich geborgen, denn Kontraste spiegelten sich auch in ihrem Inneren.
Kurz vor Aljezur bog Diana zur nahen Küste ab. Sie rollte südlich und oberhalb eines breiten Tales der Praia da Amoreira entgegen. Die Straße machte kurz vor den Klippen einen Knick in Richtung Süden und führte zu dem Dörfchen Monte Clérigo, das ihr wegen der niedlichen, bunt angestrichenen Holzhäuser schon immer besonders gut gefallen hatte.
Sie stellte den Mercedes an einem Parkplatz direkt vor einem Strandcafé ab, setzte sich an einen Tisch in die Sonne und bestellte einen Milchkaffee. Zog ihr Tablet heraus. Wollte eine Idee finden. Die Idee. Blätterte die Fotogalerie durch. Diniz. Immer und überall Diniz. Hunderte von Fotos.
Mit ihm war ihr Leben von heute auf morgen anders geworden. Eigentlich hatte es mit ihm erst begonnen. Die Schule hatte sie als Klassenbeste beendet und ein Stipendium für ihr Wunschstudium Medizin erhalten. Dafür war sie in die Traumstadt aller Studenten Portugals gezogen, in das intellektuelle und kulturelle Zentrum des Landes: Coimbra. Ein Name mit einem vielversprechenden Klang, der der Auftakt zu einer Arie sein könnte, ein Stoßgebet oder ein wehmütiges Fado-Lied, jene Musik, die in dieser Stadt einen akademisch-poetischen Stil angenommen hatte und hier ganz anders gedieh als der liebestrunkene Fado in Lissabon.
In Coimbra hatte für Diana ein neues, freieres Leben begonnen. Ihren Vergewaltiger aus ihrem Gemüt, aus Erinnerungen und Gefühlen zu verbannen war ihr dennoch nicht gelungen. Verborgen und feige war er untergeschlüpft, hauste irgendwo in ihrem Kopf, im Bauch, in ihrem Herz, ihrer Seele. Fast ständig war er rührig.
Auf Männer ließ sie sich kaum ein. Wenn, was selten vorkam, Sexualität mit ins Spiel zu kommen drohte, zog sie die Notbremse. Immer. Schluss. Mit einundzwanzig war sie noch Jungfrau, von dem einen Mal abgesehen, dem verheerenden Mal, dem Vatermal.
Aber dann war er gekommen. Diniz Andrade hatte wie sie auf der Treppe zur grandiosen Universitätsbibliothek von Coimbra gesessen. Er war ihr schon oft aufgefallen, aber er war stets in Begleitung seines Freundes Ricardo Calapaz gewesen. Manche munkelten, die beiden seien schwul.
Diniz war nicht schwul gewesen. Er war schlank und groß und trug einen Schnauzbart. Er hatte Augen wie ein Clown. Diana hätte nie mit Gewissheit sagen können, ob sie traurig oder humorvoll schimmerten. Auch nicht, als sie sich gegenseitig in die Augen geschaut hatten und zueinandergerückt waren. Sie hatte ihre dünngliedrige linke Hand so auf den Treppenstein gelegt, dass Diniz herüberreichen und seine starke darüberlegen konnte. Noch näher kamen sie sich. Diniz durfte sogar einen Arm um sie legen, und sie konnte sich an ihn drücken und die verhasste Visage des Vaters aus diesem sicheren Kreis der Zweisamkeit verbannen.
Als sie am Abend immer noch zusammen gewesen waren, inzwischen in einer Studententaverne unten am Rio Mondego, hatte sie ohne Ekel das Drücken seines Schenkels gegen ihren Schenkel ertragen, und sein Verlangen hatte ihr Verlangen geweckt – mehr noch, ihr Vertrauen.
Erstmals hatte sie einem anderen Menschen erzählt, was sie mit ihrem Vater erlebt hatte. Diniz war fassungslos gewesen. Er hatte mit den Zähnen geknirscht. Die Höcker seiner Backen standen vor.
Zwei Jahre später schloss Diana ihr Studium der Medizin ab und wollte sich anschließend als Kinderärztin spezialisieren. Zur selben Zeit beendete Diniz sein Studium der Jurisprudenz. Wurde Anwalt. Sein Freund Ricardo, der inzwischen auch ihr Freund geworden war, wurde Staatsanwalt. Er hatte eine Zeit lang versucht, Diniz die hübsche Freundin auszuspannen, aber da biss er auf Granit. Sie hatte sich für ein Leben mit Diniz entschieden. Sie heirateten, und zwar dort, wo viele Portugiesen und speziell algarvios heiraten: in der Fischerkapelle Nossa Senhora da Rocha bei Armação de Pêra, auf einem Felsplateau gelegen, umspült von Atlantikwellen, die im Zusammenspiel mit Wind und Wetter an den fast dreißig Meter hohen Klippenwänden nagten. Ein sagenumwobener, romantischer und gleichzeitig wilder Ort. Hier erbitten Fischer und ihre Familien die Hilfe der Heiligen Jungfrau auf hoher See bei Prozessionen, und hier erbitten junge Paare den Schutz der Muttergottes, auf dass sie sie sicher durch das Auf und Ab ihrer Ehe steuere und gesunden Kindersegen beschere. In dieser Kapelle zu heiraten ist auch heute noch Tradition. Und Diniz kam aus einem Haus, in dem Tradition großgeschrieben wurde.
Ricardo hatte die Rolle des Trauzeugen vor der Kulisse der Kapelle scheinbar genossen. Dass es in ihm jedoch bebte, dass er schier verrückt wurde vor Eifersucht, dass er gute Miene zu diesem für ihn so bösen Spiel machen musste, ahnte niemand. Außer Diana. Während der Zeremonie hatten sich ihre Blicke kurz getroffen. Da sah er für die Dauer eines Lidschlags in ihren Augen ein entsetztes Staunen aufblitzen, denn sie hatte in seinem Blick eine rasende Wut erkannt, vermischt mit schierer Verzweiflung. Er fühlte sich regelrecht ertappt, und sie fühlte sich, als hätte sie etwas wahrgenommen, das nicht für sie gedacht war.
Diniz spezialisierte sich auf Familienrecht. Für viele Kinder erstritt er den Unterhalt und die Erbanteile. Sie war sein erster Fall. Die Tatsache, dass ihr Erzeuger einer namhaften Familie angehörte, machte die Sache letztendlich einfacher: Das Ansehen der namhaften Familie durfte keinen Schaden nehmen.
Nach einer DNA-Analyse mit eindeutigem Resultat zahlte man die Alimente in Höhe von siebenhundert Euro pro Monat plus Zinsen für einundzwanzig Jahre nach. Sie gab ihrer Mutter einen ordentlichen Batzen davon ab. Als der unverheiratete und ansonsten kinderlose Mann kurz darauf an Speiseröhrenkrebs verstarb, erbte sie sein gesamtes Vermögen, darunter auch das stolze Anwesen in der Agrarregion des Barrocal in der Algarve.
Das Paar zog in der Quinta da Figueira ein. Beide arbeiteten jetzt im nahen Faro. Diniz’ Karriere nahm einen steilen Verlauf, und Diana arbeitete als Kinderärztin im großen Distrikthospital von Faro, bis sie endlich und heiß ersehnt schwanger wurde. Leider kam es nicht lange danach zu einer Fehlgeburt, die ihr und auch Diniz sehr zu schaffen machte. Sie blieb danach zu Hause, um sich auf eine erneute Schwangerschaft optimal vorzubereiten.
Ab sofort nahmen gesunde Ernährung und viel Sport sowie ein ausgeklügeltes Krafttraining im hauseigenen Fitnessstudio in ihrem Tagesablauf einen großen Raum ein. All diese abertausend Erinnerungen, gute, weniger gute. Immerhin eine stach als besonders angenehm heraus: Diniz durfte sich unbändig über einen Neuzugang am Amtsgericht in Faro freuen. Es war kein anderer als Staatsanwalt Dr. Ricardo Calapaz, der alte, der beste Freund aus Coimbra.
Jedes Foto, das Diana anklickte, weckte weitere Erinnerungen. Sie musste lächeln, als sie einen Schnappschuss betrachtete, der Diniz und Ricardo von hinten zeigte, beide nackt, beide auf dem Weg in den Duschraum des feudalen Landhauses.
Sie erinnerte sich genau, wie das Foto entstanden war: Wie fast jeden Samstagvormittag war Ricardo gegen neun Uhr bei ihnen eingetroffen. In seinem schnieken Joggingdress hatte er wie aus dem Ei gepellt gewirkt, während Diniz noch mit der Morgentoilette beschäftigt gewesen war, bevor die beiden zu ihrem üblichen Zehn-Kilometer-Lauf aufbrachen. Ricardo stand wie immer im Türrahmen des Badezimmers und erzählte seinem Freund den neuesten Klatsch aus dem Amtsgericht, von diesem und jenem Fall, einem Urteil, einem Freispruch. Natürlich gab Ricardo keine Dinge preis, die noch in der Schwebe waren – er hielt sich als Staatsanwalt hundertprozentig an die Vorschriften.
An jenem Tag – Diniz war inzwischen bei der Nassrasur angelangt – hatte er besonderes Interesse an einem Fall gezeigt, bei dem es um den sexuellen Missbrauch einer Minderjährigen ging, die ihren Vater angezeigt hatte. Ricardo ging nicht auf Einzelheiten ein, zeigte sich aber erbost über die Tatsache, dass der Fall zu den Akten gelegt worden war, weil die Tochter ihre Anzeige zurückgenommen hatte, wahrscheinlich auf Druck der eigenen Mutter hin, die, wie so viele den eigenen Ehemann schützenden Frauen, den »heiligen Frieden in der Familie« wiederherstellen wollte.
Als die Freunde nach zwei Stunden schweißgetränkt in der Quinta eingetroffen und bereits auf dem Weg ins Badezimmer gewesen waren, um ihre feuchte Sportkleidung auszuziehen, diskutierten sie schon wieder über den Fall.
Diana hatte die Antwort nicht mehr hören können, weil sie in jenem Moment die Tür zu dem rundherum gekachelten Duschraum schloss.
Auf der sonnigen Terrasse des Cafés sitzend, suchte sie in der Bildergalerie ihres Tablets ein weiteres Foto aus. Es zeigte die Kunstfotografie des Fotografen Luc Gautier, die in ihrem Wohnzimmer hing. Als sie zum ersten Mal davorgestanden hatte, war sie sofort fasziniert gewesen von der Besonderheit dieses Kunstwerks. Es war bei einer der VIP-Vernissagen gewesen, die die reiche Galeristin Teresa Guedes geschickt dazu genutzt hatte, ihr Netz aus einflussreichen Persönlichkeiten noch enger zu knüpfen.
Diana hatte Diniz zu dem Bild geführt. »Ist es nicht wunderbar?« Mit ihrem Zeigefinger war sie über die Stelle gefahren, wo bunte Wäschestücke über einer Dorfgasse im atlantischen Wind flatterten. Scharf war nur ein Rock abgebildet, unscharf dagegen der Rest des impressionistisch anmutenden Bildes. »Rock the Wind« war der Titel des auf eine Aluminiumplatte montierten Fotoabzugs.
Wenige Wochen später hatte sie Geburtstag gehabt. Mit verbundenen Augen wurde sie von Diniz mit seinen Händen auf ihren Schultern ins Wohnzimmer geführt, die Augenbinde hatte er ihr dann abgenommen und mit warmer Stimme gesagt: »Guck!« Da hatte es gehangen. »Rock the Wind«, ihr Lieblingsbild. Sie umarmte ihn. Sie küsste ihn. Sie liebte ihn. Sie führten ein gutes Leben.
Und dann war es plötzlich vorbei gewesen. Ihr Mann hatte zusammen mit Ricardo vor dem Gerichtsgebäude in Faro gestanden, beide im schwarzen Amtstalar, als ein Mann auf einem Moped auf sie zugerast kam. Manche Zeugen sagten aus, es seien zwei Personen gewesen. Der Fahrer richtete jedenfalls eine kleinkalibrige Pistole auf sie und schoss, schoss zweimal, traf zweimal und fuhr mit Vollgas weiter. Gefasst wurde er nie. Ricardo hatte das Glück, dass er seitwärts hinter Diniz stand. Er trug keine Schramme davon. Diniz fing die Kugeln ein. Eine senkte sich in seinen Hals, die andere ins Herz. Beide blieben stecken. Die Notärzte konnten Dianas Mann nicht retten. Er starb noch am Tatort.
Jetzt war sie wieder allein. Das Leben hat mich betrogen, hatte sie in den ersten Wochen nach dem schrecklichen Ereignis gedacht. Wie sollte sie jemals weiterexistieren? Aber sie hatte sich wieder aufgerafft, wild entschlossen, ihre große Liebe einfach weiterleben zu lassen. Fortan schrieb sie jeden Tag einen Eintrag in ihr digitales Tagebuch. Sie schrieb an ihn, sie schrieb für ihn, sie lebte von nun an für sie beide.
Dann fand sie in seinen Unterlagen diesen dubiosen Ordner, aus dem hervorging, dass Diniz, rein privat und nicht von Amts wegen, über sechs Männer Recherchen angestellt hatte, die sich an ihren eigenen Töchtern vergangen hatten, aber aus Mangel an Beweisen oder wegen Rückzugs der Anzeige seitens der Klägerin nicht verurteilt worden waren. Hatte ihr Kindheitstrauma ihn dazu getrieben? Was hatte Diniz vorgehabt? Was hatte er vielleicht sogar schon in die Wege geleitet?
Manchmal war sie kurz davor, Ricardo ins Vertrauen zu ziehen. Aber jedes Mal kamen ihr Zweifel, denn sie wusste nicht, ob Diniz’ private Recherche rechtens gewesen war. Und Ricardo war ein hundertprozentig rechtstreuer Jurist. Ob unter einem König, einem Diktator oder einem demokratischen Präsidenten – Recht war Recht, Recht war absolut, und Dr. Ricardo Calapaz war sein Vertreter. Sie wollte nicht riskieren, dass Diniz’ Verhalten Ricardos Missbilligung fand. Außerdem ging sie ihm neuerdings bewusst aus dem Weg, um zu verhindern, dass er sich nach Diniz’ Tod erneut falsche Hoffnungen auf sie machte, so wie damals in Coimbra. Der kurze Blick in seine Augen auf ihrer Hochzeit hatte sie schockiert. Dass solche Eifersucht in ihm tobte, hatte sie bis dahin nie vermutet. Nein, entschied sie, sie durfte ihn nicht ins Vertrauen ziehen.
Im Laufe der Monate nach dem Mord war sie zu der Einsicht gelangt, dass sie vollenden musste, was ihr Mann anscheinend angestrebt hatte: die Bestrafung dieser Männer. Jeden Tag las sie einige Akten durch. Sie kannte sie bald in- und auswendig. Sie zermarterte sich den Kopf auf der Suche nach einem Plan für einen gewaltlosen Rachefeldzug der ganz besonderen Art. Dafür musste sie die richtigen Komponenten finden, das richtige Bühnenbild, den richtigen Plot.
Das wurde ihr auch in diesem Moment wieder bewusst, als sie vom Tablet aufblickte und die Wellen keine zweihundert Meter entfernt am Strand von Monte Clérigo aufschlagen sah. Und hörte. Ihr Blick senkte sich, fiel auf »Rock the Wind«, jenes Luc-Gautier-Foto, das inzwischen zum Symbol ihrer großen Liebe geworden war. Plötzlich klingelte es in ihrem Kopf. So unaufhaltsam, wie eine Luftblase im Wasser nach oben trudelt, so stieg in ihren Gedanken und Vorstellungen die perfekte Lösung auf: Sie würde sechs Fotos von Luc Gautier erstellen lassen, um damit eine komplette Fotoausstellung zu arrangieren. Lucs typische Stilelemente Schärfe und Unschärfe kämen ihr gerade recht. Sie würde sie sich zunutze machen. Was scharf abzubilden war, war keine Frage. Die Idee war geboren.
Diana stand auf und legte das Geld für den Kaffee auf den Tisch. Voller Elan schritt sie zurück zu ihrem Mercedes. Kaum fuhr sie die imposante Atlantikküstenlandschaft entlang, da verspürte sie seit Langem wieder einen gesunden Appetit. Ihr Blick fiel auf das Tablet auf dem Beifahrersitz, auf dem »Rock the Wind« noch immer leuchtete.
In diesem Moment erinnerte sie sich an die köstliche cataplana, die sie damals an ihrem Geburtstagsabend verspeist hatten. Bei dem Gedanken daran bekam sie Appetit auf das Nationalgericht der Algarve. Auf der Heimfahrt kaufte sie kurzerhand in einem Supermarkt bei Lagoa die frischen Zutaten ein.
Zu Hause angekommen legte sie »Wohltemperiertes Klavier« von Johann Sebastian Bach auf, gespielt von Glen Gould. Diese Musik gab ihr stets Ruhe und Tiefe, Besonnenheit und Kraft zugleich.
Während sie Kartoffelwürfel, Zwiebelringe, Knoblauch und frischen Koriander in die Kupferpfanne gab, Olivenöl und ein Glas Weißwein darüberschüttete, außerdem Venusmuscheln, Brocken von Teufelsfischfilet und Garnelen vorsichtig daruntermischte und alles mit dem aufklappbaren Deckel der Cataplana-Pfanne abschloss, die wie eine fliegende Untertasse aussah und sich wie in einer Zeitmaschine über die Jahrhunderte seit der maurischen Herrschaft herübergerettet hatte, stellte sie fest, dass die heute geborene Idee jeder Prüfung standhielt, jedem noch so kritischen Aspekt. Dass es bei ihrer Art von Rache keinen Platz für Gewalt gab, war ihr am allerwichtigsten, und diese Prämisse wurde voll erfüllt. Die Betrachter der Fotokunstwerke würden nur Ästhetik und Harmonie, Schönheit und Frieden für sich herausziehen.
Welch Trugschluss! Sechs Verbrecher würden gezeigt werden, darunter ein Mörder – scharf herausgehoben aus der umgebenden Unschärfe und somit an einen imaginären Pranger gestellt. Und niemand würde das durchschauen – außer sie selbst und Diniz.
Sie musste schmunzeln. Die Idee gefiel ihr immer besser.
Und die abgebildeten Männer selbst? Sie würden davon nichts mitbekommen, weil sie garantiert keine Kunstgalerien besuchten. Außerdem durften diese Bilder während der Ausstellung nicht fotografiert werden, auch die Medien durften sie nicht zeigen. Ja, damit war der Plan besiegelt.
Im Laufe des Abends wurde Diana immer beschwingter. Zwei Gläschen über zwanzig Jahre alten Portweins förderten ihre gute Laune ungemein. Nach dem Festessen setzte sie sich an ihr MacBook. Über Facebook fand sie die Telefonnummer des Fotografen Luc Gautier heraus. Es war schon spät am Abend, aber sie wollte es wissen.
Sie hatte Glück, er meldete sich gleich nach dem ersten Klingelzeichen, und sie kam ohne Umschweife zur Sache: »Monsieur, ich habe einen interessanten Auftrag für Sie. Können wir uns treffen? Sie leben doch bei Lagos? Morgen? Sagen wir, elf Uhr? An der Marina? Die Sitzbänke vor den Cafés? Ich werde einen breitkrempigen Strohhut tragen. Ich bin pünktlich. Immer.«
***
Schon seit ein paar Jahren war sie nicht mehr in Lagos umhergeschlendert, obwohl sie diese Stadt so sehr mochte. Früher, nach ihrem Studium in Coimbra, wäre sie viel lieber in diesen überaus lebendigen Ort als in den Großraum Faro gezogen, auch wenn es hier im Westen der Algarve viel windiger war.
Sie mochte die Gassen von Lagos, die mächtige mittelalterliche Stadtmauer, die vielen kleinen Kneipen und Restaurants und nachts den Betrieb in Jazzclubs und Bars. Nachmittags lockten die Strände direkt vor der Stadt und noch mehr die kleinen und teils versteckten Praias, die sich in der nahen, über zwei Kilometer langen Felsenformation Ponta da Piedade eingenistet hatten, von bizarren, vom Wind und dem Wetter gemeißelten Portalen und Domen, wahren Naturkathedralen, umgeben.
Außerdem war man von Lagos aus im Nu an der wilden Westküste. Selbst von ihrer Quinta aus fuhr sie oft zu diesem Küstenabschnitt, den viele für den schönsten Europas halten. Hatte sie ein paar Wochen lang die Westküste nicht besucht, fehlte ihr etwas: das Ungestüme der brechenden Wellen, die Schwaden von Gischt, die an manchen Tagen den gesamten Küstenstrich einhüllten, wenn gigantische Wellen gegen die Klippen schlugen und der Sprüh weit über hundert Meter in den Himmel hochjagte und sich über das Land legte.
Ganz besonders mochte sie die Architektur in dieser Stadt. Lagos war ab 1577 fast zweihundert Jahre lang die Hauptstadt der Algarve gewesen, als der Hafen florierte und mit dem aufkommenden Sklaven- und Gewürzhandel satter Wohlstand ausbrach. Als das katastrophale Erdbeben des Jahres 1755 den Süden Portugals verwüstete, stand auch hier kein Stein mehr auf dem anderen. Dem Beben, das nur zweihundert Meilen südwestlich sein Epizentrum hatte und bis Finnland registriert wurde, war ein Tsunami gefolgt, der das Grauen perfekt gemacht hatte.
Als sie durch die Straßen bummelte, musste Diana daran denken, was sie als Studentin über das Beben und insbesondere über dessen Auswirkungen auf die Philosophie Europas gelernt hatte. Die kontroverse Frage, die seinerzeit heftig diskutiert wurde und in Voltaire und Kant, aber auch später im jungen Goethe und anderen großen Geistern ihre wichtigsten Vertreter hatte, war diese: Wie konnte ein allmächtiger und gütiger Gott – dass er ein solcher war, war damals die gängige Weltanschauung – eine solche Katastrophe zulassen? Ganz Europa zerbrach sich den Kopf.
Immer mehr kritische Stimmen wurden laut. Warum hatte das Beben ausgerechnet ein streng katholisches Land getroffen, das die Verbreitung des Christentums wie kein anderes verfolgte? Warum war die Katastrophe am Festtag der Allerheiligen ausgebrochen und hatte allein in Lissabon im Handumdrehen über sechzigtausend Menschenleben ausgelöscht? Warum waren vor allem Kirchen und Klöster eingestürzt, Lissabons Rotlichtviertel Alfama aber unbeschadet geblieben? Nicht nur Gelehrte waren sich uneins gewesen. Auch Diana und ihre Freunde hatten darüber leidenschaftlich in den Studentenkneipen von Coimbra diskutiert.
In den Jahren nach 1755 wurde mit aller Kraft, die das Land aufbringen konnte, wiederaufgebaut. Auch Lagos. Auch hier entstand alles in einem homogen wirkenden Stil, dem schlichten klassisch-eleganten portugiesischen Barock mit seinen wunderbaren Harmonien in schlanken, hohen Türen oder in teils pagodenhaft geformten Dächern. Das nahezu einheitliche Gesicht des 18. Jahrhunderts wirkte aber nicht gezwungen, denn es ließ jedem Bauherrn die Erfüllung seiner eigenen Vorlieben und Vorstellungen zu. Dem Zauber dieser Architektur erliegen heute fast alle Besucher von Lagos, das inzwischen in einigen Insider-Publikationen unter Europas zehn interessantesten Destinationen für einen faszinierenden Kurzurlaub rangiert.
Hatte Diana Freunde zu Besuch in ihrer Quinta, waren ein Ausflug nach Sagres und zu Europas südwestlichstem Kap Cabo de São Vicente und auf der Rückfahrt ein Aufenthalt in Lagos ein Muss. Eines der schönsten Ziele in der Altstadt war der Platz Praça Gil Eanes, benannt nach einem der legendären Seefahrer des frühen 15. Jahrhunderts, die Portugal binnen einer Generation eine neue Ausrichtung gaben: hinaus aufs Meer.
An der linken Seite des Platzes ragte ein dreistöckiges Gebäude auf, das von barocken Fenstern geprägt war. Seine Besonderheit war indes die Hausecke zum Platz hin. Sie war rund und hatte in jeder Etage ein Fenster mitten in der Rundung integriert. Nicht genug: Die Hausfassade wurde oben von einem Band aus von Hand bemalten Kacheln mit rankenden Blumen umschlossen. Auch der Rest des stattlichen Gebäudes war mit Kacheln verkleidet, und zwar in einer ins Auge springenden flaschengrünen Farbe.
Im späten Frühling blühten die davor aufragenden Jacaranda-Bäume sattblau. Der grün-blaue Kontrast verführte natürlich jeden Fotografen. Aber auch in allen anderen Monaten war der Platz sehr beliebt. Hier spielten Straßenmusiker von morgens bis abends, hier verkauften einige Kunsthandwerker ihre selbst gemachten Gürtel oder Schmuck, ein englischer Künstler zeichnete ulkige Porträts, während über diesem Betrieb die Möwen ihre Kreise in der windigen Luft drehten und hungrige Schreie ausstießen.
Diana machte sich auf den Weg zum Yachthafen, kam an dem beliebten Restaurant »Adega da Marina« vorbei, dem Hofbräuhaus von Lagos sozusagen, und überquerte auf einer Hebebrücke den Kanal, der zur Marina führte, einem von Stegen wie von einem starren Netz durchzogenen mondänen Hafen. Einige hundert Boote waren angedockt und bewegten sich bei jeder noch so kleinen Welle. Dann klackerten die Wanten der vielen Yachten, während Menschen prallvolle Einkaufstüten zu ihren seetüchtigen Villen schleppten und Hunde, an der Reling wartend, mit ihren Schwänzen wedelten.
Wie vereinbart, setzte sich Diana auf eine Bank vor dem »Café Artesão« und beobachtete, wie zahllose Fische seelenruhig im Hafenwasser umherschwammen und dann und wann ihre Silberbäuche zeigten. Der nach Südwest gerichtete Blick hinüber nach Lagos zeigte ein Gemenge aus übereinandergeschachtelten Gebäuden, aus dem der Turm der Kirche São Sebastião herausragte – unter sich ein mächtiges rosafarbenes Gebäude aus dem 18. Jahrhundert. Darunter breitete sich die alte Markthalle längs der Uferpromenade aus. Zahlreiche Palmen reihten sich entlang eines Kanals aneinander, auf dem bunte Fischerboote vertäut lagen.
Diana trug wie angekündigt einen breitkrempigen Florentiner und ein luftiges Kleid im Millefleurs-Dessin. Das sonnige Wetter an diesem erstaunlich lauen Januartag hatte sie dazu verführt. Sie bemerkte, dass einige Männer zu ihr herüberschauten.
Zweiundvierzig Jahre war sie alt. Ihre Körpersprache verriet Stolz und einen Anflug von Arroganz, dennoch war sie eine sehr höfliche und freundliche Frau, zuvorkommend und doch bestimmend. Seit dem Tod ihres Mannes versteckte sie gern ihre hellen grünblauen Augen, die im Kontrast zu ihrem schwarzen Haar standen, hinter einer Sonnenbrille mit auffallend großen Gläsern. Denn selbst Monate nach Diniz’ Tod traten ihr bisweilen aus heiterem Himmel Tränen in die Augen.
Jemand berührte sie von hinten an der Schulter. Sie drehte sich um und blickte zu einem Mann empor, den sie sich so nicht vorgestellt hatte. Sie hatte einen typischen Künstlertyp erwartet, mit grau gelocktem Haar und vom Nikotin braun verfärbten Fingerspitzen, mit einem lässigen Schal um den Hals und von Ölfarbe verschmierten Jeans.
Bei genauerer Betrachtung stellte Diana fest, dass der Mann vor ihr von diesem Klischee gar nicht so weit entfernt war. Die Kuppe seines rechten Zeigefingers war tatsächlich braun verfärbt, nur dass ihm etwas Wildes, fast Jähzorniges anhaftete, das bei Bohemiens eher seltener anzutreffen ist. Und weil er Fotograf war, war seine Hose auch nicht von Ölfarben verschmiert.
Er sah verdammt gut aus, hatte große Zähne und ein blendendes Lachen, mit dem er sein Gegenüber verführerisch anstrahlte. Ob das eine eingeübte Masche oder sein natürlicher Charme war, hätte Diana zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen können. Frauen fühlen sich auf der Stelle begehrenswert. Von einem Mann wie diesem lassen sie sich dieses angenehme Gefühl nur zu gern mal vermitteln, dachte sie. Sich selbst schloss sie da nicht aus.
»Luc Gautier?«, fragte Diana und erhob sich.
»Der bin ich. Und wie ist Ihr Name?«
»Diana. Hallo Luc. Ich bewundere Ihre Bilder. Schon seit zwei Jahren etwa. Ich habe Ihre Werke in der Galerie der leider verstorbenen Teresa Guedes erstmals gesehen. Wollen Sie sich nicht zu mir setzen?«
»Ich würde gern ein Gläschen Wein trinken, wenn Sie nichts dagegen haben«, sagte Luc Gautier.
Er hat was, dieser Typ, dachte Diana. »Gern«, sagte sie. »Hier im ›Artesão‹?« Sie zeigte hinter sich.
»Warum nicht. Die haben einen guten Rosé.«
»Für mich bitte eine bica. Ich muss noch fahren.« Sie zeigte zu einem soeben frei gewordenen gusseisernen Tisch ganz in ihrer Nähe und schlenderte hin. Luc rückte galant einen Stuhl für sie zurecht, sie setzten sich hin.
Er schwieg eine Weile, ungeduldig auf den Wein wartend. Als er den ersten kräftigen Schluck genommen hatte, fragte er: »Was wollen Sie von mir?«
»Sie sollen Fotos schießen. Sechs an der Zahl. Jedes Bild zeigt einen anderen Mann in seiner heimischen Umgebung. Er ist als Einziger scharf abgebildet, alles andere kommt unscharf. Fotos in typischer Luc-Gautier-Manier … Ich schicke Ihnen per E-Mail Schnappschüsse von den Probanden. Dann wissen Sie, wo diese sechs Männer jeweils anzutreffen sind und was sie so treiben. Auf dem Kuvert, das ich Ihnen gleich geben werde, steht die Adresse eines Hotmail-Kontos, das ich für Sie eingerichtet habe. Das Passwort steht darunter, wie auch meine Hotmail-Adresse. Wir kommunizieren ausschließlich über E-Mail.«
Luc Gautier gab sich cool und unbeeindruckt, obwohl ihm zig Fragen auf den Lippen brannten. Doch der Staccato-Stil dieser Lady amüsierte ihn, sodass er sich ein Grinsen nicht verkneifen konnte. Er beugte sich vor und ahmte ihre Sprechweise nach: »Wann?«
»Bald.«
Sie kamen überein, das Projekt innerhalb des Monats Februar durchzuziehen.
»How much?«
»Zweitausend für jedes Foto. Format sechzig mal sechzig Zentimeter. Ich muss jedes vorab genehmigen, Sie müssen es mir also per Mail schicken, bevor Sie es drucken und auf Aluminium montieren lassen. Ich zahle dann jedes fertige Bild.«
Er pfiff durch die Zähne. Das waren phantastische und völlig unverhoffte Perspektiven. »Okay. Aber nur gegen Vorkasse.« Er wusste, dass Zocken gefährlich war. Aber Diana wirkte verdammt entschlossen, da konnte er ruhig etwas riskieren.
»Die erste Hälfte. Die zweite bei Lieferung«, sagte Diana und leerte den Espresso in einem Schluck. Mit ihrer rechten Hand ergriff sie den Strohhut an der Krempe, ohne ihn zu bewegen. Sie lächelte ihr Gegenüber auf eine Art und Weise an, dass ihm ganz anders wurde. In der Kunst der Verführung war sie ihm durchaus ebenbürtig.
Sie erhob sich, ging zielstrebig zur Theke und bezahlte beide Getränke. Danach schritt Luc Gautier neben ihr in Richtung Hebebrücke.
Diana blieb plötzlich stehen und reichte ihm ein Kuvert. »Hier ist die Anzahlung für das erste Foto. Sie akzeptieren große Scheine?«
Bestimmt so ’ne High-Society-Tante, die nicht weiß, wohin mit ihrem vielen Geld. Na, auf so eine hab ich schon lange gewartet, dachte Luc und nahm das Kuvert entgegen.
»Bitte zählen Sie nach«, forderte Diana ihn auf.
Luc öffnete den Umschlag, der zwei der sich nicht häufig im Umlauf befindlichen violetten Scheine enthielt. Er nickte anerkennend und zwinkerte Diana freudestrahlend zu. Im selben Moment wurde ihm bewusst, dass sie den Betrag vorbereitet und demnach geahnt hatte, wie das Gespräch verlaufen würde. Er hatte sie unterschätzt.
Diana zwinkerte zurück. »Ich schicke Ihnen also bald die Schnappschüsse für das erste Foto unserer Serie zu«, wiederholte sie noch einmal, um ganz sicherzugehen, dass Luc alles verstanden hatte.
»Haben diese Personen keine Namen?«
»Doch, haben sie. Aber die spielen keine Rolle, weder für Sie noch für andere.«
2
Bei einheimischen Anglern war die fast zehn Kilometer lange Ilha de Tavira sehr beliebt. Wann immer die Hobbyfischer per Fahrrad, Moped oder Pick-up herkamen, hofften sie, einen Silberbarsch, eine Dorade oder eine Meeräsche aus dem Atlantik zu ziehen.
»Schon Glück gehabt?«, fragte Diana einen Angler, der soeben heftig an der Rolle kurbelte und Schnur einholte. Am anderen Ende tat sich aber nichts, also wieder kein Fang. Der Mann griff nach dem nackten Haken und befestigte einen frischen Köder. Dianas Frage beantwortete er nicht. Er nahm auch keine Notiz davon, dass sie zahlreiche Fotos von ihm schoss.
Dass der Angler Mário Baptista hieß, wusste sie. Außerdem war ihr vertraut, was in Diniz’ Akten über ihn stand. Sein Gesicht war nicht sehr markant. Das Auffälligste an ihm war seine rote Brille. Sie war dem Mann, der hergekommen war, um fern der Menschen und nahe bei sich selbst zu sein, anscheinend lästig.
Genervt antwortete er schließlich: »Heute noch nicht. Später vielleicht. Oder morgen. So ist es halt, das Leben, pois é.« Er befestigte einen Klumpen mit Brot vermengter Sardinenpaste am Haken und warf die Angel aus. Die Dame mit dem eleganten Strohhut beachtete er nicht länger.
Diana wandte sich ab und schaute im eigenen Körperschatten die bisher geschossenen Fotos auf dem Handy an. Sechzehn Megapixel sorgten für brillante Schärfe. Sie hatte Mário Baptista mehrmals aus verschiedenen Positionen gut getroffen. Trotzdem wollte sie später weitere Fotos aufnehmen und hoffte, dass sie ihm in der Innenstadt von Tavira noch einmal begegnen würde. Vielleicht würde er sich gegen Abend wie allgemein üblich mit seinen Freunden auf ein Gläschen treffen.
Mit solch umfangreicher Vorarbeit konnte sie dem Fotokünstler Luc Gautier ausreichende Informationen über den Mann liefern, den er dann auf seine Art aufs Korn nehmen sollte. So würde sie es mit allen halten. Und zwar so bald wie möglich. Bis Ende März sollte Luc diese Aufgabe gemeistert haben. Alle sechs Männer würden an die Reihe kommen, einer nach dem anderen.
***
Der Angler wurde nicht argwöhnisch, als er die Frau mit Strohhut am späten Nachmittag desselben Tages zufällig in der Innenstadt von Tavira wiedersah. Auch nicht, als er seine Freunde traf und die Frau sie alle zusammen fotografierte, wie sie vor einem Café saßen und Karten spielten. Sie benahm sich in seinen Augen wie eine typische Touristin. Sie knipste diesen und jenen Kamin oder von den Wänden abblätternden Putz, die Strukturen des Zerfalls, die die darunterliegenden alten Farbschichten zutage brachten. Sie bat eine alte Frau, die gerade einen Stuhl vor ihre Hauswand stellte, um die letzten Strahlen der Abendsonne zu genießen, ihren schwarzen Hut auf das schwarze Kopftuch zu setzen. Als Nächstes konnte sie gar nicht genug bekommen von der mit Schnitzereien verzierten Tür einer alten Hausruine. Ein Feigenbäumchen wuchs aus der brüchigen Türschwelle und verwandelte die Ruine durch dieses Detail in ein Bild der Hoffnung.
Der Angler schaute weg. Er mochte es nicht, wenn die Fremden alles abfotografierten. Ihm kam es manchmal so vor, als würden sie damit etwas von den Dingen und Menschen, die hier lebten, fortnehmen. Er schüttelte den Kopf, vielleicht auch, weil er sich wunderte, dass er solche moralisierenden Gedanken hatte.
Er wandte Diana den Rücken zu. So sah er nicht, wie sie die Männerrunde noch einmal ins Visier nahm, den nächsten Schnappschuss machte und danach zurück zu ihrem weinroten Oldtimer schlenderte.
»Warum guckst du so mürrisch, Mário? Hast heute wohl nix gefangen? Da hilft nur ein bagaço, was, mein Alter?«, sagte einer der Männer, die mit Mário Baptista am Tisch saßen, und schnipste mit den Fingern nach der Bedienung.
Das Wasserglas voll klarem Schnaps, das sie prompt brachte, schob der Mann zu Mário Baptista hinüber. »Auf unsere Gesundheit«, sagte er freundlich lächelnd.
***
Die Maus klickte. Auf dem Bildschirm des Laptops erschien ein neues Foto. Bilder von Tavira waren zu sehen, Schnappschüsse von einem Angler, der lachend seine rote Brille zurechtrückte, von ihm und seinen Kumpels im Café, von einem Wohnblock, von einem Feigenbäumchen, das in einer Ruine gedieh. Diana griff zur nächsten Zigarette und zündete sie an. Rauch wehte am Laptop vorbei. Sie hob das halb volle Glas, prostete dem Angler auf dem Bildschirm zu und nahm einen Schluck Wein. Wirst schon sehen, dachte sie.
Mehrere Fotos hatte sie in die engere Wahl gezogen und in einen speziellen Ordner verschoben. Sie lächelte zufrieden. Sie hätte nie gedacht, dass sie an dieser Arbeit so viel Freude haben würde. Nach einem weiteren Klick erschien ein Dokument mit juristischer Terminologie auf dem Bildschirm. Diana überflog es und lachte kurz und trocken. Dann klappte sie den Computer zu, stand auf und ging durch eine offene Glastür auf die Terrasse.
Sie blickte in Richtung Süden, wo in etwa zwölf Kilometer Entfernung der Atlantik glitzerte und einen angenehmen Kontrast zu den im Wind raschelnden Blättern von über einem Dutzend hoher Palmen bildete. Wie nimmermüde Wachsoldaten markierten sie die Grenzen ihres über zwei Hektar großen Grundstücks. Sie bewachten einen der herrschaftlichen Landsitze in der Region Barrocal im Herzen der Algarve. Alter Familienbesitz, alter Reichtum.
Diana fragte sich, ob dieser Reichtum sich inzwischen auf sie ausgewirkt hatte. Sie war in äußerst bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen. Ihre Mutter war von einer Beziehung in die nächste getaumelt, und mit jeder weiteren war alles noch komplizierter geworden. In keiner Wohnung hatte sie es länger als ein Jahr ausgehalten, nicht zuletzt deshalb, weil der Gerichtsvollzieher seine Marken hinterlassen hatte oder das Wasser und der Strom abgestellt worden waren.
Und jetzt lebte Diana hier. Sie besaß einen exquisiten Fuhrpark und ein beträchtliches Bankguthaben, von dem sie nicht einmal wusste, wie viele Nullen hinter den ersten Ziffern standen. Sie war sorglos. Aber ohne Diniz.
Sie ging zurück an ihren Laptop, klappte den Deckel wieder auf und holte die Fotos vom Angler erneut auf den Schirm. Ist er der Mörder? Egal. Alle, die ihr Mann aufgelistet hatte, kamen in Frage.
Sie beendete »iPhoto«, öffnete ihr Tagebuch, besann sich für einen Moment und fing an zu schreiben:
Mein Liebster, Rachegelüste haben mich eingeholt. Mit Vorstellungen und Einfällen, die mir bisher fremd waren.
Ich will dir nicht verheimlichen, dass mir meine völlig gewaltfreie Rache auf einmal nicht mehr ausreicht. Denn dieses gewaltlose Manifest unserer Liebe wird diesen Schurken nicht wehtun. Lediglich wir beide wissen, um was für eine Bilderserie, genauer gesagt: Verbrecherserie, es sich da handelt. Für alle anderen sind es nur ausgezeichnete Fotografien eines interessanten Künstlers. Reicht das? Immer häufiger stichelt in mir diese Stimme: Vergiss deinen Edelmut! Bestrafe sie hart, lass sie leiden, so wie sie ihre Opfer haben leiden lassen! Triff diese Männer mit voller Wucht! Lege ihnen ein für alle Mal das Handwerk! Mir wird dabei vor mir selbst angst, Diniz. Himmel, steh mir bei! Ich gehe jetzt besser an die frische Luft, um mich im Pool wieder etwas abzukühlen. Komm doch mit, bitte. Unsere Körper schweben im Wasser, wir umschlingen einander um unsere Hüften und Schenkel. Alles geschieht wie in Zeitlupe, und ich spüre dich wieder überall. Komm, Liebster, komm, schnell, schnell!
***
Luc Gautier, der nordwestlich von Lagos bei dem Dorf Barão de São João lebte, steuerte seinen alten Renault in Richtung Ostalgarve und erreichte nach über eineinhalb Stunden die Stadt Tavira. Einst war sie, nachdem Lagos an Bedeutung verloren hatte, weil der rasant wachsende Gewürz- und Sklavenhandel nach Lissabon abgewandert war, die Metropole der Provinz geworden.
Lucs Zielfigur, dieser Angler, musste sich laut der Angaben seiner Auftraggeberin, deren kompletten Namen er nicht einmal kannte, um diese Zeit auf der Ilha aufhalten. Er wollte ihn vor allem zusammen mit seinen Freunden zeigen, wenn er oben bei der Burg sein erstes Gläschen am späten Nachmittag trank. Das schien ihm pittoresker, es zeigte die Lebenslust der Einheimischen, eine der herausragenden Charakteristika der algarvios, wie sich die Einheimischen selbst bezeichnen.
Also hatte er Zeit. Als genussfreudiger Franzose wusste er, wo köstliches Essen winkte: Neben dem großen Parkplatz bei der Ilha, wo gleich daneben das Fährboot zur Insel übersetzte, befand sich etwa zwei Kilometer südlich von Tavira das Restaurant »Quatro Águas«. Er labte sich an Austern, die ihm hier in der Algarve viel besser schmeckten als zu Hause in Frankreich, und rundete das Festessen mit Seebarsch auf Kartoffelstampf ab. Dazu genoss er einen weißen Bauernwein aus der Umgebung.
Er schaute auf seinem Smartphone noch einmal die Schnappschüsse an, die ihm diese crazy Lady geschickt hatte. Die waren fast profihaft gut.
Gestärkt verließ er gegen sechzehn Uhr das Restaurant und machte sich an die Arbeit. Dafür brauchte er das umgehängte Stativ, seine Canon 70D und die phantastische, aber von anderen Fotografen wenig verwendete Carl-Zeiss-fünfunddreißig-bis-hundertfünfunddreißig-Millimeter-Zoomlinse. Luc Gautier grinste selbstgefällig in sich hinein.
Die Aufnahme würde eine knappe Stunde in Anspruch nehmen, anschließend musste er das Bild noch etwa zwei oder drei Stunden am Rechner bearbeiten, dann ausdrucken, den Leinenbogen auf Aluminium laminieren – und fertig. Mit ihrem Angebot von zweitausend Euro für ein Foto hatte die geheimnisvolle Dame bewiesen, dass sie seinen Marktwert ganz gut einzuschätzen verstand. Er gehörte zu den Spitzenleuten. Zumindest in dieser Region.
Vergnügt zündete er sich eine Zigarette an. Heute fühlte er sich endlich wieder einmal richtig gut. Mit Schrecken stellte er bei diesem Gedanken fest, was das bedeutete: Sein Leben war beängstigend freudlos geworden. Woran mochte das liegen? Am Suff? Am Altern? An beidem? Egal.
Er schloss die Wagentür auf und fuhr an Salinen entlang zurück zum nahen Städtchen Tavira. Ein Café beim Uhrturm in der Burg, hatte die Dame ihm als Lokation mitgeteilt. Hier traf sich der Mann, den er abzulichten hatte, regelmäßig am späten Nachmittag mit seinen Freunden.
Luc parkte den Renault, setzte einen Strohhut auf und machte sich an die Arbeit. Er musste nicht lange warten, bis die Männer eintrafen, Platz nahmen und Getränke bestellten – Bier und bagaço, einen klaren Schnaps, dem italienischen Grappa ähnlich und nicht weniger stark und gut.
Aus fünfzig Metern Entfernung konnte Luc durch seine erstklassige Linse alles beobachten. Und festhalten. Er konzentrierte sich auf den Mann mit der roten Brille. Es machte klick und klick, als würden Kinder mit Murmeln spielen.
Zurück in seinem Haus in der Westalgarve, goss er sich ein großes Glas Rosé ein, setzte sich an den Rechner und begann mit der Bearbeitung. Kurz vor Mitternacht schickte er das finale Foto an die Hotmail-Adresse seiner großzügigen Auftraggeberin. In freudiger Erwartung der zweiten Hälfte des Bildhonorars reckte und streckte er sich auf dem Weg zu seinem Bett und machte ein paar Dehnübungen, um lästigen Verspannungen vorzubeugen.
***
Lucs Mail war knapp gewesen. »Das erste Foto ist fertig. Bitte genehmigen. Soll ich es Ihnen bringen? Wollen Sie das Bild bei mir abholen? Oder sollen wir uns irgendwo treffen?«
»Das Foto ist sehr gut. Genehmigt. Ich komme zu Ihnen, hole es ab. Morgen, elf Uhr, passt das?«, lautete Dianas nicht weniger knappe Antwort.
»Passt«, war Lucs prompte Reaktion. Eine Wegbeschreibung zu seinem Haus hatte er hinzugefügt.
Diana genoss die Fahrt in den Westen der Algarve, obwohl sie in Gedanken schon mit dem nächsten Foto beschäftigt war, und diese Gedanken waren nicht angenehm, wenn sie sich in Erinnerung rief, warum der Mann, der als Nächster dran war, auf ihrer Liste stand.
Auf der Strecke von Lagos nach Aljezur bog sie nach ein paar Kilometern links ab und erreichte auf einer schmalen Landstraße das kleine, beschaulich wirkende Bauernhaus des Fotografen. Ein sandfarbener Renault R4 stand davor.
Luc hatte den Mercedes-Oldtimer offensichtlich schon kommen hören. Er war bereits vor das Haus getreten. Mit galanter Handbewegung bat er sie, einzutreten.
Diana war angenehm überrascht, als sie die gemütliche kleine Küche in Augenschein nahm, die von einem Holzofen, einer schrägen Decke aus Bambus- und runden Eukalyptusstangen sowie einem uralten Boden aus Terrakotta-Ziegeln geprägt war. Ein dunkelrotes Sofa und zwei wacklige Stühle rund um einen dunkelgrünen alten Holztisch zauberten eine gemütliche Stimmung.
Auf dem Sofa prangte die auf eine Aluminiumplatte laminierte Fotografie, wie bestellt. Sie hatte die vorgegebene Größe von sechzig mal sechzig Zentimetern und zeigte einen Mann mit roter Brille im Kreis seiner Freunde. Alle rauchten und spielten Karten. Im Hintergrund sah man einen barocken Turm mit einer großen Uhr. Ein stimmungsvolles Algarve-Bild.
»Ein Volltreffer«, freute sich Diana, die die diversen Details wahrnahm. Genau so wollte sie es haben. »Ich rufe Sie bald wieder an«, sagte sie lächelnd, schlug das Foto in eine mitgebrachte Decke ein und wollte schon zur Tür hinauseilen, als sie abrupt stehen blieb. »Na, so was, das hätte ich jetzt fast vergessen. Bitte zählen Sie nach«, sagte Diana und reichte Luc ein weiteres Kuvert.
Er riss den Umschlag auf. Seine Mundwinkel hoben sich automatisch, als ihn die zwei violetten Scheine anlachten.
»Wo und wann soll ich das nächste Foto produzieren?«, fragte er.





























