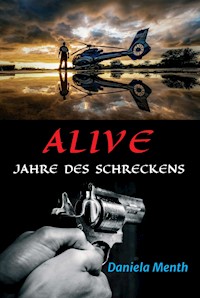
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der 24- jährige Tobey McClaine liegt erschöpft im Wasser. Kraftlos und verzweifelt lässt er sich zwischen Kaho'olawe und Lanai, zwei Hawaiianischen Inseln, im Meer treiben. Lynn, seine Freundin, welche er vor sieben Jahren auf tragische Weise verloren hat, gibt ihm Mut weiter zu schwimmen, nicht aufzugeben. Gelingt ihm die Flucht vor den Entführern, welche ihn nach Kaho'olawe gebracht haben? Sein Entführungstrauma, das er seit sechs Jahren mit sich herum trägt, und ihm jede einzelne Nacht zur Qual gemacht hat, scheint sich zu wiederholen...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 421
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Daniela Menth
Alive -Jahre desSchreckens
© 2019 Daniela Menth
Verlag und Druck: tredition GmbH, Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-7469-8560-2
Hardcover:
978-3-7469-8561-9
e-Book:
978-3-7469-8562-6
Covergestaltung: Daniela Menth
Foto Helikopter: Jacob Straube
Foto Waffe: Rudy und Peter Skitterians
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Angst
24. Juli 2019
Ich sehe in den wolkenlosen Himmel und atme tief durch. Irgendwo zwischen Lanai und Kaho'olawe treibe ich im Meer. Ich versuche mich auf der Wasseroberfläche zu entspannen, neue Kraft zu schöpfen, um danach weiterzuschwimmen. Ich möchte nicht wieder zurück zu dieser Insel, aber mir ist bewusst, dass 25 Kilometer eine wahnsinnige Strecke ist und ich noch nie eine vergleichbare Distanz geschwommen bin. Sogar für mich, aufgewachsen an den berühmten Stränden von Malibu, ist es nicht realistisch diese Strecke zu schaffen. Die einzige Motivation, die ich habe, ist die Angst, auf Kaho'olawe, einer unscheinbaren, unbewohnten, hawaiianischen Insel, dem Tod in die Augen zu blicken. Ich möchte nach Lanai rüber, um Hilfe zu holen. Den brennende Schmerz an meinem rechten Oberarm versuche ich zu überwinden, indem ich mich auf meine Gedanken konzentriere. Ich schliesse die Augen. Ein Welle schwappt über mich und reisst mich wieder aus den Gedanken. Ich ärgere mich darüber. Ich beschliesse weiterzuschwimmen, sehe mich zur Orientierung um und schwimme weiter in Richtung Lanai. Doch nach kurzer Zeit fühle ich mich, als hätte ich einen bleiernen Gürtel an, welcher versucht mich in die Tiefe zu reissen. Das Schwimmen wird immer anstrengender und bald gebe ich es auf, gegen das Schweregefühl zu kämpfen. Ich tauche ab und öffne unter Wasser die Augen. Da ist nur blaues Wasser. Die Sonnenstrahlen, welche durch die Wasseroberfläche dringen, tanzen hin und her. Sie treffen nicht auf den Boden, nahtlos gehen sie in der Tiefe verloren. Plötzlich höre ich eine leise Stimme in meinem Kopf. Es ist Lynns Stimme. „Folge der Sonne, Tobey“, sagt sie. Ich sehe mich um, doch kann ich sie nicht sehen. Ich bin verwirrt, sehe nach oben und bemerke, wie tief ich bereits im Wasser versunken bin. Ich nehme alle meine Kräfte zusammen, um die Wasseroberfläche zu erreichen. Dabei bemerke ich auch, dass Lynns Aufforderung, der Sonne zu folgen, Sinn macht. Die Sonne steht oben und dort muss ich wieder hin.
Endlich oben angekommen lege ich mich auf das Wasser mit dem Gesicht gegen die Sonne. Ich habe keine Ahnung, wie weit ich schon bin, aber ich kann einfach nicht weiter. „Lynn!“, rufe ich laut heraus und Tränen rinnen mir aus den Augen. Ich bin verzweifelt, denn ich muss doch Hilfe holen. Ich atme tief durch und schliesse wieder die Augen, denn die Sonne blendet mich. Bilder der letzten Jahre ziehen durch meinen Kopf. Schreckliche Bilder der Entführung überlagern die Bilder meiner Freunde Lynn, Julie, Ray und Claire. Tränen steigen in mir hoch. Gibt es eine Chance, sie wieder zu sehen? Ich bin voller Angst. Ich weiss, so wird das nichts mit der Entspannung. Ich muss die schlechten Bilder loswerden, wenn ich überleben möchte, und das will ich definitiv.
Vor sechs Jahren hat alles begonnen, zu einem Zeitpunkt, in dem ich verletzlich und gefordert war. Ich sollte einen wichtigen Schritt in mein eigenständiges Leben tun und über meine Zukunft entscheiden.
Reise in die Vergangenheit
10. Juli 2013
Ich sass im Flugzeug zwischen Los Angeles und Seattle. Der Flug dauerte nur zwei Stunden, doch ich langweilte mich schon. Ich wusste, was auf mich zukam, denn jeden Sommer flogen wir alle zusammen zu meinen Grosseltern und verbrachten dort einige Wochen. Mein Vater George, meine Mutter Helene, mein Bruder Jesse, welcher zwölf Jahre alt war, und ich, Tobey McClaine. Gerade war ich achtzehn Jahre alt geworden und hatte die High School abgeschlossen. Wir wohnten in Malibu und wuchsen dort behütet auf. Die Nähe zur Grossstadt war ein grosser Vorteil. Die Stadt bot uns alles, was wir uns wünschten.
Mein Vater war Professor an der University of California Los Angeles. Nach den Sommerferien war geplant, dass ich auch an diese Universität gehen konnte. Obwohl ich noch nicht wirklich wusste, in welche Richtung mich mein Studium führen sollte. Nur eines wusste ich, ich eiferte meinem Vater in keinster Weise nach. Wir hatten zwar ein tolles Haus, direkt am Meer, trotzdem hing ich manchmal total in der Luft. Die Frage, was ich aus meinem Leben machen wollte und wohin ich gehörte, war mir absolut nicht klar und ich fühlte mich nicht wirklich am richtigen Ort. Obwohl ich doch alles für ein unbeschwertes Leben hatte. Nicht jeder hatte dieselben guten Möglichkeiten wie ich, das wusste ich, jedoch hatten andere echte Ziele vor Augen. Ich konnte mir aber nie wirklich erklären, warum das so war. Mein Vater liess keinen Tag aus, um mich zu erinnern, dass ich mich für Kurse entscheiden musste während den Sommerferien. Auch er spürte, dass ich mich noch in keine bestimmte Richtung entschieden hatte. Er drängte mich nie, in dieselbe Richtung zu ziehen, welche er eingeschlagen hatte. Er erklärte mir nur meine Möglichkeiten und Wege, die mir offen standen. Manchmal nervte es mich gewaltig, obwohl er mir doch nur helfen wollte. Ich musste meinen Weg auf jeden Fall selbst finden und wollte es irgendwann auch für mich entscheiden, jedoch noch nicht anfangs der Ferien. Mein Vater hat bis zu diesem Zeitpunkt schon genug für mich getan und ich wollte ihn niemals enttäuschen, deshalb war ich fest entschlossen, bis zum Start des neuen Schuljahres an der Universität mich entschieden zu haben.
Ich starrte vor mich hin und fragte mich immer wieder, was ich tun sollte, wenn wir bei meinen Grosseltern waren. Denn ich hatte kaum die gleichen Interessen wie mein Bruder. Das lag vielleicht auch daran, dass er sechs Jahre jünger war als ich.
Kaum waren wir in Seattle gelandet, empfingen uns unsere Grosseltern. Ich empfand die ganze Zeremonie zum Einschlafen, denn es war Jahr für Jahr dasselbe. Meine Grossmutter drückte mich wie ein kleines Kind. Das war mir sehr unangenehm. Sie schien mir sehr zerbrechlich geworden zu sein, seit ich sie das letzte Mal im letzten Winter gesehen hatte. Ihre grauen, kurzen Haare standen ihr sehr gut. So passte es wunderbar zur sportlichen Erscheinung meines Grossvaters, welcher noch immer täglich einige Kilometer joggte. Kurz darauf fuhren wir los zum Haus meiner Grosseltern. Meine Grossmutter redete während der ganzen Fahrt, nicht einmal meine Mutter kam zu Wort. Das Haus war auf Anderson Island, inmitten des Puget Sound. Vom Flughafen bis dort hin waren wir zwei Stunden unterwegs, inklusive der Überfahrt mit der Fähre. Die Insel war mehr ein Feriendomizil als ein permanenter Wohnsitz. Als mein Vater noch ein Kind war, wohnten sie in Tacoma und dieses Haus auf Anderson Island wurde als Wochenend- und Ferienhaus benutzt. Doch seit mein Grossvater nicht mehr arbeitete, wohnten sie das ganze Jahr dort. Sie genossen die Ruhe direkt an der East Oro Bay. Sie hatten ein kleines Boot, welches sie zum Fischen benutzten. Es war gerade am Steg hinter dem Haus festgebunden. Für mich war es hier eindeutig zu ruhig. Die grösste Fläche der Insel war wilder Wald. Das hingegen war das Einzige, was mir an diesem Ort gefiel. Das war eine willkommene Abwechslung zu Los Angeles.
Als wir dort ankamen und unser Gepäck ins Haus gebracht hatten, überkam mich ein seltsames Gefühl. Ich fühlte mich leer und einsam. Ich wusste warum, denn Lynn fehlte mir. Ich stellte mein Gepäck ins Zimmer, welches ich mit meinem Bruder teilen musste, und ging hinaus. Ich sah den lieblich gepflegten Rosengarten meines Grossvaters an und atmete seufzend durch. Ich schnitt mit der Gartenschere, welche daneben lag, eine der schönsten roten Rosen ab. „Tobey, wo gehst du hin? Es gibt gerade Mittagessen“, rief mein Vater. Kurz drehte ich mich um. Ich fragte mich, wie man schon wieder ans Essen denken konnte, denn ich war noch immer satt vom Essen, welches während dem Flug serviert wurde. „Ich habe keinen Hunger“, sagte ich und ging der Bucht entlang bis zu dem Ort wo Lynn und ich uns bis letzten Sommer trafen. Lynn war im selben Alter wie ich und wohnte in der Nachbarschaft meiner Grosseltern. Sie lebte mit ihrer Familie das ganze Jahr hier auf der Insel. Kennen gelernt haben wir uns, als wir noch kleine Kinder waren. Wir verbrachten viel Zeit miteinander, wenn ich hier war. Zwischen uns hatte sich eine tolle Freundschaft gebildet. Wir erzählten uns alles. Ich war fasziniert von ihr, sie hatte eine riesige Lebensfreude. Sie hatte grosse Pläne für ihre Zukunft, im Gegensatz zu mir. Ich setzte mich auf einen Stein am Ufer an der Stelle, an der wir viel Zeit verbracht hatten, und sah hinaus auf den Puget Sound. Das Wetter war gut, die Sonne schien und die Weitsicht war gigantisch. In der Ferne sah ich den massiven vergletscherten Mount Rainier. Hier war unser Lieblingsplatz und genau hier passierte im letzten Sommer das Unglück. Tränen stiegen in mir hoch, denn an diesem Ort wurde die Erinnerung an Lynn und den schrecklichsten Tag in meinem Leben wieder lebendig.
Lynn
18. Juli 2012
Wir sassen hier zusammen und sahen hinaus aufs Wasser. Die Sonne spiegelte sich im ruhigen Wasser. Seit einer Woche war ich hier auf Anderson Island und wir trafen uns täglich. Jeweils gleich nach dem Aufstehen bis zum Eindunkeln verbrachten wir die Tage miteinander. Meine Grosseltern vermissten mich jedes Mal zu den Familienaktivitäten. Es war ziemlich warm an diesem Tag und wir wollten ins Wasser, um uns etwas abzukühlen. Wir kletterten auf einen Felsen, welcher zwei Meter aus dem Wasser ragte. Von dort waren wir schon unzählige Male gesprungen. Kurz blieb ich oben stehen und sah sie an. Ihre blonden Haare fielen wunderschön über ihre Schultern und ihre blauen Augen strahlten regelrecht. Ich war fasziniert von ihr, denn sie entwickelte sich zu einer wunderhübschen Frau. Wir zogen unsere Kleider aus und warfen sie hinunter auf die Steine am Ufer. Sie trug einen Bikini darunter. Dieser Anblick verdrehte mir jedes Mal den Kopf. Sie sah mich ebenfalls an. Was dachte sie wohl über mich? Ich spürte, dass es bereits um mich geschehen war. Wir sprangen gemeinsam ab. Im kalten Wasser angekommen, durchflutete mich ein Adrenalinstoss. Ich wollte gleich nochmal hoch, um zu springen. Deshalb schwamm ich schnell zum Ufer. Es war ein steil abfallender, steiniger Strand, wie überall auf der Insel. Als ich am Strand ankam, wollte ich nach Lynn zurücksehen. Doch ich stellte mit Entsetzen fest, dass sie nicht da war. Mich durchfuhr ein Schreck, weil ich eigentlich fest damit gerechnet hatte, dass sie gleich hinter mir war. „Lynn!“, rief ich laut. Doch niemand antwortete. Panik ergriff mich, als wenige Sekunden später noch immer niemand auftauchte. Das durfte doch nicht wahr sein, ich musste sie finden. Ich rannte zurück ins Wasser. Immer wieder rief ich ihren Namen. Ich tauchte nach ihr, immer und immer wieder. Doch ich fand sie nicht. Nach wenigen Minuten verstärkte sich meine Verzweiflung noch. Der Grund war so dunkel, dass ich beim Abtauchen kaum was erkennen konnte. Der Ort, an dem wir sprangen, war gut vier Meter tief. Ich holte kurz Luft und tauchte wieder ab. Dann endlich sah ich etwas, was wie eine Hand aussah. Ich war erst nicht sicher, schwamm dann doch näher ran und stellte mit Entsetzen fest, dass es Lynn war. Ich griff nach ihr und zog sie hoch. Sie hing schlaff in meinen Armen. Ich schüttelte sie, doch sie reagierte nicht. Ich schwamm ans Ufer. Meine Kräfte waren schon ziemlich am Ende, deswegen zog ich sie an den Armen über die Steine am Strand.
Als ich sie endlich aus dem Wasser gezogen hatte, kniete ich neben sie. Ich strich ihre Haare aus dem Gesicht und sah ihre blauen Lippen. Ihr Körper schien mir noch blasser als sonst, denn sie hatte eine sehr helle Haut. „Lynn, nein!“, rief ich verzweifelt. Ich wusste, dass es zu lange gedauert hatte, bis ich sie fand. Trotzdem wollte ich nicht kampflos aufgeben. Ich drückte auf ihren Brustkorb, für die Herzmassage. Ich machte immer weiter, keine Ahnung, wieviel Zeit verging, in der ich um ihr Leben kämpfte. Ich konnte einfach nicht begreifen, was gerade passiert war.
Alles was ich tat, tat ich vergebens. Lynn gab kein Lebenszeichen mehr von sich. Weinend brach ich irgendwann neben ihr zusammen. Ich fror grässlich, zitterte am ganzen Körper.
Plötzlich liess mich ein Motorengeräusch aufhorchen. Ich sah auf und bemerkte, dass ein Boot in unsere Richtung fuhr. Der Mann auf dem Boot kam in unsere Nähe und stellte den Motor aus. „Ist was passiert?“, fragte er. Ich konnte nicht sprechen, ich nickte bloss. Er liess das Boot sanft am Strand auf die Steine auflaufen und stieg aus. Ich hatte den Mann schon einige Male gesehen, kannte ihn jedoch nicht persönlich. Er schien mir sehr gepflegt, doch immer alleine. Auf jeden Fall wohnte er hier auf der Insel und fischte praktisch jeden Tag auf seinem kleinen Boot. Er bemerkte sofort, wie aufgelöst ich war. Er ging zu Lynn und suchte ihren Puls. Doch auch er sah mich danach schockiert an. Er nahm sein Telefon hervor und wählte den Notruf. Der Mann fragte mich, was passiert war, doch ich konnte es ihm nicht sagen. Ich konnte mir nämlich absolut nicht erklären, warum Lynn ertrunken war. Sie war eine ausgezeichnete Schwimmerin. Ich stand unter Schock. Etwas später traf ein Rettungsboot ein. Sie nahmen Lynn und mich mit und gaben mir eine Decke, um mich aufzuwärmen. So schnell es ging, brachten sie uns ins Krankenhaus nach Tacoma. Sie brachten uns in verschiedene Behandlungszimmer. „Was macht ihr mit Lynn?“, fragte ich. „Wir untersuchen euch beide. Was ist passiert?“, fragte mich der Arzt. „Ich weiss nicht, wie das passieren konnte. Sie schwamm gleich hinter mir. Ich habe sie gesucht. Doch ich war zu spät, als ich sie endlich gefunden hatte“, sagte ich traurig. Der Arzt nickte. „Wie ist ihr Name?“, fragte er weiter. „Lynn Coleman“, sagte ich knapp und mit Tränen in den Augen. Der Arzt notierte sich den Namen. „Wie ist dein Name, wie können wir deine Eltern erreichen?“, fragte er weiter. „Mein Name ist Tobey McClaine, meine Eltern sind auf Anderson Island“, sagte ich knapp. Der Arzt untersuchte mich und stellte Unmengen von Fragen, doch ich war mit meinen Gedanken bei Lynn und hatte keine Lust zu antworten.
Nach der Untersuchung gab er mir etwas zu trinken. Kurz darauf verliess er das Untersuchungszimmer. Ich stand auf und ging zum Waschbecken rüber, um mir meine verweinten Augen auszuwaschen. Mein Blick traf auf den Spiegel und es erschreckte mich, mich so zu sehen. Meine kurzen dunklen Haare waren zerzaust und meine braunen Augen total gerötet. Meine Haut erschien mir blass in diesem Licht des Zimmers. Ich hatte sonst eine schön gebräunte Haut, beeinflusst durch das polynesische Aussehen meines Vaters und das Aufwachsen an den sonnigen Stränden Malibus.
Nach einer Weile kam der Arzt, mit einem Plastiksack in der Hand, wieder. Es waren meine Kleider. Hastig zog ich sie an. „Was ist mit Lynn?“, fragte ich. „Nun, da ist leider nichts mehr zu machen“, sagte er zögerlich. Obwohl ich das eigentlich schon erwartet hatte, traf mich dieser Satz mit voller Wucht. „Dein Vater kommt dich abholen“, meinte er noch. „Ich möchte Lynn sehen“, sagte ich entschlossen. Der Arzt sah mich überrascht an. Nach einigen Sekunden stand er auf und meinte: „Na gut, komm mit.“ Er führte mich ins Zimmer nebenan. Wie angewurzelt blieb ich bei der Tür stehen, als ich sie sah, auf der Trage liegend und bis zur Schulter zugedecktem Körper. Der Arzt stellte einen Stuhl neben die Trage und zeigte mit einer Geste, mich dort hinzusetzen. Langsam, wie in Zeitlupe bewegte ich mich darauf zu und als ich endlich beim Stuhl angekommen war, verliess er das Zimmer. Traurig setzte ich mich auf den Stuhl und sah sie an. Meine Augen füllten sich mit Tränen, so dass ich kaum etwas sehen konnte. Ich nahm ihre Hand und umfasste sie sanft. „Lynn, es tut mir leid“, sagte ich leise. Tränen rannen unaufhörlich über mein Gesicht. Sanft berührte ich ihre Wangen und hoffte, sie würde die Augen öffnen und lachen, wie sie es unzählige Male gemacht hatte. Doch ihr Lachen blieb aus und ich begriff langsam, dass ich es nie wieder sehen würde und ich mich nun für immer verabschieden musste. Ich küsste sanft ihren Handrücken und presste die Hand an meine Wange. Ich schloss die Augen und versuchte mir Lynn vorzustellen, wie sie mit ihrem fröhlichen Lächeln vor mir stand. „Es tut mir leid“, sagte ich noch einmal.
Der Arzt kam nach einer Stunde wieder. „Wir möchten sie nun auf eine andere Station bringen“, meinte er diskret. Ich konnte mir schon denken, was dies bedeutete. Ich stand langsam auf und küsste sie auf die Wange. Ein letzter Blick in ihr Gesicht und eine letzte Berührung ihrer feinen, blonden Haare. Dann verliess ich mit gesenktem Kopf den Raum. Er brachte mich in ein anderes Zimmer. Ich setzte mich auf einen Stuhl und sah ihn erwartungsvoll an. „Es schmerzt“, sagte ich und zeigte auf meine Brust. Er nickte. „Das ist der Verlust. Brauchst du etwas? Du darfst gehen, wenn dein Vater hier ist“, meinte er. Ich schüttelte nur den Kopf. „Wenn etwas ist, melde dich. Du darfst hier warten, wenn du magst darfst du dich auch hinlegen“, sagte er und zeigte auf die Trage in der Ecke. Ich nickte wortlos. Nachdem er den Raum verlassen hatte, legte ich mich hin und schloss die Augen.
Es vergingen zwei Stunden, bis mein Vater kam. Ich reagierte nicht sofort, als die Tür aufging. Ich hörte Schritte auf mich zukommen und drehte mich langsam um. Als ich meinen Vater sah, setzte ich mich hin. „Tobey, was ist passiert? Geht es dir gut?“, fragte er. „Nein, mir geht es nicht gut. Lynn ist…“, ich konnte es nicht aussprechen, meine Stimme versagte. „Komm, wir gehen nach Hause“, meinte er und legte tröstend seine Hand auf meine Schulter. Wortlos und mit gesenktem Blick folgte ich ihm. Wir fuhren zurück nach Anderson Island. Ich war so traurig und am Boden zerstört, dass ich kein Wort redete. Als wir an Lynns Elternhaus vorbeifuhren, sah ich, wie ein Polizeiauto davor stand. Vermutlich wurden ihre Eltern gerade darüber informiert, was passiert war. Betroffen sah ich zu Boden. Ich fühlte mich schrecklich.
Als wir beim Haus meiner Grosseltern ankamen, kam meine Mutter herausgerannt. „Tobey!“, rief sie. Doch ich lief an ihr vorbei direkt in mein Zimmer und legte mich ins Bett. Den Rest des Tages kam ich nicht mehr raus. Meine Familie war ratlos, was sie tun sollte.
Am nächsten Morgen, ich sass gerade unten am steinigen Strand, nachdem ich nachts kaum geschlafen hatte, da sah ich, wie Schwertwale in die Bucht schwammen. Meine Mutter und mein Bruder rannten auf den Steg hinaus. „Toll!“, rief mein Bruder. Doch mir war nicht danach, Wale anzusehen. Ich ging traurig ins Zimmer zurück.
Eine Stunde später klopfte es zaghaft an meiner Zimmertür und sie öffnete sich langsam. Lynns Mutter stand vor mir. Ihre Augen waren total rot und ihr Gesicht erschreckend blass. Langsam stand ich auf. „Tobey, ich muss dir was sagen“, begann sie. Erwartungsvoll sah ich sie an. Sie suchte nach Worten, das konnte ich spüren. „Du kannst nichts dafür, dass das passiert ist. Lynn hatte einen Herzfehler, schon von Geburt an. Wir wussten, es wird eines Tages passieren. Es tut mir leid, dass du es so erfahren musstest“, meinte sie. Ich sah sie verwirrt an, denn Lynn hatte mir nie davon erzählt. Vor Entsetzen brachte ich kein Ton heraus. „Lynn wusste davon, seit sie sieben Jahre alt war. Im Krankenhaus hat man uns gesagt, dass du wohl hart um sie gekämpft hast, so dass zwei Rippen gebrochen waren. Der Kälteschock hat wohl den Herzstillstand verursacht, du kannst nichts dafür“, erzählte sie. „Ich war zu spät“, sagte ich beinahe ohne Ton. Sie schüttelte den Kopf. „Auch wenn du sie früher gefunden hättest, hätte das nichts geändert“, sagte sie. Ich nickte betroffen und konnte es nicht fassen, dass Lynn mir nichts davon erzählt hatte. Wir hatten das nicht zum ersten Mal gemacht, von diesem Felsen zu springen. Warum musste das ausgerechnet an diesem Tag passieren? Kurz darauf ging sie wieder.
Ihre Worte halfen mir etwas, mit Lynns Tod klarzukommen.
Wenige Tage später reisten wir vorzeitig ab. Zuhause war es für mich leichter, das Erlebte zu verarbeiten.
10. Juli 2013
Traurig sah ich zu dem Ort hinüber, an dem ich zum letzten Mal ihre funkelnden Augen und ihr zauberhaftes Lächeln sah. Sie fehlte mir so. Eine Träne rann meine Wange hinab. Ich öffnete meine Hand, in der ich die Rose festhielt. Ich hatte ihren Stiel so fest umklammert, dass eine ihrer Stacheln sich in meine Handinnenfläche gebohrt hatte. Blut rann über meine Hand und tropfte auf den steinigen Boden. Es kümmerte mich nicht, dass ich blutete, und ich legte die Rose behutsam hin. Ich stand auf und warf einige Steine hinaus aufs Wasser. Ich schrie meinen Frust laut hinaus. Es war ein erleichterndes Gefühl, denn es hatte sich ein ganzes Jahr in mir aufgestaut. Eigentlich wollte ich nie wieder hierhin kommen, doch meine Eltern wollten nicht, dass ich den ganzen Sommer alleine zuhause war. Ich drehte mich um und wollte gerade wieder zurücklaufen, da hörte ich in der Nähe ein lautes, pustendes Geräusch. Ich erschrak und drehte mich zu dem Geräusch um. Ein Schwertwal war aufgetaucht, nur gerade drei Meter vom Ufer entfernt. Ich erstarrte einen Moment. Ich sah gebannt hinaus aufs Wasser. Da tauchten noch mehr Schwertwale auf. Ich hatte sie wohl durch den Lärm, den ich veranstaltet hatte, angelockt. Kurze Zeit blieben sie am gleichen Ort und sahen zu mir rüber, ehe sie weiterschwammen. Ich lief zurück zum Haus meiner Grosseltern und zog mich ins Zimmer zurück, nachdem ich mein Blut von der Hand abgewaschen hatte.
Am nächsten Morgen beim Frühstück stocherte ich gelangweilt im Teller umher. „Wir möchten heute Morgen fischen gehen, möchtest du auch mitkommen, Tobey?“, fragte mein Grossvater. „Nein, dazu habe ich keine Lust“, sagte ich. Ich nahm mir einen Apfel aus der Früchteschale und ging raus. „Wo gehst du hin?“, fragte meine Mutter. „Irgendwo“, sagte ich eintönig und lief in den Wald. Ich hatte einfach keine Lust auf meine Familie. Eine ganze Weile lief ich durch den Wald, bis ich an den Lake Josephine kam. Ich hörte Stimmen, ging näher ran und sah, wie drei junge Männer ins Wasser sprangen, von einem Felsen herab. Offensichtlich hatten sie viel Spass dabei. Auf einer Anhöhe setzte ich mich zwischen den Bäumen hin und beobachtete das wilde Treiben. Doch ich wurde traurig, weil ich an Lynn denken musste. Ich versank in meinen Gedanken.
„Möchtest du mitmachen?“, fragte mich plötzlich eine Stimme neben mir. Ich erschrak erst und zuckte zusammen. Ein junger Mann stand neben mir. Ich hatte ihn gar nicht kommen hören und ausserdem dachte ich nicht, dass mich jemand hier zwischen den Bäumen entdeckt. „Ich habe nichts dabei“, sagte ich, noch immer etwas überrumpelt. „Möchtest du eine Badehose von mir?“, fragte er spontan. Ich war sehr überrascht von seinem Angebot, denn ich kannte ihn nicht. „Das ist nett, aber du kennst mich doch gar nicht“, sagte ich. Er lachte. „Ich bin Ray“, sagte er und streckte mir seine Hand entgegen. Ich lachte ebenfalls, denn seine offene Art gefiel mir. Ich schüttelte seine Hand und sagte: „Ich bin Tobey.“ „Na gut, mehr brauchen wir nicht, um Spass zu haben. Komm mit mir, ich wohne gleich da drüben“, sagte er und zeigte auf ein Haus direkt am Ufer des Sees. Ich stand auf und lief ihm nach. Er hatte kurze, braune Haare, leichte Locken waren noch erkennbar.
Seine Augen waren blau, wie jene von Lynn. Er gab mir eine Badehose aus seinem Schrank und wartete dann kurz vor der Tür, bis ich sie angezogen hatte. „Wir haben dieselbe Grösse, dachte ich es mir doch“, meinte er zufrieden. „Vielen Dank“, sagte ich. Wir liefen rüber zum Felsen und Ray stellte mich den anderen vor. Niemand stellte Fragen, sie liessen mich einfach am Spass teilhaben. Das empfand ich als goldrichtig für mich, um aus der Trauer um Lynn herauszukommen.
Am Abend machten wir zusammen ein Feuer und grillierten etwas. Ich hatte schon lange nicht mehr so viel gelacht. Erst spät am Abend verabschiedete ich mich. „Wir sind den ganzen Sommer hier. Du kannst jederzeit wieder kommen“, meinte Ray. „Danke, sehr gerne“, antwortete ich. Ich lief durch den Wald zurück, obwohl es schon dunkel war. Als ich beim Haus meiner Grosseltern ankam, kam mir gerade meine Mutter entgegen. „Tobey, wo warst du? Wir haben uns Sorgen gemacht“, sagte sie. „Ich bin kein Kleinkind mehr, Mam. Ich kenne mich hier aus. Ich habe einige Leute kennen gelernt am Lake Josephine, ich war nicht alleine“, sagte ich. Irgendwie schien meine Mutter erleichtert. „Ich bin müde, gute Nacht“, sagte ich und ging in mein Zimmer.
Am nächsten Morgen machte ich mich gleich nach dem Frühstück wieder auf den Weg zum Lake Josephine. Dort traf ich wieder auf Ray und die Jungs aus seiner Nachbarschaft.
Einige Tage später fragte mich Ray, ob ich Lust hätte, ihn nach Tacoma zu begleiten. Jeden Sommer besuchte er einmal den Jahrmarkt. Ich sagte zu.
Augenblick
14.Juli 2013
Am nächsten Morgen holte Ray mich mit dem Auto seines Vaters ab. So konnten meine Eltern Ray auch mal kurz kennen lernen. Bisher wussten wir nur wenig voneinander, da wenn wir uns trafen, immer nur der Spass im Vordergrund stand. „Na gut, wir wünschen euch viel Spass. Kommt aber spätestens mit der letzten Fähre wieder nach Hause“, meinte mein Vater. „Okay“, sagte ich und wir fuhren los. Auf dem Weg zur Fähre begann Ray mich auszufragen. „Woher kommst du, Tobey? Wohnst du hier auf Anderson Island?“, fragte er. „Nein, ich bin jeden Sommer hier bei meinen Grosseltern. Sie wohnen hier. Ich komme aus Los Angeles“, sagte ich. „Ach, echt? So ein Zufall. Ich bin auch aus Los Angeles und wir sind auch jeden Sommer hier, in unserem Ferienhaus“, erzählte er lachend. Ich sah ihn überrascht an. „Wo genau wohnst du?“ fragte ich. „Santa Monica, und du?“ fragte er zurück. „Malibu“, sagte ich. Ich fand es toll, dann konnten wir uns auch zu Hause mal treffen. „Kannst du surfen?“, fragte ich weiter. „Ja, kann ich“, sagte er. Ich freute mich, denn soeben habe ich jemanden gefunden, mit dem ich mein liebstes Hobby teilen konnte. Ich stand nämlich auf dem Surfboard, seit ich drei Jahre alt war. Mein Vater hatte es mir damals beigebracht. Mittlerweile war es eher umgekehrt. Ich war schon so gut, dass ich ihm Dinge beibringen konnte. Ich hatte auch viel Zeit in den Wellen verbracht. Wir nannten den Strand und die Wellen hinter unserem Haus liebevoll unseren Garten. Nachdem wir mit der Fähre nach Steilacoom rübergefahren waren, fuhr Ray einen Umweg. Es herrschte unglaublich viel Verkehr auf den Hauptstrassen. So führte unser Weg mitten durch die Wohngebiete. Ray und ich unterhielten uns und hörten dabei etwas Radio.
Plötzlich auf einen Schlag änderte sich unser Leben. Mitten auf einer Kreuzung rammte uns ein Lastwagen, ohne dass jemand von uns vorbereitet war. Wir hatten ihn nicht gesehen, obwohl wir recht aufmerksam waren. Der Lastwagen erfasste das Auto mit voller Breite auf der Beifahrerseite. Glas zersplitterte und das Auto wurde mehrere Meter mitgeschleift. Ein unheimliches Geräusch durchfuhr die ganze Gegend. Ich verlor sofort das Bewusstsein. Als das Auto endlich zum Stillstand kam, machte Ray ganz langsam die Augen auf. Er hatte keine Ahnung, was gerade passiert war. Er sah seine Hände an und griff ans Lenkrad. Er hustete und bemerkte, dass irgend etwas nicht stimmte. Er sah zu mir rüber und erschrak, als er sah, wie ich blutend in den Gurten hing. „Tobey!“, sagte er. Ich reagierte nicht. Panik stieg in ihm hoch. Er löste seinen Gurt und wollte aussteigen, doch in dem Moment stand der Lastwagenfahrer neben dem Auto. Er zog ihn grob am Arm raus und verpasste ihm mit der Faust einen Schlag ins Gesicht. Ray brach augenblicklich bewusstlos zusammen. Der Mann hob ihn auf seine Schultern und nahm ihn mit.
Langsam kam ich zu mir. Ich sah auf, hatte aber keine Ahnung, was passiert war. Ich sah, dass Ray nicht mehr da war und die Fahrertür offen stand. Alles schien mir wie in einem Traum. Ich fühlte keine Schmerzen, konnte mich jedoch auch nicht bewegen. Langsam sah ich zur rechten Seite. Da war kein Fenster mehr, sondern die Front eines Lastwagens. Sie war so nah, dass ich sie hätte berühren können, wenn ich mich hätte bewegen können. Der Mann kam zurück und riss mich rücksichtslos über den Fahrersitz aus dem Auto, da die Beifahrertür völlig eingedrückt war. Er hob mich auf die Schultern und lief zur Ladefläche des Lastwagens. Er warf mich regelrecht hin. In diesem Moment verlor ich wieder das Bewusstsein. Ich konnte bisher noch nicht begreifen, was los war.
Nur Minuten später kam ich wieder zu mir. Ich bemerkte, dass mein Mund zugeklebt war. Ausserdem waren meine Hände hinter meinem Rücken zusammengebunden. Ich bemerkte einen unfassbaren Schmerz im rechten Unterarm. Ich versuchte mich umzusehen, um mich zu orientieren.
Ich bemerkte, dass ich in einem fahrenden Lastwagen war. Die Ladefläche war leer und mit einer Blache gedeckt. In den Kurven rutschte ich etwas umher. Es verursachte noch mehr Schmerzen. Ich versuchte das Klebeband über meinem Mund loszuwerden, doch es gelang mir nicht. Ich dachte an Ray. Wo war er? Ich versuchte nach ihm zu rufen. Doch weil mein Mund zugeklebt war, waren meine Worte unverständlich. Doch sogleich hörte ich eine Antwort, genau so unverständlich. Ray war demnach gleich hinter mir. Ich hatte absolut kein Zeitgefühl mehr. Durch die Schmerzen und den Schock war ich mir nicht sicher, wie viel ich von der Fahrt auf der Ladefläche mitbekommen hatte. Vielleicht war ich in der Zwischenzeit ein weiteres Mal ohne Bewusstsein. Als wenig später der Motor ausging, begriff ich erst, dass irgend etwas gewaltig schief lief. Ich sollte ins Krankenhaus und das bestimmt nicht gefesselt auf der Ladefläche eines Lastwagens. Ich hatte so starke Schmerzen, dass ich am liebsten laut herausgeschrien hätte. Ich atmete tief durch und versuchte den Schmerz zu überwinden. Nach einer Weile kamen zwei Männer zu uns. Sie zogen uns aus dem Lastwagen. Mein Arm schmerzte so fest, dass ich laut schreien wollte. Meine Beine zitterten, als ich mitgezogen wurde. Ich versuchte so wenig Widerstand zu leisten wie möglich, denn sonst verschlimmerte sich der Schmerz noch. Sie brachten uns in eine Lagerhalle, welche fast leer war. Wir mussten uns mittendrin auf den staubigen Betonboden setzen. Ich sah nach Ray. Er sah mich besorgt an. Sein Gesicht war kreideweiss. Ich sah die zwei Männer an. Der eine hatte blonde, lange Haare, welche er zusammengebunden hatte. Seine Augen schienen mir böse und er hatte einen kräftigen Körperbau. Ich sah, dass er eine Waffe trug, gleich neben seiner glänzenden Gürtelschnalle. Der andere Mann hatte eher ein asiatisches Aussehen, war eher schmächtig, einiges kleiner als der andere und trug eine viel zu grosse Lederjacke. Sie entfernten sich einige Schritte von uns. Am anderen Ende der Lagerhalle befanden sich mehrere metallene, fassähnliche Druckbehälter, bestimmt ein Dutzend. Ich hatte keine Ahnung, was los war und warum wir hier waren.
Wenige Minuten später kam ein weiterer Mann dazu. Er war gross und entsprach eher dem Bild eines ganz normalen, durchschnittlichen Amerikaners. Das einzige Markante an ihm war seine extrem tiefe Stimme. Er blieb vor uns stehen und musterte uns. „Das hätte nicht sein müssen“, sagte er zu dem mit den blonden Haaren. „War ein Unfall“, meinte der Blonde knapp. „Na gut, dann müssen sie eben mit“, meinte der mit der tiefen Stimme. Er schien mir der Chef zu sein. Wie war das bloss gemeint, was er eben gesagt hatte? Er kniete vor mich hin. „Bitte verhalte dich ruhig, ich möchte dir den Kleber entfernen“, sagte er. Ich sah ihn nur mit grossen Augen an. „Ich bin James“, ergänzte er. Es schien mir so unwirklich. Er entfernte den Kleber vor meinem Mund und ich atmete erst mal tief durch. Er wandte sich Ray zu und entfernte auch ihm den Kleber. „Das Auto ist kaputt“, sagte Ray und Tränen rannen über sein Gesicht. James Gesichtsausdruck veränderte sich nicht. Er drehte sich dem blonden Typen zu. „Johnson, siehst du, was du angerichtet hast“, sagte James. Ich war mir nicht sicher, ob das wirklich sein Ernst war oder er es sarkastisch gemeint hatte. „Das war so nicht geplant. Wie heisst du?“, fragte er mich. „Tobey“, sagte ich knapp. „Ich möchte, dass es euch gut geht. Es wird nicht lange dauern, dann geht es los“, meinte James. Ich war verwirrt. Von was redete dieser Mann. „Ich habe Schmerzen“, sagte ich. „Ja, das sieht man. Du musst dich noch etwas gedulden“, meinte James. Ich nickte bloss und senkte den Blick zum Boden. James stand auf und ging mit dem asiatischen Typen raus. Johnson blieb in unserer Nähe stehen. Ich musterte ihn von oben bis unten. Es verging eine viertel Stunde und gerade als sich Ray wieder beruhigt hatte, kamen James und der Asiate wieder zurück. Mit dabei waren noch zwei andere Männer. Doch diese waren ebenfalls gefesselt. Als sie näher kamen, sah ich, dass sie schon etwas älter waren und Pilotenuniformen trugen. Sie sahen uns ganz entsetzt an. Sie mussten sich neben uns setzen. Während James in unserer Nähe blieb, brachten Johnson und der Asiate die Druckbehälter mit einem Stapler raus. Drehte sich alles um diese Dinger? Was war wohl dort drin? Wir trauten uns nicht zu sprechen, solange James in der Nähe war. Als alle Behälter draussen waren, brachten sie uns auch raus. Sie liessen uns hinten in den Lastwagen steigen. Gleich neben den Druckfässern mussten wir uns setzen. Langsam begriff ich, dass ich wohl so bald nicht nach Hause gehen konnte. Es war eine Entführung. Ray und ich waren, so wie es schien, rein zufällig durch den Unfall da hineingeraten. Die Blache wurde geschlossen. Kaum waren wir alleine, begann einer der älteren Männer zu fragen: „Wer seid ihr?“ „Tobey“, sagte ich knapp. Auch Ray sagte seinen Namen. Er war nun besser ansprechbar als vorhin. Es war offensichtlich, dass sie in derselben Situation waren wie wir. „Ich bin Joshua und das ist Stan“, stellte er sich und seinen Kollege vor. Der Lastwagen fuhr los. Joshua hatte schon einige graue Haare und ein freundliches Gesicht. Er trug vier Streifen auf seiner Uniform auf den Schultern. Stan war noch etwas jünger, trug drei Streifen auf den Schultern und hatte kurze dunkelblonde Haare. Er hatte die blanke Angst in den Augen. „Wo haben sie euch erwischt?“, fragte Stan. „Der Lastwagen hat das Auto meines Vaters gerammt. Was wollen die Typen?“, fragte Ray. „Das wissen wir auch nicht“, meinte Joshua und sah zu den Druckfässer hinüber. Ich hatte das Gefühl, durch die Schmerzen verlor ich langsam den Anschluss an das Gespräch. Ich konnte ihnen nicht mehr folgen. Ray bemerkte das. „Tobey, bist du okay?“, fragte er. Doch ich antwortete nicht. Ich kippte zur Seite und Tränen rannen mir übers Gesicht. Ray versuchte zu mir hinüberzurutschen und mich wieder aufzurichten, doch es gelang ihm nicht. Ich lag einfach nur dort, versuchte den Schmerz wegzuatmen, während Tränen über mein Gesicht liefen.
Die Fahrt dauerte nur kurz, dann hielt der Lastwagen an. Die Blache wurde wieder geöffnet und plötzlich standen mehrere Männer bei uns. Joshua und Stan wurden weggeführt. Dann luden sie schnell alle Fässer aus. Am Schluss wandten sie sich uns zu. Sie griffen uns unter die Arme. Doch weil es so schmerzte, schrie ich laut auf. Im nächsten Augenblick bekam ich einen Schlag auf den Hinterkopf und sofort verlor ich das Bewusstsein.
Etwa zwanzig Minuten später kam ich langsam wieder zu mir. „Tobey, bleib liegen“, sagte Ray neben mir. Ich sah mich verwirrt um. „Ray, was ist passiert?“, fragte ich. „Das ist eine Entführung“, sagte Ray knapp und gefasst. Jetzt sah ich meinen rechten Arm vor mir. Er sah schrecklich aus. So dick geschwollen und blutig. Daher kam also der Schmerz. War ich nicht mehr gefesselt? Ich bewegte meinen linken Arm, doch dieser war mit Handschellen an einem metallenen Rohr festgemacht. Erschrocken sah ich zu Ray hinüber, welcher ebenfalls an einer Hand mit Handschellen gefesselt war, nur einen Meter von mir entfernt. Ich sah, dass die Druckbehälter neben uns standen, und hörte lautes Motorengeräusch. „Ray, wo sind wir?“, fragte ich.
„In einem Flugzeug, im Laderaum. Mehr weiss ich nicht“, sagte er. Ich atmete tief durch. Wieder sah ich nach meinem rechten Arm. Der Schmerz war nicht mehr so schlimm wie vorhin. „Hast du Schmerzen?“, fragte Ray. „Ein wenig. Schon deutlich besser als vorhin“, sagte ich. „Okay, das ist gut. James hat uns ein Schmerzmittel gespritzt“, erzählt er. Verwirrt sah ich ihn an. James hat mir eine Spritze verabreicht, ohne dass ich was dagegen unternehmen konnte? Ich fühlte mich so ausgeliefert und vergewaltigt. Ich versuchte den Arm nicht zu bewegen, denn ich hatte Angst davor, dass es wieder so heftig schmerzt. Langsam konnte ich wieder klar denken. „Wo sind Joshua und Stan?“, fragte ich. „Keine Ahnung, ich habe sie nicht mehr gesehen“, antwortete Ray besorgt. „Es verging eine Weile und niemand sagte etwas. Ich sah zu den Druckfässern hinüber und konnte eine Aufschrift entdecken.
„C4H10FO2P“ stand drauf. Ich überlegte eine Weile, hatte jedoch keine Ahnung, was es bedeutete. „Weisst du, was in den Fässern ist?“, fragte ich. Er nickte wortlos. „Was ist es?“, fragte ich. Ray sah mich mit grossen Augen an. „Das willst du nicht wissen, Tobey“, sagte er. Doch ich wollte es wissen, denn ich wollte verstehen, was diese Leute vorhatten und was der Grund dafür war. „Es ist… Sarin“, sagte er zögernd. Ich sah ihn erschrocken an.
In diesem Moment kamen vier Männer in den Frachtraum. Sie trugen eine grosse Kiste aus Holz mit. Vier Fässer luden sie in diese Kiste. Dann vernagelten sie den Deckel der Kiste. Danach verliessen sie den Frachtraum wieder.
„Wir sitzen hier neben zwölf Fässern Sarin?“, fragte ich entsetzt. Ray nickte nur. Es lief mir eiskalt den Rücken hinunter. Ray hatte wohl in Geschichte besser aufgepasst als ich, denn bei Sarin handelte es sich um eine chemisch einsetzbare Waffe. Schon sehr geringe Mengen auf der Haut oder in der Atemluft reichen aus, um einen Menschen zu töten. Ich fragte nicht mehr weiter. Es war mir augenblicklich bewusst, dass, wenn eines der Fässer auslaufen würde, wir keine Chance hätten zu überleben. Die Stunden vergingen und irgendwann spürte ich einen Druck in den Ohren. Es schien mir, als wären wir im Sinkflug. Und tatsächlich merkte ich wenig später, wie wir auf der Landebahn aufsetzten. Kurz darauf kamen wieder mehrere Männer in den Frachtraum und luden die Kiste mit den vier Fässern aus. Ich konnte erkennen, dass wir in einer Region waren, welche sehr trocken war. Der Blick aus der Luke zeigte sich als Wüstenlandschaft mit rötlichem Sand. Neben der Landebahn konnte ich einige Pflanzen entdecken mit schmalen, spitzen Blättern. Ich konnte die Gegend keiner mir bekannten Region, zuordnen. Danach wurde gleich wieder die Luke geschlossen, bevor ich mich weiter umsehen konnte. Die Männer verliessen den Raum wieder. Nur eine Minute später kamen Stan und Johnson zu uns. Stan war nicht mehr gefesselt. Johnson hielt seine Pistole in der Hand. „Tobey, Ray, seid ihr in Ordnung?“, fragte Stan. „Es geht“, sagte Ray knapp. Stan hatte einen Koffer dabei. Er legte ihn auf den Boden neben mich. Als er ihn öffnete, sah ich dass Verbandsmaterialien drin waren.
Er kniete sich neben mich. „Kannst du deine Hand bewegen, Tobey?“, fragte er. „Nein, ich möchte nicht“, sagte ich ängstlich. „Vielleicht ist sie gebrochen. Wir sollten den Arm schienen“, meinte er. Ich sah ihn erschrocken an. Er suchte nach etwas, was er zum Schienen benutzen konnte. Das Einzige, was herumlag, waren ein paar Holzbretter in verschiedenen Längen. Er fand eines, welches etwa 30 cm lang war. „Mit dem sollte es gehen“, meinte Stan. Ray kam näher, um mit seiner freien Hand mitzuhelfen. Vorsichtig berührte Stan meinen Arm. Auch wenn er wirklich vorsichtig war, schmerzte es höllisch. Er nahm Verbandsmaterial aus dem Koffer und verband meinen Arm zusammen mit dem Holzbrett. Anschliessend band er den Arm, mit einer Schlinge um den Nacken, vor meine Brust. So konnte ich mich endlich hinsetzen. Ich stöhnte vor Schmerz auf. Kaum war Stan fertig, drängte Johnson ihn wieder weg. Ich lehnte mich an die metallene Aussenwand des Flugzeuges und atmete tief durch. „Was wohl unsere Eltern denken, wenn wir nicht nach Hause kommen?“, fragte ich. Ray nickte nur nachdenklich. Ich hatte in der Zwischenzeit völlig das Zeitgefühl verloren.
Kurz darauf begann wieder das Motorengeräusch. Ray sah mich verwirrt an. Was war los, flogen wir noch weiter? Und tatsächlich bemerkten wir, dass wir wieder abhoben. Wir waren sehr müde und lehnten uns gegeneinander. Wir mussten uns darauf einstellen, noch eine Weile hier zu sitzen. Es war kalt, laut und die Schmerzen verhinderten, dass ich einschlief. Ununterbrochen starrte ich auf die Sarinfässer. Es war eine gewaltige Menge. Ich konnte es nicht fassen, dass so etwas in meinem Land hergestellt wurde mit dem Plan, Mensch und Tier massenweise umzubringen.
Meine Eltern waren noch immer wach, weil sie sich sorgten. Die letzte Fähre hatte schon lange auf Anderson Island angelegt. Meine Mutter starrte auf das Telefon, während mein Vater die Strasse beobachtete und hoffte, wir würden gleich um die Ecke kommen.
Bei Rays Eltern klingelte mitten in der Nacht das Telefon. Sein Vater nahm blitzartig den Hörer ab. Die Polizei meldete sich am anderen Ende der Leitung. Sie hatten das Auto gefunden und herausgefunden, dass es Rays Vater gehörte. „Was ist passiert? Mein Sohn Ray war mit dem Auto unterwegs. Wo ist er?“, fragte er besorgt. „Wo Ray ist, wissen wir nicht. Wir haben schon in den Krankenhäusern nachgefragt. Heute hatten sie keine Verletzten durch einen Verkehrsunfall. Die rechte Seite des Autos ist eingedrückt. Es stand verlassen in einem Wohnquartier auf der Strasse“, erklärte der Polizist. Rays Vater musste sich gleich hinsetzen. „Nein, ein Unfall? Das darf nicht wahr sein. Was ist mit Tobey? Ray war nicht alleine unterwegs?“, fragte er. „Es war niemand im Auto. Ist Tobey auch ihr Sohn?“, fragte der Polizist. „Nein, Tobey ist ein Freund von Ray. Ich weiss, dass er im Sommer bei seinen Grosseltern auf Anderson Island an der East Oro Bay wohnt. Sein Nachname ist McClaine. Mehr weiss ich nicht“, erzählte Rays Vater. „In Ordnung, wir versuchen seine Angehörigen zu finden, ausserdem werden wir gleich nach ihnen suchen. Wenn es möglich ist, sollte jemand morgen früh nach Steilacoom ins Polizeirevier kommen“, sagte der Polizist. „Ja klar“, antwortete er. Mittlerweile war mein Vater kurz davor, selbst bei der Polizei anzurufen. Er wollte gerade zum Telefon, als es klingelte. Er nahm sofort den Hörer ab. Vor Spannung hielt er den Atem an. Augenblicklich erblasste er, als der Polizist ihm erklärte, was passiert war. Meine Mutter hatte schon Tränen in den Augen, als sie die Reaktion meines Vaters sah. Es wurde ihnen klar, dass etwas Schreckliches passiert war.
Landung im Nirgendwo
Es schüttelte heftig. Ich war wohl doch noch eingeschlafen. Die Motoren heulten auf und ein unheimliches Gefühl überkam mich. Angst stieg in mir hoch, denn dieses Schütteln war mir überhaupt nicht geheuer neben den Fässern voll mit Sarin. Ich sah nach Ray. Auch er sah mich panisch an. „Tobey, hast du eine Ahnung, wie lange wir schon unterwegs sind?“, fragte er. „Nein, ich habe keine Ahnung“, sagte ich. Durch die Erschütterungen wurden meine Schmerzen wieder schlimmer. Es hörte gar nicht mehr auf zu schütteln, bestimmt eine ganze Stunde lang. Die ganze Zeit starrten wir wie gebannt auf die Fässer. Es reichte aus, wenn nur eines umfiel und ein Leck bekam, um uns und alle in diesem Flugzeug zu töten. Irgendwann spürte ich einen Druck in den Ohren. Wahrscheinlich waren wir im Sinkflug. Dann plötzlich schüttelte es so fest, dass Ray und ich nicht mehr sitzen konnten. Es warf uns regelrecht umher. Dann wie auf einen Schlag war es plötzlich still, die Motoren waren aus. Langsam öffnete ich die Augen. Waren noch alle Fässer heil? Langsam richtete ich mich auf. Ich sah, dass alle Fässer noch standen.
Erleichtert atmete ich durch. Eine Tür ging auf und bestimmt zehn Leute kamen nach hinten in den Laderaum. Ich erschrak, denn ich hätte nicht mit so vielen Leuten gerechnet. Sie öffneten die hintere Ladeluke und ein eiskalter Wind kam uns entgegen. James kam mit Stan und Joshua zu uns. Sie waren mit Handschellen aneinander gekettet. James kettete mich mit Ray zusammen. Er half uns aufzustehen, sagte aber kein Wort zu uns. Er führte uns die Rampe hinab zu einem dunkelgrünen Pickup. Wir mussten auf die Ladefläche klettern. Nur mit Hilfe von Stan schafften wir es. Es war eiskalt. Kaum sassen wir auf der Ladefläche fuhr das Auto los. Ich sah durch das Fenster, dass Johnson der Fahrer war. Die Wolken hingen tief über unseren Köpfen und es regnete leicht. Dadurch empfand ich es als extrem kalt. Wir waren ja nur mit unseren Sommerkleidern unterwegs und hatten keine Jacken dabei. Die Landschaft war düster. Viel Wald und Grasland und zwischendrin eine dichte Nebelwolke. Ich sah weiter oben sogar etwas Schnee. Die Strasse war nur ein schmaler Schotterweg. Johnson fuhr sehr rücksichtslos. Auf der kurvigen Strasse warf es uns hin und her. Joshua versuchte mich etwas festzuhalten, da ich selbst nicht konnte. „Ich will nach Hause“, sagte Ray unter Tränen. Ich konnte absolut mitfühlen, denn ich wünschte es mir auch. Nach endlosen zwei Stunden und total unterkühlt kamen wir zu einer Hütte vollständig aus Holz. Nur der steinerne Kamin rauchte und es erweckte den Anschein, dass der Rauch nahtlos in den Nebel überging. Sie stand wirklich im Nirgendwo und hatte nur wenige kleine Fenster. Auf dem Weg dorthin hatte ich keine Spuren von Zivilisation erkennen können. Rundherum war dichter Wald. Wir waren alle durch und durch nass und schlotterten regelrecht. Joshua und Stan standen auf. Eine Frau trat aus der Hütte und Johnson ging auf sie zu. Sie unterhielten sich und sahen zu uns rüber. „Ich dachte, es sind zwei! Ich habe nicht mit vier gerechnet“, sagte sie laut und wir konnten ihre Empörung hören. Ich sah zu ihr hinüber. Sie war schon etwas älter, vielleicht etwa im Alter meiner Eltern. Sie hatte dunkle Haare mit einigen grauen Strähnen. „Ich kann nichts dafür. James hat entschieden, sie mitzunehmen“, sagte Johnson und wies die Schuld von sich. Die Frau kam auf uns zu. Aus der Nähe sah sie freundlich aus. „Ihr könnt reinkommen“, sagte sie. Joshua und Stan kletterten langsam von der Ladefläche. Sie halfen Ray und mir auszusteigen. Meine Beine zitterten wie verrückt. Nach einigen Schritten brach Ray plötzlich zusammen und fiel wie ein Sack Kartoffeln zu Boden. Ich fiel ebenfalls hin, da ich noch immer an ihn angekettet war. Joshua und Stan konnten auch nicht mehr rechtzeitig reagieren, bevor Ray auf dem steinigen Boden aufschlug. Ich schrie vor Schreck und Schmerz auf. „Ray, was ist los?“, fragte Stan neben ihm. Doch Ray antwortete nicht. Joshua versuchte Ray auf den Rücken zu drehen, doch weil wir zusammen an den Handschellen hingen, ging es nicht. „Kann mal jemand die Handschellen öffnen!“, schrie Joshua. Johnson kramte den Schlüssel hervor und öffnete die Handschellen von uns allen. Joshua drehte Ray um. Ray hatte die Augen geschlossen. Stan schüttelte ihn, doch er reagierte nicht. Joshua hielt seine Finger an Rays Hals und suchte seinen Puls. Dabei sah er verzweifelt Stan an. „Ich finde ihn nicht“, sagte er. Ich sass starr daneben und hielt den Atem an. „Nein, Ray!“, rief ich. Das durfte nicht wahr sein. Erst hatte ich mit Ray jemanden gefunden, der mich aus der Trauer um Lynn herausgeholt hat. Ray durfte nicht sterben. Stan und Joshua begannen mit der Herzmassage. Es erschien mir so unwirklich, das zu sehen. So als wäre es ein schlechter Film. Die Frau und Johnson zogen mich hoch auf die Beine und brachten mich in die Hütte. Tränen rannen mir aus den Augen, ich konnte absolut nichts dagegen unternehmen. In der Hütte fiel mir sofort auf, dass es schön warm war. Im Kamin brannte ein Feuer. Johnson ging wieder raus. Die Frau führte mich vor den Kamin.
Dort setzte ich mich wie in Trance hin und sah auf das Feuer. Ich spürte die Wärme und sah den lodernden Flammen zu. Die Frau streckte mir einen warmen Tee hin. Ich trank ihn hastig, denn ich hatte seit einem Tag nichts gegessen und getrunken. Langsam entspannte ich mich, denn ich merkte, wie mir wärmer wurde. Ich vergass völlig, was gerade mit Ray passiert war. „Wie ist dein Name?“, fragte die Frau freundlich und mit sanfter Stimme. „Tobey“, sagte ich eintönig. „Ich bin Ashley. Hast du Schmerzen? Du bist verletzt“, meinte sie. Ich nickte nur. „Ich habe Schmerzmittel hier. Ich kann dir welches geben“, meinte sie. Ich nickte ein weiteres Mal. Sie stand auf und holte etwas aus der Tasche. Sie nahm eine Spritze hervor und stach mir damit in den Oberschenkel. Ich sah zwar, dass sie es tat, jedoch spürte ich absolut nichts. So als wäre ich aus meinem Körper gewichen. Es tat so gut, als die Wirkung einsetzte, dass ich die Augen schloss und gleich einschlief.
Als ich etwas später wieder erwachte, lag ich zugedeckt vor dem Feuer. Ich hörte nur das knistern des Feuers. Als ich aufsah, erkannte ich gleich Ray, der neben mir lag. Ich legte meine Hand auf seine Brust, um zu fühlen, ob sein Herz schlug. Und tatsächlich spürte ich einen ruhigen Herzschlag. Ich war sehr erleichtert. „Tobey?“, hörte ich eine Stimme hinter mir. Ich setzte mich hin und sah mich





























