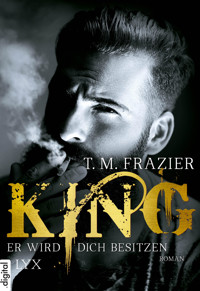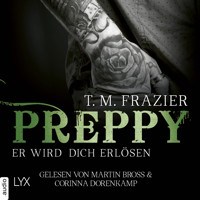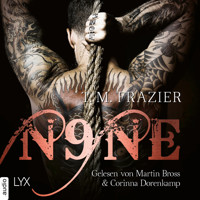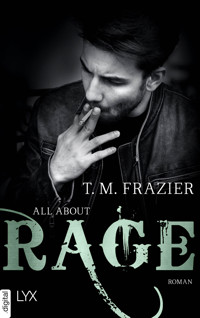
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: King-Reihe
- Sprache: Deutsch
Er bringt ihre Welt ins Wanken ...
Die 19-jährige Rage kennt als Auftragskillerin keine Gnade, keine Reue - und keine Gefühle. Doch das ändert sich, als sie Nolan, ihr nächstes Zielobjekt, kennenlernt. Nolan ist so anders als alle Männer, die sie in ihrer rauen und gefährliche Welt um Logan's Beach bisher kennengelernt hat, und er berührt etwas in ihr, das sie noch nie zuvor gespürt hat. Rage steht vor der größten Entscheidung, die sie jemals treffen musste. Eins von beidem muss sie für immer hinter ich lassen: Nolan oder das Leben, das sie bisher geführt hat. Egal, wie sie sich auch entscheidet, den Abzug muss sie ganz alleine bedienen ...
"Gefahr, Freundschaft, verbotene Gefühle. Ich habe alles an diesem Buch geliebt!" ANA'S ATTIC BOOK BLOG
Sequel zur Dark-Romance-Reihe KING von USA-TODAY-Bestseller-Autorin T. M. Frazier
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 409
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Titel
Zu diesem Buch
Triggerwarnung
Widmung
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Epilog
Bonusszene
Danksagung
Die Autorin
Die Romane von T. M. Frazier bei LYX
Impressum
T. M. FRAZIER
All About Rage
Ins Deutsche übertragen von Silvia Gleißner
Zu diesem Buch
Die 19-jährige Rage kennt als Auftragskillerin keine Gnade, keine Reue – und keine Gefühle. Doch das ändert sich, als sie Nolan, ihr nächstes Zielobjekt, kennenlernt. Nolan ist so anders als alle Männer, die sie in ihrer rauen und gefährlichen Welt um Logan’s Beach bisher kennengelernt hat, und er berührt etwas in ihr, das sie noch nie zuvor gespürt hat. Rage steht vor der größten Entscheidung, die sie jemals treffen musste. Eins von beiden muss sie für immer hinter sich lassen: Nolan oder das Leben, das sie bisher geführt hat. Egal, wie sie sich auch entscheidet, den Abzug muss sie ganz alleine bedienen …
Triggerwarnung
Dieses Buch enthält explizite Szenen, derbe Wortwahl, Gewalt und die Schilderung von schweren sexuellen Übergriffen. Leser:innen, die derart heftige Darstellungen nicht lesen möchten oder durch sie an ein Trauma erinnert werden könnten, wird hiermit geraten, diesen Roman nicht zu lesen. Alle sexuellen Handlungen zwischen Held und Heldin sind einvernehmlich.
Dieses Buch ist für die zwei großen Lieben meines Lebens.
#TeamTLC
Prolog
Rage
Irgendwer hat einmal gesagt: Wenn du einen Menschen genug liebst, lass ihn gehen. Kommt der Mensch dann zu dir zurück, war es ihm immer bestimmt, zu dir zu gehören.
Irgendwie ist das Mist.
Meine Geschichte ist anders als die meisten. Ich bin anders als die meisten.
Denn in meiner Geschichte heißt es: Wenn du einen Menschen genug liebst, dann lass als Erster die Knarre fallen.
1
Hope
Zehn Jahre alt
»Ich will zu keinem Arzt mehr«, verkündete ich und stürmte durch die Tür auf Codys Veranda. Ich sagte das, als sei es eine brandneue Info, aber die Wahrheit war, dass es dasselbe war, was ich jedes Mal verkündete, wenn ich mal wieder von einem sinnlosen Termin bei wieder einem anderen Seelenklempner kam, der mich auch nicht kapierte.
Ich ließ mich auf das alte Zweiersofa fallen, das schon in dem Anbau hinter Codys Zuhause stand, seit ich denken konnte. Ich registrierte eine lose Naht an der Ecke des Polsters und fing an, abwesend daran herumzuzupfen.
»Verstehe ich nicht. Ich dachte, du hattest darum gebeten, zum Arzt zu gehen?«, fragte Cody.
»Ja, aber das war der andere Arzt. Der Termin war gestern, und da wollte ich nur hin, weil ich mir ganz sicher war, dass ich einen Hirntumor Stadium vier habe«, erklärte ich, als sei es für eine Zehnjährige vollkommen normal, so etwas zu sagen. »Es ist wichtig, so etwas zu überprüfen, weißt du.«
Für mich war es normal.
»Muss ich fragen?«, frage Cody, lehnte sich zu mir und tat so, als meine er es ernst. »Ist das Ende nahe? Soll ich einen Priester rufen? Warte, in deinem Fall vielleicht eher einen Exorzisten.« Er klappte vornüber, legte die Arme um seine Mitte und lachte sich auf meine Kosten schlapp.
»Ich hatte alle Symptome«, argumentierte ich. »Ich kann dir Dads Medizinzeitschrift als Beweis zeigen.«
»Okay, also hast du keinen Krebs …«
»Jedenfalls keinen Hirntumor«, korrigierte ich. »Aber hier geht es nicht um diese Ärzte. Es geht um die anderen. Die Seelenklempner. Ich will nicht mehr zu denen. Ich denke, an mir ist genug herumgeschraubt worden.«
Cody sah aus, als würde er darüber nachdenken. Dann leuchteten seine Augen auf. »Also, wenn du zu den anderen Ärzten nicht mehr hinwillst, dann schmeiß deinen Tisch nicht mehr um, wenn Mrs Carmine dir sagt, dass du nicht mit dem Stift reinkratzen sollst. Oder noch besser, versuch nicht mehr, Jimmy Meyers vor den Schulbus zu schubsen«, meinte er.
Als wäre es so einfach.
»Jimmy hat mich an den Haaren gezogen«, argumentierte ich.
»Na ja, der gute Teil daran ist, dass er es sich zweimal überlegen wird, bevor er das noch mal macht, richtig?« Cody sah immer eine Seite an den Dingen, die ich nie sehen konnte. Genau deshalb ging ich jeden Tag zu ihm rüber.
Genau deshalb war er mein bester Freund.
»Also?«, fragte er. »Gib mir einen Überblick. Was hat der neue Arzt so erzählt?«, fragte Cody, und riss einen Kit-Kat-Riegel auf. Die mochte ich am liebsten.
Er setzte sich neben mich, und sein Knie stieß auf der schmalen ramponierten Couch an meinen Oberschenkel. Er brach zwei von den vier Riegeln ab und gab mir die Hälfte, die noch in der Verpackung steckte.
»Danke«, sagte ich und nahm einen großen Bissen. Ich kaute und ließ die Schokolade in meinen Organismus sickern, während ich überlegte, wie ich Codys Frage am besten beantworten konnte. »Ich habe mitgehört, wie der Arzt meinen Eltern gesagt hat, ich sei … ungleich?«
»Pah«, meinte Cody, schlug sich an die Stirn und stupste mich dann an der Schulter. »Der könnte der bisher dümmste Arzt von allen sein, denn das weiß doch sowieso jeder.«
Ich schüttelte den Kopf und spitzte die Lippen. »Nein, so wie Dr. Klondike es gesagt hat, klang es irgendwie komisch.«
Cody zog die Nase kraus und tippte sich mit dem Zeigefinger ans Kinn. »Was hat er denn genau gesagt? Versuch dich zu erinnern.«
Ich biss mir auf den Daumen, doch als ich registrierte, was ich da machte, nahm ich ihn vom Mund und setzte mich auf meine Hände.
Ich versuchte mich zu erinnern, wie der Arzt das Wort gesagt hatte, während Cody geduldig auf meine Antwort wartete. Er hatte es nie eilig und drängte mich nie nach Antworten, wie meine Eltern oder die Ärzte es taten. Ich hatte das Gefühl, als hätten meine Eltern meiner Reparatur eine begrenzte Menge an Zeit gewidmet, und wenn das nicht in dieser bezahlten Stunde klappte, dann gaben alle auf, um sich umzuorganisieren und von vorn anzufangen, wenn ich das nächste Mal etwas tat, das sie zwang, Telefonate zu führen und neue Termine auszumachen.
Cody hatte ein Maß an Geduld, das zu erreichen ich mir nicht einmal vorstellen konnte, aber zum Glück für mich hatte mein bester Freund genug Geduld für uns beide.
Endlich fiel es mir ein. »Es sagte, ich sei ungleich, weil ich emotional nicht erreichbar und zu den meisten anderen Menschen keine Verbindung hätte, oder« – ich wedelte in der Luft herum – »irgendwas in der Art.« Ich kniff mir in den Nasenrücken und gab mir Mühe, mich an mehr zu erinnern, aber wenn man bei so vielen Ärzten war wie ich, dann wurden die alle irgendwann zu einem einzigen Mischmasch. »Oh!«, rief ich dann aus und reckte den Finger hoch, als es mir einfiel. »Ich glaube, er hat auch die Worte ›emotional leer‹ gebraucht.« Ich biss wieder von meinem Schokoriegel ab, lehnte mich zurück und starrte hoch zu dem schiefen Ventilator mit dem kaputten Propellerflügel, der sich eiernd langsam und quietschend drehte.
Neue Woche. Neuer Arzt. Neue unbehagliche Unterhaltung mit einem völlig Fremden. Neuer Ausdruck von Sorge und Angst in den Augen meiner Eltern, als ihnen gesagt wurde, dass mit mir zwar etwas nicht stimmte, aber man den Grund dafür nicht bestimmen und daher natürlich keine Behandlung empfehlen könne.
Cody schüttelte den Kopf und meinte mit vollem Mund: »Gleichgültig.«
»Hm?«
Er schluckte. »Ich denke, er sagte, du bist gleichgültig. Nicht ungleich.«
»Was bedeutet das überhaupt so genau?«, fragte ich und zog die Knie an meine Brust. Cody war nur ein Jahr älter als ich, aber manchmal fühlte es sich an wie hundert Jahre.
Einen Klugscheißer als besten Freund zu haben, war nicht immer der größte Spaß, vor allem, wenn er mir jedes Mal, wenn der Green Truck vorbeirollte, die Wissenschaft hinter dem Recycling erklären wollte oder mir ein Diagramm über Wasserkreisläufe malte, immer wenn ein Sturm heraufzog. Aber wenn es um mich und mein verkorkstes Hirn ging, war die Superschlauheit von Cody echt nützlich.
Cody aß seine Hälfte Kit-Kat zu Ende. Er knüllte das Papier zusammen und warf es durch die Luft zum Mülleimer, als würde er einen Basketball in den Korb werfen. Aber er warf total daneben. Das Papier traf die Wand und rollte in die entgegengesetzte Richtung davon.
Cody war grottenschlecht in Basketball. Baseball war eher sein Ding.
»Es bedeutet, dass du nicht dasselbe fühlst, was andere Menschen fühlen. Zum Beispiel, weißt du noch, als wir uns diesen Film angesehen haben, von dem deine Eltern gesagt haben, dass wir ihn nicht schauen dürfen? Der, wo am Ende die Frau von dem Zug überfahren wird?«
»Ja«, antwortete ich. Ich erinnerte mich daran, dass wir herausfanden, wie wir den Film, der erst ab siebzehn Jahren freigegeben war, über die Fernbedienung freischalten konnten. Als er zu Ende war, hatte Cody sich von mir weggedreht, aber es war zu spät. Ich hatte seine Tränen schon gesehen. Die Frau wurde von einem Zug überfahren, nachdem sie gerade erst erfahren hatte, dass sie krebsfrei war. Sie starb. Der Film war vorbei. »Sie haben nicht mal den coolen Teil gezeigt, wo sie tatsächlich vom Zug getroffen wurde. Sie haben nur die Gleise gezeigt und ihren Hut, der durch die Luft flog.«
Cody starrte mich an, als hätte ich gerade bewiesen, dass er recht hatte.
»Vielleicht war es ein dummer Film, und ich bin die Einzige, die begriffen hat, wie dumm er war«, meinte ich und kuschelte mich tiefer in die Couchpolster.
»Okay, vielleicht war das nicht das beste Beispiel, aber ich versuche dir nur zu erklären, was der Seelenklempner gemeint hat«, meinte Cody und tippte mir an die Stirn. »Aber wenn du mich fragst« – er schüttelte langsam den Kopf – »hat er seinen Job nicht besonders gut gemacht.«
Ich setzte mich auf. »Wieso sagst du das?« Wenn es um Traurigkeit ging, war ich ja vielleicht gleichgültig, aber mein Zorn war immer putzmunter und wollte sich unbedingt durchsetzen. Ich sah Cody in die goldbraunen Augen, und er schenkte mir ein strahlendes Lächeln mit weißen Zähnen.
Cody war der Einzige, der meinen brennenden Zorn wieder beruhigen konnte, wenn der erst mal hochkam. Nicht meine Eltern, nicht die Ärzte, nicht die Beratungshilfen in der Schule. Kein Einziger von denen konnte schaffen, was Cody mit nur einem albernen Grinsen schaffte.
»Nerd«, meinte ich und warf ihm ein Kissen an den Kopf.
Er schlug es beiseite. »Die machen keinen besonders guten Job dabei, deinen Kopf kleinzukriegen.« Er streckte übertrieben die Arme aus, so weit er konnte, als versuche er mit den Fingerspitzen von einer Wand zur anderen zu reichen. »Weil, der ist so riesig wie immer!« Er streckte die Hand aus und wuschelte mir durchs Haar, sodass mein Pferdeschwanz sich löste und mein Haar wie ein unordentlicher blonder Vorhang über meine Augen fiel.
Cody brach in unkontrolliertes Gelächter aus. Sein dunkles Haar, fast so lang wie meins, hing ihm auch ins Gesicht, als er seinen Bauch umfing, von der Couch rollte und hysterisch lachte, bis er gegen die Fliegengittertür rollte und sich dort den Arm an einem schartigen Stück Aluminium aufkratzte. »Mist«, zischte er durch zusammengebissene Zähne. Er hielt sich den Ellbogen und hob den Arm, um sich den Schaden anzusehen. Ein Tröpfchen leuchtend roten Bluts tropfte aus dem Kratzer unter seinem T-Shirt-Ärmel und rollte in die Beuge seines Ellbogens.
Ich stieg hastig von der Couch, kniete mich neben ihn und hob seinen Ellbogen höher, um den Kratzer sehen zu können. »Alles okay?«, fragte ich.
Cody blickte zu mir auf und strich sich die Haarsträhne aus dem Gesicht, die ihm über die Augen gefallen war. »Ja, alles gut«, sagte er und stand auf. Er griff nach meinen Händen und zog mich zu sich hoch. »Ist nur ein kleiner Kratzer.«
Cody und ich waren immer etwa gleich groß gewesen, bis letztes Jahr, als er förmlich in die Höhe geschossen war. Ich glaube, mir war nicht klar gewesen, wie groß er wirklich geworden war, bis ich mir den Hals verrenken musste, um zu ihm hochzublicken. Er runzelte die Stirn, als hätte er etwas Übles gerochen.
»Was ist?«, fragte ich und wich einen Schritt zurück, für den Fall, dass ich das war. Vielleicht war die Extraportion Zwiebeln auf meinem XXL-Hotdog nicht die beste Idee gewesen.
»Kann ich dich was fragen?«, fragte Cody, was dumm war, denn das war ja schon eine Frage.
Ich warf ihm einen Blick zu, der zeigte, was ich dachte, mit Schmollmund zur Seite und verdrehten Augen.
Cody winkte ab. »Okay, also raus damit. Was hast du gerade gefühlt, als du von der Couch aufgestanden und zu mir gekommen bist?«
»Ich verstehe nicht.« Und jetzt war ich mit Stirnrunzeln an der Reihe.
Er zeigte auf seinen Arm und dann seinen Kratzer, wo der Blutstropfen schon zu trocknen begonnen hatte. »Als ich mich verletzt habe, bist du hergekommen, um nach mir zu sehen. Was hast du gedacht, als du das getan hast?«
Ich zuckte mit den Schultern. »Keine Ahnung. Ich schätze, ich habe einfach das Blut gesehen und wollte sichergehen, dass es dir gut geht«, sagte ich und fragte mich, worauf er hinauswollte.
»Siehst du?«, meinte Cody, so als hätte er gerade etwas bewiesen, das ich noch nicht begriffen hatte.
»Was denn?«, fragte ich und biss mir innen in die Wange.
Cody wedelte mit den Armen, als sei die Antwort offensichtlich, aber ich sah sie immer noch nicht. »Puh. Du kannst auf keinen Fall so gleichgültig sein, wie dieser Quacksalber sagt. Kann gar nicht sein, dass du keine Gefühle hast oder gleichgültig bist. Denn wenn das wirklich wahr wäre, dann wäre dir doch egal gewesen, was mit mir ist, oder? Leute, denen andere Leute gleichgültig sind, oder die keine Gefühle haben, schauen nicht nach ihren Freunden, um zu sehen, ob es ihnen gut geht. Also, da haben wir es doch. Der Arzt ist ein Idiot und wir können wieder Videospiele machen.«
Irgendwie hatte Cody schon recht, aber ich machte mir nicht die Mühe, ihn daran zu erinnern, dass er abgesehen von meinen Eltern der Einzige war, bei dem ich so reagierte. Bei all den Menschen auf der Welt, zählte es überhaupt, wenn einem nur drei von ihnen wichtig waren?
In der Woche davor war ein älterer Nachbar vor unserem Haus von seinem Fahrrad gestürzt. Ich hatte fasziniert vom Wohnzimmerfenster aus zugesehen, wie er sich mit seinem offensichtlich gebrochenen Bein quälte, bis ein Auto vorbeikam und anhielt, um zu helfen.
Mir kam nie auch nur der Gedanke, zu helfen. Nicht ein Mal.
Es war der Gedanke, die Idee, dass ich defekt war, die mir heißen Zorn über den Rücken jagte, und es war dieser Zorn, der mich dazu brachte, den gesamten Inhalt von Moms Geschirrschrank auf den Boden zu donnern.
»Du darfst nicht vergessen, dass du anders bist, nicht kaputt. Wir müssen dich nur ein bisschen in Ordnung bringen. Dafür sorgen, dass andere nicht all das sehen, was anders ist an dir.« Er zwinkerte mir zu, etwas, das er in den letzten Monaten ziemlich oft tat. Und immer wenn ich zurückzwinkern wollte, dann zwinkerte ich nur ein paarmal und sah am Ende irgendwie aus wie Dschinn, weil ich nicht mit nur einem Auge zwinkern konnte.
Cody ging zum Fernseher und fing an, zwei Controller für seine Spielkonsole zu entwirren. »Aber es ist ein Anfang, stimmt’s? Wir kommen weiter. Ich bin dir wichtig, also ist das, was der Arzt gesagt hat, nicht wahr. Ich würde sagen, das ist genug Fortschritt für heute.«
»Ganz sicher«, stimmte ich zu und setzte mich im Schneidersitz auf den Boden vor die Couch.
»Du darfst dir nicht so viele Sorgen machen, was normal ist und was nicht«, meinte Cody. Ich wünschte, es wäre so einfach, aber meine Eltern waren total darauf fixiert, mich in Ordnung zu bringen. Es gab Tage, an denen ich mir mehr wie ein Experiment in einer Petrischale vorkam und nicht wie ihr Kind.
Ich wusste, dass ich nicht normal war, ohne dass mir das irgendwer sagen musste. Meine Eltern müssten keinen einzigen Dollar dafür ausgeben, dass ein Fachmann ihnen etwas so Offensichtliches sagte. »Aber meine Eltern machen sich Sorgen um mich. Deswegen haben sie mich zu jedem Seelenklempner zwischen hier und Georgia geschleppt, um herauszufinden, was mit mir los ist.«
»Aber sie haben dich nur zu denen geschleppt wegen dem Ding mit deiner Wut, richtig?«, fragte Cody. »Ich meine das andere Zeug. Dass du dir ständig Sorgen machst, dass du krank sein könntest, die Sache mit den Keimen, dass du nie schläfst, das alles bringt sie nicht dazu, die Ärzte anzurufen, oder? Sondern nur wenn du so richtig wütend wirst.« Ich nickte, denn ich wusste genau, dass mein Zorn und das, was ich machte, wenn ich einen »Anfall« hatte, das war, was sie in den meisten Nächten auf den Beinen hielt.
Cody hatte die Controller entwirrt und gab mir einen. Dann schaltete er die Spielkonsole ein, und der kleine Fernseher erwachte mit leuchtenden, animierten Farben zum Leben. »Dann ist die Antwort einfach, denke ich.«
»Ja?«, fragte ich. »Welche Antwort?«
Codys Blick war unbewegt auf die kleine grüne Figur auf dem Bildschirm gerichtet. Seine Zunge hing ihm aus dem Mundwinkel, als er sich konzentrierte. Seine Ellbogen waren nur Zentimeter von meinem Gesicht entfernt, als er dramatisch mit seinem Controller durch die Luft fuhrwerkte. »Hm-hm. Wir müssen dir nur beibringen, wie du es vortäuschst.«
»Vortäuschen?«, fragte ich. »Was vortäuschen?«
»Alles. Das mit den Emotionen. Zuerst, wenn du die Wut rauslassen musst, wenn du das Gefühl hast, dass du an deinem eigenen Zorn erstickst, dann finden wir etwas, das du tun kannst, um alles rauszulassen, aber nicht in Gegenwart deiner Eltern. Was immer du tust, lass es sie nur nicht sehen. Was sie nicht wissen, tut ihnen nicht weh.«
Das könnte klappen.
Was Cody da vorschlug, klang schwer, aber vielleicht war es nicht ganz unmöglich.
»Okay, Doktor Delacroix, und was ist mit dem anderen Zeug?«, fragte ich, interessiert zu sehen, was er sonst noch so im Sinn hatte.
Codys Figur sprang in die Luft und umklammerte ihren Hals, als sie starb. Das Spiel spielte ein paar traurige Noten ab, als die Figur an den unteren Rand des Bildschirms sank. Meine pinke Figur wurde lebendig und ersetzte seine.
Mir war nicht mehr besonders nach Spielen. Ich legte meinen Controller auf den Boden und drehte mich zu Cody um, der seinen auch hingelegt hatte. »Das mit gleichgültig.«
»Das kannst du auch vortäuschen«, sagte Cody und klang dabei weit selbstsicherer, als ich war.
»Wie?«, fragte ich.
»Ich bringe es dir bei«, sagte Cody und nahm meine Hände. »Wenn in einem Film ein Hund stirbt, wird erwartet, dass du traurig bist, also machst du so ein Gesicht.« Cody runzelte dramatisch die Stirn, doch das brachte mich nur zum Kichern. »Oder wenn der Held am Ende die Prinzessin rettet, wird erwartet dass du dich freust, also machst du so ein Gesicht.« Cody lächelte und klimperte mit den Wimpern, als sei er eine gerettete Prinzessin.
»Du bist albern«, sagte ich und gab ihm einen scherzhaften Schlag auf die Schulter. Die beste Medizin, die keiner von diesen Ärzten mir je verschreiben konnte, war Cody.
»Ja, bin ich«, gab er zu. »Aber ich meine es auch ernst. Ich bringe dir bei, wie man das vortäuscht. Wir kriegen das hin.« Sein Griff um meine Handgelenke wurde stärker. Mein Blick ging ruckartig hoch und begegnete seinem, und sein Lächeln wurde zu Ernst. »Wir machen eine Liste mit allen Dingen, die helfen könnten, und was nicht hilft, streichen wir durch. Wir haben sie immer dabei, und immer wenn du bei etwas nicht weißt, was du tun sollst, dann musst du nur die Liste lesen.« Cody meinte es wirklich ernst. »Wir machen das zusammen«, versprach er. »Immer.«
»Zusammen«, wiederholte ich, allerdings mit nur einem Bruchteil seiner Zuversicht.
»Gut. Ich bin froh, dass das geklärt ist.« Cody hob meinen Controller auf und klickte mit den Daumen auf die verschiedenen Knöpfe.
»Aber was ist mit …?«, fing ich an, und die halbe Frage kam als Flüstern heraus.
Er hielt mit den Daumen über dem Controller inne. Er wusste genau, was ich fragen wollte, ohne dass ich es zu Ende aussprach. »Nur weil du etwas tun möchtest, heißt das nicht, dass du es tun sollst«, sagte er und wiederholte damit denselben Satz, mit dem er immer anfing, sobald das Thema aufkam. »Wird es schlimmer?«
Ich senkte den Kopf und antwortete mit einem knappen Nicken. Er starrte auf den Fernseher, und meine pinke Figur erstarrte mitten im Sprung. Cody schloss fest die Augen, seufzte und presste die Lippen aufeinander. Einen Herzschlag später startete er das Spiel erneut, als sei nichts passiert. Alle Spuren von Sorge waren aus seiner Miene verschwunden. Ohne mich anzusehen, antwortete er: »Das kriegen wir auch noch raus. Versprich mir nur, dass du niemandem sonst davon erzählst. Vor allem nicht deinen Eltern.« Schließlich schaute er zu mir, nachdem meine Figur auf demselben Hügel ihr Leben ausgehaucht hatte wie seine grüne. »Im Ernst. Ich meine es ernst. Wenn deine Eltern das je erfahren, wenn das irgendwer je erfährt, schleppen sie dich nicht nur zu Seelenklempnern, sondern dann … sperren sie dich weg.«
»Ich weiß«, antwortete ich. Google hatte mir dasselbe verraten.
Cody streckte die Hand aus und verschränkte seine Finger mit meinen. Ein Gefühl von Erleichterung überkam mich, so lindernd wie Aloe nach einem üblen Sonnenbrand. »So lange ich dich habe, geht es mir gut«, sagte ich.
Cody nickte. »Stimmt. Ich lasse nicht zu, dass sie dich mir wegnehmen, aber du musst mir versprechen, dass ich der einzige Mensch auf der Welt bin, der es je erfahren wird.« Er drückte meine Hand. »Du musst es versprechen. Du musst es sagen.«
»Nur du«, stimmte ich zu. »Ich verspreche es.« Der Gedanke, weggebracht zu werden, machte mir nicht so viel aus wie der Gedanke, von Cody getrennt zu sein.
»Zusammen«, sagte Cody wieder und drückte meine Hand noch einmal. Dann warf er mir wieder sein Superheldengrinsen zu, hob seinen Controller auf und unser Spiel ging weiter.
Ich wusste nicht, was Liebe war, aber ich dachte, dass das, was ich für Cody fühlte, dem wohl so nahe kam, wie ich je an etwas wie Liebe kommen konnte. Was ich aber genau wusste, war, dass ich ihn nicht im Stich lassen würde.
Vielleicht, wenn ich das mit dem Vortäuschen richtig gut machte, konnte der besorgte Blick in den Gesichtern meiner Eltern ja endlich wieder zu den glücklichen Gesichtern werden, wie sie auf den Fotos im Flur zu sehen waren.
Fotos von vor meiner Geburt.
Mom und Dad hatten ihr eigenes Leben immer mehr auf Eis gelegt, um mit ihrer gestörten Tochter »umzugehen«. Die Arztbesuche, die schlaflosen Nächte voll Sorge um mich, die Blicke, die sie sich beim Abendessen zuwarfen und dachten, ich würde sie nicht sehen. Aber ich sah sie.
Ich sah sie immer.
Das waren die Gründe – und es gab noch Hunderte mehr – warum sie niemals die Wahrheit erfahren durften.
Ich wollte nicht daran denken, was es ihnen antun würde, wenn sie je erfuhren, dass ihre einzige Tochter … sich danach sehnte zu töten.
2
Hope
Sechzehn Jahre alt
Die Sterne blinkten vom klaren Nachthimmel aus durch das Glasschiebedach. Die hohen dünnen Kiefern rauschten über unseren Köpfen und bogen sich extrem, obwohl der Wind bestenfalls leicht war. In dem Gebüsch in der Nähe spielten Grillen ihre Abendmusik. Ein Sprinkler schoss aus dem Boden, erwachte zischend zum Leben und erfüllte die Luft mit dem Geruch von Schwefel, der für mich immer nach faulen Eiern roch. In der Mittelkonsole spielte ein alter Country-Lovesong auf Codys iPhone.
Es verspottete mich. Das alles.
Sogar die verdammten Grillen waren eine Erinnerung daran, dass ich ein Fehlschlag war.
Im Leben. In der Liebe.
In Freundschaft.
In Normalität.
»Hier, dreh dich um«, sagte Cody. Ich drehte mich um, soweit das auf dem schmalen Rücksitz ging. Cody zog den Reißverschluss meines Kleides zu und riss dabei ein paar Haare aus, die sich aus den Haarklammern gestohlen hatten. Er drückte mir einen Kuss auf den Nacken.
Immer noch nichts.
Ich atmete tief ein und versuchte mich daran zu erinnern, dass Cody mein bester Freund war. Mein einziger Freund. Ich vertraute ihm. Und zwischen uns würde sich nichts ändern.
Nur dass das eine Lüge war, denn alles war gerade im Begriff, sich zu verändern. Für ihn. Für mich.
Denn ich würde gehen.
Heute Nacht.
Sobald ich mich zu Cody umdrehte, würde er die Wahrheit wissen. Ich konnte sie nicht verheimlichen, vor allem nicht vor ihm. Er hatte meine Lügen immer durchschaut, und heute Nacht war keine Ausnahme.
»Hope?«, fragte er flüsternd. Doch die Aufregung darüber, was wir gerade auf dem Rücksitz seines Honda getan hatten, mitten im geschlossenen Caloosa State National Park, verschwand völlig aus seinen Augen, als unsere Blicke sich trafen.
Ich schenkte Cody ein kleines Lächeln und hoffte gegen jede Wahrscheinlichkeit, dass er vielleicht nicht sehen konnte, was ich innerlich fühlte.
Aber er sah es immer.
Ich war eine schreckliche Schauspielerin und eine ganz schlechte Lügnerin, aber als ich Cody gesagt hatte, dass ich Lilly Heights nach dem Abschlussball endgültig verlassen würde, hatte er gewollt, dass ich noch eine Sache probierte, für ihn. Die Wahrheit war, dass ich auch noch einen letzten Versuch unternehmen wollte. Das Normale. Das war ich ihm schuldig. Das war ich mir selbst schuldig.
Also machten wir, was normale Teenager nach dem Abschlussball tun.
Und währenddessen fühlte ich nichts.
Und danach fühlte ich nichts.
»Hope?«, fragte Cody wieder und musterte mich.
»Ich bin hier, ich bin bei dir«, sagte ich und gab mein Bestes, mein vorgetäuschtes Lächeln zu einem echten zu machen, denn tief in mir wünschte ich, es wäre echt. Ich senkte den Blick auf meinen Schoß, rang die Hände und zupfte an meiner French Manicure.
»Blödsinn!«, fauchte Cody und lenkte meine Aufmerksamkeit wieder auf sein Gesicht und seine Augen, die eine Mischung aus Schmerz und Zorn widerspiegelten. Ich kannte ihn, seit er nebenan eingezogen war, als ich vier Jahre alt war, und noch nie zuvor hatte ich ihn so gequält gesehen. Er war mein bester Freund.
Mein einziger Freund.
Ich sah in seine braunen Augen und ließ das falsche Lächeln sein.
Shit.
»Ich habe dir doch gesagt, dass das nicht klappen wird«, fauchte ich, holte noch einmal tief Luft und löschte den Zorn in mir aus, der sich jeden Moment in mir festsetzen wollte. Ich konnte es noch ein paar Minuten länger aushalten. Für ihn. »Ich habe dir gesagt, dass ich kaputt bin. Ich habe dir gesagt, dass man es damit nicht in Ordnung bringen kann, aber ich wollte, dass wir es probieren.«
Cody griff nach meiner Hand, und ich ließ zu, dass er ein letztes Mal seine Finger mit meinen verschränkte. Ein Gefühl von Vertrautheit, mit dem ich mich immer wohlgefühlt hatte, wenn es um ihn ging. Cody seufzte. »Ich verstehe das nicht. Ich meine, wir können es noch mal versuchen. Vielleicht müssen wir ja nur …« Codys Griff um meine Hand wurde fester. »Hope, sei ehrlich. Sag es mir. Wir schaffen es nicht, dass das funktioniert, wenn du nicht …« Sein ständiger Gebrauch eines Namens, den ich hasste – das war es, was mich über die Grenze trieb, und plötzlich schien der Rücksitz seines Honda viel zu klein.
Ich fühlte mich gefangen.
»Dass was funktioniert?«, fragte ich unwirsch, zog meine Hand aus seiner und stieß die Autotür auf. Ich stolperte barfuß auf den Rasen und lehnte mich an den Honda. Cody stieg aus und blieb auf der anderen Seite stehen, und der Mond erleuchtete jede Sorgenfalte in seinem Gesicht, die ich nicht sehen wollte.
»Wir!«, rief Cody laut. »Wir natürlich! Darum ging doch das alles, oder nicht? Dass wir sehen, ob das mit uns als Paar funktionieren kann, auch mit deinen … Problemen?«
Da begriff ich endlich, wie naiv er wirklich war. Die ganze Zeit. All die Jahre, die er versucht hatte, mir zu helfen, und er kapierte es immer noch nicht. Er kapierte MICH nicht.
Ich straffte die Schultern und schleuderte ihm die Wahrheit entgegen. »Was willst du hören, Cody? Dass wir glücklich bis an unser Lebensende leben können? Denn ausgerechnet du solltest wissen, dass das für mich nicht denkbar ist. Und was wir gerade getan haben? Sex? Vögeln? Willst du die Wahrheit hören, was das angeht? Denn die Wahrheit ist, dass ich mich innerlich taub gefühlt habe«, gestand ich. »Es hat nicht wehgetan. Ich habe tatsächlich nicht mal irgendwas gefühlt. Um ehrlich zu sein, dachte ich an mein Haar und an die Nadeln, die mir womöglich gleich ins Gehirn piksen. Und dann ist mein Verstand abgedriftet, und ich weiß gar nicht, wohin, aber er war nicht da. Das ist das Problem – er war nie HIER!« Ich hob die Hände und zog an den beiden Nadeln, die mein Haar in einem Turm aus festen Locken auf meinem Kopf hielten. Ich warf die Nadeln auf den Boden. Mein Haar fiel herab um meine Schultern, und die Anspannung wurde auf der Stelle leichter. »Ich fühle mich wie ein Fehlschlag, nicht weil das hier nicht funktioniert hat, sondern nur, weil ich dich im Stich gelassen habe.«
»Du hast mich nicht im Stich gelassen«, sagte Cody und ging um das Auto herum auf die andere Seite, zu mir. »Es ist nicht so, dass das alles sofort passiert. So was braucht Zeit. Da ist so viel mehr dran als …«
»Cody!« Ich stieß mich vom Auto ab, drehte mich zu ihm herum und deutete mit einer Handbewegung auf mein rosa paillettenbesetztes Ballkleid. »Es ist vorbei. Das war’s. Das war mein letzter Versuch. Du stehst hier und siehst verletzt aus, und ich bin aufgebracht, weil ich dich verletzt habe. Das ist alles, was ich fühle. Du bist mir wichtig, und ich will dich so lieben, wie du es verdient hast, geliebt zu werden, aber ich kann nicht. Du bist einer der wenigen Menschen auf der Welt, bei denen ich, falls du tot umfällst, nicht einfach nur über dich hinwegsteigen und weitergehen würde. Das ist meine Definition von Liebe. Du verdienst mehr als das, Cody, aber ich kann dir nicht mehr geben.«
»Aber Rage«, wollte Cody widersprechen und versuchte es mit dem Spitznamen, bei dem ich lieber genannt werden wollte. Er trat einen Schritt auf mich zu.
»Nein!«, sagte ich und hob die Hand, um ihn aufzuhalten. Ich beugte mich durch das Autofenster, holte meine Tasche heraus und hängte sie mir über die Schulter. Dann holte ich mein Handy heraus und tippte eine kurze Textnachricht. Danach kramte ich das zerknitterte Blatt Papier heraus, das ich mit mir herumtrug, seit Cody und ich vor über sechs Jahren angefangen hatten, daran zu arbeiten. »Es gibt kein ›aber Rage‹. Wir haben alles versucht und noch mehr. Jahrelang. Ich habe bei jeder Idee und jedem Vorschlag mitgemacht. Und obwohl ich es geschafft habe, ein paar Leute zu täuschen, kann ich dich nicht täuschen, und – noch wichtiger – ich kann den einen Menschen nicht täuschen, der weiß, wer ich wirklich bin und der nicht will, dass ich länger den Schein wahre.«
»Und wer genau ist das?«, fragte Cody. In seiner Stimme lag Eifersucht.
Ich gab ihm die gefalteten Seiten. »Ich.«
»Behalte es«, sagte er mit einem Blick auf meine Hand, in der ich Jahre voller Vorschläge hielt, wie ich normal gemacht werden könnte, treffend überschrieben mit DIE REGELN, UM RAGE ZU SEIN.
»Ich will nicht, dass du gehst«, flüsterte Cody mit Tränen in den Augen. Die Psychologen hatten gesagt, mir fehle es an Reue, Empathie und einem generellen Respekt vor menschlichem Leben. Damit hatten sie größtenteils recht, aber ich war fähig, ein paar Menschen zu mögen.
Genug, um zu wissen, dass ich gehen musste, damit ich sie nicht mehr verletzen konnte. Cody eingeschlossen.
»Du wusstest, dass das kommen würde«, sagte ich, so als ob, wenn Cody wusste, dass eine Bombe explodieren würde, die Explosion dadurch irgendwie weniger schlimm wäre.
»Ich habe gehofft, heute Nacht würde irgendwie alles ändern«, sagte er, schob die Hände in die Taschen und sah mich verlegen durch die dunklen Haarsträhnen an, die ihm über die Augen gefallen waren.
»Ich bin erleichtert«, sagte ich und musste kurz lachen. »Jetzt gibt es keine Verwirrung mehr, die sich durch alles durchzieht. Ich weiß, was ich tun muss.« Das Röhren eines Motors dröhnte durch die Stille der Nacht und kam näher, bis es über die Kiefern hinweg hallte und nach mir rief wie Freiheit.
Ein einzelner Scheinwerfer leuchtete hinter dem Gestrüpp auf und verbarg den Fahrer der Maschine hinter den Schatten.
»Wieso ist der hier? Du hast ihn schon angerufen?«, fragte Cody und steckte sein weißes Anzughemd in die Hose, als könne wer auch immer da draußen war seinen unordentlichen Aufzug sehen.
»Ich habe ihm eine Nachricht geschickt«, gab ich zu.
»Willst du ihn?«, fragte Cody zu meiner Überraschung. »Ist er deshalb so schnell hier? Geht es darum, dass er dir lieber ist als ich?«
»Was?«
»Willst du ihn?«, fragte Cody und schlug mit der Faust auf das Autodach.
»Bist du total irre? Denkst du denn, ich hätte gerade mit dir …« Ich verstummte und versuchte das richtige Wort zu finden, damit es nicht zu grob herauskam.
»Mit mir gefickt«, beendete Cody den Satz, ohne sich um grob oder nicht zu kümmern. Sein gehässiger Tonfall ging mir unter die Haut, und ich warf ihm einen warnenden Blick zu. Er war der einzige Mensch, der je so einen Blick bekommen hatte. Er wusste, was das hieß und öffnete widerwillig die Fäuste und holte tief Luft.
»Ja, denkst du, ich hätte gerade mit dir gefickt, denkst du, ich hätte diesen einen letzten Versuch gemacht, um zu sehen, ob ich fähig bin zu Anziehung, zu einer Beziehung, dazu, ein normaler Teenager zu sein, wenn es da draußen jemand anderen gäbe, den ich will?« Cody sagte nichts, aber ich konnte die Reue über seine Wortwahl in seinem Gesicht sehen. »Ich will niemanden. Das ist ja das verdammte Problem. Ich will nichts außer ich sein. Wenn du wirklich denkst, ich haue mit einem anderen ab, weil ich ihn vögeln will, dann bin ich froh, dass ich gehe, denn ich dachte tatsächlich, du wärst der Einzige, der mich wirklich kennt, aber jetzt sehe ich, dass du mich nie wirklich gekannt hast.« Ich schnaubte. »Wenn ich mir vorstelle, dass es nur ein paar Minuten auf dem Rücksitz deiner verdammten Karre gebraucht hat, dass du alles vergisst, was du je über mich gewusst hast.«
Codys Reue stand ihm deutlich ins Gesicht geschrieben, noch bevor meine letzten Worte ausgesprochen waren. »Es tut mir leid, aber …« Er knurrte und raufte sich die Haare. »Was ist mit deinen Eltern?«, fragte er dann, packte mich an den Schultern und grub die Finger in meine Haut. Sein Zorn war vergessen, und stattdessen war da nur noch Verzweiflung.
Ich schüttelte den Kopf. »Ich habe schon alles geregelt.«
Cody blickte zum Parkplatz und schirmte seine Augen ab vor dem einzelnen Lichtstrahl aus blendend weißem Licht, das mich zu sich lockte wie die Wärme der Sonne, die mich aus einem langen kalten Winter auftauen ließ.
Ich streckte die Hand aus und berührte Codys Wange. Und ich schenkte ihm ein seltenes, echtes Lächeln. »Du weißt, dass ich niemand anderen will, oder?«, fragte ich. Es war mir wichtig, dass er verstand, dass ich nicht von ihm weg, sondern zu mir hin floh.
»Ja, Rage, aber mich willst du auch nicht«, erklärte er rundheraus. Es war das zweite Mal, dass er meinen Spitznamen sagte. Rage war ein Name, den Cody sich hatte einfallen lassen, doch als wir älter geworden waren, hatte er aufgehört, ihn zu benutzen und mich stattdessen wieder Hope genannt. Ich wusste wieso. Weil er wollte, dass ich Hope war. Hope war ein Mädchen, mit dem man Dates verabredete und ins Kino ging. Hope war ein Mädchen, mit dem man Zukunftspläne schmiedete, und das nach dem Abschlussball auf dem Rücksitz deines Hondas seine Unschuld an dich verlor.
Aber ich war nicht sie.
Ich versuchte, sie zu sein. Sie wahr werden zu lassen, doch heute Nacht war die Wahrheit klarer denn je.
Nichts, was ich versucht hatte, funktionierte … weil Hope Michaels nicht existierte.
»Nein, ich will dich nicht. Aber du musst wissen, wenn ich je irgendeinen gewollt hätte, wünschte ich, dass du es hättest sein können«, sagte ich. Cody nickte, schloss die Augen und lehnte seine Wange in meine Handfläche.
»Was soll ich machen ohne dich?«, fragte er, und seine Worte flüsterten über meine Handfläche. Eine Träne stieg in seinen Augenwinkel und lief über seine Nase. Er schniefte.
Cody war ein Einserschüler, dem die Ivy League offenstand. Er war ein Mathegenie und Star im Baseballteam unserer Highschool. Wenn ich nicht da war, um ihn runterzuziehen, gab es für ihn nur eine Richtung – an die Spitze jedes Berges, den er erklimmen wollte.
Der Motor der Maschine heulte auf und vibrierte tief in mir. Er ließ mich wissen, dass es Zeit war.
»Willst du wirklich wissen, was du ohne mich tun sollst?«, fragte ich. Ich nahm meine Hand von Codys Wange, drehte mich um, rannte so schnell ich konnte und hielt dabei den albernen Tüllrock mit der Faust hochgerafft. »Lebe!«, rief ich über die Schulter zurück. »Und du kannst die Liste behalten. Ich brauche sie nicht mehr!« Trockenes Laub und Kiefernnadeln stachen mir in die nackten Fußsohlen, aber das war mir egal.
Ich blickte nie zurück. Nicht zu Cody. Nicht auf mein altes Leben.
Ich rannte zu mehr hin als nur einem Motorrad. Ich rannte der Freiheit entgegen, ich selbst zu sein. Einem neuen Leben. Meinem wahren Ich.
Freiheit.
Da, wo ich hinging, würde Hope Michaels nicht mitkommen. An ihrer Stelle würde das Mädchen stehen, das ich, so lange ich denken konnte, beiseitegeschoben hatte. Diejenige, die die etablierte Gesellschaft, meine Lehrer, meine Ärzte, meine Eltern und sogar Cody mit viel Zeitaufwand in jemand anderen zu verwandeln versucht hatten.
Als ich den Parkplatz erreichte, zog ich mein Kleid um die Taille herum hoch, stieg rittlings hinter dem Fahrer auf die Maschine und hielt mich an der Mauer aus Leder und Muskeln vor mir fest.
Ich konnte Cody nicht sehen, aber ich konnte seinen Blick auf mir fühlen, als das Motorrad in die Schwärze der Nacht losraste. Ins Unbekannte.
Cody konnte Hope haben, denn die nahm ich nicht mit.
Als der Wind durch mein Haar peitschte und mein rosa Ballkleid im Wind wehte, war Hope offiziell verschwunden.
Und alles, was an ihrer Stelle blieb … war Rage.
3
Rage
Meine Tasche vibrierte zum millionsten Mal innerhalb von drei Minuten. Da dieses Handy ausdrücklich für Anrufe von lediglich zwei Personen reserviert war, und nur sehr selten die eine anrief, ohne dass die andere mit in der Leitung war, wusste ich genau, wer hier gerade immer wieder versuchte, mich zu erreichen. Ich konnte es nicht ewig ignorieren, vor allem nicht, da sie nicht aufhören würden, anzurufen, bis ich entweder abhob oder der Akku schlappmachte, aber ich war immer noch mit Verkabeln beschäftigt. Eine Aufgabe, die meine ganze Aufmerksamkeit erforderte.
Ich hatte jede Sekunde der letzten drei Jahre damit verbracht, mit Smoke zu arbeiten und zu trainieren. Ich war stark, sowohl physisch als auch in meinem Handwerk. Ich hatte meinen Drang nach Zerstörung zu einem Geschäft gemacht, das während des letzten Jahres aufzublühen begonnen hatte, als sich mein Ruf verbreitete als jemand, der den Job durchzog.
Nur eine kleine Handvoll meiner Auftraggeber wusste, wie ich aussah, eingeschlossen Smoke, und ich war fest entschlossen, es so zu lassen. Anonymität war entscheidend. Nicht nur, um unerwünschte Auswirkungen zu vermeiden, sondern sie war auch der Schlüssel zu meinem Erfolg. Ich konnte viel näher an eine Zielperson herankommen als ein Biker in Leder. Blondes Haar, Pferdeschwanz und rosa T-Shirt ließ nicht annähernd dieselben Alarmglocken läuten.
Ich ging in die Hocke und kroch durch das hohe spröde Gestrüpp auf ein leeres Feld, wo ich vollständig verborgen war, aber dennoch einen perfekten Blick auf das dreistöckige Gebäude unten hatte. Ich saß mit gekreuzten Beinen da und drehte gerade die letzten Drähte zusammen, als mein Handy zum einmillionundelften Mal vibrierte. Ich stellte meine hellblaue Sporttasche mit der Aufschrift LEE COUNTY HIGHSCHOOL, die ich immer dabeihatte, ab und kramte darin nach dem speziellen Handy, bis meine Hand darauf traf und ich auf ein Foto von zwei lächelnden Gesichtern auf dem Display starrte. Ich atmete tief durch, setzte das erforderliche falsche Lächeln auf, als könnten sie mich sehen und drückte auf den grünen ANNEHMEN-Button. »Hey, Moe! Hey, Va!«, grüßte ich mit eingeübter Fröhlichkeit.
Plötzlich weckte das unverkennbare Geräusch einer Klapperschlange, die warnend rasselte, meine Aufmerksamkeit.
»Mein wundervolles Mädchen«, schwärmte Mom, als wäre ich noch ein Baby. »Wieso hast du meine Anrufe nicht beantwortet, Mijn Zoeteken?«, fragte sie und nannte mich dabei bei ihrem flämischen Kosenamen für mich. Ich holte mein Messer aus der Scheide in der hinteren Tasche meiner abgeschnittenen Hose und sah sofort den verwachsenen Strauch, in dem sich mein neuer Freund versteckte.
»Ist gerade echt irre hier, Mom. Ich habe dir ja erzählt, dass das Café jetzt noch länger geöffnet hat, also bleibt Becs und mir nicht viel Zeit für eine Pause zwischen dem Andrang vom Mittag und dem vom Abend«, erzählte ich. Ich stand auf und umrundete die Schlange. Ohne Zeit zu verlieren, machte ich einen Satz nach vorn, stieß ihr mein Messer in den Kopf und nagelte sie auf der Erde fest. Dann zog ich das Messer heraus und wischte die Klinge mit einem Desinfektionstuch ab. Ich desinfizierte meine Hände bis zu den Ellbogen mit der kleinen Flasche Desinfektionsmittel, die immer am Reißverschluss meiner Tasche hing, bevor ich mich wieder hinsetzte, um den Rest der Vorrichtung vorzubereiten.
Es gab eine kurze Pause in der Unterhaltung, während meine Eltern ihren uralten elektrischen Dosenöffner anwarfen, was schon für sich wie eine Explosion klang. Wahrscheinlich öffneten sie sich eine Dose Suppe. Meine Eltern waren große Suppenfans. Suppe aus der Dose oder hausgemacht stand immer auf ihrer Speisekarte, was ich dem Umstand zuschrieb, dass sie Europäer waren.
Meine Eltern stammten beide aus einer Kleinstadt in Belgien und waren wegen Dads Job in die Vereinigten Staaten gezogen, als meine Mutter mit mir schwanger war. So wie sie den Ort beschrieben, in dem sie aufgewachsen waren, klang es, als hätte es in der Stadt nur etwa dreizehn Leute in ihrem Alter gegeben. Es war wohl keine arrangierte Ehe, aber ich konnte nur annehmen, dass allein auf Grundlage der Bevölkerung ihre Optionen bestenfalls ein wenig begrenzt waren.
»Wir sind sehr froh, dass du dort eine Freundin gefunden hast«, sagte mein Dad und klang dabei, als riefe er es vom anderen Ende der Küche, was wahrscheinlich der Fall war. Ich hatte ihnen unzählige Male gezeigt, wie sie die Lautsprecherfunktion nutzen konnten, aber das ist eins der Dinge, die ich ihnen jeden Tag zeigen könnte, und trotzdem würden sie das Konzept nicht begreifen. Das iPad, das ich ihnen letztes Jahr geschickt hatte, setzte wahrscheinlich im Regal Staub an, neben Moms Kollektion aus Delfter Blau. Oder vielleicht erschien es ihnen einfach viel sinnvoller, quer durch den Raum zu rufen. »Becs klingt nach einem tollen Mädchen.«
Becs klang tatsächlich nach einem tollen Mädchen. Zu schade, dass sie nicht existierte.
Als ich die Stadt verließ, wollte ich meinen Eltern damit nicht noch mehr Schmerz bereiten, als ich ohnehin schon hatte. Also tat ich das Undenkbare. Ich blieb in Verbindung. Ich sagte ihnen, dass ich immer in ihrem Leben bleiben würde, so lange sie nicht versuchten, mich zu finden und nach Hause zurückzuschleppen. Smoke fand die Idee albern, aber es ist ja nicht so, als wären wir überhaupt je eine normale Familie gewesen.
»Wir wissen ja, dass du viel zu tun hast«, meinte Mom und klapperte mit Tellern. »Dein Vater und ich wollten dir nur sagen, wie stolz wir auf dich sind. Nachdem du weggegangen warst, dachten wir, ich meine, dein Vater und ich waren so voller Sorge. Und jetzt sieh dich nur an, wie sehr du versuchst …« Meine Mom zögerte, aber ich wusste, was es war, das sie nicht zu sagen versuchte. NORMAL ZU SEIN.
Ich war nur froh, dass sie jedes bisschen falsche Normalität schluckten, das ich ihnen gab. Egal wie unsere Beziehung war, egal welche Lügen dazugehörten, es musste so sein. Und das Wichtigste war, dass es funktionierte. Meine Mutter fuhr fort: »Auch wenn wir dich vermissen, und auch wenn du so plötzlich gegangen bist, sind wir einfach nur froh, dass du so gut klarkommst.«
Ich seufzte und holte mein Fernglas heraus. Ich spähte durch die Linsen, stellte den Fokus und dann Nachtsicht ein. Ich zoomte auf die Hintertür und sah zu, wie die letzten Nachtschichtarbeiter das Gebäude verließen. Nach Anweisung des Klienten musste es leer sein, bevor ich weitermachen durfte. Ich zählte, als die Männer und Frauen in Overalls zu ihren Autos gingen. Eins, zwei, drei, vier. Vier, das waren alle. Ich setzte das Fernglas ab und prüfte die Zeit auf meiner Uhr. Dann klemmte ich das Handy zwischen Schulter und Kinn, als ich die Drähte in ein kleines Metalldreieck schob und oben zusammendrehte.
»Danke, Leute. Manchmal ist es schwer. Und ich weiß, dass ihr nicht so begeistert davon wart, dass ich so weit weg und ganz allein bin, aber ich weiß, dass es gut für mich ist. Ich habe das Gefühl, dass es mir hier besser geht«, sagte ich und wiederholte damit eine andere Version derselben hohlen Lügen, die ich ihnen jeden Tag erzählte, mit so viel Emotion, wie ich aufbringen konnte. »Eine neue Stadt erforschen, ein neues Land, das war die richtige Entscheidung für mich. Ich liebe es hier.« Der letzte Teil war gar nicht so sehr eine Lüge, obwohl hier für tausend verschiedene Orte stand, abhängig vom Job. An diesem speziellen Tag war ich weniger als einhundert Meilen von Lilly Heights entfernt, wo meine Eltern wahrscheinlich gerade ihre Fernsehtabletts an die Couch schoben, damit sie ihre Suppe essen und dabei Jeopardy gucken konnten.
»Hast du etwas von Cody gehört?«, fragte meine Mutter und fuhr fort, ohne auf meine Antwort zu warten. »Seine Mutter sagt, er macht sich toll auf der Brown, und dass er eine Freundin hat. Sie sagt, es sei ziemlich ernst, und dass sie nach dem Ende des nächsten Semesters in eine gemeinsame Wohnung ziehen wollen. Es ist schade, dass ihr beide euch nicht mehr nahesteht.«
Na ja, Moe, was wirklich passiert ist, war, dass ich meinen besten Freund mitten in der Nacht stehen lassen habe, nachdem wir Sex hatten, und hinten auf ein Motorrad gestiegen bin, gefahren von einem Biker mit Namen Smoke, der so etwas wie mein Mentor war.
Ich wartete auf das Gefühl. Auf dieses Ding tief im Bauch, von dem die Leute behaupten, dass es passiert, wenn sie eifersüchtig werden oder sich über das Glück anderer Menschen ärgern.
Nichts.
»Er verdient es, glücklich zu sein«, sagte ich, was gleichzeitig alles und gar nichts sagte. Sosehr ich meine Freiheit brauchte, sosehr verdiente Cody es, glücklich zu sein. Zum Glück bohrte meine Mutter nicht weiter.
»WAS IST MIT JUNGS DA DRÜBEN?«, rief Dad. »Jemanden im Auge?«
Meine Mutter mischte sich sofort ein. »Oder, weißt du, es würde uns auch nicht stören, wenn du ein Mädchen mitbringst. Liebe bleibt Liebe, wie es so schön heißt«, trällerte meine Mom, und es klang ziemlich einstudiert.
»Ich bin nicht lesbisch, Moeder«, erklärte ich rundheraus, obwohl ich mir manchmal dachte, es wäre besser gewesen, wenn ich es wäre. Eine Anziehung zu irgendwem wäre so viel einfacher als Erklärungsversuche oder lügen müssen, weil man sich zu absolut niemandem hingezogen fühlte.
»Nein, nein, natürlich nicht. Siehst du, Thomas? Habe ich dir doch gesagt, dass sie nicht lesbisch ist«, sagte Mom zu Dad, als sei das allein seine Idee gewesen. Ich wusste es besser. »Obwohl es trotzdem okay ist, wenn du es doch bist. Ich meine … wärst.«
Ich richtete meinen Pferdeschwanz, zog das Gummiband fester und streifte die langen blonden Strähnen ab, die immer an meinen Fingern hängen blieben und an allem anderen, womit mein Haar auch nur kurz in Berührung kam. »Ich hatte nur bisher keine Zeit, jemanden zu treffen, und ihr wisst ja, dass ich weggegangen bin, um mich selbst zu finden, nicht jemand anderen. Ich bin noch jung und habe es nicht eilig«, sagte ich und dachte dabei an die Werbetafel für eine Kreuzfahrt, von der ich den Spruch hatte.
Ich konnte ihre Erleichterung fast durch die Leitung hindurch hören, nicht weil ich nicht homosexuell war, denn das würde meine Eltern tatsächlich nicht stören, wie sie mir unzählige Male gesagt hatten. Nein, ihre Erleichterung kam daher, dass ich mein Leben lebte, und weil ich wusste, dass sie, in dem, was ich sagte oder tat, immer nach Spuren des kleinen Mädchens horchten. Des Mädchens mit dem Wutproblem und der morbiden Neugier. Das, das nachts seine Schranktüren offen ließ und hoffte, dass die Monster herauskamen und es mit sich nach Hause nahmen. Das, das noch nicht die Kunst der Lüge erlernt hatte.
Oder die Kunst des Tötens.
Ich denke, die Hälfte der Zeit schluckten sie den Mist, den ich ihnen erzählte, nicht zwingend, weil sie mir glaubten, sondern weil es einfach leichter war.
Immer wenn ich mit meinen Eltern redete, was täglich der Fall war, bewies mir das nur, dass Wegzugehen die beste Entscheidung für uns alle war. In ihren Stimmen lag kein Schmerz mehr. Ihre früheren Sorgen über meinen geistigen Zustand hatten sich reduziert auf die Sorge, die alle Eltern hatten, wenn sie von ihrem Kind getrennt waren. Diese Form von Sorge gefiel mir besser als die Art, bei der sie ständig die Fragen stellten. Wird sie jemanden verletzen? Wird sie sich selbst verletzen? Wieso fühlt sie nicht, wie andere Menschen fühlen?