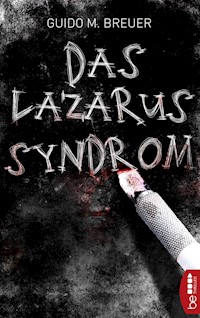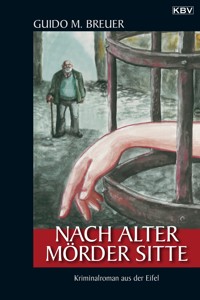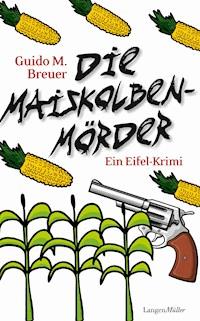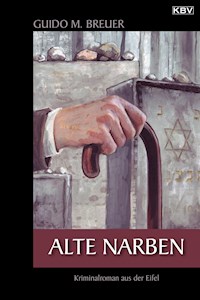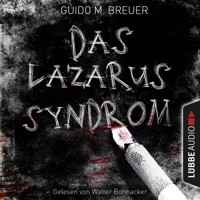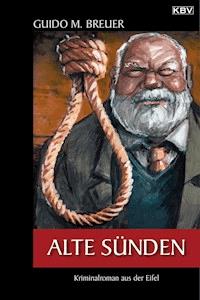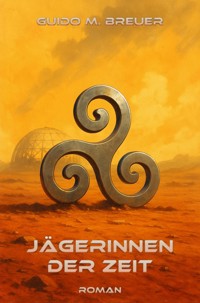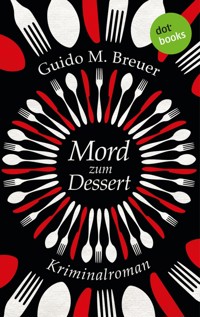Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: KBV
- Kategorie: Krimi
- Serie: Opa Bertold
- Sprache: Deutsch
Im Hürtgenwald in der Nordeifel ist der Boden mit Blut getränkt. In der Mitte des vergangenen Jahrhunderts tobte hier eine der verlustreichsten Schlachten des Zweiten Weltkriegs. Hier lebt Opa Bertold in der beschaulichen "Seniorenresidenz Burgblick" und denkt an sein ereignisreiches Leben zurück. Sein komfortabler Ruhesitz, das schöne Nideggen und die wunderbare Natur der Nordeifel gefallen ihm zwar, aber trotzdem langweilt ihn das beschauliche Pensionärsdasein. Da kommt es ihm gerade recht, dass amerikanische Kriegsveteranen nach Nideggen kommen, die ein dunkles Geheimnis aus den Tagen des zweiten Weltkrieges und den verheerenden Kriegsereignissen im Hürtgenwald mit einigen Bewohnern der Seniorenresidenz verbindet. Als der erste Mord geschieht, ist Opa Bertold klar, dass sein kriminalistischer Spürsinn gefragt ist, sehr zum Leidwesen seiner Enkeltochter Rita, der Kriminalkommissarin aus Köln. Opa Bertold findet in der Seniorenresidenz tapfere Mitstreiter: Die lebensfrohe Künstlerin Bärbel Müllenmeister und der geheimnisvolle Gustav Brenner. Dazu gesellt sich der junge Pfleger Benny, der die agilen Senioren tatkräftig unterstützt. Mehrere Menschen müssen sterben, bevor Opa Bertold und seine Freunde das Geheimnis um die alten Kameraden und die Hölle im Hürtgenwald aufklären können.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 226
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Guido M. Breuer
All die alten Kameraden
Vom Autor bisher bei KBV erschienen:
All die alten Kameraden
Altes Eisen
Alte Narben
Guido M. Breuer wurde 1967 in Düren geboren. Er wuchs in Düren und in der Nordeifel auf. Nach einer Ausbildung zum Bankkaufmann und anschließendem Wirtschaftsstudium arbeitete er als selbstständiger Unternehmensberater und lebt heute als Autor in Bonn. Seine Tatorte finden sich vornehmlich in seiner Nordeifeler Heimat, den Tälern und Höhen von Nideggen bis Monschau. Dort ermittelt auch sein Lieblings-Protagonist Opa Bertold, der sich erstmals im Frühjahr 2009 mit »All die alten Kameraden« in das kriminalistische Geschehen der rauen Eifel einschaltete und 2012 bereits seinen vierten Fall zu lösen hat.
Guido M. Breuer
All die altenKameraden
1. Auflage 2009
2. Auflage 2010
3. Auflage 2012
© KBV Verlags- und Mediengesellschaft mbH, Hillesheim
www.kbv-verlag.de
E-Mail: [email protected]
Telefon: 0 65 93 - 998 96-0
Fax: 0 65 93 - 998 96-20
Umschlagillustration: Ralf Kramp
Redaktion: Nicola Härms, Rheinbach
Satz: Volker Maria Neumann, Köln
Print-ISBN 978-3-940077-51-6
E-Book-ISBN 978-3-95441-014-9
»Es ist die reine, unverdünnte Hölle.Ihr habt nichts darüber gehört,denn sie haben Angst,darüber zu sprechen.«
Paul Boesch, Forest in Hell, Houston/Texas, 1985
1. Kapitel
Bitte, Herr Bertold, stellen Sie sich doch nicht so an!« Die Ärztin lächelte etwas hilflos.
Der graubärtige Mann blickte auf seine heruntergelassene Hose, dann auf die Ärztin und entgegnete freundlich:
»Junge Frau, bitte unterstellen Sie mir nicht, ich würde mich anstellen, nur weil ich mich nicht auf der Stelle so hinstelle, wie Sie es sich vorstellen.«
»Aber Herr Bertold«, versuchte sie es wieder und wedelte mit der Spritze, die sie in ihrer Rechten hielt und die offenbar darauf wartete, in das halb entblößte Gesäß des Mannes versenkt zu werden.
»Sie müssen sich nur an den Tisch lehnen und ein Bein etwas entlasten, sonst kann ich den Impfstoff nicht injizieren.«
Lorenz Bertold schüttelte langsam, aber bestimmt den Kopf. »Früher bekam man die Spritzen in den Oberarm, und dann war gut. Jetzt muss es der Hintern sein, und die Stellung wird auch vorgeschrieben!«
»Wollen Sie nun geimpft werden oder nicht, Herr Bertold?«
»Sie wissen doch, dass ich das ohnehin nicht will. Und bestimmt nicht rückwärtig in dieser Haltung!«
Die Ärztin seufzte. »Ich glaube, es ist besser, ich rufe Ihren Pfleger.«
»Tun Sie das, der ist ein netter Kerl, passt zu Ihnen«, knurrte der Alte und versuchte ein Grinsen.
Die Frau seufzte nochmals und verließ den Raum. Als sie die Tür hinter sich geschlossen hatte, grummelte Lorenz vor sich hin: »Kommissar Wollbrand war in einer misslichen Lage. Wenn die schöne Agentin zurückkehren und das Natriumpentothal in seinen Hintern jagen würde, wäre er ihr hilflos ausgeliefert. Nicht auszudenken, was sie ihm entlocken könnte, wenn sein starker Geist, und wer weiß, vielleicht sogar auch sein Hintern nicht mehr seiner Kontrolle unterliegen würden.«
Die Tür öffnete sich wieder, und die Ärztin kehrte in Begleitung eines jungen Mannes zurück.
»Hi, Opa Bertold«, grüßte dieser. »Ist Kommissar Wollbrand mal wieder in Lebensgefahr?«
Lorenz blickte den jungen Mann tadelnd an, um ihm zu zeigen, dass er die Erwähnung des Kommissars überhaupt nicht schätzte. Dann antwortete er freundlich: »Benny, du musst mir helfen. Diese Mörderin in Weiß« – er zeigte mit dem Kinn auf die abwartend in der Tür stehende Ärztin – »will mich rückwärtig intramuskulär vergewaltigen. Können wir das zulassen?«
Benny Bethge lachte lauthals los. »Klar können wir das, Opa!«, rief er aus. »Das hat sie mit mir letzte Woche auch schon gemacht!«
Lorenz runzelte die Stirn. »Das sagst du mir doch jetzt nicht nur so?«
Der junge Mann grinste wölfisch. »Nee, wirklich. Das war echt eine Erfahrung. Und ich konnte danach immer noch gehen.«
Lorenz grunzte. »Dein Hintern ist auch ein bisschen jünger als der meinige.«
»Ausreden, nichts als Ausreden«, versetzte Benny. »Da wird doch nicht etwa eine Spur Angst vor dem kleinen Piekser dabei sein?«
»Jetzt reicht’s mir aber«, brummte Lorenz. Er zog die Hose wieder etwas herab, lehnte sich an den Tisch, versuchte wie von der Ärztin empfohlen ein Bein locker zu lassen und meinte: »Los Mädchen, rein damit, damit ich zum Kaffee nicht zu spät komme!«
Das ließ sich die Ärztin nicht zweimal sagen. Sie trat rasch näher, desinfizierte Lorenz Bertolds Gesäß und verabreichte ihm die Injektion. Bertold zuckte kurz, murmelte leise etwas vor sich hin, was niemand verstehen konnte (aber Benny Bethge wusste, dass Kommissar Wollbrand gemeint war), und zog dann eilig seine Hose wieder an.
Die Ärztin lächelte erleichtert: »Na, das ging doch wunderbar.«
Der Alte grinste schief zurück. »Na, mal sehen, ob ich jetzt auch noch wunderbar gehen kann!«
Benny lachte. »Hauptsache geimpft. Wofür oder besser gefragt wogegen war das jetzt eigentlich?«
»Hey, ich dachte, du hättest diese Impfung auch vor Kurzem bekommen?«, schimpfte Lorenz.
Benny lachte weiter und bugsierte den alten Mann aus dem Zimmer. »Ups, da hab ich mich doch jetzt mal wieder verplappert!«
»Ich wusste, dass du ein Schlingel bist«, grinste Lorenz, als die beiden auf dem Gang waren. »So was wie dich sollte man nicht als Pfleger beschäftigen.«
»Wozu bin ich denn sonst zu gebrauchen?«
»Na, da wird sich bestimmt schon noch was finden«, orakelte Lorenz. »Jetzt geh ich aber wirklich erst mal einen Kaffee trinken.«
»Ich muss noch ins Schwimmbad«, meinte Benny. »Wenn’s recht ist, sehen wir uns später am Nachmittag noch mal.«
»Das ist recht«, meinte Lorenz und blickte dem davoneilenden Bethge nach, bis dieser um die nächste Biegung des Ganges verschwunden war. Er nahm sich vor, Benny nachher unbedingt einzuschärfen, dass er Kommissar Wollbrand im Beisein anderer nicht zu erwähnen hatte. Dann machte er sich auf den Weg in den Garten, wo täglich ab fünfzehn Uhr Kaffee serviert wurde.
Seine rechte Gesäßhälfte schien ein wenig zu ziepen, darum ging er sehr langsam. Anderenfalls wären ihm die leisen Stimmen, die aus einem Zimmer drangen, wohl gar nicht aufgefallen. Die Zimmertür war geschlossen, doch ließ der Klang der Stimmen Lorenz Bertold innehalten und genauer horchen. Er murmelte vor sich hin: »Wollbrands Ohren waren vielleicht schon alt, jedoch immer noch sehr scharf. Dieses Gespräch hinter geschlossener Tür drehte sich sicher nicht um Alltäglichkeiten, erst recht nicht, wenn es in einem Zimmer in der beschaulichen Seniorenresidenz Burgblick stattfand.«
Und so war es auch. Bei genauerem Hinhören bekam Lorenz Seltsames zu hören. Eine kalte und schneidende Stimme, die ihm bekannt vorkam, sagte: »So so, kommen die Amis also endlich.«
Eine andere Stimme antwortete: »Ja, endlich. Ich bin das lange Warten und Suchen wirklich leid.«
»Wer wird dabei sein?«
»Das ist leider nicht zu erfahren. Wir können nur hoffen, dass jemand dabei ist, der Bescheid weiß. Müsste mit dem Teufel zugehen, wenn nicht.«
»Ich brauche Namen, verdammt!« Die schneidende Stimme wurde noch schärfer. »Besorg mir die Namen. Ich will vorher wissen, mit wem ich es zu tun habe. Ende der Diskussion!«
Lorenz Bertold hörte Schritte, die sich der Tür näherten, und wandte sich schnell ab. Er war erst zwei, drei Schritte den Flur hinuntergegangen, als die Tür geöffnet wurde. Lorenz konnte nicht anders, er musste sich umdrehen und nach den Männern schauen, die gerade aus dem Zimmer traten. Ein Mann, etwa im selben Alter wie Lorenz, ging voran. Lorenz kannte den Mann, er war ein Mitbewohner des Hauses. Hinter ihm wurde ein offensichtlich sehr alter Mann im Rollstuhl aus dem Zimmer gefahren. Auch diesen kannte Lorenz, es war ebenfalls ein Mitbewohner, der ihn soeben mit bösem Blick fixierte. Er wurde von einem dritten, jüngeren Mann, offenbar seinem Sohn, geschoben, der als Letzter auf den Gang trat.
Lorenz war froh, die nächste Biegung erreicht zu haben und dem stechenden Blick des Alten zu entkommen. Leise murmelte er vor sich hin: »Kommissar Wollbrand brauchte nicht lange nachzudenken, um zu erkennen, dass er hier einem konspirativen Treffen mit kriminellem Hintergrund auf die Schliche gekommen war.«
Lorenz kratzte sich den Kopf, versuchte, sich auf das eben Gehörte einen Reim zu machen, und kam zu dem Schluss, dass ihm dies im Garten bei einer guten Tasse Kaffee viel besser gelingen würde.
2. Kapitel
Die Frau räkelte sich wohlig. Ohne die Augen zu öffnen, rollte sie sich auf die andere Seite des Bettes. Dort befand sich jedoch nicht das, was sie erwartet hatte. Sie tappte mit beiden Händen suchend umher, öffnete die Augen aber immer noch nicht.
»Paul?«
Keine Antwort.
Nun versuchte sie es mit heftigem Strampeln. Damit erreichte sie zwar nicht die erwünschte Reaktion, allerdings wurde sie etwas wacher. »Paul, wo bist du?«, rief sie jetzt lauter und vergrößerte den Suchradius ihrer Hände. Sie bekam ihre Walther P99 zu fassen, die auf dem Nachttisch im Schulterholster lag.
»Hey, komm sofort her oder ich erschieß dich, du Schuft.«
»Rita, du hast doch heute Morgen schon jemanden abgeknallt«, sagte der Mann, offenbar Paul, der eben das Schlafzimmer betrat, mit nichts bekleidet außer zwei dampfenden Kaffeetassen. Er war so groß, dass er unter dem Türrahmen den Kopf senken musste.
»Das war nur ein Streifschuss«, grinste die Frau und öffnete jetzt ihre Augen. Allerdings sah sie nun immer noch fast nichts, weil ihr ihr langes blondes Haar in wirren Strähnen ins Gesicht hing. »Außerdem war es kurz nach Mitternacht, das zählt noch gar nicht für heute.«
»Hier, nimm lieber eine Tasse und lass die Knarre stecken.«
Paul setzte sich auf die Bettkante, reichte Rita ihren Kaffee und nutzte dann die frei gewordene Hand, um ihre Pistole auf den Nachttisch zurückzulegen. Sie ließ sich ohne Gegenwehr entwaffnen und nahm einen Schluck.
»Ah, das tut gut. Aber ich hätte dich auch erschießen können.«
Paul grinste. »Wie denn? Entladen und Schlagbolzen entspannt?«
»Woher willst du das wissen?«
»Weil du deine Dienstwaffe immer vorschriftsmäßig ablegst, besonders nachdem du sie benutzt hast, mein Schatz.«
Rita stellte die Tasse ab und lehnte sich zurück. »Das war vielleicht eine dumme Geschichte heute Nacht.«
»Ist es gefährlich geworden?«
»Nicht wirklich.« Rita nahm noch einen Schluck Kaffee.
»Beim Zugriff kam uns ein scharfer Hund dazwischen. Ich schoss auf ihn, aber der Typ wollte seinen Hund schützen, da hab ich ihn am Bein erwischt, stell dir vor!«
»Ein Tierliebhaber also. Und was machte der Hund?«
»Einen letzten Kläffer, bevor Kollege Schmitz ihn erlegte.«
»Dann muss Frau Schmitz ihrem Mann heute Morgen die Tränchen trocknen, während dein Gewissen unbelastet ist.«
»Na klasse«, murmelte Rita und schloss erneut die Augen. »Dafür hatte ich den ganzen Protokollkram, weil ich einen Tropfen Zuhälterblut vergossen habe. Und jetzt bin ich müde, während der Hundemörder sicher schon ausgeschlafen ein Frühstücksei köpft.«
»Du meinst sicher, dass er gerade den Schweinebraten anschneidet«, versetzte Paul.
»Wieso?«
»Weil es kurz nach zwölf ist, meine süße Nachteule.«
»Ach scheiße«, entfuhr es Rita. »Ich wollte doch mit Opa zu Mittag essen.«
»Dann besuchen wir ihn eben zu Kaffee und Kuchen.«
»Du kommst mit?«
»Klar. Ich muss doch deinen kriminalistischen Opa endlich kennenlernen.«
»Ach Paul, sag so was ja nicht in seiner Nähe. Da reagiert er manchmal ganz komisch drauf.«
»Keine Angst. Ich halte mich brav zurück. Magst du etwas essen?«
Rita streckte lustlos die Zunge heraus. »Nee, Kaffee reicht.«
»Aber ich«, meinte Paul. Er stand auf und verließ kurz das Schlafzimmer, um nur wenig später immer noch nackt, aber dafür mit einem großen Tablett voller Rührei und Toast zurückzukehren.
»Es könnte schon etwas abgekühlt sein, aber da du ja eh nix essen willst ...«, grinste er und begann, das Rührei in den Mund zu löffeln.
»Hey, nicht so eilig«, rief Rita. Dann setzte sie sich schnell aufrecht, nahm eine Gabel vom Tablett und beeilte sich, auch eine tüchtige Portion abzubekommen. »Ist doch noch warm«, meinte sie kauend. Und sie fügte hinzu: »Und wann bekomme ich heute endlich meinen ersten Kuss?«
»Hm«, meinte Paul. »Ich wollte zuerst essen, denn wenn ich dich jetzt küsse, wird bestimmt alles kalt.«
»Darauf lass ich’s ankommen«, erwiderte Rita und schob das Tablett beiseite.
Zwei Stunden später saßen Rita und Paul im Auto. Der Weg führte sie aus der Kölner Innenstadt über die Autobahn 4 nach Düren. Dort folgten sie den Hinweisschildern in Richtung Nideggen. Bald wurde es grün beidseits der Straße. Rita, die die Gegend gut kannte, lenkte den Wagen auf einen Parkplatz, der vor einem mittelalterlichen Stadttor dazu einlud, den Ort zu Fuß zu betreten. Die beiden verließen den Wagen und durchschritten das aus mächtigen roten Sandstein quadern erbaute Tor. Paul grummelte: »Hat dieses Alten heim keine Zufahrt? Da muss man doch auch mit dem Auto hinkommen können.«
Rita lachte. »Das habe ich mir gedacht, mein Lieber. Sport in allen Variationen ist das eine, aber wehe, der Herr Kommissar fährt irgendwo nicht direkt mit dem Wagen vor.«
»Sport ist auch was anderes«, maulte Paul. »Jetzt wollen wir halt wohin.«
»Und wir gehen jetzt fünf Minuten durch dieses wunderschöne Städtchen, und der große Paul hört sofort auf zu jammern, sonst gibt’s gleich kein Eis!«
»Hm«, machte Paul, da er soeben bereits die erste Eisdiele in der schmalen Gasse entdeckt hatte. Doch allzu lange waren sie noch nicht auf dem kopfsteingepflasterten Weg gegangen, als sie an ein großes, gusseisernes Eingangsportal gelangten, an dem in kupfernen Lettern Seniorenresidenz Burgblick zu lesen war. Sie durchschritten das offene Tor. Vor ihnen erstreckte sich eine großzügige Grünanlage mit einem akkurat gemähten Rasen, Blumenbeeten, vereinzelten Büschen und mehreren zierlichen Holzbänken. »Das sieht ja aus wie ein Stadtpark«, meinte Paul. »Ja«, antwortete Rita. »Nur dass hier die ganze Stadt beinahe so etwas wie ein einziger Park ist.«
Rechter Hand wurde die Grünanlage begrenzt von einem lang gestreckten Gebäude mit einem unschwer als Eingangsbereich erkennbaren Glasvorbau. Rita und Paul traten dort ein.
Sie gelangten an eine Rezeption, an der sie eine alte Dame aus einem tief zerfurchten Gesicht freundlich anlächelte. »Einen schönen Sonntag, Frau Bertold«, sagte sie und strich sich mit dem Kuli eine Strähne ihres silberweißen Haares aus der Stirn. »Sie möchten bestimmt Ihren Großvater besuchen.«
»Aber ja«, antwortete Rita. »Wo kann ich ihn am besten finden?«
»Um diese Zeit wird er vermutlich auf seinem Zimmer sein. Soll ich ihn anrufen?«
»Nein, nicht nötig, vielen Dank. Wir schauen einfach bei ihm vorbei.«
»Tun Sie das. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt bei uns.«
»Vielen Dank«, antwortete Rita und zog Paul mit sich fort. Der grinste kurz in Richtung der Empfangsdame und flüsterte Rita nach ein paar Schritten zu: »Die müssen hier was falsch verstanden haben. Es heißt Rente ab siebenundsechzig und nicht ab siebenundneunzig. Die Frau war doch steinalt!«
»Frau Melzer ist neunundachtzig«, sagte eine hochgewachsene Frau, die von der Seite zu den beiden stieß und Pauls letzte Äußerung offensichtlich vernommen hatte. Sie reichte Paul die Hand und stellte sich vor: »Entschuldigen Sie mein gutes Gehör, ich bin Sybille Klinkenberg.«
Paul ergriff die ausgestreckte Hand und antwortete: »Paul Gedeck, freut mich.«
Auch Rita wandte sich der Frau zu. Es war eher selten, dass sie mit ihren einsfünfundachtzig Körperlänge einer Frau auf gleicher Höhe gerade in die Augen blicken konnte. Bei Sybille Klinkenberg war dies der Fall. »Hallo, Frau Klinkenberg«, sagte sie, und, zu Paul gewandt, ergänzte sie: »Sie leitet das Haus.«
Sybille Klinkenberg lächelte. »Um kurz Ihre Frage zu beantworten, Herr Gedeck: Unsere Senioren übernehmen auf freiwilliger und ehrenamtlicher Basis viele Tätigkeiten hier im Hause. Das senkt die Kosten nicht unerheblich und trägt immens dazu bei, bis ins höchste Alter aktiv zu bleiben. Zudem stärkt es die Gemeinschaft.«
»Ah«, antwortete Paul, der zu diesem Thema auf die Schnelle nichts Sinnvolles zu sagen hatte.
Sybille Klinkenberg dagegen schien bei ihrem Lieblingsthema angelangt zu sein, denn sie fuhr rasch fort: »Selbst die Gebrechlichsten und auch die Demenzkranken unter unseren Senioren möchten noch als vollwertige Mitglieder unserer Gemeinschaft wahr- und ernst genommen werden, und wir geben ihnen die Gelegenheit dazu! Jeder trägt im Rahmen seiner Möglichkeiten zum Gelingen der Gesellschaft bei, nicht wahr? Tun wir das nicht alle?«
»Mehr oder weniger«, entfuhr es Paul, der spontan an die eher schwach ausgeprägten sozialen Instinkte seiner Klientel dachte.
Rita ergänzte schnell: »Sie müssen entschuldigen, Frau Klinkenberg, wir sind beide in der Verbrechensbekämpfung tätig. Da kann sich schon einmal ein anderes Menschenbild einstellen.« Die Heimleiterin lächelte nachsichtig. »Ich verstehe«, sagte sie. »Aber mal etwas anderes. Sie möchten bestimmt Ihren Großvater besuchen. Haben Sie vielleicht vorher fünf Minuten Zeit für mich?«
»Gerne«, antwortete Rita. »Worum geht’s?«
Sybille Klinkenberg lud die beiden mit einer Handbewegung zum Weitergehen ein und begann: »Ihr Großvater erhält ja nie Besuch von anderen Freunden oder Verwandten als von Ihnen. Deshalb spreche ich Sie an.« Sie machte eine kleine Pause, ohne allerdings eine Entgegnung zu erwarten, die dann auch nicht kam. »Herr Bertold ist jetzt vier Monate bei uns. Er ist ein liebenswerter Mensch, der niemandem etwas Böses will. Allerdings – er hat doch gewisse Anpassungsschwierigkeiten.«
»So?«, fragte Rita, um zwischendurch irgendetwas zu sagen.
»Ihr Großvater erkennt offenbar den Sinn einiger Punkte unserer Hausordnung nicht. Die wenigen Anordnungen, die das Personal erteilt, befolgt er in der Regel eher nicht. Zudem ...«, sie machte eine Pause, um die Wichtigkeit des nun Folgenden zu unterstreichen, »... entfernt er sich sogar zu Unzeiten und ohne eine Nachricht zu hinterlassen aus dem Haus und kehrt nach Belieben erst nach vielen Stunden zurück.«
Rita blickte irritiert. »Sie meinen, er geht einfach hinaus und kommt irgendwann wieder, wie es ihm gefällt?«
»Genau«, antwortete Sybille Klinkenberg.
»Ja, darf er das denn nicht?«, fragte Rita weiter.
Die Heimleiterin lächelte. »Oh, natürlich darf er das Haus verlassen. Ich habe mich missverständlich ausgedrückt. Was ich damit sagen wollte: Er ist manchmal den ganzen Tag unterwegs, ohne eine Information zu hinterlassen, erscheint dann nicht zu vereinbarten Terminen und ähnliches. Verstehen Sie, es dient dem Wohl unserer Senioren und dem reibungslosen Ablauf in unserem Hause, dass wir wissen, wie lange die alten Herrschaften wo bleiben möchten. Verstehen Sie?«
»So ungefähr«, antwortete Rita. »Ich kann mir vorstellen, dass dies dem Opa Bertold nicht passt.«
»Ja«, seufzte Sybille Klinkenberg erleichtert. »Ich wusste, Sie verstehen, was ich meine. Glauben Sie, dass Sie vielleicht in dieser Hinsicht auf Ihren Großvater einwirken können? Er ist doch so ein lieber Mensch, und auf Sie hört er bestimmt.«
»Ich kann es versuchen«, meinte Rita. Mittlerweile hatten sie das Ende des Gangs erreicht. Eine Glastür führte in ein angeschlossenes Wohngebäude. Sybille Klinkenberg reichte erst Rita, dann Paul die Hand und sagte: »Ich danke Ihnen für das Gespräch. Einen schönen Aufenthalt in unserem Hause wünsche ich. Und liebe Grüße an Ihren Großvater.«
»Vielen Dank, Frau Klinkenberg«, antwortete Rita und lächelte der Heimleiterin freundlich hinterher, als diese sich bereits umdrehte und strammen Schrittes den Gang wieder hinablief. Als sie die Tür durchschritten und hinter sich geschlossen hatten, meinte Paul: »Ach du Scheiße!«, und beide lachten.
»Ich wusste gar nicht, dass du eine solche Engelsgeduld haben kannst, mein Schatz.«
»Mein Opa muss hier leben und mit den Leuten auskommen, ich nicht«, antwortete Rita und hielt an einer Tür an. Sie klopfte energisch und horchte. Sie wartete einige Sekunden, dann holte sie aus, um erneut anzuklopfen. Ein lauter Ruf aus dem Zimmer hielt sie davon ab. »Wagen Sie es nicht, nochmals anzuklopfen!«
Die Tür wurde mit einem Ruck vollständig geöffnet. »Ach, du bist es«, sagte Lorenz Bertold und trat einen Schritt zurück. »Wenn du noch einmal angeklopft hättest, wäre dies ein Zeichen gewesen, dass du mir zutraust, das erste Mal überhört zu haben.«
»Ach Opa«, sagte Rita und trat ein.
»Du hast einen ziemlich großen Kerl mitgebracht«, sagte der Alte während der Umarmung seiner Enkeltochter.
»Paul Gedeck, sehr erfreut, Sie kennenzulernen, Herr Bertold«, sagte Paul und trat ins Zimmer. Lorenz Bertold ließ Rita los und reichte Paul die Hand. »Ebenso, Herr Kommissar. Habe schon so einiges von Ihnen gehört. Wurde Zeit, dass Sie sich vorstellen.«
»Opa«, grinste Rita.
»Nein nein, ist schon recht«, antwortete Paul. »Ich habe auch schon viel von Ihnen gehört und bin froh, dass Rita sich heute endlich getraut hat, mich mitzubringen.«
»Und da seid ihr also nun«, sagte Lorenz. »Kommt erst mal richtig rein.«
Paul und Rita gingen einige Schritte weiter in das helle und geräumige Zimmer hinein. Geradeaus sah man durch ein Fenster, welches sich über die gesamte Zimmerfront erstreckte und hinter dem sich ein Balkon befand. An der linken Wand standen ein langes Bücherregal und ein sehr aufgeräumter Schreibtisch mit einem Computer. Die rechte Wand war bis auf ein Bild leer. Dort befand sich eine Tür, die zu weiteren Zimmern führte. Paul schritt durch den Raum bis hin zu dem Balkonfenster. Von hier aus blickte er in ein dicht bewaldetes und tief eingeschnittenes Tal. Zwischen den Bäumen standen vereinzelt Türme aus dunkelrotem Sandstein.
»Schöner Ausblick«, kommentierte Paul.
»Ja, durchaus.«
»Wir wollten ja eigentlich zum Mittag schon hier sein. Ich hab aber verschlafen«, sagte Rita.
»Nachtschicht?«, fragte Lorenz.
»Ja, leider.«
Paul schaltete sich ein: »Schnickschnack, Herr Bertold. Glauben Sie ihr kein Wort. Es hat ihr Spaß gemacht heute Nacht. Sie hat einen bösen Buben niedergeschossen. Nichts tut sie lieber.«
»Ist das wahr?« Lorenz Bertolds Augen begannen zu funkeln. »Davon musst du mir erzählen.«
»Ach Opa«, seufzte Rita. »Das ist doch nur Arbeit.«
»Pah, nur Arbeit«, versetzte Lorenz. »Ich wünschte, ich könnte nur diese Arbeit machen. Hier ist nix passiert letzte Nacht. Oder doch – gegen drei Uhr bin ich wach geworden und habe Pipi gemacht. Danach nicht mehr geschlafen. Ist doch auch was, oder?«
»Pipi gemacht hab ich auch«, meinte Paul grinsend. Rita warf ihm einen missbilligenden Blick zu. Dann sagte sie zu ihrem Großvater: »Opa, ich mag meine Arbeit und will keine andere, aber irgendwann werde ich auch in Pension gehen und andere machen lassen.«
»Wenn du hier sitzen würdest, dächtest du anders darüber.«
»Das kann ich nicht beurteilen, aber ich hoffe es nicht«, meinte Rita. Dann lächelte sie und fragte munter: »Was habe ich denn heute Mittag verpasst?«
Lorenz kratzte seinen hellgrauen Bürstenschnitt. »Da gab es irgendein Tier in Soße zu essen, es war vermutlich aber nicht das Kaninchen, welches heute nach dem Frühstück aus dem Garten entwich. Ach ja – Frau Klinkenberg maßregelte mich wegen meines Verhaltens. Ich habe vergessen, welche Aspekte sie diesmal im Speziellen meinte.«
»Frau Klinkenberg hat mich eben auch angesprochen.«
»Die alte Petze.«
»Ach Opa. Die Frau ist vielleicht etwas seltsam, aber ich glaube, sie will auch nur, dass du dich hier endlich einlebst.«
»Na ja.« Lorenz grinste. »Vielleicht bin ich einer kriminellen Machenschaft auf der Spur. Mit ein bisschen Glück kann man hier doch was erleben.«
»Opa, das will ich eigentlich nicht hören«, antwortete Rita. »Hatten wir nicht beschlossen, dass kriminelle Machenschaften nicht dein Metier sein sollten?«
»Nein, mein Engelchen. Du hattest dies beschlossen.«
Rita seufzte wieder. »Okay, lassen wir das.« Sie wechselte das Thema: »Und wann gibt’s Kaffee?«
»Wann immer ihr wollt«, antwortete Lorenz. »Sonntags bekommen die Besucher, die die engsten Verwandten darstellen, kostenlos Kaffee und ein Stück Kuchen. Das nennt man hier übrigens ein Gedeck, Herr Gedeck.«
Paul grinste. »Dann lassen Sie uns zusammenbringen, was zusammengehört.«
»Hast du denn nicht Papa und Mama als deine engsten Verwandten angegeben?«, fragte Rita.
Lorenz schnaubte. »Mein Sohn? Der geht mir auf die Nerven, und umgekehrt wohl auch. Der braucht mir nicht zu kommen – was er übrigens auch nicht tut.«
Rita kannte ihren Opa gut genug, um dieses Thema jetzt nicht zu vertiefen. Paul war schon zur Tür gegangen, Rita folgte ihm. Lorenz suchte noch ein geeignetes Paar Schuhe aus, dann folgte er den beiden. Dabei grummelte er leise: »Kommissar Wollbrand zog es vor, weiterhin den gelangweilten Pensionär zu spielen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt war es nicht sinnvoll, seine unerfahrenen Assistenten einzuweihen.«
3. Kapitel
Ganz behutsam wurde die Tür geschlossen, sodass sie nicht mehr als ein kaum hörbares Klicken von sich gab. Lorenz Bertold schaute sich in dem Gang, in den er getreten war, um. Unauffällige Wandleuchten erzeugten ein dämmeriges Licht, das ihm angesichts der Tatsache, dass es ein Uhr nachts war, unerhört grell erschien. Er betrachtete die diffusen Schatten, die seinen Körper auf dem Fußboden nachäfften und die sich seltsamerweise viel schneller als er selbst flatterhaft hin und her bewegten. Er ging den Flur entlang und würdigte dabei weder die Vielzahl bunter Bilder noch die Namensschilder an den Türen eines Blickes. Vorsichtig setzte er seinen Gehstock auf, um kein Geräusch zu verursachen, das irgendeinen der hinter den Türen Liegenden zum Aufstehen hätte veranlassen können. Er wusste, wenn man die alten Leute beim Nicht-Einschlafen-Können störte, ließen sie sich am Ende gar zur Betätigung eines Signals an den Nachtdienst hinreißen.
Lorenz ließ sich Zeit. Nichts trieb ihn zur Eile. Er wollte dieses Haus mit den vielen Zimmern nur möglichst unentdeckt verlassen, um wieder frei atmen zu können. Vielleicht geschah dabei ja auch etwas, das spannender und erlebnisreicher war als der vergangene Tag.
Der nächste Gang, in den er einbog, war zur rechten Seite hin heller erleuchtet, linker Hand brannten keine Lichter. Zu dieser dunklen Seite hin lenkte er seine Schritte, obwohl der Ausgang in der entgegengesetzten Richtung lag. Allerdings befand sich dort auch die ständig besetzte Rezeption, die er nicht unbemerkt zu passieren hoffen durfte. Leise Geräusche drangen von dort an sein Ohr, die einem Radio oder auch einem Fernsehgerät entstammen mochten. Als er um eine weitere Ecke des Flures bog, umfing ihn angenehme Dunkelheit. Es wurde still.
Er lehnte sich kurz an die Wand, atmete tief durch und murmelte leise vor sich hin: »Kommissar Wollbrand kannte sich in dem Gebäude nicht aus, daher wusste er nicht, wohin er sich wenden sollte, um einen weniger auffälligen Ausgang zu finden.«
Er ging weiter, nahm eine Treppe, die ihn ein Stockwerk tiefer führte, und bog in einen schmaleren Gang ein. Dort befanden sich Türen, die offensichtlich nicht zu bewohnten Zimmern gehörten. Er versuchte sich zu vergegenwärtigen, in welcher Richtung der Garten hinter dem großen Gebäude liegen mochte. Doch alle Türen, die in dieser Richtung lagen, waren verschlossen. Es ließ sich überhaupt nur eine Tür öffnen, die jedoch zu einem ansonsten tür- und fensterlosen Geräteraum gehörte. Der bemerkenswerteste Inhalt dieses Raumes war eine Katze, die ohne sichtbares Anzeichen der Dankbarkeit für ihre Befreiung und ohne einen Laut von sich zu geben an ihm vorbeistrich. Sie streifte wie zu einem kurzen Gruß zumindest flüchtig die Beine des Mannes und schlich dann weiter.
Lorenz grinste in seinen grauen Bart, dann folgte er dem Tier, wobei er flüsterte: »Doch der erfahrene Kommissar wusste dank seines untrüglichen Instinktes wieder einmal, an wen er sich zu halten hatte.«
Die Katze wandte sich bald hier-, bald dorthin. Hin und wieder schien sie an einer Wandstelle, an der ihr Verfolger nichts Auffälliges feststellen konnte, unsichtbare Zeichen zu prüfen. Dann lief sie eine Treppe hinab.
»Nicht so schnell, Mieze, ich bin nicht so ein junger Hüpfer wie du«, murmelte Lorenz, der hier froh über die spärliche Notbeleuchtung an den Treppenstufen war. Die Katze huschte flink die Stufen hinab und pirschte dann weiter, zwängte sich durch den Spalt einer offen stehenden Tür und verschwand im Dunkel. Ihr Verfolger schaffte es gerade, einen letzten Blick auf das zuckende Katzenschwanzende zu erhaschen und so den weiteren Weg des Tieres zu erahnen. So stand er bald vor dem offenen Fenster eines Kellerraumes, durch das er einige flackernde Sterne am Himmel sehen konnte. Durch dieses musste die Katze nach draußen gehuscht sein. Lorenz fand eine Kiste, die er leise ächzend vor das Fenster stellte, um dann wesentlich lauter ächzend auf die Kiste zu steigen und sich durch das Fenster zu zwängen. Dabei machte ihm neben der ungewohnten Hubarbeit am eigenen Körper auch das Mitnehmen seines Gehstocks nicht wenig zu schaffen. Doch selbst von der dadurch verursachten Luftknappheit in seinen Lungen ließ er es sich nicht nehmen, einige Worte hervorzustoßen: »Kommissar Wollbrand war keinen Moment überrascht, so schnell einen Weg nach draußen gefunden zu haben.«