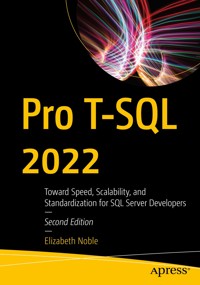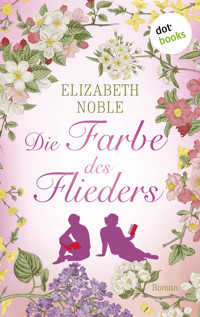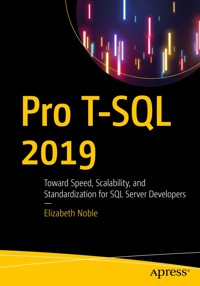4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Reise, die alles verändern wird: Der ergreifende Freundinnen-Roman »All die Sommer zwischen uns« von Elizabeth Noble jetzt als eBook bei dotbooks. In Oxford schließen die Studentinnen Tamsin, Freddie, Reagan und Sarah eine enge Freundschaft, die sie weit über ihre Studienzeit hinaus verbinden wird: Auch Jahrzehnte später halten die so unterschiedlichen Frauen weiter zusammen – doch gleichzeitig hat jede von ihnen mit ihren ganz eigenen Problemen zu kämpfen: Während Reagan zwar beruflich erfolgreich, insgeheim aber entsetzlich einsam ist, hat Tamsin alle Hände voll zu tun mit ihrer immer weiter wachsenden Familie. Freddie steht unterdessen vor den Scherben ihrer Ehe, und muss kurz darauf auch noch vom plötzlichen Tod ihres Vaters erfahren. Fest entschlossen, ihrer Freundin beizustehen, fliegen die Frauen in Freddies amerikanische Heimat – eine Reise, die ihre Leben für immer verändern soll … »Ein herzerwärmendes Buch, dessen Protagonistinnen man einfach ins Herz schließen muss. Einfach unwiderstehlich!« Glamour Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der Liebesroman »All die Sommer zwischen uns« von Bestsellerautorin Elizabeth Noble wird alle Fans von Cecilia Ahern und Kristin Hannah begeistern. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 556
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über dieses Buch:
In Oxford schließen die Studentinnen Tamsin, Freddie, Reagan und Sarah eine enge Freundschaft, die sie weit über ihre Studienzeit hinaus verbinden wird: Auch Jahrzehnte später halten die so unterschiedlichen Frauen weiter zusammen – doch gleichzeitig hat jede von ihnen mit ihren ganz eigenen Problemen zu kämpfen: Während Reagan zwar beruflich erfolgreich, insgeheim aber entsetzlich einsam ist, hat Tamsin alle Hände voll zu tun mit ihrer immer weiter wachsenden Familie. Freddie steht unterdessen vor den Scherben ihrer Ehe, und muss kurz darauf auch noch vom plötzlichen Tod ihres Vaters erfahren. Fest entschlossen, ihrer Freundin beizustehen, fliegen die Frauen in Freddies amerikanische Heimat – eine Reise, die ihre Leben für immer verändern soll …
Über die Autorin:
Elizabeth Noble wurde 1968 in England geboren und studierte englische Literatur in Oxford. Danach arbeitete sie einige Jahre im Verlagswesen, bis sie die Liebe zum Schreiben schließlich dazu brachte, ihre eigenen Romane zu veröffentlichen, von denen viele zu internationalen Bestsellern wurden.
Bei dotbooks veröffentlichte die Autorin ihre Romane:
»Die Farbe des Flieders«
»All die Sommer zwischen uns«
»Für immer bei dir«
»So wie es einmal war«
»Das leise Versprechen des Glücks«
»Wo die Liebe zu Hause ist«
***
eBook-Neuausgabe August 2023
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 2004 unter dem Originaltitel »The Tenko Club« bei Hodder & Stoughton, a division of Hodder Headline, London. Die deutsche Erstausgabe erschien 2005 unter dem Titel »Das Glück, dich zu lieben« bei Goldmann, München.
Copyright © der englischen Originalausgabe 2004 by Elizabeth Noble
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2005 by Wilhelm Goldmann Verlag, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2023 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ah)
ISBN 978-3-98690-771-6
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »All die Sommer zwischen uns« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Elizabeth Noble
All die Sommer zwischen uns
Roman
Aus dem Englischen von Susanne Engelhardt
dotbooks.
Prolog
Oktober 1985, College St. Edmund Hall, Universität Oxford
Die Zimmer des Kelly-Blocks lagen direkt über der Halle. Eines der großen Spiegelglasfenster war ganz zurückgeschoben. Freddie Valentine saß auf der Fensterbank, ein langes Bein im Zimmer, das andere über dem Fenstersims. Den Fuß hatte sie auf dem betonierten Balkon abgestellt. Sie rauchte eine Silk Cut, die Asche schnippte sie vorsichtig in die Nachtluft. Tamsin ließ sie im Zimmer selbst nicht rauchen, also fühlte sie sich zu dieser unbequemen Position genötigt, denn von Tamsins Bude aus hatte man den besten Blick auf den Hof, wo die Rugby-Spieler sich versammelten, bevor sie zur Unifete weiterzogen.
»Born in the USA« dröhnte durch die Nacht. Jedes einzelne, energische Wort Springsteens war klar und deutlich zu verstehen, selbst im dritten Stock. Mochte Gott denen beistehen, die jetzt versuchten zu lernen. Obwohl jemand, der das am dritten Freitagabend des Wintersemesters tatsächlich tat, eher vom Teufel geritten wurde, als sich von Gott helfen zu lassen.
»Hast du ihn letztes Jahr auf Tour gesehen?«
»Ja. Er war klasse. Was ist dein Lieblingslied von Springsteen?«
»›The River‹, ganz klar.« Freddie nickte zustimmend. »Und deins?« fragte Tamsin.
»›Drive All Night‹.« Das kannte Tamsin nicht. »Auf Seite vier von The River. Hat einfach den besten Text.«
And I swear I’d drive all night again
Just to buy you some shoes and to taste your tender charms
And I just wanna sleep tonight again in your arms.
Ich schwöre, dass ich nachts aufbrechen würde, nur um dir Schuhe zu kaufen und deine Reize zu erleben.
Ich will heute Nacht nur in deinen Armen einschlafen.
»Stell dir nur mal vor, jemand sagt so etwas über dich.«
»Stimmt.« Tamsin nahm sich insgeheim vor, das Album zu kaufen, obwohl der Text sie gar nicht so sehr berührte. Sie war einfach nur hin und weg von ihrer neuen Freundin Freddie.
Sie hatten sich gleich am ersten Tag getroffen. Nachdem ihre Eltern abgefahren waren, hatte Tamsin völlig verängstigt im dritten Stockwerk zwischen Oxfords verträumten Turmspitzen auf ihrem schmalen Bett gekauert, sich verlassen gefühlt und sich zwingen müssen, in die Mensa zu gehen. Alle in der Warteschlange hatten angeregt miteinander geplaudert. Einige Studenten kannten sich anscheinend von früher. Tamsin war die Erste aus ihrer Schule, die es an ein Oxforder Universitätscollege geschafft hatte, und sie kannte hier keine Menschenseele. Einmal abgesehen von der schafsgesichtigen Tochter Muriels, einer Freundin ihrer Mutter. Und die war nicht einmal in einem College, sondern machte irgendeine Sekretärinnenausbildung in der Stadt. Obwohl Tamsin ihrer Mutter und Muriel versprochen hatte, dass sie sich treffen würden, war sie sich da gar nicht so sicher. Die Mädchen vor ihr sprachen über das Probetraining der Hockeymannschaft. Nun, auf diesem Weg würde sie niemand Neues kennen lernen, es sei denn, die hatten hier eine Sumomannschaft. Tamsin wusste genau, dass sie zu dick war, und neben diesen aufreizend angezogenen Mädchen in knallengen Jeans kam sie sich glatt wie ein Nilpferd unter Gazellen vor. Bisher war ihr das nicht wichtig gewesen ‒ zumindest nicht wichtig genug, dass sie etwas dagegen unternommen hätte. Jetzt aber wünschte sie, das wäre anders gewesen.
Sie stand kurz davor, das Mittagessen sausen zu lassen ‒ warum nicht gleich mit der Diät anfangen? ‒, als ein weiterer Neuankömmling ihr den Rückweg abschnitt. Diese Studentin war allein ‒ ein gutes Zeichen. Allerdings war sie auch sehr hübsch und, obgleich nicht wirklich schlank, doch wohlgeformt, und Tamsin verließ erneut der Mut. Die Andere aber lächelte sie an und streckte ihr die Hand hin. Sie sprach mit amerikanischem Akzent. »Hi, ich heiße Freddie.«
»Und ich Tamsin.« Mehr fiel ihr nicht ein.
»Hör mal«, sagte Freddie, »ich hab schon einen Blick auf das Zeug geworfen, das die da drin austeilen, und ehrlich gesagt finde ich, dass wir mit McDonald’s besser fahren. Es gibt hier doch einen, oder?«
»Ich glaube schon ‒ die High Street runter, in der Innenstadt.«
»Hast du Lust?«
So einfach war das gewesen. Ihr Name war Freddie Valentine, sie war fast eins achtzig groß und von geradezu klassischer Schönheit, wie Tamsins Mutter sich ausdrücken würde ‒ eine richtige Frau eben. Sie hatte genau diese üppigen blonden Locken und diese leuchtend blauen Augen, die Tamsin schön fand. Schön, lustig, frech und einfach wunderbar. Freddie wohnte im Emden-Block, genau gegenüber von Tamsins Zimmer ‒ so konnten sie sich gegenseitig einladen, indem sie den Teekessel schwenkten und imaginäre Kekse knabberten ‒, und sie hatte jede Wand und jede freie Fläche in ihrem Zimmer mit auffälligen indischen Tüchern und Überwürfen bedeckt, die sie auf einem Basar erstanden hatte. Bei ihr fühlte man sich nicht wie in einer Studentenbude, sondern wie in Scheherazades Zelt mitten in der Wüste. Sie verbrannte Räucherstäbchen, trank seltsamen Tee, und wenn Tamsin wiedergeboren werden würde, wollte sie so sein wie Freddie.
Eine Zeit lang war ihr nicht bewusst, dass diese Zuneigung auf Gegenseitigkeit beruhte. Ob nun den Bettbezug mit Pooh dem Bär, den Tamsin vom ersten Tag an gehasst hatte, das gerahmte Foto ihrer Eltern, das über dem Bett hing, oder die Dose mit den Haferkeksen und dem Brausepulver ‒ Freddie fand all das klasse. Tamsins Schüchternheit war schnell der Wärme und Fröhlichkeit gewichen, die sie für Freddie und andere so unwiderstehlich machten. Und wenn Freddies Zimmer exotisches Flair hatte, dann war Tamsins Bude der Ort, wo alle am liebsten waren, um Tee zu schlürfen, ihre Vorräte zu plündern und bemuttert zu werden.
Auch heute Abend hatten sie sich dort getroffen, um dann zur Unifete zu gehen, wollten aber auf keinen Fall zu früh kommen. Außerdem mussten sie noch auf Sarah warten, die zwei Zimmer neben Freddie wohnte. Zwischen ihnen hauste nur ein einfältiger, aber netter Chemiestudent aus dem fünften Semester, der sich ihnen bei einer ungemütlichen Tasse Tee in seinem Zimmer vorgestellt hatte. Anschließend hatten Freddie und Sarah sich auf eine Schutzgemeinschaft gegen zukünftige Besuche in Graemes Zimmer verständigt. Fleute hatte Sarah den ganzen Nachmittag beim Probetraining der Ruderer unten am Fluss zugebracht, aber versprochen, anschließend schnell zu duschen und dann zu ihnen zu stoßen.
Tamsin hatte so ihre Zweifel, ob es eine gute Idee war, gemeinsam mit Sarah einen Raum zu betreten. Sarah sah so toll aus, dass alle Jungs mitten im Satz innehielten, wenn sie an ihnen vorbeiging. Tamsin hatte immer gedacht, Frauen wie sie gäbe es gar nicht ‒ aber es gab sie eindeutig. Und trotz ihrer Schönheit und ihrer Herkunft aus dem schicken Seebad The Mumbles war sie einfach nur nett. Und darüber hinaus wirklich und wahrhaftig treu, wie sie selbst von sich behauptete. Sie war so gut wie verlobt. Er hatte ihr nur noch keinen Ring geschenkt und ihr ohne Umschweife einen Antrag gemacht, weil er dachte, ihre Eltern könnten sich Sorgen machen, da sie noch so jung seien. War das nicht rücksichtsvoll von ihm? Er machte wirklich etwas her und ‒ doch, das mussten sie zugeben ‒ sah ein bisschen aus wie Sting. Was Hunderte von Bildern in Sarahs Zimmer belegten. War Freddies Zimmer eine Hommage an Marrakesch, dann glich Sarahs Zimmer einem Schrein für Owen. Bald würde er zu Besuch kommen, hatte Sarah ihnen versprochen, dann hätten sie alle Gelegenheit, ihn kennen zu lernen.
»Ob wir es wohl so lange aushalten?«, scherzte Tamsin Freddie gegenüber, wobei sie Sarahs Waliser Akzent nachahmte.
Doch das Liebesleben der anderen beschäftigte Tamsin gar nicht so sehr, denn inzwischen hatte sie Neil kennen gelernt. Genauer gesagt, ihn über den Haufen gefahren. Die Vorstellung, sich hauptsächlich mit dem Rad durch Oxford zu bewegen, hatte ihr in der Theorie irgendwie gefallen, doch leider war sie in der Praxis eine schlechte Fahrerin und gleich in der ersten Woche vor dem Lesesaal der Bibliothek in ihn gerast. Glücklicherweise studierte er Medizin ‒ im Grundstudium ‒ und hatte seine Fleischwunde gleich bei sich auf dem Zimmer versorgen können. Anscheinend hatte er ihr die ganze Sache nicht übel genommen, falls die heftige Knutscherei auf der Fete im Queens College letzte Woche etwas zu bedeuten hatte. Und auch Tamsins Speckpölsterchen schienen ihn nicht abgeschreckt zu haben. Sie hatte ihn bei einem Treffen im Café so ganz nebenbei auf heute Abend hingewiesen. Und ihr Gefühl sagte ihr, dass er auch kommen würde. Sie konnte es kaum erwarten.
Freddie war mit ihrer Zigarette fertig und schloss das Fenster. Sie steckte in einer schlabberigen Jeanslatzhose. Tamsin wusste genau, dass sie darin wie eine durchgeknallte Moderatorin fürs Kinderfernsehen wirken würde. Freddie aber sah darin einfach cool aus.
Wenigstens Reagan war schon da. Tamsin hatte sie auf dem Korridor abgefangen. Sie war angeblich auf dem Weg in die Jurabibliothek gewesen, einem winzigen Kabuff voller staubiger Bücher am Ende der Universitätsbibliothek, die in einer alten Kirche untergebracht war. Tamsin war noch nie nachts in der Bibliothek gewesen, zum einen aus Prinzip, zum anderen, weil die alte Kirche direkt neben einem Friedhof lag und ihr bei diesem Gedanken ganz anders wurde. Als sie begriff, dass Reagan nicht wegen eines verbotenen Stelldicheins mit einem Kommilitonen in die Jurabibliothek gewollt hatte ‒ was noch okay gewesen wäre, weil so etwas schließlich romantisch war ‒, sondern wirklich und wahrhaftig, um sich in einen Wälzer über Strafrecht zu vertiefen, verbat Tamsin ihrer reichlich spröden und langweiligen Nachbarin zu lernen und schenkte ihr stattdessen ein Glas Cidre ein. »Kein Aber, du kommst heute Abend mit uns.«
Ein bisschen seltsam war Reagan schon, dachte Tamsin. Eine harte Nuss, die man erst mal knacken musste. An ihrer Tür hing eine von diesen Schiefertafeln, auf der oft in Kreide stand »Bitte nicht stören! Aufsatzkrise!« (offensichtlich ein Versuch, cool zu wirken, der aber kläglich scheiterte). Nach einer besonders feuchtfröhlichen Nacht hatte ein Witzbold eines Morgens die »Aufsatzkrise« weggewischt, das Ausrufezeichen aber gelassen, und dann hingeschrieben »Bin gerade am Wichsen«. Tamsin hatte es fortgewischt, sobald sie es entdeckte, aber es gelang ihr nie herauszufinden, ob auch Reagan es gelesen hatte.
Auch äußerlich war Reagan eher unscheinbar: ziemlich dünn ‒ und eine der wenigen Frauen, die das nicht gerade attraktiver machte. Sie hatte keinen Busen und kaum Po. Darüber hinaus war ihre ganze Kleidung irgendwie braun und ausgeleiert ‒ vielleicht nicht jedes einzelne Stück, aber auf alle Fälle der Gesamteindruck. Man musste sich wirklich um sie kümmern. Tamsin sah sich selbst frei nach dem Motto des Titelsongs aus Der 6-Millionen-Dollar-Mann: »Gentlemen, wir können diesen Mann neu zusammensetzen. Und zwar besser als vorher.« Für solche Herausforderungen war Tamsin immer zu haben. Aber zugegeben, der Vorname war klasse: Reagan hatte ihnen erzählt, dass Shakespeares König Lear das Lieblingsstück ihrer Mutter war, und dass es viel schlimmer hätte kommen können ‒ eine von Lears anderen Töchtern hieß Goneril. Ein exotischer Name war ein guter Anfang, fand Tamsin. Man stelle sich nur mal vor, wie fade Reagan erst mit einem anderen Namen gewesen wäre. Reagan hatte allerdings reumütig daraufhingewiesen, dass ihre Mutter das einzig Interessante, das ihr je eingefallen war, leider vermasselt hatte ‒ indem sie den verdammten Namen falsch schrieb.
Jetzt sah Tamsin zu ihr hinüber, wie sie mit Freddie redete. Reagan lächelte. Sie gehörte zu den Leuten, bei denen ein Lächeln einen himmelweiten Unterschied bewirkte: Ihre Augen strahlten, ihre Mundwinkel hoben sich, und mit ihrer leicht gekräuselten Nase sah Reagan schließlich fast hübsch aus.
Tamsin schenkte allen nach und sah ängstlich auf die Uhr. Was, wenn Neil längst unten war und die Menge nach ihr durchkämmte, während sie hier oben festsaß? Er wusste schließlich nicht, welche Zimmernummer sie hatte, konnte also auch nicht raufkommen. Was ihr Herz nicht daran hinderte, heftig gegen die Rippen zu pochen, als es an der Tür klopfte. Vielleicht hatte er sie gefunden. Vielleicht war er zum Kabuff des Hausmeisters gegangen, hatte ihr Fach gesucht und den Hausmeister gelöchert … und vielleicht hatte eine Freundin aufgeschnappt, wie er ihren Namen aussprach … und …
Aber es war nur Sarah, die immer noch in ihrer schwarzen Rudershorts und einer Regenjacke steckte und das lange dunkle Haar in einem Pferdeschwanz trug. Sie hatte geweint: Ihr Gesicht war ganz verquollen.
Tamsin legte die Arme um sie und zog sie ins Zimmer. »Was ist denn los, Sarah?«
Tamsins Mitgefühl löste eine neue Welle von Schluchzern aus, und die drei mussten warten, bis sie abgeklungen waren.
Reagan wünschte, sie wäre woanders. Sie fühlte sich wie das fünfte Rad am Wagen, doch niemand sonst schien das zu finden ‒ alle konzentrierten sich auf Sarah.
Sarah hatte einen Brief in der Hand ‒ der Bogen war eng mit schwarzer Tinte beschrieben. Jetzt hielt sie ihn zur Erklärung hoch, doch keine wollte ihn nehmen: Ein Brief war etwas Privates. Sarah ließ ihn fallen. »Owen hat Schluss gemacht.«
»Du Arme«, sagte Tamsin.
»Arschloch«, sagte Freddie.
»Das tut mir Leid«, fügte Reagan ruhig hinzu, als meinte sie, auch etwas sagen zu müssen.
Ein dankbares Lächeln huschte über Sarahs Gesicht. »Das ist noch nicht das Schlimmste. Er hat sich davongemacht ‒ so nennt man das wohl, oder? … Und zwar mit meiner besten Freundin ‒ mit Cerys.«
Cerys war in The Mumbles geblieben, um Friseurin zu werden, hatte Sarah ihnen erzählt. Sie hatte es auf einen Salon in der Hauptstraße abgesehen. Und offensichtlich auch auf Owen.
»Wir hatten vor zu heiraten.« Mehr Schluchzen. »Und jetzt schreibt er mir, sie wollen zusammenziehen.«
»So viel zum Thema Warten aus Rücksicht auf deine Eltern.« Freddie grinste, und Tamsin sah sie streng an, während sie Sarah übers Haar streichelte.
»Ich bin doch erst drei Wochen weg ‒ gerade mal drei Wochen, verdammt noch mal.«
Sie wussten nicht, womit sie Sarah trösten sollten. Keine von ihnen hatte schon einmal eine Beziehung gehabt, in der es auch nur ansatzweise ums Heiraten ging. Bis zu Neils Auftauchen hatte Tamsins Liebesleben aus ein paar langsamen Tänzen im Jugendzentrum ihres Dorfes bestanden, und aus einer äußerst enttäuschenden Begegnung mit einem Kumpel ihres Bruders letztes Silvester. Sie hatte vorgehabt, ihn wirklich ranzulassen, aber offen gesagt war der erste Teil des Unterfangens so abschreckend gewesen, dass sie ihre Meinung geändert, ihren Rock glatt gestrichen und sich wieder in die Disco verkrümelt hatte. Und jetzt, da sie Neil getroffen hatte, war sie froh, gewartet zu haben. Sie nahm an, dass es mehr Spaß machte, ihn ranzulassen. Zumindest, falls sie es jemals auf diese verfluchte Fete schaffte.
Freddie hatte das alles bereits mehrmals hinter sich, soweit Tamsin sagen konnte, und zwar mit einer beeindruckenden, wenn nicht sogar beängstigenden Zahl Jungs in Amerika, von denen ihr aber keiner etwas bedeutet zu haben schien. Denn reden wollte sie darüber nicht.
Während Tamsin über ihr Liebesleben sinnierte, dachte sich Freddie insgeheim, dass Owens Verrat das Beste war, was Sarah hatte passieren können. Sie mochte Sarah wirklich ‒ sie war gut drauf und würde die kommenden drei Jahre vermutlich ohne diesen blöden Freund, der sie ständig nach Wales zurückpfiff, weit mehr genießen. Freddie konnte sich überhaupt nicht vorstellen, jemals zu heiraten ‒ aber daran schon zu denken, wenn man gerade mal neunzehn war, schien ihr einfach verrückt. Es gab doch so viele Jungs. Sie hatte gerade ihren Blick über einige auf dem Hof da unten schweifen lassen. Es wäre doch viel lustiger, sich gemeinsam mit Sarah unter sie zu mischen.
Reagan hingegen spürte einen Stich der Eifersucht, was sie verwirrte. Sich vorzustellen, etwas so Starkes für jemanden zu empfinden. Klar, der Herzschmerz und das mit dem Sitzengelassenwerden waren ätzend, aber dieses Gefühl überhaupt einmal erlebt zu haben …
»Männer sind Schweine!«, verkündete Tamsin. Ohne wirkliche Überzeugung, aber es schien ihr angebracht, das zu sagen.
»Und was ist mit Cerys?«, konnte Reagan sich nicht verkneifen einzuwerfen. »Er war es ja wohl nicht allein, oder? Diese Cerys ist doch angeblich deine beste Freundin?«
Sarahs Gesicht verzog sich erneut.
»Reagan hat Recht«, nahm Freddie den Faden auf. »Ich meine, Männer sind eben einfach gestrickt, oder? Sogar die guten Exemplare. Magen- und schwanzgesteuert, und das nicht unbedingt in dieser Reihenfolge.«
Tamsin dachte bei sich, dass es ihr nicht zustand, sich dazu zu äußern, da sie ja noch nicht viele Männer kannte ‒ und »richtig« kannte sie schon gar keinen. Freddie hingegen schien ganz schön sauer zu sein. Vielleicht war an ihren »Affären« doch mehr dran gewesen, als sie zugegeben hatte.
»Vor den Frauen muss man sich in Acht nehmen«, sagte Freddie gerade. »Frauen sind einfach vielschichtiger ‒ viel komplizierter. Seht euch doch nur mal diese Cerys an. Was sie mit Sarah angestellt hat.«
»Was? Dass sie sich wie ein Mann benommen hat, meinst du? Weil sie ‒ ihr wisst schon wovon ‒ gesteuert war?«
»Ich wette, dass alles noch viel schlimmer ist. Sarah glaubt, das Ganze geht erst seit drei Wochen, aber wir alle kennen die Frauen doch etwas besser, nicht wahr? Glaubt ihr nicht, sie hat das schon ewig geplant ‒ seit Monaten vermutlich, vielleicht schon, seit sie wusste, dass Sarah zum Studieren weggeht?«
Tamsin war nicht sicher, ob Freddies Taktik besonders hilfreich war, aber Sarah sah sie gespannt an. Vielleicht lag es an Freddies Stimme oder an ihrer Art zu sprechen, auf jeden Fall wollte man ihr zuhören.
»Denk doch mal zurück, Sarah«, fuhr Freddie fort. »Wie haben die beiden sich benommen, als klar war, dass du weggehst? Denk mal darüber nach, wie Cerys sich dir gegenüber verhalten hat … und ihm gegenüber.«
Sarahs Blick verlor sich für eine Minute in der Ferne. Dann kniff sie die Augen zusammen und nickte. »Ich weiß, was du meinst … o ja.«
»Siehst du? Frauen eben.«
Freddie lehnte sich befriedigt zurück.
Reagan war beeindruckt. »Du solltest Jura studieren«, sagte sie.
Freddies Augen blitzten. »Kommt nicht in die Tüte! Ich hasse Rechtsanwälte. Mein Vater ist so einer.« Reagan wünschte, sie hätte nichts gesagt.
»Ich finde das ein bisschen ungerecht, Freddie«, warf Tamsin ein. »Wir sind schließlich auch Frauen. Willst du etwa behaupten, dass keine von uns den anderen trauen kann? Ich bin nämlich nicht so, und ich glaube, ihr auch nicht.«
Eine von Tränen durchweichte Sarah schüttelte nachdrücklich den Kopf.
»Fiat jemand von euch Tenko gesehen?«, fragte Reagan.
Sarah und Tamsin nickten.
Freddie schüttelte den Kopf. »Nein.«
»Das war so eine Fernsehserie, die lief glaube ich vor fünf Jahren. Es ging um eine Gruppe Frauen im zweiten Weltkrieg, hauptsächlich Engländerinnen, die von den Japanern eingesperrt wurden, in Singapur oder so. Sie kamen in ein Kriegsgefangenenlager ohne Männer, nur Frauen. Die Serie war echt klasse. Ich glaube, es reicht, wenn man eine Frau nur fünf Minuten beobachtet, mit ihr spricht oder ihr zuhört, egal welcher Frau, und schon weiß man, wie sie sich in einer solchen Situation, in einem solchen Lager, verhalten würde. Und sobald man das einmal herausgefunden hat, weiß man ziemlich genau, wie sie in jeder anderen Situation auftreten würde.«
»Wie meinst du das?« Alle schauten gespannt auf Reagan. Noch nie hatten sie es erlebt, dass sie so lange am Stück redete.
»Na ja, nehmt zum Beispiel Sarahs angeblich beste Freundin, Cerys. Ich kenne sie ja nicht persönlich, aber nach allem, was Sarah erzählt hat, gehört sie zu der Sorte Frauen, die in einem japanischen Kriegsgefangenenlager mit den Wachen schlafen, um an Essen zu kommen, es dann aber nicht mit den anderen teilen. Egoistisch und selbstsüchtig. Eben unmoralisch.«
Alle starrten sie an.
»Und weiter? Was ist mit uns?«
»Ich kenne euch ja kaum.« Sie wollte dieses Spiel nicht spielen.
»Du hast gesagt, fünf Minuten würden reichen. Dabei kennst du jede von uns schon viel, viel länger!«, drang Freddie in sie.
»Lass gut sein, Freddie«, sagte Tamsin. »Sie muss nicht, wenn sie nicht will.«
»Verstehst du jetzt, was ich meine?«, konnte Reagan nicht umhin einzuwerfen. »Tamsin wäre die Lagermutter. Sie würde die Streitigkeiten schlichten, nach den Schwachen sehen und sich um alle sorgen. Die Gerechtigkeit in Person.«
Tamsin grinste. »Das gefällt mir.«
»Sarah wäre die Verletzliche. Man müsste sie beschützen.«
»Klar ‒ vor den Wachen! Die wären alle hinter ihr her!«
»Vor allem und jedem. Vor schlechten Neuigkeiten, Krankheiten und der Sonne ‒ und vor den Wachen, stimmt«, fuhr Reagan fort. Sarah blickte leicht gequält. »Aber alle würden gerne auf sie Acht geben ‒ sie wäre niemandem eine Last oder so.«
»Was ist mit mir?« Freddies Augen glitzerten herausfordernd. Reagan war klar, dass sie jetzt tapfer sein musste. Was Freddie da machte, kam einer Art Aufnahmeritual gleich, und sie wollte nichts sehnlicher, als diesen Test bestehen.
»Du würdest mit den Wachen schlafen, aber du würdest teilen, was sie dir geben«, erklärte Reagan ihr.
Freddie lachte. »Glaube ich auch. Und was ist mit dir? Wahrscheinlich wärest du die Prinzipientreue, die Idealistin, die sich den Wachen in den Weg stellt und am zweiten Tag erschossen wird, was?«
Jetzt grinste Reagan breit. »Ich habe nur gesagt, dass ich andere Frauen durchschauen kann. Aber nie, dass ich mir selbst in die Karten blicken lasse.«
Aus der Unifete wurde an diesem Abend nichts mehr. Tamsin kippte den Rest Cidre in sich hinein, um eine Ausrede zu haben, unten ein paar Bier zu besorgen. Neil war nirgends zu sehen, und sie war schon wieder auf dem Weg nach oben, als sie ihn entdeckte, wie er mit hängenden Schultern in Richtung Ausgang strebte. »Hallo«, rief sie. Strahlend drehte er sich um und kam auf sie zu. »Ich kann heute Abend leider nicht«, erklärte sie ihm. Er blickte verwirrt. »Ich kann doch nicht aus dem Lager ausbüchsen.« Das machte es ihm nicht gerade leichter. »Aber vielleicht könnten wir uns ja morgen Abend treffen? Auf ein Bier oder so? Ich wohne hier im Kelly. Dritter Stock, Zimmer fünf.«
»Gerne«, sagte er, und sie stellte sich auf die Zehenspitzen, um ihm einen Kuss auf die Lippen zu drücken. Uuuij, er hatte wirklich etwas an sich …
Sie spielten noch länger das Tenko-Spiel, und Sarah weinte noch ein Weilchen, und sie verdrückten Tamsins sämtliche Keksvorräte und zwei von Reagans Instant-Nudelsuppen, und sie redeten und redeten, rauchten und wurden immer betrunkener. Jede von ihnen schaute sich wiederholt im Zimmer um und dachte dabei, dass sie genau aus diesem Grund hierher gekommen war, dass sie es sich genauso erträumt hatte. Und als die drei Mädchen in ihre Zimmer zurückkehrten ‒ lange, nachdem die Musik aufgehört hatte ‒, da war aus ihnen der Tenko-Club geworden. Die Clubregel war einfach: Männer, Kinder, Beruf, Shoppen und Schokolade ‒ all das ist wichtig, aber nicht so wichtig. Falls die anderen dich brauchen, bist du zur Stelle. Aufgeben zählt nicht. Ja, sie waren der Tenko-Club, und während sie den Flur entlangwankten, schworen sie, dass das immer so bleiben würde.
Kapitel 1
September 2004, England
Gegen Tränen am Steuer hätte es ein Gesetz geben sollen. In diesem Zustand war Fahren nämlich weit gefährlicher als nach dem dritten Glas Wein. Es schien Freddie, als wäre sie fast nie auf der A3 unterwegs, ohne zu weinen. Die ganze Gegend war immer völlig verschwommen ‒ von der hässlichen, modernen Kathedrale, die breit über Guildford aufragte, bis zur Jahresgartenschau in Wisley, wo die Ausfahrt mit ältlichen Gartenfreunden verstopft war, die viel zu vorsichtig und zu aufmerksam fuhren. Denn jedes Mal hatte sie gerade Harry verlassen.
Sie schnäuzte sich beherzt, biss sich auf die Unterlippe und schaltete das Radio ein. Womans Hour auf BBC. Jenni Murrays Stimme zu lauschen war, als äße man Galaxy-Schokolade, während man es sich in Cashmere-Socken auf einem Wildledersofa bequem machte. Sollte Freddie jemals im Lotto gewinnen, würde sie Jenni Murray ein Vermögen dafür bieten, bei ihr zu leben und ihr fortan sämtliche Rechnungen, Einkaufs- oder To-do-Listen vorlesen ‒ um wie viel angenehmer dann das Leben wäre.
Jenni Murray war ganz entschieden eine Tenko-Mutterfigur.
Freddie versuchte, sich auf die Moderatorin zu konzentrieren, die begeistert von der Suffragetten-Bewegung erzählte, aber sie sah immer nur Harry vor sich. Er war viel tapferer als sie ‒ das musste er auch ‒, also weinte sie nicht in seiner Gegenwart. Sie wusste, dass ihre Stimme schrill und unnatürlich geklungen hatte, als sie sein Revers glatt zog und ihm die widerspenstige Tolle aus dem Gesicht strich, die sich immer aus dem spitzen Haaransatz löste, den er von ihr geerbt hatte. Das hatte ihm den Spitznamen Pugsley eingebracht, der, so versicherte er ihr, als sie das erste Mal hörte, wie ihn jemand über den Parkplatz brüllte, auch nicht schlimmer war als Knasti, Willy Weichei oder Timmy Tampon. Sie wusste, dass er ihr seinen Kopf entziehen würde, genau wie sie wusste, dass er sich bei derselben Geste zu Hause an ihre Schulter lehnen und sie umarmen würde, sodass ihre Köpfe sich berührten. Er war groß für sein Alter, aber sie war immer noch größer. Sie befahl ihm nicht, die Hände aus den Jackentaschen zu nehmen, obwohl ein Lehrer es sicher getan hätte. Sie wusste, dass er sie zu Fäusten geballt hatte.
Für sie war es erträglich ‒ sie musste nur wenige Minuten durchhalten, bis sie im Auto losheulen konnte, ohne dass es jemand sah. Harry aber musste einem ganzen Schlafsaal gegenübertreten, dem Speisesaal, vierhundert anderen Jungen. In den nächsten sieben Wochen hatte er keine Rückzugsmöglichkeit, konnte nirgends ungestört sein. Dann würde sie kommen, um ihn für die ach so kostbaren Herbstferien nach Hause zu holen.
Adrian hatte keine Ahnung davon, wie sehr sie das alles verabscheute. Wenn er abends nach Hause kam, hatte sie sich längst leer geweint. Beim ersten Mal war sie vor ihm zusammengebrochen, auch noch in Gegenwart seiner Eltern. Es hatte sie wütend gemacht, dass sie da waren, verköstigt und unterhalten werden wollten, während Harry, der eigentlich hätte da sein sollen, fort war. Sie hatte während des ganzen Abendessens geweint.
Adrians Mutter Clarissa (die zwei Drittel der Lagerinsassinnen gegen sich aufbringen und mit etwas Glück wirklich frühzeitig wegen ihrer Aufsässigkeit und Hochnäsigkeit erschossen werden würde) hatte sie mit einer Mischung aus Verachtung und Verwirrung angesehen. »Natürlich ist es schwer«, hatte sie gesagt und dabei geklungen, als wäre es alles andere als das, »aber es ist eindeutig zu seinem Besten«. Widerspruch zwecklos.
»Eindeutig«, war das Echo von Charles gekommen, Adrians blasiertem Vater. Beide benutzten das Wort »eindeutig« sehr oft. Dadurch fühlten sie sich noch rechthaberischer, als sie ohnehin schon waren. Was den beiden an Intelligenz fehlte, machten sie durch Verbissenheit und Unnachgiebigkeit wett. Eindeutig zum Aus-der-Haut-fahren.
»So wurde mit mir verfahren, Freddie, und so wird auch mit ihm verfahren«, hatte Adrian zugestimmt. Die drei erinnerten sie an diese Wackeldackel, die sich manche Leute hinten ins Auto stellen.
Am liebsten hätte Freddie sie der Reihe nach geohrfeigt und ihnen ins Gesicht geschrien: »Was heißt hier ›verfahren‹, ihr Idioten! Er muss doch nicht bestraft werden. Er ist perfekt, so wie er ist. Und er ist gerade mal acht Jahre alt.« Doch selbst sie hatte erkannt, dass so ein Ausbruch sinnlos war. Alles war längst entschieden. Das war es bereits, als die Hebamme ihn hochgehalten und Adrian die geschwollenen, dunkelroten Hoden gesehen hatte, von denen er schon vorher sicher war, dass das Baby sie haben würde. Adrian war auf dieselbe Schule gegangen wie sein Vater und sein Großvater vor ihm, und Harold Thomas Adrian Noah, dreitausendvierhundert Gramm schwer, würde da keine Ausnahme machen.
Sie konnte sich nicht gegen die ganze Sippe stellen. Vielleicht hätte sie es sogar getan, aber Harry wollte es nicht. Er wollte, dass sein Vater stolz auf ihn wäre, genau wie sein Großvater. »Ist schon okay«, hatte er gesagt. »Ist schon okay.« Und das war es auch. Nach drei Jahren hatten sie und er sich an die qualvollen Abschiede gewöhnt. Sechs schreckliche Male hatten sie einander auf diesem verhassten Parkplatz Auf Wiedersehen gesagt. Es brach ihr das Herz, dass Adrian nicht wusste, wie viel Überwindung es seinen Sohn jedes Mal kostete. Dass er nicht wusste, wie viel Überwindung es sie kostete, machte ihr nichts mehr aus.
»Frederica ist Amerikanerin.« Mit diesen Worten stellte Clarissa sie immer bei ihren grässlichen Stehempfängen oder den geselligen Beisammensein im Golfclub vor. Es klang wie »Frederica hat äußerst ansteckende Eiterbeulen.« Mit dem Unterschied, dass diese Erkrankung behandelt werden konnte. Gegen das Amerikanersein aber gab es keine Behandlungsmethode ‒ abgesehen von erbarmungslosem Indoktrinieren und dem regelmäßigen Gebrauch des Wortes »eindeutig«. Sicher hätte sie die Notwendigkeit einer Privatschule erkannt, wäre sie »eine von uns«. Clarissa hatte nie verstanden, warum Adrian eine Ausländerin geheiratet hatte, wo so etwas doch so viele kulturelle Probleme mit sich brachte, von denen dieser unangemessene Ausbruch nur eines war. Um Himmels willen, das arme Kind hieß Noah. Gott sei Dank kamen davor noch drei anständige Vornamen ‒ die meisten Anmeldeformulare (ob für Oxbridge, Coutts oder den In-and-Out-Club) hatten sowieso nicht genug Platz für den vierten Namen. Clarissa hatte darauf bestanden, die Geburtsanzeige im Telegraph persönlich aufzugeben, natürlich in der Absicht, ihn wegzulassen. Anschließend war sie so gnädig gewesen, Fredericas unerfreulichen Wutausbruch beim Lesen derselben als ein Ergebnis der langen, anstrengenden Entbindung zu betrachten.
Freddie hatte immer angenommen oder gehofft, dass Adrian sich in sie verliebt hatte, weil sie anders war als die Mädchen, die er vorher getroffen hatte. Sie hatten sich in den Alpen kennen gelernt, wo Freddie in dem Skiort Meribel jobbte. Es war der fünfte Job seit ihrem Uniabschluss und mit Abstand der lustigste. Sie teilte sich eine Wohnung mit vier anderen Mädchen, schlief jede Nacht höchstens drei Stunden und ernährte sich von einer ausgewogenen Mischung aus Rice Krispies und Schnaps (den sie und ihre Mitbewohnerinnen jeden Abend in legendären Mengen in den Nachtclubs des Ferienortes konsumierten). Sie hatte, was man allgemein »die Zeit ihres Lebens« nennt. Adrian war mit ein paar Kumpels vom Militär dort gewesen und hatte sie erspäht, bevor sie ihn entdeckte. Er gestand ihr, dass sein Freund Stuart auf sie gezeigt und gesagt hatte, »So eine Frau will ich mal heiraten«. Sie hatte auf einem klobigen Holztisch gestanden und »Unbelievable« gesungen. Und das unglaublich schlecht, wie Adrian ihr immer wieder lachend versichert hatte. Er hatte ständig gelacht. Soweit sie wusste, hatte er seit Jahren nicht mehr daran gedacht. Manchmal fragte sie sich, ob er sie nur geheiratet hatte, weil Stuart diese Bemerkung gemacht hatte.
In jener Nacht hatte sie ihn zu dem Chalet begleitet, in dem er mit seinen Kumpels logierte. Sie waren beide zu betrunken gewesen, um es zu tun. Am nächsten Morgen aber, nachdem eine Tasse Kaffee, eine heiße Dusche und eine Zahnbürste ihre Lebensgeister wiedererweckt hatten, o ja, da hatten sie es getan. Und dabei einen ganzen Tag Skifahren verpasst.
Zu der Zeit hatte er umwerfend ausgesehen. Er war größer als sie ‒ wenn auch nur um einige Zentimeter ‒ und breit gebaut. Freddie selbst war kräftig ‒ »statuesk«, wie Tamsins Mutter ihr einmal geraten hatte, es zu nennen, doch jahrelang war sie sich einfach nur derb vorgekommen ‒ und im Gegensatz zu kleinen Frauen nicht daran gewöhnt, sich in den Armen eines Mannes beschützt und begehrt zu fühlen. Sicherlich hätte sie die meisten Männer, mit denen sie einmal aus war, beim Armdrücken schlagen können, nicht aber Adrian. Als sie von ihrem Tisch gestiegen war, er ihr einen Drink spendiert hatte und sie sich einander näher kamen, hatte er von hinten die Arme um ihre Taille gelegt und seine Hände immer noch bequem verschränken können. Er hatte das Kinn neben ihrem Kopf aufgestützt, und sie war sich plötzlich klein und behütet vorgekommen. Das war eine neue und angenehme Erfahrung. Die Kumpel, mit denen er in dieser Nacht aufgekreuzt war, hatten ihn Red gerufen, aber das war nicht ganz fair: Sein Haar war kupferfarben, und seine braunen Augen waren kupfern gesprenkelt. Er war vom Skifahren gebräunt und sah einfach nur proper, strahlend, gesund und stark aus, und Freddie hatte ihn hinreißend gefunden.
Sie erinnerte sich, dass sie, als er sie einige Monate später mit nach Hause genommen hatte, um sie seiner Familie vorzustellen, spontan gedacht hatte, es sei kein Wunder gewesen, dass er in jener Nacht auf sie zugekommen war. Alle dort waren so steif. So falsch. So kalt. Sie hatte einen ganzen Tag dort verbracht, und niemand hatte etwas Sinn- oder Gefühlvolles geäußert. Das Wetter, Golf, Essen, Golf, die Leute aus dem Golfclub, Golf. Seine Mutter hatte kurz bei den etwas attraktiveren Punkten verweilt, die Adrian ihr über Freddie berichtet hatte: dass ihr Vater ein angesehener Rechtsanwalt in den Staaten gewesen war und seit der Pensionierung an der Küste von Cape Cod lebte, dass Freddie selbst in nichts Geringerem als Oxford studiert hatte (was zwar beeindruckend, aber nicht beängstigend war, da sie keinerlei Neigung zeigte, ihren Titel als Bachelor of Arts zu nutzen). Und dass sie eine Schönheit war. Groß und schlank, mit diesen üppigen blonden Locken, diesem bemerkenswerten, spitz zulaufenden Haaransatz und diesen außergewöhnlich weißen Zähnen, die viele Amerikaner hatten. Clarissa betonte besonders das mit den Zähnen ‒ und Freddie kam sich vor wie ein Pferd. Charles tätschelte zerstreut ihren Arm, als sich herausstellte, dass Freddies Vater ein begeisterter Golfer war, der mehrere Male pro Woche in einem Club auf Cape Cod spielte, dann übersah er sie größtenteils. Er brannte darauf, Adrian den neuen Golfschläger vorzuführen, den er bei der Tombola des Frühjahrsballs gewonnen hatte.
Wenn sie nicht, wie sie damals annahm, so heftig in Adrian verliebt gewesen wäre, dann hätte sie nach diesem Treffen wohl die Flucht ergriffen. Doch sie war es nun einmal, und sie hatte gedacht, dass sie und er es mit der ganzen Welt aufnehmen würden, auch mit seinen Eltern. Beim Aufbruch hatten sie hysterisch gekichert. Er hatte seinen Austin Healey, der noch aus der Zeit vor dem Krieg stammte, an einem See in der Nähe geparkt und ihr Gesicht in seine großen Hände genommen. »Wollen wir uns besagte Zähne doch mal näher anschauen, hm?« Er hatte ihr die Zunge in den Mund geschoben und war damit über ihre Zähne gefahren, dann hatte er eine Hand über ihren Oberschenkel gleiten lassen und ihr einen freundlichen Klaps gegeben. »Hm. Eine hübsche Kruppe. Wollen wir doch mal sehen, wie sie so anspringt, was?« Natürlich hatten sie aussteigen müssen. Der Healey war einfach nicht groß genug. Er hatte sie im Stehen geliebt, mit einem ihrer Füße auf der Motorhaube, und ihr dabei Ausdrücke über Pferde ins Ohr geflüstert, die sie noch nie gehört hatte, sodass sie selbst im Moment der Konzentration hatte kichern müssen. In jenen Tagen hatten sie es wirklich überall getrieben. Das Bett hatte bei ihnen weit hinten auf der Beliebtheitsskala rangiert, dachte Freddie.
Seit wann stand er auf der anderen Seite? Seit wann waren er und der Rest der Welt gegen sie?
Als sie die M 25 erreichte, war Womans Hour zu Ende. Der Verkehr war wie immer unerklärlich dicht. Sie nahm die Auffahrt und fuhr mit nicht viel mehr als dreißig Stundenkilometern auf der Mittelspur. Eilig hatte sie es sowieso nicht. Sie wechselte von Kanal vier zu Kanal eins. Das Lied, das gerade lief, kannte sie ‒ Harry besaß das Album und hatte es den ganzen Sommer über gehört. Sie drehte lauter. Es tat gut, etwas zu hören, das er mochte. Für September war es warm, weshalb sie das Seitenfenster öffnete und den Fahrtwind hereinließ. Allmählich wurde sie ruhiger.
Sie hörte ihr Handy nicht klingeln ‒ die Musik war zu laut ‒, aber sie sah das hartnäckige grüne Blinken der Freisprechanlage neben der Mittelkonsole. Adrians Büronummer. Widerwillig stellte sie Harrys Lied leiser. Sie hasste Handys. Man war nie mehr »nicht zu sprechen«.
»Hallo?«
»Hallo, ich bin’s.«
»Ich weiß. Hab deine Nummer erkannt.«
»Verstehe. Wie war’s denn?« Er rief nie an, um sie das zu fragen.
»Gut.« Sie würde es ihm auch nicht erzählen.
»Kannst du gerade telefonieren?«
Sie dachte, das würden sie bereits. »Ja. Ich stecke im Stau und krieche nur noch. Was ist los?«
Er atmete tief durch ‒ sie konnte es hören. »Vielleicht hat es doch Zeit, bis wir zu Hause sind.«
»Was?«
»Nein … Schon gut.«
Freddie war sofort gereizt. »Um Himmels willen, was ist los, Adrian? Du rufst doch nicht ohne Grund an …«
Als er weitersprach, klang seine Stimme lauter. Und fester. »Ich denke, du solltest wissen, dass ich eine andere Frau kennen gelernt habe. Ehrlich gesagt ist es ziemlich ernst. Ich liebe sie, wir wollen Zusammenleben. Ich wollte damit warten, bis Harry wieder dort ist. Ich kann mir vorstellen, dass es ziemlich kompliziert wird …« Er brach ab.
Er hatte so souverän angefangen, dachte sie. Nachdem man seiner Frau einmal gestanden hat, dass man in seine Geliebte verliebt ist, sollte man meinen, dass es nicht mehr viel schwerer ist, ihr zu sagen, man wolle die Scheidung und der eine oder andere müsse aus dem gemeinsamen Heim ausziehen. Doch anscheinend war es das.
Schweigen. Er tat ihr beinahe Leid. Die Büchse der Pandora: geöffnet. Die Bombe: geplatzt. Die Katze: aus dem Sack.
»Freddie? Bist du noch dran, Freddie?«
Noch mehr Schweigen.
»Jetzt komm schon, Freddie. Wir wollen doch offen darüber reden …«
»Nein, Adrian. Du willst offen darüber reden. Ich will aber just in diesem Moment absolut nicht, wie du gleich feststellen wirst.« Sie drückte den roten Knopf und schnitt ihm damit das Wort ab. Ihre Hand zitterte.
Sie stellte das Radio wieder laut. Der unerklärliche Stau hatte sich genauso unerklärlich aufgelöst, und bald konnte sie auf achtzig, hundert und dann hundertzwanzig beschleunigen. Sie scherte auf die Überholspur aus und gab Gas.
Es wäre noch unverzeihlicher gewesen, hätte die Nachricht sie überrascht. Natürlich hatte sie davon gewusst. Gab es denn Frauen, die wirklich nichts wussten? Das bezweifelte sie. Es ging wohl eher darum, ob man es wissen wollte oder nicht. Denn wenn man es wollte, musste man auch damit fertig werden. Und damit fertig zu werden war mehr als »ziemlich kompliziert«, fürchtete sie.
Sie kam sich fast gemein vor, weil sie ihn abgewürgt hatte. Schlechtes Timing. Vermutlich war es so, als würde man einen Furunkel aufschneiden. Oder sich nach verdorbenen Garnelen erbrechen. Er hatte wahrscheinlich so lange gezögert, bis er es nicht mehr ausgehalten hatte. Sie hatte Harry vor vielleicht einer Stunde verlassen.
Antonia Melhuish. Wenn Freddie ehrlich war, so hatte sie gesehen, wie es zwischen den beiden gefunkt hatte, als sie sich das erste Mal trafen. Antonia war mit Jonathan verheiratet gewesen, einem Freund Adrians aus Armeetagen. Sie war eher hübsch als schön. Adrett ‒ das hatte Freddie immer über sie gedacht. Und dass sie total ausrasten würde, wenn sie sich beim Campen nicht mit heißem Wasser waschen könnte. Sie gehörte zu der Sorte Frauen, die nie ungeschminkt aus dem Haus gingen oder ohne einen Gürtel zu tragen, und deren Zehennägel im Sommer immer passend zur Kleidung lackiert waren. Zu der Sorte Frauen, neben der sich Freddie Vorjahren immer so unpassend und unfeminin vorgekommen war. Jetzt nicht mehr. Freddie fühlte sich in ihrer Haut mehr oder weniger wohl, und diese Art Detailverliebtheit kam ihr irgendwie absurd vor. Antonia und Jonathan hatten keine Kinder bekommen, und Freddie hatte immer angenommen, deshalb nicht, weil Kinder nicht adrett waren: so adrett wie ihre Figur, ihr Heim und ihr Leben. Aber sie hatten sich nie nahe genug gestanden, damit sie hätte nachfragen können. Jonathan hatte sich vor etwa drei Jahren jemand Schmutzigerem zugewandt, und jetzt hatten sie ein Baby. Er hatte ihr einmal auf einer Party, als er betrunken war, vorgejammert, dass Antonia immer aus dem Bett stieg, nachdem sie miteinander geschlafen hatten, und sich wusch. Er kam sich schmutzig vor bei der Vorstellung, dass sie mit seinen Säften an sich nicht schlafen konnte.
Sie wusste nicht, wie lange es schon so ging. Wahrscheinlich länger, als sie ahnte. Was besagten die Statistiken, die Jenni Murray vor einigen Monaten zitiert hatte? Im Durchschnitt dauerte eine außereheliche Affäre sieben Jahre. Vielleicht galt das auch für ihre. Wie Freddie herausgefunden hatte, hatte diese Liaison so gar nichts Talkshowmäßiges oder Sitcomartiges an sich ‒ weder hatte sie eines von Antonias Höschen aus der Waschmaschine gezogen, nachdem sie die Betten frisch bezogen hatte, noch hatte sie Rechnungen romantischer Abendessen gefunden, die sie nie gegessen hatte, als sie die Taschen von Adrians Anzügen leerte, um diese anschließend in die Reinigung zu geben. Ehrlich gesagt war sie dazu nicht häuslich genug, und Adrian war ein vorsichtiger Mann ‒ er hätte sich nicht bei etwas so Offensichtlichem ertappen lassen. Sie hatte die beiden weder beim Vögeln in ihrem eigenen Bett ertappt noch beim Händchenhalten, oder sie dabei gesehen, wie sie auf irgendeiner Dinnerparty unter dem Tisch die Knöchel aneinander rieben. Es war alles viel subtiler gelaufen. Wie er aufgehört hatte, sich ihr anzuvertrauen und sie in Büroangelegenheiten um Rat zu fragen. Er fragte auch nicht mehr, wie er aussah oder ob sie ihn noch liebte. Er hatte aufgehört, sich auf sie zu verlassen. Auch die Art, wie er mit ihr schlief, hatte sich geändert. Nicht, dass er sich geweigert hätte, es bei eingeschaltetem Licht zu tun oder etwas Ähnliches … Freddie fragte sich, ob Antonia Melhuish wusste, dass sie und Adrian noch genauso oft Sex miteinander hatten wie früher. Wohl nicht. Und dass er im Bett jetzt entgegenkommender war, weniger seine Interessen im Auge hatte. Er war immer ein großartiger Liebhaber gewesen ‒ jetzt aber war er fantastisch. Ein Schokoladenseiten-Liebhaber. Eines Tages hatte plötzlich alles einen Sinn ergeben. Von ihr brauchte er nichts mehr: Er bekam es von einer anderen.
Antonia Melhuish.
Und jetzt wollte er für immer mit ihr zusammen sein. Er wollte Freddie, Harry und das Reihenendhaus in Shepherd’s Bush verlassen, wo sie seit zehn Jahren lebten. Und er wollte es jetzt tun.
Seltsam, aber je länger die Affäre ging, desto unwahrscheinlicher schien es, dass er sie verlassen würde. Männer verließen ihre Frauen und Kinder doch nicht. Wie oft hatte sie das in den Ratgeberspalten der Frauenzeitschriften gelesen? Sie erzählten alles Mögliche darüber, dass sie die andere liebten und sich besser verstanden fühlten und nur den richtigen Zeitpunkt abwarteten, aber sie taten es nie.
Doch Jonathan hatte es getan, und einige Monate lang machte Freddie sich ziemliche Sorgen. Antonia Melhuish hatte ganz allein in ihrem Loft in Battersea gesessen.
Aber Adrian war geblieben, die beiden hatten sie nicht damit konfrontiert, und sie hatte sich wieder entspannt. Verheiratete Männer verließen ihre Frauen nicht.
Inzwischen war Freddie auf der M 4. Ihr war leicht schwindelig, so als solle sie nicht fahren. Sie fuhr an einer Tankstelle ab und parkte in einer leeren Reihe. Adrian hatte eine Straßensperre in ihrem Kopf errichtet, wo sie jetzt bedrohlich groß, dunkel und unüberwindbar aufragte. Er würde sie dazu zwingen, damit fertig zu werden.
Freddie war nicht gut im Weinen. Ihr Vater pflegte immer zu sagen, Frauentränen wären manipulativ, und sie hatte früh kapiert, dass Tränen sie bei ihm nicht weiterbrachten. Stattdessen weinte sie sozusagen auf dem Trockenen, wozu sie die Augen zukniff und spürte, wie ihre Lungen sich anspannten, doch nichts passierte: Keine Tränen wollten ihr über die Wangen kullern, es gab weder Schluchzer noch verquollene Augen. Es war bei weitem nicht so befriedigend, aber es war das Beste, was sie tun konnte. Sie legte den Kopf aufs Steuer und schloss die Augen. Sie war erschöpft.
Als das Telefon erneut klingelte, wirkte es laut und störend in dem stillen Wagen. Widerstrebend hob sie den Kopf. Sie würde nicht mit ihm reden, bevor sie nicht dazu bereit war. Sie hatte keine Ahnung, was sie ihm sagen sollte.
Allerdings erschien nicht seine Nummer im Display ‒ weder die seines Handys noch seine Büronummer oder ihre Privatnummer. Es war auch nicht die von Antonia Melhuish. Es war eine amerikanische Nummer.
»Hallo?«
»Hallo, Freddie?«
»Ja?« Die Leitung war schlecht, ganz undeutlich und weit weg.
»Hier ist Grace.«
»Ich kann dich kaum hören.«
»Es geht um deinen Vater, Freddie. Ich fürchte, ich habe …« Die Verbindung brach ab.
Freddie wusste die Nummer nicht auswendig ‒ sie rief selten dort an ‒ und musste in ihrer Handtasche nach dem Adressbuch wühlen. Sorgfältig tippte sie sie ein. Dieses Mal war die Leitung einwandfrei. »Grace?«
»Oh, Freddie. Dem Himmel sei Dank. Es geht um deinen Vater …«
»Was? Was ist passiert?«
»Er ist tot, Freddie.«
Tamsin Bernard brauchte fünfundzwanzig Minuten, um in ihrem großen, bordeauxroten Van von zu Hause zur Westseite der Tankstelle Heston Services zu gelangen, und weitere fünf Minuten, um die Fußgängerbrücke zur Ostseite zu überqueren. Sie war zu schwanger, um schneller zu gehen. Bereits in der siebenundzwanzigsten Woche war Tamsins Bauch so riesig, dass Treppensteigen für sie eine langsame und unangenehme Angelegenheit war. Sie verharrte kurz vor dem Kentucky Fried Chicken, erinnerte sich daran, dass sie ihre Handtasche im Auto gelassen hatte und dass sie in einer Mission des Mitleids auf dem Weg zu ihrer besten Freundin war, und drückte die Tür zum Parkplatz auf. Sie blinzelte in die Septembersonne hinaus und hielt Ausschau nach Freddies silbernem Volvo.
Freddie hatte ihr den Rücken zugewandt, lehnte am Auto und rauchte eine Zigarette. Tamsin hatte sie seit mehreren Jahren nicht rauchen gesehen. »Thelma«, rief sie, »deine Louise ist da. Wo solls hingehen?« Freddie hatte ihr nicht gesagt, warum sie sie brauchte, nur, dass sie es tat und wohin sie kommen sollte. Tamsin hatte keine Fragen gestellt. Sie wusste, dass Freddie Handys hasste, und dass sie nie fragen würde, wenn sie nicht verzweifelt wäre ‒ so etwas machte sie nie.
Freddie drehte sich um und lächelte ihre beste Freundin an. Was für eine Erleichterung, sie zu sehen. Auch Tamsin lächelte. »Falls es eine lange Fahrt wird, kannst du mir vielleicht erst mal einen Fünfer für den Kentucky Fried Chicken vorschießen?«
In einer hilflosen Geste streckte Freddie die Arme aus. »Mein Vater ist gestorben, Tamsin.«
»Was ist er? Wann?«
»Letzte Nacht. Im Schlaf.«
»Woher weißt du das?«
»Grace hat mich angerufen, bevor ich dich angerufen habe.«
»Grace? Die Haushälterin deines Vaters?«
»Ja. Sie hat ihn gefunden.«
»Oje. Die Arme. Und wie geht’s dir?«
»Ich weiß nicht. Was mache ich denn jetzt, Tams?« Freddie nahm einen tiefen Zug.
Tamsin nahm ihr die Zigarette weg, warf sie zu Boden und trat sie mit der Stiefelspitze aus. »Also, das auf jeden Fall nicht. Erstens hilft es nicht, und außerdem kriegst du davon Lungenkrebs und Mundgeruch.«
Freddie verdrehte die Augen und ließ sich von Tamsin in die Arme nehmen, obwohl diese nur einssiebenundfünfzig groß war und es lächerlich aussehen musste, wie sie beide da standen.
Sie sprach über Tamsins Schulter. »Ich mochte den Kerl nicht mal.«
»Ich auch nicht.«
Freddie lachte. Weinte fast. »Er konnte dich nicht ausstehen.«
»Vielen Dank.«
»Schon in Ordnung. Also …«
»Also was?«
»Also, ich habe ihn seit fast zwei Jahren nicht gesehen. Er war kaum noch Teil meines Lebens. Ich kann mich an kein Treffen erinnern, bei dem wir uns nicht über irgendetwas gestritten hätten, bei dem er mir nicht das Gefühl gab, eine Versagerin zu sein, eine Enttäuschung und ein blasser Abklatsch des Sohnes, den er sich zweifelsohne immer gewünscht hatte. Ich glaube nicht, dass er mich geliebt hat, und ich bin nicht sicher, ob ich ihn lieb hatte. Ich habe den Kontinent gewechselt, um von ihm wegzukommen. Warum also, in Gottes Namen, stehe ich hier, qualme und komme mir vor, als hätte man mir den Boden unter den Füßen weggezogen?«
Tröstend tätschelte Tamsin ihren Arm. »Ein Elternteil nicht zu mögen heißt ja nicht, dass es kein Gepäck gibt, mit dem man nach seinem Tod fertig werden muss, Fred. Vermutlich bedeutet es, dass mehr dahinter steckt.«
»Gepäck? Was faselst du da?«
»Gepäck halt. Ballast. Zeug. Gefühle. Du weißt, was ich meine.«
Freddie zuckte die Achseln.
»Elast du es schon Adrian erzählt? Oder hast du mich angerufen, weil du ihn nicht erreichen konntest?«
Das hatte sie ganz vergessen. Sie sah in Tamsins offenes, liebes Gesicht.
»Ach, Tams. Da ist noch etwas …«
Der bordeauxrote Van war dreckig und roch nach Hund. Nach Hund und Kentucky Fried Chicken. Freddies letzte Enthüllung hatte Tamsin umgehauen, und nun balancierte sie unsicher eine Pappschachtel auf ihrem ständig kleiner werdenden Schoß und stopfte während der Fahrt Chicken Wings in sich hinein. Der silberne Volvo stand noch immer an der Tankstelle. »Adrian wird es sich ja wohl an drei Fingern abzählen können, oder? Du kommst mit zu mir.«
Das war es, was Freddie erwartet und ersehnt hatte. Seit fast zwanzig Jahren war sie immer auf die eine oder andere Weise zu Tamsin gerannt. Beim ersten Mal hatten sie sich eigentlich kaum gekannt. Das war einige Wochen nach Beginn des ersten Semesters. Tamsin hatte ihr erklärt, dass sie nach Hause musste, um für ihre älteste Schwester als Brautjungfer zu fungieren, und es würde alles so grauenvoll werden, lauter aprikotfarbener Taft und das dämliche Rumgehopse, und Freddie musste einfach mit ihr kommen, bitte, bitte, bitte. Freddie hatte den Essay über die Präraphaeliten, den sie hätte schreiben sollen, links liegen gelassen und war gemeinsam mit ihr eines schönen Freitagabends in den Zug gestiegen. Allerdings hatte Tamsin es bis zum Umsteigen in Reading, wo es dann für Freddie zu spät zum Umkehren war, vernachlässigt zu erwähnen, dass sie eines von neun Kindern war, darunter sieben Mädchen, und dass Freddie drauf und dran war, ins Chaos gestürzt zu werden.
Freddie war Einzelkind. Nichts hätte sie darauf vorbereiten können, was sie erwartete, oder genauer gesagt, wie es sie packte und ihr Herz jubilieren ließ. Das Heim der Johnsons in Wiltshire lag meilenweit abseits vom Schuss. Der dreckige Landrover brauchte ewig, um den langen, holprigen Feldweg dorthin zu bewältigen, der offensichtlich bis zum ersten Frost vor ein paar Tagen unglaublich schlammig gewesen war. Er wurde völlig unberechenbar und unter lautem Fluchen von Tamsins ältester Schwester Anna gesteuert, der alles andere als zum Erröten neigenden angehenden Braut, die ein kehliges Lachen ausstieß, als sie ihnen jedes Detail ihres Jungfernabschieds vom Wochenende berichtete. Sie hielt vor einem riesigen, baufälligen Bauernhaus im Queen-Anne-Stil, und zwei Collies stürzten sich ausgelassen auf sie, sobald sie ausgestiegen waren.
Tamsins Vater erschien in der Tür und rief die Hunde zurück, entdeckte Tamsin, rannte auf sie zu und wirbelte sie durch die Luft. »Mein kleines Mädchen! Willkommen daheim!« Es war eindeutig, wie sehr er sich freute, sie zu sehen. Freddie fühlte sich unbehaglich, fremd und ziemlich verloren, denn dieser Ort glich so gar nicht dem Zuhause, das sie kannte. Dann stellte er Tamsin wieder auf die Füße und kam zu ihr. »Tams hat uns alles über dich erzählt, Freddie. Wir freuen uns riesig, dass du mitgekommen bist.« Dann wurde auch sie herzlich gedrückt, und es kam ihr gar nicht seltsam vor. »Kommt rein, kommt rein ‒ deine Mutter braucht dringend Hilfe, Tams. Du bist keinen Augenblick zu früh da.«
Tamsins Mutter Caroline war in der riesigen Küche. Eine Wand wurde von einem großen, alten schwarzen Herd eingenommen, eine andere war über und über mit Fotos bedeckt, die wild durcheinander hingen; Schulfotos, Hochzeiten, Taufen, Abschlussfeiern, Kinder, die durchs Gras kullerten, stolz auf Hügeln posierten oder an weiten Winterstränden lachten.
Mitten im Raum stand ein langer, blank gescheuerter Kiefernholztisch. Am einen Ende befanden sich ungefähr zwanzig Milchkännchen, in jedem waren Rosen mit Gipskraut und Grün arrangiert. Am anderen Ende stand Tamsins Mutter über die Hochzeitstorte gebeugt. Ihr Gesicht war konzentriert, als sie eine Rosenblüte auf dem obersten Stockwerk platzierte. Sie war klein und rund wie ihre Tochter (wie all ihre Töchter, sollte sich herausstellen), und sie hatte Tamsins schimmerndes dunkles Haar (obwohl sie immer dazu stand, dass ihres jetzt aus einer Tube kam). Als sie die beiden in der Tür sah, wischte sie sich strahlend die Hände an der Schürze ab. »Endlich seid ihr zu Hause, ihr zwei!«
Bei Tamsins Familie zu sein, kam Freddie vor, als würde sie in ein weiches Daunenbett sinken. Bei diesem ersten Besuch und jedem weiteren.
Das Bauernhaus war Freddies Zuflucht in England geworden, die Familie ihr adoptierter Clan, von Anna, der inzwischen dreifachen Mutter, bis hin zu George, Tamsins Bruder, der das Down-Syndrom hatte und noch immer zu Hause bei Caroline lebte. Freddie war immer gerne dort gewesen. Tamsins Vater war gestorben, und Freddie erinnerte sich an seine Beerdigung als das einzige Mal, wo sie im Bauernhaus zu Besuch war, ohne dass es vor Lachen, Rufen und Frank Sinatra widerhallte. Doch selbst damals war bei ihnen Platz für sie gewesen, und die Trauer hatte sie fast genauso ergriffen wie die anderen.
Als Tamsin Neil heiratete, hatte sie eine eigene Version des Bauernhauses in Wiltshire erschaffen und diese in eine Doppelhaushälfte in Ealing gequetscht, wo die Wände in knalligen Farben gestrichen waren, während das Porzellan nicht zusammenpasste und abgestoßen war. Jetzt war es das Heim ihrer eigenen drei Kinder (das vierte war unterwegs), eines Labradors und Meghans, des australischen Au-Pair-Mädchens, und hallte vom gleichen Lärm wider wie das Heim ihrer Kindheit, abgesehen davon, dass Robbie Williams Frank Sinatra ersetzt hatte ‒ sehr zu Neils und Carolines Bedauern.
Es war immer noch der Zufluchtsort für Freddie, wenn etwas schief ging. Heute war ein passender Tag, um dort zu sein.
Auf dem Heimweg redeten sie nicht viel. Freddie konnte sehen, dass Tamsin wütend war. Ihr runder Mund war zusammengepresst, und ihre Fingerknöchel zeichneten sich weiß auf dem Lenkrad ab. Es war lieb von ihr, so sauer auf Adrian zu sein. Freddie fragte sich, warum sie selbst es nicht war. Bis zu dem Moment, als Tamsin auf dem Parkplatz nach ihm fragte, hatte sie seinen Anruf fast vergessen. Es war wie ein Schlag ins Gesicht gewesen, dem sofort ein kräftiger Punch gefolgt war ‒ der Schlag hatte gebrannt, doch der zweite Hieb hatte ihn ausgelöscht. In ihrem Kopf hallten die Worte wider: »Mein Vater ist tot. Mein Vater ist tot.« Es hörte sich irgendwie verkehrt an.
Tamsins Haus hatte einen Parkplatz vor der Tür, da Neil den Vorgarten hatte asphaltieren lassen. Tamsin parkte neben Meghans Fiat Uno, wobei sie nur knapp dessen Seitenspiegel verpasste. Fahren war nicht gerade ihre Stärke, und sie wurde spürbar schlechter, sobald sie schwanger war. Nur das derzeit Jüngste und Meghan waren zu Hause. Flannery ‒ so benannt nach Flannery O’Connor, einer von Tamsins Heldinnen aus der amerikanischen Literatur, wurde von allen nur »Flancase«, also Tortenboden, genannt ‒ von allen bis auf Tamsin, die immer bemüht war, den ganzen Namen zu benutzen, und von Caroline, die all ihre Kinder und Enkelkinder Schätzchen rief, weil das einfacher war. Besagte Flannery hielt draußen in einem Hochstuhl Hof und wedelte mit einer halben Banane, deren andere Hälfte sie auf Haaren und Kleidern verschmiert hatte. Meghan lag in Hüftjeans und einem knappen Bikinioberteil (die Wachen hätten sich überschlagen, um mit ihr zu schlafen, doch Meghan hatte Prinzipien und den legendären australischen Schneid) neben ihr in einem Liegestuhl und murmelte abwechselnd Ermutigungen und Ermahnungen, während sie versuchte, ihr Buch zu Ende zu lesen. Sie verschlang gerade Tamsins Taschenbuch-Klassiker.
Tamsin hatte mehr Bücher als irgendjemand sonst, den Freddie kannte. Literatur war ihre Leidenschaft. Daher die Namen der Kinder und ihre offensichtliche Bereitschaft, ihren Sohn ein Leben lang zu dem Satz zu verdammen: »Ich heiße Homer ‒ wie in der Ilias, nicht Simpson.« Tamsin fand den Namen Homer Bernard gut. Sie war eine sensationell gute Gymnasiallehrerin, weil ihre Begeisterung ansteckend war. Bücherregale bedeckten praktisch jede Wand und verstopften jeden Treppenabsatz. Zum Erstaunen derer, die darauf achteten, waren die Bücher peinlich genau in alphabetischer Reihenfolge geordnet. Selbst die Kinder hatten schnell kapiert, dass es okay war, Küchenschränke auszuräumen oder Blumenzwiebeln aus den Rabatten zu buddeln, aber ein Frevel, Marvell und Milton durcheinander zu bringen.
»Hallöchen.« Meghan stand nicht auf, als sie kamen.
»Hallo. Und hallo, meine Süße! Wie geht’s denn Mummys Liebling?«
Tamsin küsste einen bananenfreien Fleck auf Flannerys Stirn.
»Hi, Flancase.« Freddie wuschelte ihr durchs Haar und wurde mit einem Einhundert-Watt-Grinsen belohnt.
Meghan winkte. »Wie geht’s, Freddie?«
Freddie lächelte mit aufeinander gepressten Lippen. »Gut, danke. Toller Spätsommer, was?« Insgeheim dachte sie: Verflucht, bin ich Englisch. Wann ist denn das passiert?
»Ich hab den Salat gemacht, den du so magst, Tams, den mit Pecannüssen und diesem Dressing, und es ist noch ein abgepacktes Ciabatta in der Speisekammer, das brauchst du nur für zehn Minuten in die Röhre zu schieben. Und eine Stachelbeercreme. Flancase und mich bist du in ein paar Minuten los, nicht wahr, Süße?«
Tamsins Kopf steckte im Kühlschrank. »Wo wollt ihr denn hin? Ich weiß, du hast es mir gesagt… Schwangere sind so vergesslich …«
»Musikgarten. Ein paar Kinderlieder trällern. Dabei geht’s ganz schön zur Sache, was, Flan? Anschließend geh’n wir vermutlich noch’n Kaffee trinken. Homer und Willa hol ich auf dem Heimweg ab.«
»Super.«
Erst jetzt bemerkte Freddie den Esstisch, der für zwei Personen gedeckt war, mit Stoffservietten und einer Vase Gerbera. »Ach, Tamsin, tut mir Leid. Du erwartest jemanden zum Essen, und ich platze hier einfach so rein. Hör mal, ruf mir ein Taxi, und schon bin ich weg.«
»So ein Quatsch. Du bleibst schön hier. Außerdem hatte ich ja Kentucky Fried Chicken ‒ und der Salat will gegessen werden.«
»Mir ist aber nicht wirklich nach Gesellschaft.«
»Ist auch keine Gesellschaft, ist nur Matthew. Er arbeitet diese Woche zu Hause, muss irgend so ein Dingsda mit Millionen von Seiten durchackern, und ich hab ihm versprochen, dass ich ihn bekoche. Das ist alles.« Sie warf Freddie einen Blick zu. »Ich kann ihm auch absagen, wenn dir das lieber ist.«
»Nein. Matthew ist okay.«
»Erst letztes Wochenende hat er gesagt, dass er dich und Adrian seit Ewigkeiten nicht gesehen hat. Er freut sich bestimmt riesig. Bei dir ist er sowieso in besserer Gesellschaft. Zur Zeit schlafe ich nämlich nach dem dritten Bissen beim Mittagessen immer ein.«
Freddie lachte. »Halt die Klappe.«
»Gut, dann sind wir uns ja einig. Mach die mal auf«, sie reichte Freddie eine Flasche gekühlten Sauvignon Blanc, »ich wasch dem Fräuleinchen hier das Gesicht, während Meghan rausfindet, wer der Mörder ist.«
»Mann, ej«, hörten sie Meghan die Treppe hinunterrufen, »ich lese Thomas Hardy und nicht Agatha Christie, bitte schön.«
»Freut mich zu hören!« Tamsin hievte Flannery aus dem Hochstuhl und setzte sie sich auf die Hüfte. »Los, Freddie, raus mit dir. Mach’s dir bequem.«