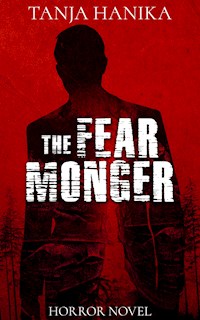4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
»Halloween ist die eine Nacht im Jahr, in der man Fledermäuse quietschen und Totenköpfe mit den Zähnen klappern hört, in der der eigene Schatten einen erschreckt und gruselige Musik durch die Straßen weht. An Halloween erscheint alles möglich, wenn man einen Friedhof betritt, die Kerze im ausgehöhlten Kürbiskopf ausbläst oder Gläserrücken spielt.« Hailey kann es kaum erwarten, das weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannte Spukhaus zu besuchen, um am Halloweenabend die angeblich nie zuvor bestandene Challenge zu meistern. Ihre beste Freundin Ella hingegen freut sich mehr auf die anschließende Studentenparty, die ihre eigenen Überraschungen für die beiden Freundinnen bereithält. Um sich die letzten Tage bis dahin zu vertreiben, erzählen sie sich Gruselgeschichten, testen den Mythos »Never blow out a Jack O’Lantern!« und stellen sich ihren Ängsten mit Gläserrücken, einem Verstecken-und-Erschrecken-Spiel und vielem mehr. Ein etwas pikaresker Horrorroman für Halloweenfreunde über Mut und Mutproben. Triggerwarnungen: Blut, Gewalt, Leichen, Verwesung, Tod. Eine genaue Auflistung über die Content Notes einzelner Kapitel befindet sich im Buch.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Die Halloweennacht im Jahr zuvor
EINS.
Ein Jahr später
ZWEI.
DREI.
VIER.
Zwei Tage vor Halloween
FÜNF.
SECHS.
SIEBEN.
ACHT.
Ein Tag vor Halloween
NEUN.
ZEHN.
ELF.
Halloween
ZWÖLF.
DREIZEHN.
VIERZEHN.
FÜNFZEHN.
SECHZEHN.
SIEBZEHN.
ACHTZEHN.
NEUNZEHN.
ZWANZIG.
EINUNDZWANZIG.
ZWEIUNDZWANZIG.
DREIUNDZWANZIG.
Danksagung
All Horrors Eve
– Eine Halloweengeschichte –
Ein Horrorroman von
Tanja Hanika
Impressum
1. Auflage Juni 2021
Copyright © 2021 by Tanja Hanika
www.tanja-hanika.de
Gartenstr. 12, D-54595 Weinsheim
Korrektorat:
Doris Eichhorn-Zeller, www.perfekte-texte-coburg.de/
Unter Verwendung von:
© Covergestaltung: Cathy Strefford | www.catherine-strefford.de
© Coverdesign »Roadkill« Cathy Strefford
© Coverdesign »Hexenwerk« Cathy Strefford
© Coverdesign »Werwölfe in Aremsrath« Cathy Strefford
© Coverdesign »Das Grab im Schnee – Tödlicher Waldgasthof« unter Verwendung von Aleksey Stemmer / Fotolia.com
© Coverdesign »Zwietracht« by Rob Allen @n23art
© Coverdesign »Der Angstfresser« Christian Eickmanns
© Coverdesign »Scream Run Die« Catherine Strefford | www.catherine-strefford.de mit der Verwendung eines Fotos von © Виталий Давыдов / Adobe Stock
© Coverdesign »Arbeitsbuch für Schriftsteller« unter Verwendung von Jag_cz / Fotolia.com
© Coverdesign »Ideenbuch für Schriftsteller« unter Verwendung von KoalaParkLaundromat / Pixabay.com
© Halloweenschriftart: Khurasan / Fontriver.com
Alle Rechte in jeglicher Form vorbehalten. Sowohl Einspeicherung und Verarbeitung in elektronische Systeme als auch mechanische, elektronische sowie fotografische Vervielfältigung – auch auszugsweise – nur mit schriftlicher Genehmigung der Autorin. Figuren, Namen und Handlung sind frei erfunden, etwaige Ähnlichkeiten mit real existierenden Personen oder Institutionen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Über die Autorin:
Tanja Hanika wurde 1988 in Speyer geboren. Ab 2008 studierte sie erfolgreich an der Universität Trier Germanistik und Philosophie. Nun lebt sie mit Mann, Sohn und zwei Katzen in der Eifel.
Mit acht Jahren entdeckte Tanja Hanika durch eine Kinderversion von Bram Stokers »Dracula« nicht nur ihre Liebe zu Büchern, sondern wollte fortan auch selbst solche Geschichten schreiben.
Content Notes resp. Triggerwarnungen zu den einzelnen Kapiteln sind direkt nach der Danksagung zu finden.
Für alle,
die Halloween und Gruselgeschichten
so sehr lieben wie ich.
Inhaltsverzeichnis
Die Halloweennacht im Jahr zuvor
EINS.
Blutspiele
Ein Satanistenopfer
Jeffs Beutel voller Süßigkeiten, die er so fleißig an allen Haustüren gesammelt hatte, entglitt seinen vom Angstschweiß feuchten Fingern. Das Kind rannte wie so oft zuvor in seinen Albträumen durch die Dunkelheit, nur waren dieses Mal die Schattenmänner mit ihren Kapuzen real, die es holen wollten. Er ließ seine Beute ohne zu zögern zurück, denn er wusste genau, dass die Gefahr groß war. Echt und gewaltig wie nie.
Einer der Männer hatte »Genug! Schnappt ihn jetzt!« gerufen und damit unweigerlich seine Trick-or-Treat-Runde beendet. Seither rannte Jeff um sein Leben. Tatsächlich, nicht sprichwörtlich.
Jeff hetzte um die nächste Straßenecke und hoffte, seine vier Verfolger abzuschütteln, indem er sich irgendwo versteckte. Zunächst waren sie ihm noch mit einigem Abstand gefolgt, inzwischen jagten sie ihn ganz eindeutig. Sein Herz hämmerte in seiner Brust, während die Panik sein Gehirn lahmlegte. Die Straßen waren leer, alle Kinder außer ihm hatten ihre Touren beendet. Es gab keine Passanten, die er um Hilfe bitten konnte. Jeff entdeckte kein Versteck, das ihn verbergen würde.
Vor wenigen Minuten hatte er noch geglaubt, sein älterer Bruder würde ihm mit seinen Freunden einen Streich spielen. Vielleicht aus Ärger darüber, dass ihre Mutter ihn losgeschickt hatte, um Jeff heimzuholen, der seine Trick-or-Treat-Tour nach Süßigkeiten weit über die vereinbarte Zeit ausgedehnt hatte.
An jeder einzelnen Haustür der letzten zehn Häuser war sicher gewesen, dass er das letzte Mal an diesem Halloweenabend klingelte, um seinen Spruch »Süßes, sonst gibt’s Saures!« aufzusagen und eine Leckerei einzustreichen. Danach würde er heimgehen. Aber immer wollte er bloß noch herausfinden, welche Süßigkeiten es beim nächsten Haus abzustauben gab. Die Neugier hatte Jeff stets weitergetrieben. Dieses Jahr wollte er zudem endlich mehr Beute als sein großer Bruder nach Hause tragen, sodass der Dummkopf nicht damit prahlen konnte, wie viel mehr er bekommen hatte.
Jetzt aber wünschte Jeff sich wie nie zuvor in seinem Leben, doch auf seine Mutter gehört zu haben. Es gab sie also wirklich, solche Bösewichte, die Kinder in der Dunkelheit jagten. Es war nicht länger eine Pyjamaparty-Mutprobe mit Freunden, wer am kühnsten war und sich am weitesten vom hell erleuchteten Haus weg in die Finsternis des Gartens wagte. Die Freunde seines Bruders hätten ihn längst mit Pfefferminzbonbons und Lakritzschnecken beworfen und ihm grölend Schimpfwörter hinterhergerufen, um anschließend Bier zu trinken und um lächerliche Versuche zu starten, Mädchen zu beeindrucken. Die Schattenmänner, die ihm folgten, verhielten sich nicht wie lärmende Jugendliche, sondern ernsthaft und erbittert.
Der letzte Hoffnungsfunke, dass sein Bruder doch unter einer der schwarzen Kutten verborgen war, verlöschte vollständig, als er das Gesicht eines Mannes darunter entdeckte. Dessen grimmiger Blick zusammen mit dem blutroten umgekehrten Kreuz auf seiner Stirn überzeugten Jeff, dass etwas nicht stimmte. Sein Jedi-Kostüm schnürte ihm die Luft ab, der Kragen seines T-Shirts war zu eng für den Klumpen Angst, der in seiner Kehle feststeckte.
Er war einer der schnellsten Läufer im Leichtathletikkurs in der Schule. Was ihm beim letzten Sportfest einen netten Pokal eingebracht hatte, konnte nun hoffentlich verhindern, dass ihn diese Kerle schnappten. Die Süßigkeiten in seinem Magen, die er unterwegs in sich hineingestopft hatte, bildeten eine unangenehm klebrige Kugel, die ihm die Magensäure die Kehle hinaufjagte, aber unter keinen Umständen durfte er langsamer werden. Kurz fasste er den Plan, in die Hundehütte im Vorgarten rechts von ihm zu schlüpfen, aber die Männer waren bereits um die Ecke herum und auf seinen Fersen. Die Hundehütte wäre damit zur Falle für Jeff geworden.
»Scheiße, scheiße, scheiße«, keuchte er. Seine Verzweiflung wuchs, machte ihm die Knie weich und die Beine schwer. Lähmte ihn fast. Er zwang sich zu weiteren kraftvollen Schritten, einem nach dem anderen, bis er die drohende Starre abgeschüttelt hatte. Obwohl sich der asphaltierte Boden unter ihm sumpfig anfühlte, verlangsamte er seinen Sprint nicht. Zwar konnte Jeff sich mit seinen acht Jahren noch nicht exakt ausmalen, was Menschen einander antaten, wie manche Erwachsene Kinder quälten, aber er wusste genau, dass es schlimm wäre, falls sie ihn zu fassen bekämen.
»Ihr zwei: Da lang«, rief einer der Kuttenmänner, aber mehr bekam Jeff von ihren Plänen nicht mit. Er schaffte es nicht, sie abzuhängen, aber für den Moment kamen sie auch nicht näher an ihn heran.
Es war schließlich keiner der Männer, sondern ein Stein, der ihn einholte. Einer, der ihn kräftig am Hinterkopf traf und ihm sofort das Bewusstsein nahm. Vor seinen Augen war es schwarz, bevor sein Körper auf dem Asphalt aufschlug.
Dröhnende Kopfschmerzen, die an einer Stelle hinten an seinem Kopf in einer Beule gipfelten, waren das Erste, was Jeff später wieder wahrnahm. Dann spürte er die Kälte, die der harte Boden unter seinem Rücken ausstrahlte, und einen schwefelhaften Gestank wie nach verdorbenen Eiern machte er in der Luft aus. Seine Brust war entblößt und seine Arme und Beine waren ausgestreckt gefesselt worden. Zuletzt schmeckte Jeff die bittere Angst, die wie Pech Gaumen und Zunge verklebte. Wäre ihm nicht so kalt gewesen, hätte Jeff angenommen, dass er in der Hölle gelandet war.
Seine Kehle wurde eng und die Süßigkeiten in seinem Magen schienen zu brodeln, sodass Jeff meinte, er würde sich gleich übergeben müssen. Mehr als ein Würgegeräusch verließ aber nicht seinen Mund. Er konzentrierte sich auf seine Umgebung und erkannte, dass er sich in einer abgedunkelten Scheune oder in einer Lagerhalle befand. Kerzen flackerten hier und da, sorgten aber nur für spärliches Licht, sodass Jeff kaum etwas von seiner Umgebung erkannte.
Aus den ihn umgebenden Schatten traten einige in Kutten gekleidete und hinter Totenkopfmasken versteckte Menschen hervor. Jeff wäre es lieber gewesen, er wäre allein geblieben. Ein Wimmern entfuhr ihm, da hier gewiss niemand war, der ihm helfen wollte. Die bestimmt fünfzehn, vielleicht auch zwanzig Gestalten bildeten einen Kreis um ihn herum, der einen ungefähren Durchmesser von fünf Metern hatte.
Einer dieser dämonenhaften Schemen trat hervor und hielt in seiner locker zur Seite herabhängenden Hand einen silbernen Dolch. Jeffs Mund wurde trocken und er schluckte beschwerlich die Magensäure herunter, die seine Kehle hinaufgestiegen war. Er wollte nicht glauben, dass er in diese Lage geraten war. Er musste träumen, anders durfte es nicht sein. Aber die Angst, die schwer wie ein Nachtmahr auf ihm lag und ihm die Luft aus der Lunge presste, war stärker als in jedem Albtraum zuvor. Der Mann kam auf ihn zu und blieb neben ihm stehen. Die Leute begannen rhythmische, aber für Jeff unverständliche Wörter zu sprechen. Es klang für ihn nach Kirche, fühlte sich aber ganz anders an.
Völlig unvermittelt ging der Mann neben Jeff auf die Knie. Langsam hob er den Dolch über seinen totenkopfmaskierten Kopf und streckte ihn so weit nach oben, wie er konnte. Er bewegte die Klinge so, dass sie ein umgekehrtes Kreuz in die Luft schnitt. Der Mann betete eindeutig ein höheres Wesen an, das jedoch gewiss nicht der Gott war, an den Jeffs Eltern ihre Gebete richteten.
Endlich fand Jeff seine Sprache wieder und auch den Mut, sie zu benutzen. »Bitte, lassen Sie mich gehen. Bitte«, wisperte er. Mehrfach hatte er die Wörter »Satanas« oder Satan gehört und er bezweifelte nicht länger, wozu er hier war.
Der Satanist senkte die Klinge auf Jeffs Brust. Die Spitze pikte ihn, jedoch ohne ihm ernsthafte Schmerzen zu bereiten. Der Mann in der Kutte bewegte den Dolch eine Weile nicht, bis Jeff beinahe zu hoffen wagte, es würde gar nicht mehr geschehen. Doch dann erhöhte sich der Druck und der Teufelsanbeter schnitt eine brennende, blutende Spur in Jeffs Fleisch, ohne Rücksicht auf seine Schreie zu nehmen. Jeff wand sich, flehte, doch seine Marter hörte nicht auf. Mehrere Linien ritzte der Kuttenmann in seine Haut und jede einzelne schmerzte mehr, als jedes aufgeschlagene Knie und jeder blaue Fleck, die sich Jeff bisher zugezogen hatte. Als der Mann das Messer wieder absetzte, erkannte Jeff einen Satansstern, ein blutiges Pentagramm, auf seinem Körper.
Jeff wurde es schwindelig und die Ränder seines Sichtfelds verschwammen und pulsierten. »Ihr habt mein Blut. Lasst mich gehen. Lasst mich doch bitte, bitte einfach gehen«, schrie Jeff und rang nach Atem. Er verstand nicht, was sie noch haben wollten. Tränen liefen über seine Wangen. Die ersten seit Jahren, für die er sich auch vor seinen Freunden nicht schämen würde. Er wusste nicht, warum gerade ihm so etwas angetan wurde. Aber Jeff bezweifelte nicht, dass sie noch Schlimmeres mit ihm vorhatten.
Rings um ihn herum fielen einige der Sektenmitglieder auf die Knie. Derjenige aber, der ihn geschnitten hatte, schlenderte gemütlich den Kreis entlang. Jeder, den er passierte, sagte dieselben Worte in dieser für Jeff unverständlichen Sprache. Einen der Niederknienden ohrfeigte er, sodass dieser sich erhob und zurück auf seinen vorherigen Platz im Kreis trat. Nach einer Dreivierterunde blieb er schließlich vor einer Kuttengestalt stehen. Diese beugte sich weiter vor, bis die Gestalt mit dem Stirnbereich seiner Schädelmaske den Boden berührte.
Dann erhob der Kuttenmann sich, nahm das Messer entgegen und kam mit ausladenden Schritten geradewegs auf Jeff zu. Aus der Nähe erkannte Jeff, dass seine Schädelmaske das exakte Ebenbild derer des Satanisten zuvor war. Ein Schluchzen entrang sich seiner Kehle. Jeff befürchtete, dass das, was diese Gestalt ihm antun würde, noch schlimmer werden würde als die Verletzungen davor. Er wollte heim. Heim in sein Zimmer, zu seinen Spielsachen und vor allem wollte er zu seiner Familie. Sogar seinen großen Bruder, der ihn ständig ärgerte, vermisste er mit einer Inbrunst, die er nicht kannte. Sein Herz zog sich vor Kummer und Sehnsucht zusammen.
Vielleicht waren es zwei oder drei dieser unverständlichen Sätze, dann presste der Satanist den Dolch links an Jeffs Kehle. Die anderen Kuttengestalten fielen in die Beschwörungen mit ein. Der Druck war so enorm, dass er es nicht mehr wagte, zu atmen, denn sonst würde die Klinge seine Haut zerschneiden und sein Blut vergießen.
Dann spürte Jeff, wie der Stahl seine Haut durchdrang, und der Schmerz trat hinter der Erkenntnis in den Hintergrund, dass er sterben würde. Er würde sich nicht am nächsten Tag mit seinem besten Freund zum Spielen treffen. Er würde nicht mehr nach Hause zurückkehren. Dabei hatte er wegen des fehlenden Windes in den letzten Tagen noch gar nicht seinen neuen Lenkdrachen ausprobiert. Hilflos huschten seine Augen hin und her, bis zuletzt auf der Suche nach einem Ausweg aus dieser Hölle.
Der Chor der Stimmen steigerte sich zu einem donnernden Flehen, einige fielen auf die Knie, andere bogen ihren Rücken durch und breiteten die Arme aus. Das Wort »Diabolus« wiederholten sie so oft, bis es schier pulsierend in einem gemeinsamen Rufen gipfelte.
Die klaffende Wunde in Jeffs Kehle brannte wie das Höllenfeuer, dem er geopfert werden sollte. Er spürte, wie das Leben zusammen mit seinem Blut aus seinem Leib rann. Panik hielt ihn noch einige Herzschläge lang wach, dann ersetzte eine allumfassende Schwäche seinen Körper und dämpfte auch seine Gefühle. Die Angst wurde stumpfer und entglitt ihm. Die Schatten an den Rändern seines Sichtfeldes wurden immer größer, bis die Dunkelheit ihn umschloss.
Ein Jahr später
Drei Tage vor Halloween in einer anderen Stadt
ZWEI.
Kürbisfratzenschnitzen
Ella
Mit einem beherzten Griff förderte Ella eine Handvoll Innereien zutage und warf sie in die bereitstehende Schüssel, sodass das matschige Geräusch, mit dem sie dort landeten, ihre beste Freundin Hailey zum Lachen brachte.
»Was für eine ekelige, schleimige Schweinerei«, sagte sie und warf ihrerseits ebenfalls Kürbiskerne samt ausgehöhltem Fruchtfleisch dazu. »Ich liebe das. Könnte ich öfter als einmal im Jahr machen. Allein dieser fruchtige Kürbisgeruch. Himmlisch.«
»Hättest dich vielleicht doch zum Töpferkurs in der Uni anmelden sollen, wenn du so versessen darauf bist, zu basteln. Da kannst du dir auch die Hände schmutzig machen. Und zwar das ganze Semester lang.«
Hailey mimte ein entsetztes Gesicht. »Töpfern? Never. Wie sehr musst du mich eigentlich hassen, dass du mir so etwas vorschlägst?« Eifrig kratzte sie mit einem Löffel in ihrem Kürbis herum, um möglichst viel Fruchtfleisch herauszuschaben. Die Zunge hatte sie zwischen ihren Lippen eingeklemmt, wie immer, wenn sie sich konzentrierte. Kurz arbeitete sie noch weiter, dann sah sie auf und meinte: »Töpfern würde ich nicht mal, wenn Dylan im Kurs wäre. Du weißt schon, der aus Antiker Geschichte. Der ist heiß!«
Ella lachte. »Du würdest sogar einen Pathologiekurs machen und Leichen statt Kürbissen ausnehmen, wenn der dabei wäre!«
»Okay, wahrscheinlich stimmt das. Aber Pathologie finde ich auch ohne Dylan ziemlich interessant. Wie es wirklich da drinnen aussieht, kann man sich wahrscheinlich kaum vorstellen«, gestand Hailey. »Obwohl es dazu im Internet bestimmt einige Videos gibt, oder? Wären unsere Hände nicht so schleimig vom Kürbis, könnten wir direkt danach suchen. Aber wie es riecht und das Gefühl, durch Haut zu schneiden und dann den Brustkorb aufzubrechen, können sie einem auch nicht vermitteln.« Hailey grinste spitzbübisch.
»Also darauf kann ich gut verzichten.« Ella schüttelte lose geschabtes Fruchtfleisch direkt aus ihrem Kürbis in die Schüssel. »Ich schau mir lieber sexy Bauchmuskeln mit Haut darüber an als das Gedärm darunter.«
Einträchtig kratzten beide weiter in ihren Kürbissen herum, bis Ellas Cousine die sie zum Kürbisfratzenschnitzen eingeladen hatte, die Küche betrat. Die Küchen in ihren Wohnheimen waren das genaue Gegenteil von Kaylas großem, sauberem Kochparadies. Nichts dort war so sauber, dass Ella mit Genuss hätte kochen wollen. Manche Krusten wirkten so alt, dass ihnen mit Sicherheit bald Beine wachsen würden, damit sie endlich aus der Küche flüchten könnten.
Ellas Cousine Kayla, die hier zusammen mit ihrem Freund und ihrem Sohn Dan lebte, betrachtete die Arbeit der beiden und lobte die Kürbisfratzen, die sie mit wasserfestem Filzstift auf die Schale vorgezeichnet hatten. Nachdem sie den Plastik-Triceratops weggenommen und stattdessen eine Tasse unter die Kaffeemaschine gestellt hatte, drückte sie auf die Cappuccino-Taste. Sobald das Rauschen leiser wurde, erklärte sie ihnen, welchen Kürbis sie selbst zu Halloween schnitzen wollte.
»Ein großer, der einen kleineren zerkaut?«, wiederholte Hailey mit funkelnden Augen. »Cool, so einen mache ich nächstes Jahr auch. Hättest dich uns ja auch anschließen können.«
»Zuerst muss ich noch Dans Piratenkostüm fertignähen. Ich schalte euch mal das Radio an, mit ein bisschen Musik macht das Schnitzen mehr Spaß«, sagte sie. Kaffeeschlürfend zog sich Kayla wieder ins Wohnzimmer zurück.
»Deine Cousine ist cool, echt praktisch, dass sie hiergeblieben ist nach ihrem Studium. Am liebsten würde ich meine Mutter gegen deine Cousine eintauschen«, sagte Hailey ganz nebenbei und nickte zum Takt des rockigen Halloweenlieds, das der örtliche Radiosender spielte. »Meine Mutter ...« Hailey seufzte und kratzte mit mehr Kraft an ihrem Kürbis herum.
Ella ließ den Löffel sinken und legte ihn für den Moment zur Seite, damit sie ihn nicht zur Musik auf die Tischplatte klopfen würde. »Was hat sie dieses Mal wieder gemacht?«, fragte sie und hatte ein mulmiges Gefühl im Bauch. Haileys Mutter war bekannt dafür, dass sie die Pläne der Freundinnen durchkreuzte, was früher ein bedeutend größeres Problem gewesen war als heute, wo sie beide von zu Hause ausgezogen waren.
Ehe Hailey antwortete, nahm sie eins der größeren Messer zur Hand, die sie zum Schnitzen bereitgelegt hatten. Träumerisch musterte sie es. »Ich könnte sie manchmal wirklich umbringen. Ich stelle mir vor, wie es danach wäre, und weißt du was: Es wäre besser. Sie ist so unerträglich! Sie hat wieder angerufen und an allem, wirklich allem etwas auszusetzen gehabt.« Hailey war ein Einzelkind und obwohl sie alt genug war, um eigene Entscheidungen zu treffen, versuchte ihre Mutter sich weiterhin einzumischen, wo sie konnte. Letzten Endes setzte Hailey die finanzielle Unterstützung aufs Spiel, wenn sie sich nicht an die Wünsche und Forderungen hielt, die ihre Mutter von sich gab. Schlimmer als ein verminderter Geldeingang auf dem Konto konnte aber die schneidende Missbilligung ihrer Mutter sein: Sie zeigte einem, was sie von einem hielt, und das auf sehr deutliche Weise. Irgendwie schaffte es die Frau, dass man ihr gefallen wollte, als spräche sie einen Fluch über ihre Mitmenschen.
»Sie hält nichts von der Halloweenparty, oder? Komm schon, das kann sie doch nicht machen. Das ist sogar für sie zu heftig. Deinen Unikram kannst du sonst wann machen. Du bist Studentin, sie kann doch nicht erwarten, dass du alle Partys auslässt. Verdammt noch mal, du bist zweiundzwanzig, was hat sie sich da einzumischen?« Ella ließ die Tischkante los. Auch sie war dünnhäutig geworden, was Haileys Mutter anging. Am liebsten hätte sie Hailey zum sicherlich hundertsten Mal gefragt, warum sie es überhaupt zuließ, dass ihre Mom sich derartig einmischte. Aber dieses Thema löste immer öfter denselben Streit aus, den sie jetzt nicht führen wollte.
»Ganz so schlimm ist es zum Glück nicht.« Hailey rammte das Messer in das vorgezeichnete Auge des Kürbisses und grinste kurz schief. »Sie findet das Hexenkostüm, das ich auf der Party tragen will, zu aufreizend. Sie hat mein Selfie auf Instagram gesehen.«
»Nein, das steht dir so megagut. Du wärst die heißeste Hexe der Welt, Hay!«
»Genau das ist das Problem. Ich soll etwas anziehen, das nicht so nuttig aussieht, findet sie.«
»Hat sie das gesagt? Dass du nuttig damit aussiehst?« Ella klappte ihren Mund zu, sobald ihr aufgefallen war, dass er ihr vor Verblüffung offen stand.
»Nein, was denkst du denn?« Hailey ahmte die Stimme ihrer Mutter auf möglichst unschmeichelhafte Weise nach: »›So gehst du doch nicht vor die Tür. Du siehst darin billig aus, das willst du ja wohl nicht! Ich habe garantiert keine Tochter großgezogen, die ihren Körper verkauft.‹ Als ich ihr dann gesagt habe, lieber billig als verklemmt, hat sie wieder so bescheuert mit der Zunge geschnalzt, du weißt schon. Ich habe das Gespräch, so schnell es ging, beendet, bevor mir noch was rausrutscht, was ich mir besser verkniffen hätte.«
»Und jetzt?«
Hailey machte ein entschlossenes Gesicht. »Jetzt müssen wir mir ein zweites Kostüm besorgen. Aber ich habe eine Idee: Ich kaufe eins, das ich über das Hexenoutfit ziehe, und nachdem ich ein paar Selfies darin gemacht habe, lege ich es dann einfach ab. Wenn sie einen ihrer Kontroll-Videoanrufe macht, bin ich gewappnet. Kommst du morgen nach den Kursen mit shoppen?«
Ella nickte. Vorsichtig schob sie ihren Ärmel über den Ellenbogen, damit ihr Shirt keine Kürbisflecken bekam. »Klar. Guter Plan. Oh, hör mal, im Radio bringen die was über die Satanisten.«
Die Radiomoderatorin sagte mit vor Aufregung überdrehter Stimme: »Eine Meldung kam gerade rein. Auf dem Zentralfriedhof in Bakersville wurden nicht nur Kerzenstümpfe und Tierblutreste gefunden. Es wurden auch einige Grabsteine beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen Grabschändung und wegen Störung der Totenruhe. Bakersville liegt zudem keine fünfzehn Meilen entfernt von Bloomington, wo zuletzt vermehrt Viehmorde gemeldet wurden. Ein Zusammenhang wird vermutet, der die Gerüchte über satanistische Handlungen befeuert. Ruft an, dann quatschen wir nach der Musik darüber, wie ihr zu nächtlichen Besuchen auf dem Friedhof steht. Als Nächstes habe ich aber erst einmal Marilyn Manson für euch mit ›This is Halloween‹.«
»Na ja, wenn die Sache mit den Satanisten schlimmer wird, machen die noch das komplette Wohnheim dicht. Oder am Ende ruft meine Mutter dort an und gibt Anweisung dazu. Dann ist sie aber wirklich fällig und ich bring sie um. Dafür würde ich sogar noch vor Weihnachten nach Hause fahren.«
Ella verzog den Mund. Sie kannte solche Sprüche von ihrer besten Freundin zur Genüge. Aber in der Häufigkeit wie zuletzt hatte sie früher nicht vom Ableben ihrer Mutter geträumt oder es herbeigeredet. Zwar konnte sie sich nicht vorstellen, dass Hailey ihrer Mom wirklich etwas antat, aber irgendwie machte sie sich inzwischen Sorgen und es ließ sie nicht mehr kalt wie früher, als es definitiv nur das Gerede eines genervten Teenagers gewesen war. Wenn Ella jedoch ansprach, dass sie den Kontakt einfach beenden konnte, wurde Hailey immer ziemlich still. Nachdem ihr Vater vor etwas über drei Jahren gestorben war, war ihre Mutter alles, was ihr an Familie blieb. Ella vermutete, dass sie das nicht aufgeben konnte.
»Denkst du, du könntest deine Mom wirklich umbringen. Also im Ernst?«
»Was weiß ich. Ich kann nur hoffen, dass die Satanisten sie sich schnappen. Aber sogar denen ist die wohl zu heftig.«
Ella lehnte sich zurück und ließ ihren Kürbis stehen. »Ich glaube nicht, dass ich jemanden umbringen könnte. Nur, wenn es wirklich um Leben und Tod ginge, so zur Verteidigung. Stell dir vor, du müsstest ewig damit leben, dass du deine Mutter umgebracht hast.«
Hailey tat ganz sehnsüchtig, als sie antwortete: »Ja, das wäre vielleicht ein Leben.« Dann seufzte sie. »Diese Frau ist ein Unmensch. Sterben muss sie deswegen ja nicht unbedingt – noch nicht – guck nicht so, das war nur ein Spaß. Sie übertreibt es einfach maßlos mit ihrem Verhalten und ihrer Vorsicht. Als wäre ich zwölf.« Hailey rammte dem Kürbis das Messer nun auch ins andere Auge und schnitzte fleißig daran herum, sodass eine gruselig blickende Kürbisfratze entstand. »Wozu man wirklich fähig ist, merkt man erst in Extremsituationen.«
Ella widmete sich der Nase ihrer Jack O’Lantern und grübelte, ob es viel gab, was sie von der Beziehung zwischen Hailey und ihrer Mutter nicht mitbekam. Wahrscheinlich war Hailey einfach beleidigt. Wieder einmal. Sie verkniff es sich, ihre beste Freundin darauf hinzuweisen, dass sie endlich ihr eigenes Ding durchziehen sollte. Manchmal sah sie tatsächlich noch die Zwölfjährige in ihrer besten Freundin. So wie früher, als sie zusammen geübt hatten, wie man Lippenstift aufträgt, als sie geheime Liebesbriefe an Jungs geschrieben oder sie beieinander übernachtet und von ihrem Leben als Erwachsene geträumt hatten. Ella hätte sich damals nicht vorstellen können, irgendwo ohne Hailey zu sein, und auch heute konnte sie es nicht.
»Glaubst du, dass diese Meldungen über die Satanisten, die zu Halloween ein dreizehnjähriges Kind opfern wollen, stimmen?«, fragte Hailey unvermittelt. Das Messer bewegte sie nun wieder deutlich langsamer.
»Hört man alle paar Jahre wieder, oder nicht? Wir hatten auch nie irgendwelche Rasierklingen oder Rattengift in den Süßigkeiten, die wir in der Nachbarschaft eingesammelt haben. Ich wüsste auch von niemandem, dem das passiert ist, seit ich denken kann. Ich halte das für Gerüchte. Macht Halloween einfach spannender, wenn es ein paar Gruselgeschichten dazu gibt. So wie das Spukhaus.«
»Oh ja, dieses Jahr schaffen wir es komplett durch! Abgebrochen wird nicht«, sagte Hailey und machte eine siegessichere Miene.
»Uns im Vergleich zum letzten Jahr zu steigern ist auch nicht schwer«, gab Ella grinsend zurück.
»Komm schon, dass wir zum Eingang zurückgerannt sind, lag nur an den Mistratten, die uns so erschreckt haben. Damit haben wir einfach nicht gerechnet.«
Ella schüttelte sich. »Mir ist echt das Herz stehen geblieben, wenn auch nur für eine Sekunde, als mir einer mit seiner kalten Hand ins Genick gefasst hat. War das nicht Lucas? Hinter dem Vorhang hab ich ihn nicht gesehen.«
Das Radio gab eine kurze Melodie von sich, die die Aufmerksamkeit seiner Hörer wecken sollte, und bei den beiden jungen Frauen gelang ebendies. Ein anderer Sprecher, der wohl im Gegensatz zur Moderatorin von vorhin nicht für die Unterhaltung, sondern für die seriösen Nachrichten zuständig war, las mit monotoner Stimme die Meldung vor: »Alle Rinderhalter und -züchter im Umkreis von 20 Meilen um Fairview herum sind dazu aufgefordert, jedwedes Ableben und jegliche Erkrankung ihrer Tiere den Behörden zu melden. Auf einem Hof ist knapp die Hälfte des Bestands in sehr kurzer Zeit verendet und eine um sich greifende oder gar sich ausbreitende Seuche will das Veterinäramt ausschließen. Alle Informationen wie immer auf unserer Homepage unter ...«
»Viehsterben«, wiederholte Hailey. »Geht so nicht die Apokalypse los?«
»Keine Ahnung.« Ella setzte zufrieden den Deckel mit Stiel auf ihren Kürbis. Ihr Messer und ihren Löffel legte sie in die Spüle und die matschige Masse aus Kernen und Kürbisinnereien kippte sie in den Mülleimer, während Hailey noch an den scharfen Zacken sägte, die den Fratzenmund ihres Kürbisses bilden sollten. Auf der Arbeitsplatte standen Teelichter für die Kürbisse bereit.
Auch Hailey legte wenige Minuten später ihr Messer zur Seite und betrachtete zufrieden ihre Schnitzerei. Gemeinsam zündeten sie ihre Kürbislaternen an. Vor dem Küchenfenster setzte die Dämmerung ein und die beiden machten es sich zusammen mit Ellas Cousine bei einer Tasse heißer Schokolade gemütlich, um den Abend noch ein wenig ausklingen zu lassen.
DREI.
Die Sage von Little Johnny
Scott
Zusammen mit seinem Kumpel Ben saß Scott tief eingesunken in den Polstern seiner Couch und schaute einen alten Horrorfilm über einen Mann, der Augen sammelte und dabei nicht zimperlich vorging. Die Mitte des Films war erreicht und das Einmachglas des Killers, in dem er die gestohlenen Augäpfel aufbewahrte, drohte schon jetzt überzuquellen. Scott stellte die Chips-Schüssel auf den Tisch und griff sich sein Bier. »Nachschub?«, fragte er und bewegte die leere Flasche.
Ben kratzte die Bartstoppeln an seiner Wange. »Hab noch. Wusste gar nicht mehr, dass es in dem Film so blutig zugeht.«
Scott lachte. »Ja, ziemlich brutal.«
Die beiden Studenten verfolgten, wie der Mann im Fernseher zwei weitere Augäpfel ihren Höhlen entriss, als wären es Schnecken, die er aus ihrem Häuschen pulte. Die Nerven, an denen die Augäpfel bis zuletzt hingen, rissen schließlich mit einem matschigen Ploppen.
»Hast du Pläne für Halloween?«, fragte Ben, ohne sich vom Film abzuwenden.
»Klar. Ich gehe auf die Party bei Nic. Davor wollte ich wieder eine Runde durch das Spukhaus drehen. Ist irgendwie Tradition geworden. Ohne das würde mir an Halloween etwas fehlen.«
»Das Spukhaus!«, rief Ben und richtete sich auf. »Ich war zuletzt dort, da muss ich sechzehn gewesen sein. Das ist echt gruseliger Scheiß, den die dort veranstalten. Joy schleppt mich mit zu einer Party ihrer Freundinnen, aber ins Spukhaus würde ich vorher gerne mitkommen.«
»Mach das. Zusammen wird es lustiger, falls sie sich traut mitzukommen. Ein bisschen ist es schon eine Mutprobe, wenn man es noch nicht kennt. Vielleicht schaffe ich dieses Jahr sogar die Challenge.«
»Never. Das hat bis jetzt keiner geschafft.«
Scott zuckte mit den Schultern. »Zumindest wird das behauptet.«
»Dann muss ich Joy vorher nur verklickern, dass wir eine Runde durch das Spukhaus drehen, wenn sie anschließend bei ihren Freundinnen mit mir angeben will.«
»Mit dir angeben? Wer würde denn auf die Idee kommen?«
»Elendes Sackgesicht«, murmelte Ben, konnte sich ein Grinsen aber nicht verkneifen.
Im Fernseher schrie sich eine hübsche Blonde die Kehle aus dem Leib. Noch hatte sie beide Augen. Scott erinnerte sich aber, dass dem nicht mehr lange so war und der Killer mit ihr den grausamen Höhepunkt des Films veranstaltete.
Sobald der Augensammler die Blondine für seine Zwecke verschlissen hatte, ließ er ihren Körper fallen wie einen toten Fisch, dem die Kaviar-Eier entnommen worden waren. Die Kamera zoomte auf die blutigen Tränen, die ihr über die Wangen liefen.
»Wie bei Little Johnny. Der soll doch auch Blut geweint haben«, kommentierte Ben und trank sein Bier aus.
»Was? Von den Bluttränen habe ich noch gar nichts gehört. Er soll sich doch die Augen selbst ausgekratzt haben.«
Ben rutschte auf dem Sofa herum und formte sich eine gemütlichere Kuhle, in der er sitzen konnte. »Ach, komm schon, den Mist glaubst du doch nicht wirklich. Das sind nur Gerüchte. Kennst du nicht die wahre Geschichte von Little Johnny?«
»Offensichtlich nicht. Aber ich habe im Gegensatz zu dir auch nicht eine Familie, die schon immer hier gewohnt hat. Ich bin ja erst zum Studieren hergezogen. Dann klär mich mal auf.«
»Na gut. Also, vor achtzig oder neunzig Jahren soll dieser Junge gelebt haben. Timothy John Porter, genannt Little Johnny, weil er ein Nachzügler war und seine Geschwister alle viel älter waren als er.«
Scott lachte. »Wow, du fängst ja echt ganz vorne an. Über seine Zeugung ist wohl nichts bekannt?«
»Jedenfalls hat er meistens allein vor dem Haus gespielt. Er hatte so ein Steckenpferd, das er behandelte wie ein richtiges Tier. Tagein, tagaus, Sommer wie Winter ritt er, wann immer er konnte, mit diesem Holzding vor dem Haus herum, redete mit ihm, kämmte die Mähne, fütterte ihm Gras und Blätter und streichelte es.«
»Klingt jetzt schon creepy«, meinte Scott.
Ben nickte. »Wart’s ab. Ein Nachbar, Rentner und Witwer, heißt es, spazierte jeden Tag eine Runde durch das Viertel. Und immer, wenn er Johnny draußen mit dem Pferd sah, warnte er ihn, dass er sich nicht zu sehr hineinsteigern sollte. Holz war Holz und was das Kind da trieb, sei ja nicht normal.«
»Wie sympathisch.« Scott schüttelte über den Mann den Kopf. »Wie alt war Johnny denn, als der Nachbar ihm das Spiel verderben wollte?«
»Gestorben ist Little Johnny kurz vor seinem sechsten Geburtstag. Wer weiß, ab wann der Typ sich da eingemischt hat. Jedenfalls kam es dann eines Tages so, dass der Junge sein Steckenpferd irgendwo liegen ließ, vielleicht, als ihn seine Mutter zum Essen nach drinnen rief. Und als er zurückkam, war es weg.«
»Weg?«, fragte Scott nach. »Hat der Alte es genommen?«
Ben grinste schief. »Little Johnny suchte danach bis in die Nacht hinein. Er lief in der Dunkelheit die Straße hinunter, obwohl seine Mutter ihn rief. Zehn Minuten später machte sich der Vater auf die Suche nach dem Kind, aber Little Johnny wurde nie wieder lebendig gesehen.«
»Und jetzt geht die kranke Scheiße los, schätze ich.« Scott nahm seine Bierflasche, aber als er merkte, dass sie leer war, stellte er sie wieder zurück.
»Am übernächsten Tag und damit am Tag nach Halloween wurde seine Leiche im heutigen Uni-Wald gefunden. An der Stelle wächst kein Grashalm mehr. Ihm war die Zunge herausgeschnitten und die Kehle aufgeschlitzt worden und ein Pentagramm war in seine Brust geritzt worden. Außerdem war sein Gesicht blutbeschmiert. Es sah unter anderem so aus, als hätte er Bluttränen geweint. Aber seine Augäpfel hatte er noch. Nur waren sie nach oben verdreht.« Scott rieb seine Handflächen über seine Jeans an den Oberschenkeln. »Von Teufelsanhängern geschnappt und nach der dunklen Messe entsorgt.«
Ben spielte an seiner leeren Bierflasche herum und zupfte Schnipsel vom Etikett ab. »Das hat die Polizei geschlussfolgert. Seine Eltern soll das ziemlich mitgenommen haben: Johnnys Mutter landete in der geschlossenen Psychiatrie, nachdem sie das Holzpferd fand, das irgendwann von einem Unbekannten vor der Haustür abgelegt worden war. Es hatte rote Striche unter den Augen, als hätte auch das Pferd Bluttränen geweint. Sie behandelte es, als wäre es ihr Little Johnny, bis man es ihr wegnahm und sie einsperrte. Ihr Mann konnte nicht mehr mitansehen, wie sie die Mähne kämmte, die Nase streichelte und dem Holzding Kinderlieder vorsang, also brachte er sie weg. Johnnys Vater wurde zum stadtbekannten Alkoholiker, wenn man dem Gerede glauben darf. Danach ist hier zum Glück kein Kind mehr zu Halloween verschwunden. Und jetzt sollen sie zurück sein.«
»Wer? Johnnys Eltern?«
»Die Teufelsanhänger.«
Scott riss die Augen auf. »Dieselben, die Little Johnny geschnappt haben?«
»Sag mal, kriegst du denn überhaupt nichts mit? Sicherlich nicht dieselben, außer ihr Satan verleiht ihnen ewiges Leben, wovon ich nicht ausgehe. Jetzt würde ich noch eine Flasche nehmen.«
Scott holte zwei Biere aus dem Kühlschrank. »Du meinst, in der Stadt treiben sich echt Satanisten herum?«, fragte er, nachdem er sich auf die Couch gesetzt und Ben eine der beiden Flaschen gereicht hatte.
Ben trank einen großen Schluck und stieß genüsslich auf. »Zumindest welche, die sich dafür halten.«
»Verrückt.«
»Noch verrückter: Wenn man die Leute fragt, die hier leben, dann glauben nicht wenige daran, dass Little Johnny jedes Jahr an Halloween zurückkommt. Manche sagen, er skalpiert jeden, dem er begegnet, bis er die richtigen Haare findet, die ihn an die Mähne seines Steckenpferds erinnern. Andere behaupten, dass er sich in dieser Nacht an allen rächen will, die den Satan verehren, und den Rest des Jahres würde er in der Hölle schmoren und dort dem Teufel dienen.«
Scott fiel nichts ein, was er darauf erwidern sollte. Der augensammelnde Killer im Fernsehen warf sein Einmachglas an die Wand, sodass die Augen wie Murmeln davonrollten, und fesselte damit wieder die Aufmerksamkeit der beiden.
»Gleich beginnt der Showdown«, murmelte Scott und schob sich die nächste Ladung Chips in den Mund.
VIER.
Verstecken und Erschrecken
Hailey
Hailey saß allein in ihrem Wohnheimzimmer am Schreibtisch und malte mit schwarzer Tinte einen Raben, der vor einem Baum und einem Grab auf einem Totenkopf mit Vampirzähnen saß, in ihr großformatiges Notizbuch. Als ihr Handy neben ihr auf der Tischplatte vibrierte, zuckte sie so stark zusammen, dass sie fast das Bild verdorben hätte. Eine Nachricht war im Uni-Jahrgangsgruppenchat eingetroffen, die sie zuerst ignorieren wollte, um weiterzumalen. Nur wenige Striche später gestand sie sich seufzend ein, dass ihre Neugierde dafür zu groß war.
»Verstecken und Erschrecken auf dem Campus um 18 Uhr. Wer ist dabei?«, stand im Chatfenster und es wurden bereits einige nach oben gestreckte Daumen und andere zustimmende Emojis geschickt.
Lächelnd öffnete sie den Chat mit Ella. »Na, Lust?«, tippte sie lediglich.
»Und wie! Bist du dabei? Kellnerst du nicht heute Abend?«
Hailey betrachtete ihr Notizbuch. Sie hätte den Abend durchaus am Schreibtisch verbringen können. Als Nächstes wollte sie einen großen aufgehenden Vollmond zeichnen, vor dem ein paar Bäume und eine Bank auf der Hügelkuppe als Silhouetten angerissen waren. Malen konnte sie aber auch später. »Nein, eine Kollegin hat noch Stunden gebraucht. Die hab ich ihr gerne überlassen, dann hab ich bis nach Halloween frei. Bin dabei«, schrieb sie zurück.
»Toll, bis gleich«, poppte im Chatfenster auf.
Da sie leider in unterschiedlichen Wohnheimen untergekommen waren, würden sie sich wie üblich direkt an der Uni treffen. Meistens warteten sie an den Fahrradständern aufeinander und Hailey ging davon aus, dass dem auch dieses Mal so war. Sie schraubte das Tintenglas zu und spülte im kleinen Badezimmer, das zu ihrem Zimmer gehörte, ihre Füllfeder aus. Am Spiegel frischte sie ihre Wimperntusche auf und wickelte sich dann den Lieblingsschal um den Hals. Draußen war es inzwischen kalt geworden. Schnell schlüpfte sie in ihre Chucks, steckte das Handy in die Jackentasche und lief mit einer Banane durch das Wohnheim.
Während sie die Treppen hinunterrannte, klingelte ihr Handy mit der berühmten Filmmelodie aus Hitchcocks »Psycho«, die sie für ihre Mutter ausgewählt hatte. »Mom? Ich bin gerade unterwegs. «
»Was, so spät noch?« Die Stimme ihrer Mutter tat ihr in den Ohren weh. Wie zuletzt jedes Mal, wenn diese etwas sagte.
»Spät? Hast du auf die Uhr geschaut? Es ist erst kurz vor sechs. Da sind noch Kinder auf den Spielplätzen. Ella und so ein Haufen Kommilitonen bilden Lerngruppen für die nächsten Prüfungen.« Auf das verdutzte »Ach?« ihrer Mutter hin begann sie zu lachen. »Nein, wir wollten eine Runde Verstecken spielen. Auf dem Campus.«
»Aber es ist doch schon dunkel draußen. Und kalt ist es geworden.«
»Du sagst doch immer, Bewegung ist gesund. Und meine sozialen Kompetenzen trainiere ich in der Gruppe auch. Ich muss auflegen, bis bald.«
An den Fahrradständern biss sie in die Banane, schwang sich auf ihr Rad und fuhr los. Der kalte Fahrtwind schlug ihr entgegen und sie war froh, dass sie so nah an der Uni untergekommen war. Sie zog die Ärmel ihrer Jacke, so gut es mit der Banane eben ging, über ihre Hände und kuschelte sich in ihren Schal.
Kurz vor der Uni warf sie die Bananenschale in ein Gebüsch und hoffte, dass sie niemand dabei beobachtet hatte. Verrottet im Handumdrehen, dachte sie und wartete schließlich an den Fahrradständern des Westgebäudes auf Ella. An ihrem Handy verteilte sie derweil ein paar Herzen für Bilder, die ihre Freunde online gepostet hatten.
»Buh!«, rief Ella und bremste das Fahrrad kurz vor Hailey ab.
Hailey grinste sie lediglich an. Das Quietschen von Ellas Fahrrad war lange vor ihrem kläglichen Versuch, sie zu erschrecken, zu hören gewesen. »Da musst du dir aber nachher mehr Mühe geben, falls du wirklich wen erschrecken willst.«
Ella sagte: »Hätte mich das klapprige Ding hier nicht verraten, wärst du aus der Haut gefahren.«
»Und was hättest du dann mit meiner schönen weichen Haut gemacht?«
Ella schnitt eine Grimasse und sagte: »Erzähl du es mir.«
Hailey grinste in bester Schurkenmanier. »Verkauft. Irgendein Perverser hätte seinen Spaß damit gehabt. Auf welche Weise auch immer.«
Beide lachten und sobald Ella wieder Luft schnappen konnte, sagte sie: »Hailey, du bist so ekelhaft.« Ellas Fahrradschloss rastete mit einem Klicken in den Verschluss ein und die beiden spazierten zum von Universitätsgebäuden umgebenen Innenhof, wo bereits einige ihrer Kommilitonen eingetroffen waren. Noch bildeten sich die üblichen Grüppchen, die laut miteinander sprachen, Flaschen in braunen Tüten verborgen herumreichten und Späße trieben, bis alle, die kommen wollten, da waren.
»Ich hätte nicht gedacht, dass wir zwei in unserem Leben noch mal zusammen Verstecken spielen«, sagte Hailey.
Ella zuckte mit den Schultern. »Die Version mit dem Erschrecken macht bestimmt Spaß. Außerdem hat irgendwer garantiert Hochprozentiges dabei. Das wird lustig.«
Sie begrüßten anschließend Joy und Dylan, die beide darüber spekulierten, warum einer ihrer Dozenten so kurz nach Semesterstart von der Uni abgegangen war, sodass nun seine studentische Hilfskraft das Seminar leitete.
Joy sagte: »Der musste in ein Zeugenschutzprogramm und sich vor irgendeiner Mafia oder einer Drogenbande verstecken.«
»Was soll er denn beobachtet haben? Und wann und wo?« Dylan schüttelte den Kopf. »Ich bin mir sicher, dass der was mit einer Studentin hatte und fristlos entlassen wurde.«
Ella seufzte. »Das wäre viel zu öde. Lebt er denn noch? Vielleicht hatte er ja einen Autounfall.«
»Oder er ist der Chef der Satanisten und hat jetzt Wichtigeres zu tun als zu unterrichten.«
Sie lachten und dachten sich weitere verrückte Geschichten darüber aus, was aus dem Dozenten geworden sein könnte.
Joshua, einer der Vorsitzenden der Studierendenvertretung an der Uni, klatschte kräftig in die Hände. Er stand auf der Treppe, die zu den Haupteingangstüren ins Gebäude führte. Hailey und Ella beendeten das Gespräch mit Dylan und Joy und drehten sich gespannt zu Joshua um.
Als endlich die meisten der Studierenden still waren – irgendjemand quatschte immer – erhob Joshua seine Stimme, ohne zu schreien: »Cool, dass ihr alle da seid. Dann lasst uns loslegen. Wir brauchen circa …«, er zählte mit ausgestrecktem Zeigefinger grob die Teilnehmer ab, »sagen wir zehn Leute, die suchen, damit es nicht zu lange dauert, und der Rest versteckt sich. Wer erschreckt wird, ist raus, egal ob er gesucht hat oder sich versteckt hat. Jeder darf jeden erschrecken. Alle, die raus sind, versammeln sich wieder hier.«
»Und was ist mit denen, die gefunden, aber nicht erschreckt wurden?«, fragte Joy.
»Okay, ihr könnt abstimmen. Wer ist dafür, dass die auch raus sind?« Joshua wartete kurz und zählte die erhobenen Hände. »Und wer ist dafür, dass die sich einfach noch mal verstecken? Gut, das ist die Minderheit. Dann sind die Gefundenen, aber Unerschreckten ebenfalls raus.«
Ein Student meldete sich und Joshua rief ihn auf. »Was ist denn, wenn die Sucher alle erschreckt und raus sind, bevor alle gefunden wurden?«
Chloe, Ober-Schwester aus der angesagtesten Verbindung, seufzte. »Leute, lasst uns endlich loslegen, okay? Wenn niemand mehr sucht, geht es eben von vorne los. Wir schicken dann eine Nachricht in den Uni-Chat, dass alle wieder herkommen.«
»Die Cleverness hätte ich dir gar nicht zugetraut«, rief jemand, aber Hailey wusste nicht, zu wem die Stimme gehörte. Pfiffe ertönten, dann Gelächter. Chloe suhlte sich förmlich in der für Hailey eher zweifelhaften Aufmerksamkeit und wischte sich eine Haarsträhne hinters Ohr.
Joshua bedeutete allen, wieder still zu sein. »So, Leute, wer möchte suchen? Das sind zu viele. Dann such ich eben ein paar aus.« Er zeigte auf einige Kommilitonen, die nach vorne kamen. »Ich suche mit euch«, fügte er grinsend hinzu. »Wir schließen jetzt für eine Minute die Augen und ihr könnt euch auf dem Campus verstecken, im Uni-Wald und um die Turnhalle und den Sportplatz herum, okay? Aber nicht weiter als bis zur Projekthütte.« Die Sucher drehten sich um und begannen mehr oder weniger synchron, aber lauthals bis sechzig zu zählen.
»Bis später«, sagte Hailey zu Joy und Dylan. Sie und Ella würden sich zusammen verstecken, aber zu viert wären sie zu leicht zu finden. Sie rannten Seite an Seite über den Campus, weg von den Suchern, wie die meisten.
»Hinter die Turnhalle oder in den Wald?«, fragte Ella.
Hailey beobachtete das Treiben um sich herum: Manche wankten ganz ordentlich von den Getränken, die sie mitgebracht hatten. Viele rannten zur Turnhalle. »Definitiv in den Wald«, sagte sie. Der Uni-Wald konnte zwar mit einem richtigen Wald nicht mithalten, aber er war größer, als man es von einem Unigelände annehmen würde. Die Stadt hatte der Universität ein Nutzungsrecht eingeräumt, was nicht wenige Dozenten gerne beanspruchten. Nicht nur einige Biologie- oder Erdkundekurse führten Projektarbeiten im Wald durch; im Sommer wurde der Unterricht manchmal nach draußen verlagert und viele Studenten verbrachten ihre Freistunden gerne dort.
Hailey und Ella rannten auf den artenreichen Mischwald zu, der gierig mit seinen Schatten nach ihnen zu greifen schien. Als sie die Baumgrenze endlich hinter sich ließen, wurde es dunkler. Das Licht der Straßenlaternen erreichte sie hier nicht mehr und es war, als würde die Finsternis sie verschlucken. Kälte kroch über ihre Körper, und das lag nicht nur an den Temperaturen: Es war etwas anderes, nachts hier zu sein als tagsüber mit einem Kurs samt Dozent. Hier, in dem Wald, wo vor beinahe hundert Jahren die Leiche eines Kindes gefunden worden war. In der Unistadt hatte es gar keine andere Möglichkeit gegeben, als dass sich zahllose Legenden und Mythen um Little Johnny und um seinen Tod gebildet hatten. Hailey nestelte an ihrem Schal herum. Sie glaubte nicht an Geister und wollte Spaß am Versteckspiel haben, statt sich irgendwelche Ängste einzureden. Little Johnny würde nicht neben ihr im Gebüsch auftauchen, um sie zu skalpieren. Er würde sie nicht mit seiner kleinen toten Kinderhand anpacken und ihr auch nicht in den Nacken atmen, wenn sie hinter einem Baum kauerte.
»Wenn wir auf dem Weg bleiben, finden sie uns sofort«, sagte ein paar Meter vor ihnen Grace, eine Mathematikstudentin.
»Sie hat recht«, meinte Hailey. »Komm mit.« Sie liefen quer durch den Wald, wo das Gestrüpp nicht so dicht war, und stiegen über einige Farne. Äste und Laub knisterten unter ihren Schuhen, während sie sich grob in Richtung Projekthütte hielten, aber das Gemurmel der anderen Studierenden wurde langsam leiser. Hailey genoss das Spiel, weil die Gänsehaut unter ihrer Jacke nicht nur von der Kälte kam. Nachts im Wald zu sein ließ ihr die Nackenhaare zu Berge stehen. Knackende Äste und raschelnde Blätter bildeten zwar die typische Geräuschkulisse eines Waldes, aber wer konnte schon sicher sein, dass die Laute tatsächlich von Tieren kamen und nicht von einem umherstreifenden Irren stammten? Die sie umgebenden Schatten verhießen Abenteuer und hüllten sie in Geheimnisse ein, die es zu ergründen galt. Jedes Geräusch konnte eine unerkannte Warnung vor einer sich nähernden Gefahr sein – oder auch nicht. »So weit wie möglich weg vom Start. Kann doch nur vorteilhaft sein, oder?«
Ella nickte. »Weißt du, was wir machen? Wir suchen uns ein megagutes Versteck bei der Projekthütte. Dann beobachten wir. Legen uns auf die Lauer. Und wenn die Sucher kommen, schleichen wir in großem Bogen um die herum und verziehen uns.«
Hinter einer Hecke, deren Dornen Hailey immer wieder durch die Jeans pikten, blieben sie dann in Deckung und lauschten, ob ihnen jemand auf den Fersen war. Beim Warten darauf, dass irgendetwas geschah, schaute sich Hailey im Wald um, während Ella an ihren Fingernägeln herumspielte. Ihre Pupillen hatten sich bemerkenswert gut an die Finsternis gewöhnt, aber zwei Meter vor ihr, am Boden vor einem Stamm, lag etwas Weißes, das sie nicht identifizieren konnte. Es war kein Pilz, es war keine Pflanze und für einen Stein wirkte es zu ebenmäßig und zu hell, wenn nicht einfach so ein Marmorbrocken im Wald herumlag. Hailey wurde unerträglich neugierig, weil ihr Gehirn schlichtweg nicht begriff, was dort liegen mochte. »Guck mal, siehst du das Weiße dort vor dem Baum? Was ist das?«
»Keine Ahnung.« Ella klang ziemlich gelangweilt und Hailey verdrehte die Augen. Ihre beste Freundin hatte zu Recht kein naturwissenschaftliches Fach, sondern die sehr theoretische Betriebswirtschaftslehre gewählt. Zur Naturforscherin war sie jedenfalls nicht geboren.
»Ich geh mir das anschauen.« Zuerst spähte sie in den Wald und als keiner der Sucher in den Schatten zu erkennen war, setzte sie sich in bester Ninja-Manier in Bewegung. Ella beobachtete das Schauspiel, das Hailey ihr bot, und schüttelte dazu zwar vermeintlich missbilligend über Haileys kindisches Verhalten den Kopf, aber ihr breites Grinsen verriet ihre Erheiterung. Die beiden zwinkerten sich zu. Geduckt und ohne verräterische Geräusche zu verursachen, drang Hailey zu dem Ding am Boden vor. Noch bevor sie es erreicht hatte, fiel endlich der sprichwörtliche Groschen. Aus der Nähe erkannte sie Ausbuchtungen, Wölbungen und Löcher besser als vom vorherigen Versteck aus.
Vor ihr lag ein Tierschädel. Wegen der kleinen Knubbel, die wie gerade durchbrechendes Geweih aussahen, vermutete sie, dass es der eines Rehs war. Von anderen Knochen fehlte jegliche Spur. Der Schädel war blitzblank sauber: weder Fell- noch Hautreste hingen daran und er war in unversehrtem Zustand. Sie ging in die Hocke und dachte an das Gehirn, das sich einstmals im Schädel befunden hatte. An die wie beim Hund feuchte Nase. Sie überlegte kurz, welche Eindrücke das Tier in seinem Leben gesammelt haben mochte, was die Augen in den nun leeren Höhlen wohl zuletzt erblickt hatten und wie der Schädel letztendlich hierhergekommen sein konnte. Wer es eher erlegt hatte: Mensch oder Tier? Möglicherweise war es auch an einer Krankheit verendet. Sie fragte sich, wie sie reagiert hätte, wenn sie nicht den Schädel eines Tieres, sondern den eines Menschen gefunden hätte. Wie den von Little Johnny.
Ein Schauer schüttelte Haileys Körper und die Schatten schienen näher an sie heranzukriechen. Langsam streckte sie die Hände aus. Sie war sich nicht sicher, ob sie den Tod anfassen wollte, der da vor ihren Fingerspitzen lag und die Berührung eines Lebewesens ersehnte. Der vielleicht danach lechzte, auch auf sie überzuspringen, sodass bald ihr blanker Schädel auf dem Waldboden lag, um gefunden zu werden. Entschieden packte sie zu und erhob sich. Sie hielt den Tierkopf etwas auf Abstand vor sich und schaute ihm in das nicht mehr vorhandene Gesicht. Nachdem ihn Hailey gründlich gemustert hatte, stapfte sie zu Ella zurück. »Ein Tierschädel. Irgendeine Wildart, schätze ich.«
»Schmeiß das Ding weg, das ist ja eklig«, sagte Ella und betrachtete fasziniert den Schädelknochen. Hailey drehte ihn für sie ein wenig hin und her. »Wie kommt das Ding hier her? Leben etwa Rehe im Uni-Wald? Ich habe zumindest noch nie eins gesehen. Und welches Tier jagt die überhaupt?«
Hailey ergänzte: »Außer dem Menschen, der den Kopf als Trophäe bestimmt mitgenommen hätte?«
»Ich dachte, hier in der Gegend gäbe es momentan keine Bären mehr.«
Hailey versuchte, ihr aufbrodelndes Lachen zu ersticken, indem sie ihren Mund in ihre Armbeuge drückte, um nicht zu laut loszuprusten. »Weißt du noch, damals, als du dachtest, dass in deinem Garten-Spielhäuschen ein Grizzlybär lebt?«
Ella seufzte theatralisch, aber breit grinsend. »Wie könnte ich das vergessen, wenn du mir das ständig vorhältst?«
»Du hast dich den ganzen Sommer geweigert, in euren Garten zu gehen«, ein kurzer Lachflash schüttelte Hailey. »Nur um am Ende herauszufinden, dass ... dass ...« Wieder lachte Hailey sich schlapp.
»Dass es nur ein Waschbär war. Ich weiß gar nicht, warum du das so lustig findest.« Ella musste selbst kichern. »Dieses kleine flohverpestete, tollwütige Killervieh hat echt böse ausgeschaut. Wir hätten uns wer weiß was geholt, wenn wir da reingegangen wären.«
»Aber Waschbären fressen keine kleinen Mädchen. Können die überhaupt brummen wie ein Bär?!« Hailey wischte sich eine Lachträne aus dem Augenwinkel. »Außerdem hast du ihn gar nicht gesehen. Ich war todesmutig und habe sie durchs Fenster entdeckt. Und deine Mum hat ihn dann ›ausgesiedelt‹. Ich hoffe, sie hat ihm nichts angetan.«
»Bestimmt nicht.«
Nachdem sich die beiden wieder beruhigt hatten, legte Hailey den Tierschädel ins Gebüsch. »Vielleicht hole ich ihn mir morgen und stelle ihn in mein Zimmer. Sieht fast aus wie von einem Mini-Teufel mit den Hörnern.«
Keine zwei Minuten später, als Ella gerade mit gesenkter Stimme von den Ohrringen erzählte, die sie sich unbedingt kaufen wollte, waren Schreie am Waldrand zu hören.