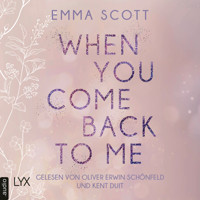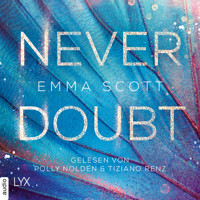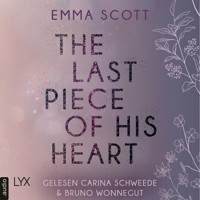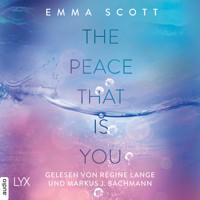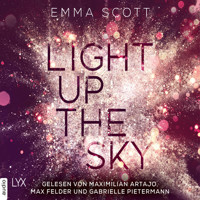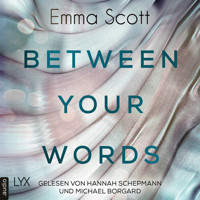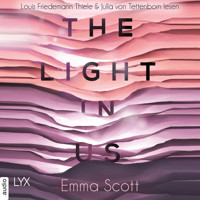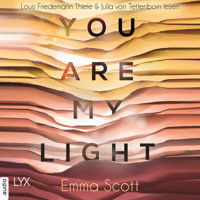9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: All-In-Duett
- Sprache: Deutsch
Zu lieben ist das größte Wagnis, das Einzige, was zählt ...
Vom ersten Moment an wusste Theo, dass Kacey die Eine für ihn war. Doch sie gehörte zu dem einen Menschen, für den er alles tun, alles aufgeben würde. Theo war für Kacey bestimmt, doch sie nicht für ihn. Als ihrer beider Leben entzweigerissen wird und Kacey den Halt zu verlieren droht, ist er es, der sie vor dem Schlimmsten bewahrt. Vereint in ihrem Schmerz entwickelt sich eine tiefe Verbundenheit zwischen ihnen, die beiden den Mut gibt, wieder an ihre Träume zu glauben. Doch als klar wird, dass ihre Gefühle weit über Freundschaft hinausgehen, stehen sie vor der größten Herausforderung: ihre Versprechen einzulösen und der Liebe eine Chance zu geben.
"Danke Emma Scott für diese wundervollen Worte. Danke für all den Schmerz und jede einzelne Träne. Danke für all das "Fühlen" und all die Liebe." Bookaholic
Band 2 des All-In-Duetts
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 449
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
TitelZu diesem BuchWidmungPlaylist1. TeilProlog1. Kapitel2. Kapitel3. Kapitel4. Kapitel5. Kapitel6. Kapitel7. Kapitel8. Kapitel9. Kapitel10. Kapitel11. Kapitel12. Kapitel13. Kapitel14. Kapitel15. Kapitel16. Kapitel17. Kapitel18. Kapitel2. Teil19. Kapitel20. Kapitel21. Kapitel22. Kapitel23. Kapitel24. Kapitel25. Kapitel26. Kapitel27. Kapitel28. Kapitel29. Kapitel30. Kapitel31. Kapitel32. Kapitel33. Kapitel34. Kapitel35. Kapitel36. Kapitel37. Kapitel38. Kapitel39. Kapitel3. Teil40. Kapitel41. Kapitel42. Kapitel43. Kapitel44. Kapitel45. Kapitel46. Kapitel47. Kapitel48. Kapitel49. KapitelEpilogEpilog IIAnmerkung der AutorinDanksagungDie AutorinDie Romane von Emma Scott bei LYXImpressumEMMA SCOTT
All In
Zwei Versprechen
Roman
Ins Deutsche übertragen von Inka Marter
Zu diesem Buch
Für Kacey liegt die Welt in Scherben. Das Versprechen, das sie Jonah gegeben hat, scheint unerfüllbar. Kacey flieht nach New Orleans, um dort neu anzufangen. Doch auch wenn sie nun die Musik machen kann, die sie immer wollte, schlittert sie langsam auf den Abgrund zu. Als Jonahs Bruder Theo davon erfährt, lässt er sofort alles stehen und liegen, um sie vor dem Absturz zu bewahren. Aber auch auf Theos Seele liegt eine Last, die ihn zu zerbrechen droht. Jetzt, da er seine Familie am dringendsten bräuchte, kann er von dieser Seite am wenigsten Rückhalt erwarten. Für seinen Vater ist nichts, was er tut, jemals gut genug. Obwohl er ein ebenso talentierter Künstler ist, wie sein Bruder es war, zweifelt er an sich selbst und seinem Traum, sich als Tattoo-Artist selbständig zu machen. Erst Kacey gibt ihm das Gefühl, alles erreichen zu können. Zusammengeschweißt durch den Verlust, den sie erlitten haben, entwickelt sich zwischen Theo und Kacey eine tiefe Verbundenheit. Doch als sie begreifen, dass ihre Gefühle weit über Freundschaft hinausgehen, stehen sie vor der größten Herausforderung: ihre Versprechen einzulösen und der Liebe eine Chance zu geben.
Für Desiree, die diese Figuren in ihrem Herzen sicher für mich bewahrt, und für Tom, meinen kleinen Bruder, der Fels, an den ich mich anlehne.
PLAYLIST
Kaleo: Way Down We Go
Bishop: Like a River
X Ambassadors: Unsteady
Amy Winehouse: Love is a Losing Game
Bryan Adams: Everything I Do
Hozier: Arsonist’s Lullaby
ZZ Ward: Lil Darlin
Adele: Love in the Dark
Louis Armstrong: What a Wonderful World
1. TEIL
Full tilt: 1. mit größtmöglicher Energie oder Kraft; mit höchster Geschwindigkeit.
PROLOG
Theo
»Theo, mein Lieber, er fragt nach dir.«
Kaceys sanfte Hand drückte meine. Ich blickte die Freundin meines Bruders an und sie warf mir ein mattes, beruhigendes Lächeln zu. Noch einmal drückte sie meine Hand, dann fand ich irgendwie die Kraft aufzustehen.
Meine Mutter lächelte schwach. Sie stand an Dads Arm vor Jonahs Zimmer im Krankenhaus. Sie sah so verloren und erschöpft aus. Zerbrechlich. Dad wirkte düster, aber gleichmütig. Er stützte Mom. Aber Jonah war der Kitt unserer Familie. Ohne ihn würden wir auseinanderfallen. Es war nur eine Frage der Zeit.
Jetzt musste ich mich von meinem Bruder verabschieden. Als ich auf die Tür seines Zimmers zuging, drehte sich ein Karussell von Bildern in meinem Kopf, alle verblasst, als hätten sie zu lange in der Sonne gelegen. Jonah und ich, wie wir auf einem Jahrmarkt eine Ziege fütterten. Jonah und ich beim Schwimmunterricht. Als Kinder in Baseball-Trikots. In den Gängen der Highschool, wo Jonah ohne Mühe beliebt war und ich ihm nicht von der Seite wich. Wie ich ihn an der Uni Las Vegas besuchte, dann an der Carnegie Mellon. Wie wir in Venezuela schwimmen waren.
Wo er krank wurde … und ich nicht.
Ich schloss die Tür hinter mir und blickte zu dem Bett, in dem Jonah im Sterben lag. Eine dünne, blasse Version des gesunden Mannes aus dem Fotoalbum in meinem Kopf.
»Theo …«
Mein Bruder. Er rang nach Luft. Kämpfte um sein Leben. Während ich noch immer stark war. Stark und kurz davor, die Wände dieses verfluchten Zimmers einzureißen und die ganze beschissene Welt abzufackeln, weil es so ungerecht war.
Und doch nicht stark genug, um zu seinem Bett zu gehen und mich zu verabschieden.
Jonah schaffte es, schwach zu lächeln. »So schlimm?«
»Du hast schon schlimmer ausgesehen«, sagte ich, ging endlich zu ihm und setzte mich auf einen Stuhl neben dem Bett.
»Du kannst … mich mal.« Sein Lachen war ein entsetzlich klingendes Keuchen. Seine Hand zuckte auf dem Laken. Er hatte nicht mal die Kraft, sie zu heben. Ich nahm sie, schloss die Finger darum.
Jonahs Lächeln verblasste, und er sah mich trotz allem klar und aufmerksam an. »Ich mache mir … Sorgen … um Mom.« Er bekam immer nur genug Luft für zwei oder drei Worte, die er zwischen flachen Atemzügen hervorstieß.
»Ich kümmere mich um sie«, sagte ich.
»Und Dad … Er wird einlenken … was das … Studio angeht. Ich … glaube an dich.«
Ich bezweifelte, dass unser Vater meine Arbeit als Tätowierer jemals befürworten würde, aber in diesem Augenblick brauchte ich nicht mehr als Jonahs Ich glaube an dich.
»Hör zu«, sagte Jonah, und sein Blick war entschlossen. »Der Gefallen … um den ich … dich bitten will. Du erinnerst dich?«
Ich rutschte auf dem Stuhl nach vorn. »Sag.«
»Kacey …«
Die Frage blieb mir im Hals stecken. Ich räusperte mich. »Was ist mit ihr?«
»Du liebst sie.«
Seine Stimme war leise und schwach, aber jedes seiner Worte traf meine Brust wie ein Hammer. Ich konnte nichts sagen, mich nicht rühren. Ich stand in Flammen. Eine Million widerstreitender Gefühle kochten in meinem Inneren, raubten mir den Atem, erstickten meine Worte.
Obwohl ich meine wahren Gefühle so tief in mir vergraben hatte, dass sie niemals ans Tageslicht drangen, und ich meinen Bruder auch nie hintergehen würde … hatte er sie wahrgenommen. Das hatte er immer schon.
Er lächelte, als er meinen erstarrten Gesichtsausdruck sah. »Ich bin froh, Theo. Ich bin … erleichtert … dass du es bist.«
Ich hätte beinahe meine Stimme wiedergefunden, um ihm zu sagen, dass ich es sicher nicht war. Dass ich nichts war. Was zum Teufel wusste ich von Liebe? Rein gar nichts. Und außerdem irrte er sich.
Sie wird mich niemals lieben, weil sie nur dich liebt. Und genau so soll es sein.
»Der Gefallen …« Jonah sah mir mit all der Kraft in die Augen, die der Körper, der ihn im Stich ließ, noch hatte. »Kümmere dich … um Kacey. Bitte. Sie wird … dich brauchen. Sie ist stark. Aber wenn sie … es nicht schafft … hilf ihr … Liebe sie, Theo. Das Leben … ist kurz. Halt deine Gefühle … nicht zurück. Okay?«
Ich nickte. Weil es ihm wichtig war. Nicht, weil ich auch nur die geringste Ahnung gehabt hätte, wie ich das anstellen sollte, was er da von mir wollte.
Jonah seufzte erleichtert. Er war jetzt schon völlig erschöpft und musste sich noch von Kacey verabschieden. Von der Liebe seines Lebens. Ich durfte ihre Zeit nicht verschwenden.
Ich biss die Zähne zusammen, um die Tränen zu unterdrücken, aber sie kamen trotzdem.
Sag es. Jetzt oder nie. Du hast nie wieder die Gelegenheit.
»Ich hab dich lieb«, presste ich hervor.
»Ich dich auch«, sagte Jonah, und seine Stimme war so schwach und dünn. »Ich hab … dich lieb, Theo. Werde ich immer.«
Die Trauer packte mich mit aller Kraft und zog mich runter. Ich vergrub mein Gesicht in der Armbeuge und kämpfte die Tränen zurück. Ich musste stark sein. Für Mom und Dad und für Kacey. Für Jonah, der mir eine Aufgabe gegeben hatte.
»Ich hole Kacey«, sagte ich und fuhr mir mit dem Handrücken über die Augen.
Dann setzte ich die Füße auf und versuchte aufzustehen, kam aber nur mühsam aus dem Stuhl hoch. Noch immer hielt ich Jonahs Hand. Ich beugte mich vor, um meine Stirn an seine zu legen, ihn ein letztes Mal zu umarmen.
Mein Bruder …
Jonah seufzte meinen Namen.
»Ich kümmere mich um sie«, sagte ich mit brechender Stimme. »Ich schwöre es.«
Es war nur das halbe Versprechen, aber es war die Hälfte, die ich halten konnte.
Ich werde niemals aus diesem Zimmer rausgehen können.
Aber ich tat es. Ich verließ das Zimmer meines Bruders und lehnte mich draußen an die Wand, wankend wie ein Schiff auf hoher See.
Das war’s. Ich habe ihn ein letztes Mal gesehen, mit ihm geredet … Nie wieder werde ich mit meinem Bruder reden. Nie wieder seine Stimme hören, seine Worte …
Seine letzten Worte. Liebe sie …
Mein Blick suchte Kacey im Warteraum. Etwas, woran ich mich festhalten konnte. Etwas Reales. Sie war wie eine Bombe vom Himmel gefallen, hatte unser sorgsam geplantes Leben gesprengt, unsere Routine zerschlagen und Jonahs Pläne durchkreuzt. Zuerst hatte ich Angst gehabt, sie würde ihn verlassen, und als klar war, dass sie das nicht tun würde, hatte ich Angst, es würde Jonah zu sehr wehtun, dass sie blieb. Er würde sich nach nur wenigen Wochen von ihr verabschieden müssen.
Kacey ging zu Jonahs Zimmer. Ihr Gang war anmutig, ihr Gesicht war von Trauer gezeichnet, aber gleichzeitig brannte die Liebe darin.
Ich sah sie an, und Jonahs Wunsch hallte in meinen Ohren wider. Eine kurze, elende Sekunde lang empfand ich, ganz egoistisch, Hoffnung …
Dann zerquetschte ich sie. Bis sie tot war.
Tut mir leid, Bro. Sie gehört dir, und das wird bis ans Ende aller Zeiten so bleiben.
Aber ich konnte mich um sie kümmern. Schwarze Tage würden kommen. Wochen. Monate. Wahrscheinlich Jahre. Egal, wie lange sie mich brauchte, ich wäre für sie da.
*
Einen Monat nach der Beerdigung rief meine Mutter mich an.
»Theo, mein Lieber, Kacey geht nicht ans Telefon. Ich versuche schon seit zwei Tagen, sie anzurufen.« Ihre Stimme war brüchig vor Angst. Noch einen Schlag würde sie nicht verkraften. Und ich auch nicht.
Ich rief Kacey an. Eine automatische Ansage verkündete, dass die Nummer vorübergehend nicht erreichbar sei.
Ich rief im Luxor an, wo sie eine Stelle bekommen hatte, nachdem sie im Caesar’s gekündigt hatte. Dort sagte man mir, dass sie seit drei Tagen nicht zur Arbeit erschienen sei.
Ich fuhr zu ihrer Wohnung und hämmerte an die Tür. Keine Antwort. Ich hämmerte lauter, und eine ältere Nachbarin kam aus ihrer Wohnung.
»Sie ist weg, junger Mann«, sagte die Dame ärgerlich. »Haben Sie nicht gesehen, dass ihr Auto nicht da ist?«
»Wann ist sie weg?«
Die Frau taxierte mich aus schmalen Augen. »Vor zwei Tagen. Als würde sie sich davonschleichen, ihre eigenen Sachen stehlen. Ganz nervös.«
Mein Herzschlag verlangsamte sich, wurde zu einem schweren, ängstlichen Dröhnen. »Sie hat Sachen mitgenommen?«
»Kartons. Koffer.« Die Frau strich ihr geblümtes Hauskleid glatt. »Und diese komischen Flaschen, aus denen Kabel kamen. Keine Ahnung, was in aller Welt …«
»Lampen«, sagte ich dumpf. »Es sind Lampen aus alten Whiskeyflaschen.«
»Na, wenn Sie das sagen.«
Ich rieb mir über die Stoppeln am Kinn. Die Anspannung hatte meinen Körper verlassen, und die Trauer machte sich wieder breit.
»Sie hat einen Brief dagelassen«, sagte die Nachbarin. »Ich soll ihn nur Beverly, Teddy oder Henry Fletcher geben.« Die Frau beäugte mich. »Sind Sie einer von denen?«
»Ich bin Theo Fletcher.« Ich räusperte mich. »Sie nennt mich Teddy. Nannte. Nennt.«
»Warten Sie kurz.« Die Frau ging in ihre Wohnung und kam mit einem einmal gefalteten Stück Papier zurück. Ich überflog die Worte:
Ich kann hier nicht bleiben. Ich habe es versucht, aber es ist zu viel. Ich hab euch alle lieb. Es tut mir leid.
Kacey
Die Seite fiel mir aus der Hand wie ein welkes Blatt, schaukelte durch die Luft und landete vor meinen Füßen. Die Nachbarin sagte leise etwas und ging zurück in ihre Wohnung. Ich blieb stehen und starrte auf Kaceys Tür.
Es tut mir leid, Jonah, dachte ich, und die Worte wurden mit jedem Herzschlag lauter.
Ich hatte eine Aufgabe gehabt. Nein, nicht mal das. Nur eine halbe Aufgabe. Und ich hatte versagt.
1. KAPITEL
Theo
Sechs Monate nach der Beerdigung …
Der Wecker ging um sechs Uhr morgens. Ich schob die Hand unter der Decke hervor und machte ihn aus. Ein paar Sekunden lang ging es mir gut. Alles war in Ordnung. Dann fiel mir ein, dass Jonah tot war, und der Gedanke an den Rest des Tages traf mich wie ein Vorschlaghammer auf die Brust.
Ich atmete stockend ein und starrte an die Zimmerdecke, bis die erste Welle des Schmerzes abebbte. Dann schlug ich die Bettdecke zurück. Der beste Teil des Tages waren diese ersten drei Sekunden. Danach musste ich sofort aufstehen. Dem Schmerz vorauseilen. Irgendetwas tun, damit ich nicht den ganzen Tag wie ein Idiot im Bett lag und über etwas jammerte, was sowieso nicht zu ändern war. Aufstehen, es aus der Decke schütteln und mit einem Tritt unters Bett befördern.
Eine leise Stimme in mir flüsterte, dass ich mich lieber darum kümmern sollte. Eine Art finden sollte, mit der Trauer umzugehen, bevor ich explodierte.
Aber ich hatte ja eine Art gefunden. Ich stand auf. Ging zur Arbeit. Tat verflucht noch mal mein Bestes.
Meine Sportklamotten warteten am Fuß des Bettes, wo ich sie gestern Abend bereitgelegt hatte. Ich zog mich an, trank in der Küche einen Schluck Wasser und aß einen Proteinriegel. Die Morgensonne funkelte in den gläsernen Briefbeschwerern auf der Fensterbank – alles Jonahs Werke. In einem war eine Unterwasserszene. Als die Sonne auf das Glas fiel, sah sie richtig lebendig aus. Kacey hatte diesen Briefbeschwerer am liebsten gemocht. Sie hatte mir einmal gesagt, dass es so ruhig aussah im Inneren des Glases. Friedlich. Als sie zum ersten Mal auf Jonahs Couch aufgewacht war, hatte sie sich beim Anblick der Unterwasserszene sicher gefühlt.
Wenn ich in die Kugel hineinblickte, fühlte ich mich erstickt. Gefangen. Unbeweglich wie die Meerestiere darin.
Auf dem Weg zum Fitnesscenter kam ich an Jonahs alter Wohnung vorbei, dann drei Querstraßen weiter an Kaceys. Beide waren jetzt leer. Mit Ausnahme der Briefbeschwerer auf meiner Fensterbank und einem handgeschriebenen Brief war von dem, was ihnen gehört hatte, nichts mehr da.
An einer roten Ampel kehrten meine Gedanken zu den vier hingekritzelten Sätzen zurück, und ich grübelte über sie nach wie über einen Songtext, gefolgt von dem Refrain: Ich habe Jonah enttäuscht …
Ein Hupen hinter mir ließ mich hochschrecken: Die Ampel war grün. Ich fuhr mit quietschenden Reifen an, dann ging ich ein wenig vom Gas und versuchte, mich verdammt noch mal zu beruhigen, bevor ich noch einen Unfall baute.
Im Fitnesscenter stemmte ich Gewichte, bis meine Armmuskeln protestierten und mir der Schweiß übers Gesicht lief. Ich machte Sit-ups, bis ich mich fast übergeben musste, dann Squats mit einer Langhantel auf den Schultern, bis meine Beine zitterten.
Gute zwei Stunden lang versuchte ich, die Gefühle auszuschwitzen, die tief in mir vergraben waren. Am Ende war ich völlig erschöpft und hätte mich am liebsten noch mal hingelegt – ich bekam nicht viel Schlaf in diesen Tagen –, aber Schlafen war in meinem Tagesablauf nicht vorgesehen.
Ich duschte, zog Jeans und T-Shirt an und fuhr wieder zu meiner Wohnung zurück, um mir etwas zu essen zu machen. Dann setzte ich mich mit dem Lehrbuch Management für kleine Unternehmen an die Küchentheke. Links von mir ein riesiges Sandwich mit Spiegelei, Bacon und Tomate, rechts von mir der Laptop. Es kamen ein paar Klausuren auf mich zu, und das Lohnsteuerzeug machte mir noch Schwierigkeiten.
Nach drei Stunden konzentrierten Lernens fühlte ich mich besser. Jedenfalls, was die Klausuren anging. Ich klappte Bücher und Laptop zu und versteckte beides in einer Schublade, falls Oscar und Dena überraschend vorbeikamen. Sie fragten mir Löcher in den Bauch über mein Masterstudium der Betriebswirtschaftslehre, und ich wollte nicht darüber reden. Es war sowieso dumm. Als ob so ein dämlicher Universitätsabschluss irgendwas besser machen würde.
Das Handy klingelte, als ich gerade zur Arbeit im Vegas Ink loswollte. Auf dem Display sah ich die Nummer meiner Mutter. Genau ihre Zeit.
»Hey, Ma.«
»Hallo, Schatz. Tut mir leid, dass ich störe.«
»Du störst nicht, Ma. Du störst nie.«
»Ich wollte nur wissen, wie es dir geht.«
Sie rief jeden Tag an. Nur selten hatte sie ein echtes Anliegen oder etwas zu erzählen. In der Regel wollte sie nur Kontakt zu dem einzigen Sohn, der ihr noch blieb. Und wenn wir uns trafen, wollte sie spüren, dass ich da war: Ihre Hand wanderte zu mir, wann immer ich in Reichweite war. Ich konnte es ihr nicht verübeln – ich hatte dasselbe mit Jonah gemacht, nachdem wir erfahren hatten, dass sein Körper das Spenderherz abstieß.
»Theo?«
Ich fuhr aus meinen Gedanken hoch. »Sorry, Ma. Was hast du gesagt?«
»Ich wollte wissen, ob du etwas von Kacey gehört hast.«
»Bisher nicht. Bestimmt geht es ihr gut.« Als könnte ich das wissen, nachdem ich sie hatte gehen lassen.
Du hattest eine Aufgabe. Eine halbe Aufgabe.
»Ich wünschte, sie würde wenigstens anrufen«, sagte Mom mit falscher Leichtigkeit. »Ich frage mich, wo sie ist.«
Ich rieb mit der Hand über meine Brust, spürte den dumpfen Schmerz. »Ich muss zur Arbeit, Ma. Wenn ich was von Kacey höre, gebe ich dir Bescheid.«
»In Ordnung, mein Lieber.«
Als ich merkte, dass ich ihr höchstens sechzig Sekunden meiner Zeit gewidmet hatte, fragte ich: »Was macht ihr, du und Dad?«
»Ach, nicht viel«, sagte sie. Gott, wenn sie nur nicht immer klingen würde, als würde sie gleich in Tränen ausbrechen. »Wir würden uns freuen, wenn du, Oscar und Dena am Sonntag zum Essen kommen würdet.«
»Klar, klingt gut«, sagte ich und biss die Zähne zusammen. Etwa einmal im Monat versammelten wir uns, vor allem aus einer Art Pflichtgefühl heraus. Als schuldeten wir es den alten Erinnerungen und besseren Zeiten.
Es war jedes Mal grauenvoll.
Die Abende waren eine Tortur, nichts als steife, gestelzte Gespräche, dazu die Erinnerung an Jonahs Stimme und Kaceys Lachen. Egal wie sehr wir versuchten, sie mit lauten Gesprächen und Lachen zu übertönen, ihre Liebesgeschichte war so präsent wie das Licht von Jonahs Glaslampen. Nicht einmal Oscar konnte die Stimmung heben. Selbst er war niedergedrückt, und Denas Lächeln war schwermütig geworden.
Meine Mutter stellte sich noch an den Herd, aber oft ließ sie etwas überkochen, während sie ins Leere starrte. Sie hatte abgenommen. Genau wie Dad. Seine Blicke folgten meiner Mutter überallhin, doch mich sah er kaum an. Er sprach auch kaum mit mir. Wir waren uns nie besonders nah gewesen, aber Jonah hatte die Kluft zwischen uns überbrückt. Ohne ihn lag zwischen mir und meinem Vater ein Abgrund. Eine Distanz, die wir nicht einmal zu überwinden versuchten.
Komm zurück, Jonah, und mach, dass alles wieder in Ordnung ist. Ich kann das nämlich nicht, verdammt.
»Ich sage Oscar und Dena Bescheid«, sagte ich meiner Mom. Mein Blick wanderte zur Wohnungstür, die Autoschlüssel klimperten in meiner Hand.
»Was macht das Studium?«
»Läuft gut. Ich hab demnächst wichtige Klausuren.«
»Ich bin so stolz auf dich, Theo. Ich finde es wunderbar, was du tust. Stell dir nur vor, welche Türen dir offen stehen, wenn du nächstes Jahr deinen Abschluss machst.«
»Danke, Ma«, sagte ich und versuchte, nicht so genervt zu klingen, wie ich mich fühlte. Dass Mom stolz auf mich war, klang erst einmal gut, aber auch sie war nicht wirklich begeistert von meinem Plan, ein Tattoo-Studio zu eröffnen. Natürlich stand sie dem hundertmal positiver gegenüber als Dad, aber ich machte mir keine Illusionen. Sie war nicht besonders wild darauf, dass ich das Geld, das Jonah mir vermacht hatte, für einen Laden ausgab, in dem laute Musik lief, »schillernde Persönlichkeiten« ein- und ausgingen und ich den ganzen Tag flammende Schädel und Rosen tätowierte.
»Ach, Theo, mein Lieber, könntest du vielleicht heute Nachmittag im Supermarkt vorbeifahren? Ich habe keine Milch und keine Eier mehr.«
Ich biss erneut die Zähne zusammen. Nach der Arbeit konnte ich nicht, sonst würde ich es nie rechtzeitig zur Uni schaffen. Ich würde das jetzt erledigen müssen, bei meinen Eltern vorbeifahren und danach zur Arbeit gehen. Und zu spät kommen.
»Arbeitet Dad heute schon wieder?«, fragte ich knapp.
»Ja«, seufzte sie. »Du weißt ja, wie er in letzter Zeit ist.«
»Ja, ich weiß.« Ich rieb mir die Augen. »Ich fahre vor der Arbeit da vorbei. Bin in einer halben Stunde bei dir.«
»Danke, mein Lieber. Du bist mir eine solche Hilfe.«
»Ich muss los, Ma. Wir sehen uns gleich.«
»Wunderbar, mein Lieber. Und, Theo?«
»Ja?«
»Wenn Kacey anruft, sag ihr, dass ich nicht böse auf sie bin. Sag ihr … Sag ihr, ich möchte nur wissen, ob es ihr gut geht.«
»Natürlich, Ma.«
Ich legte auf und blickte eine Weile auf das Telefon, wollte es zwingen, noch einmal zu klingeln, Kaceys Nummer auf dem Display aufleuchten zu lassen, damit ich ihre Stimme hören konnte. Ich wollte nur, was auch meine Mutter wollte: wissen, ob es ihr gut ging.
*
Im Vegas Ink war viel Betrieb an dem Tag. In unserem kleinen Wartebereich waren zwei Frauen in ein Ringbuch mit Entwürfen vertieft, an der Wand lehnte ein Typ. Edgar war dran mit Musikaussuchen, also konnte man das Surren der Tätowiermaschinen kaum hören bei dem dröhnenden Death Metal.
Vivian, unsere Kraft vorne am Empfang, hob die Augenbrauen, als ich in den Laden stürzte.
»Du bist spät dran.«
»Sorry, Viv«, sagte ich und warf einen Blick auf die Termine für heute. »Sag’s nicht Gus.«
»Das mache ich nie, aber ihm sind Beschwerden zu Ohren gekommen, Darling.«
Ich zuckte mit den Achseln. Ich konnte es nicht ändern. Meine Mutter, im Prinzip absolut in der Lage, Dinge allein zu erledigen, hatte sich in ihr Schneckenhaus zurückgezogen. Sie war wie ein Kind, das sich verbrannt hatte, streckte kaum noch die Hand aus. Und Dad stürzte sich in die Arbeit, als wäre er wieder ein frischgebackener junger Stadtrat, nicht jemand, der das Amt seit dreißig Jahren innehatte und bald in Rente gehen würde.
Irgendjemand musste sich um meine Mutter kümmern. Aber manchmal, wie heute zum Beispiel, wusste ich, dass ich mit zu vielen Bällen jonglierte. Meine Arme wurden müde, und früher oder später würde ich einen Ball fallen lassen. Und der erste, der auf dem Boden aufkommen würde, wäre der Job – wenn Gus, der Besitzer des Vegas Ink, mich feuerte, weil ich ständig zu spät kam.
»Die beiden da warten auf dich.« Vivian deutete mit ihrem komplett rasierten Kopf auf die beiden jungen Frauen, einen wissenden Ausdruck auf ihrem mit Piercings übersäten Gesicht. »Neukundinnen. Sie haben nach dir persönlich gefragt.«
Ich zuckte mit den Achseln. »Eine Empfehlung.«
»Hmm.« Viv ließ den Blick von Kopf bis Fuß über meinen Körper wandern. »Deine beeindruckende Gestalt … äh … gestalterische Arbeit muss sich wohl rumgesprochen haben.«
Ich verdrehte die Augen und klappte den dicken Kalender zu. Ich hatte bis sechs Uhr abends durchgehend Termine.
»Ach komm, ein bisschen witzig war es schon«, sagte Viv, beugte sich über den Tresen und spielte zwischen den beringten Fingern mit einem Stift. Tattoos bedeckten jeden Zentimeter ihrer Haut, gingen bis zu ihrem Hinterkopf hoch. Sie drückte kurz meinen Bizeps. »Und es stimmt. Da hat jemand härter trainiert als sonst. Und ich bin nicht die Einzige, der das aufgefallen ist.«
Viv rieb sich das Kinn an der Schulter und blickte zu der einzigen Tätowiererin des Studios, Zelda Rossi. Die kleine, schmale Frau beugte sich gerade mit der Tätowiermaschine in der Hand über einen Kunden. Ihr langes schwarzes Haar hing wie ein Vorhang vor ihrem Gesicht. Sie hob den Kopf, während sie Blut vom Schulterblatt ihres Kunden tupfte. Ihre großen, schwarz umrandeten grünen Augen entdeckten mich, und ein Lächeln breitete sich auf ihrem Gesicht aus. Sie ertappte sich dabei, streckte mir die Zunge raus und arbeitete weiter.
Viv grinste. »Muss echt schwer sein – all die Frauen, die sich dir an den Hals werfen …«
»Ich kann nicht klagen«, sagte ich mit einem selbstgefälligen Grinsen. »Gib mir eine Minute, und schick dann die erste Kundin rein.«
»Klar doch, Schätzchen.«
Das Vegas Ink war ein kleines, beengtes Rattenloch. Durch die knallrote Farbe und den schwarzweißen Fußboden kam es einem noch kleiner vor. Mein Studio würde anders aussehen. Dunklere Farben, ältere Möbel und Kunst von abgefahrenen, coolen Künstlern wie Edward Gorey und Ann Harper an den Wänden. Wie das Wohnzimmer eines Spukhauses.
Mein Studio …
Jonah hatte mir Geld gegeben, um einen Laden zu eröffnen, und ich studierte Betriebswirtschaft, damit ich es nicht vermasselte. Trotzdem wurde mir übel bei dem Gedanken, es wirklich durchzuziehen und Räume zu kaufen. Wenn ich versagte, hätte ich nichts mehr, was von Jonah übrig war. Er hatte sein Glas verkauft, damit ich meinen Traum wahr machen konnte, aber was, wenn ich pleiteging? Wenn niemand kam? Ich hatte schon Kacey verloren. Ein gebrochenes Versprechen. Noch einen beschissenen Fehlschlag könnte ich nicht ertragen.
Edgar, ein großer, ungeschlachter Typ in einem Konzert- T-Shirt von Tool, das über seinem massigen Oberkörper spannte, sah von seinem Kunden auf und nickte mir zu. »Hey T, was geht, Mann?«
»Alles wie immer«, sagte ich und holte meine Tätowiermaschine aus der zweiten Schublade. Wenn die erste Kundin mir sagte, was sie wollte, würde ich die Tinte bereitstellen und die Nadeln auswählen.
»Hast du Lust, heute Abend was zu machen? Ich geh mit ein paar Freunden zu Killroy im Pony Club.«
Ich verzog das Gesicht und überspielte es mit einem Husten. »Nee, ich hab was vor.«
»Ein heißes Date?« Edgar hob vielsagend die Augenbrauen, während sein Kunde mit einem Handspiegel den neuen Drachen inspizierte, der sich um seine Wade wand.
»Jepp«, sagte ich. Aus dem Augenwinkel sah ich Zelda, die kurz zu mir sah und sich dann wieder über die Arbeit beugte.
Edgar lachte leise. »Sag’s nicht. Es ist die Rothaarige von letzter Woche. Rose und Dolch, rechtes Fußgelenk.«
»Kann schon sein.«
Edgar ließ ein kurzes, brüllendes Lachen hören. »Du bist ’ne Nutte, Fletcher. Bleib so.«
Die beiden Frauen aus dem Wartebereich kamen zu meinem Platz. Die Blonde setzte sich auf die Liege, ihre Freundin daneben, um ihre Hand zu halten. Sie waren beide heiß, und beide flirteten mit mir, als ob ihr Leben davon abhinge. Ich erwiderte es, so gut ich konnte, weil Edgar zusah.
Zwanzig Minuten später stand die Blonde mit einem Stay true to yourself auf, das sich filigran über die Innenseite ihres Handgelenks zog. Sie und ihre Freundin luden mich zu einer Party ein.
»Klar, vielleicht komm ich vorbei«, sagte ich und war zunehmend genervt, als sie kichernd darauf bestanden, dass ich ihre Adresse und Telefonnummer in mein Handy eingab. Ich tat so, als würde ich sie als neuen Kontakt hinzufügen, dann schob ich das Telefon zurück in die Gesäßtasche meiner Jeans.
»Wär’ schön, wenn du kommst«, warf die Blonde mir auf dem Weg nach draußen über die Schulter zu.
Als sie weg waren, lachte Edgar und schüttelte den Kopf. »Ich dachte, du hast heute ein Date?«
Ich zuckte mit den Achseln. »Ich nehm’ sie mit auf die Party.«
Er lachte dröhnend. »Du bist ein Held, T.«
Nein, ich bin ein verlogenes Arschloch.
Früher – was eine gefühlte Ewigkeit her war – hätte ich direkt nach der Arbeit die Nummer gewählt und in der Nacht wahrscheinlich nicht viel Schlaf gekriegt. Jetzt fand ich eine verdammt scharfe Blondine und ihre Freundin nicht interessanter als den Wetterbericht. Aber alle in dem Glauben zu lassen, dass ich jeden Abend mit einer anderen Frau loszog, war immer noch besser als die Wahrheit: Seit ich vor all den Monaten Kacey am Lagerfeuer hatte singen hören, war ich ein hoffnungsloser Fall.
Ich beendete den Arbeitstag, und als wir unsere Plätze aufräumten, deutete Edgar mit dem Kinn auf mich.
»Viel Spaß mit der Rothaarigen«, sagte er. »Oder der Blonden. Oder der Rothaarigen und der Blonden. Ich will morgen einen detaillierten Bericht.«
»Kriegst du«, sagte ich und zog meine Lederjacke an. »Wenn ich nicht zu fertig bin.«
Edgar lachte, und Zelda zog eine Grimasse. Ich lächelte ihr zu und schüttelte leicht den Kopf, um ihr zu signalisieren, dass das alles nur Bullshit war. Ich hatte gehört, dass sie in mich verknallt war, seit sie vor einem Jahr hier angefangen hatte. Sie sah ziemlich gut aus, aber ich fing nichts mit Kolleginnen an. Zu kompliziert, wenn es schiefging, und zwischen mir und Frauen ging es früher oder später immer schief.
»Hab einen schönen Abend, Z«, sagte ich.
»Du auch, T«, gab sie zurück. Dann sah sie auf und warf mir ein trockenes Lächeln zu. »Schlampe.«
Edgar und ich lachten, aber sobald ich ihnen den Rücken zugewandt hatte, fing mein Lächeln an zu bröckeln. Als ich aus dem Laden trat, fiel es von mir ab wie eine Maske und zerschellte auf dem Fußweg.
*
In der Lee Business School der Uni Las Vegas hörte ich der Professorin zu, wie sie über Lohnsteuer und die Identifizierungsnummern von Angestellten sprach. Ich konnte ihr folgen. Ich hatte es kapiert. Die Zahlen ergaben Sinn für mich, und fast war ich stolz. Als würde ich etwas gebacken kriegen.
»Ich möchte Sie noch einmal daran erinnern«, sagte Professor Hadden hinter ihrem Pult, »die Klausur nächste Woche macht 45 Prozent der Gesamtnote aus. Sie können und werden diesen Kurs nicht bestehen, wenn Sie sie versäumen oder durchfallen. Machen Sie einen Termin bei mir, wenn Sie das Gefühl haben, dass eins von beidem passieren könnte.«
Der Weg zum Wagen war wie eine kleine Ehrenrunde. Ich würde die Klausur nicht versäumen oder durchfallen. Keine Chance.
Mein Telefon signalisierte eine eingehende Nachricht. Von Oscar.
Wollen wir uns heute treffen? Ich vermisse dich nicht, aber Dena schon.
Ich lachte leise über das zweifelhafte Angebot. Es war eine Weile her, seit ich mit meinen Freunden etwas unternommen hatte. Sie waren zuallererst Jonahs Freunde – seine besten Freunde –, und sie zu treffen war so ähnlich, wie bei meinen Eltern zu Abend zu essen. Erinnerungen an alte Zeiten lagen über allem wie dunkle Schatten.
Ich tippte eine Antwort. Kann nicht. Hab ein Date.
Hätte ich mir denken können, schrieb Oscar zurück. Nächste Woche?
Klar.
Es war leicht geworden zu lügen. Ich log meine Kollegen an, meine Freunde, es machte mir kaum noch etwas aus.
Nach Jonahs Tod hatten wir uns voneinander entfernt. Er war das Zentrum unseres verfluchten Universums gewesen, und ohne ihn fehlte die Anziehungskraft oder was immer uns sonst in derselben Umlaufbahn gehalten hatte. Oscar und Dena versuchten es. Meine Mom versuchte es. Aber ich brachte nicht die Energie auf, zu lächeln, zu lachen und mich mit irgendwelchem Blödsinn durch den Small Talk zu quälen. Es war zu anstrengend, die Trauer in Schach zu halten. Die Trauer darüber, erst Jonah und dann Kacey verloren zu haben.
Ich lenkte den Pick-up vom Parkplatz der Uni, dann durch Seitenstraßen, die parallel zum Strip verliefen. Dann fuhr ich in die Straße hinter dem Wynn Hotel und Casino, parkte und klopfte am Personaleingang.
Die Leute der Security kannten mich alle. Heute hatte Wilson Dienst.
»’n Abend, Theo«, sagte er und winkte mich rein.
»Hey, Wilson.«
Ich lief durch die hinteren Gänge, das Innenleben des Hotels, dann durch einen Korridor mit nackten Wänden und grellem Neonlicht. Augen beobachteten mich von oben, aber ihr Blick war wohlwollend. Niemand würde meine Anwesenheit infrage stellen. Dafür hatte Eme Takamura, die Kuratorin der Galerie, gesorgt.
Dreimal rechts abbiegen, einmal links, dann öffnete ich eine schwere Tür und kam neben den Fahrstühlen im ersten Stock raus. Ich ging in den Gang gegenüber des lärmenden Casinos, das rund um die Uhr geöffnet war.
Paulie bewachte die geschlossenen Türen der Galerie. Die letzten Besucher hatte er vor Stunden rausgeworfen.
»Wie geht’s, T?«, fragte er und gab den Türcode ein. Das Lämpchen sprang von Rot auf Grün.
»Kann nicht klagen«, sagte ich. »Danke, Mann.«
Er lächelte, seine glatte schwarze Haut und der weiße Schnurrbart verzogen sich zu einem traurigen kleinen Lächeln. Er öffnete die Tür und hielt sie mir auf. »Hab einen schönen Abend.«
Ich nickte und betrat die Galerie.
Nach der Beerdigung war ich gewissenhaft jeden Abend hergekommen. Dann jeden zweiten. In letzter Zeit hielt ich mich bei zwei- bis dreimal die Woche. Ich kam her, wenn ich einen Scheißtag hatte oder Jonah zu sehr vermisste.
Die Einzelstücke waren längst weg, alle verkauft und in die Häuser der verschiedenen Leute gebracht worden. In dem längeren Gang der L-förmigen Galerie standen jetzt Skulpturen, die Arbeiten irgendeines Nachwuchskünstlers aus der Stadt. Ich würdigte sie keines Blickes und ging um die Ecke zu dem kurzen Ende des Ls. Hier befand sich Jonahs Installation, erhob sich wie eine Flutwelle an der gegenüberliegenden Wand. Die Sonne, immer kräftig strahlend, schien auf die Wellen und die Wasserbewohner hinab, die aussahen, als würden sie jeden Moment zum Leben erwachen.
Ich setzte mich wie üblich auf die Bank davor und lehnte mich an die Wand. Ich verschränkte die Arme vor der Brust und betrachtete Jonahs Glas. Die Installation war perfekt. Makellos. So, wie ich Jonah immer gesehen hatte – ein toller großer Bruder, der in den Augen seines kleinen Bruders nichts falsch machen konnte. Ich hatte den Boden angebetet, auf dem er stand.
Ich schloss die Augen vor so viel Perfektion. Wäre Jonah hier, das wusste ich, dann würde er sagen, dass ich keine Schuld trug. Er würde sagen, dass Kacey ein erwachsener Mensch war, der seine eigenen Entscheidungen traf.
Manchmal glaubte ich ihm. Manchmal war die Galerie meine Zuflucht, ein Ort seiner Glaskunst, an dem ich Frieden fand. Dieselbe Ruhe, die Kacey in Jonahs gläsernem Briefbeschwerer entdeckt hatte.
Manchmal.
Heute gab es keinen Frieden. Ich hatte meinem Bruder ein Versprechen gegeben und es nicht gehalten.
Ich zwang mich, die Augen zu öffnen und Jonahs Meisterwerk anzusehen. Die brillanten Farben verschwammen vor meinem starren Blick. Das Blau des Wassers strömte von der Decke und ergoss sich über den Boden. Ich konnte das Salz riechen, spürte das kalte Nass auf meiner Haut, und das Salzwasser brannte in meinen Augen wie Tränen. Ein endloser Ozean aus Tränen.
2. KAPITEL
Kacey
»Dieser Song ist aus meinem Album Shattered Glass. Er heißt ›The Lighthouse‹. Ich hoffe, er gefällt euch.«
Das Publikum im Le Chacal applaudierte und pfiff. Das Gemurmel der Gespräche verstummte. Man hörte das Eis in den Gläsern klirren, dann wurde es still in dem kleinen Jazzclub. Sie warteten.
Ehrlich gesagt war mir scheißegal, ob das Publikum den Song mochte oder nicht. Es klang einfach wie etwas, was man sagte. Es war überzeugender als ein bloßes »Dieser Song ist aus meinem Album …«.
Mein Album. Ganz toll. Ich und mein Album. Als wäre es ein konkreter Gegenstand – eine verpackte CD oder wenigstens eine Reihe von Dateien – und nicht nur zwölf Songs, die ich in ein Notizbuch gekritzelt und mit ein bisschen Musik unterlegt hatte. Ich verkaufte meine Songs auf der Bühne und nannte sie Album. Die Leute zahlten einen Unkostenbeitrag als Eintritt in den Club, ich bekam einen Anteil. Vier unterschiedliche Clubs, vier Abende pro Woche. Und da ich in jedem dieser vier Clubs das Haus füllte, war es gutes Geld. Gut genug, um eine Routine draus zu machen. Jetzt hatte ich eine Routine.
Ich rückte die Gitarre zurecht und warf dabei fast den Mikroständer um. Der Boden drehte sich vor meinen Augen langsam um den Barhocker, auf dem ich saß, und die Bühnenbeleuchtung tat weh: große, unscharfe Lichtflecken, die mir in den Augen brannten. Das Publikum dahinter bestand nur aus verschwommenen Gesichtern. Ich schloss die Augen. Ich musste nichts sehen. Die Finger fanden die Bünde, die rechte Hand schlug die Saiten an, und ein Song kam heraus.
Routine.
Mein Körper wusste, was er zu tun hatte, und es schien egal, wie betrunken ich war. Er würde sich immer erinnern. Es war eine Art Bewegungsgedächtnis oder vielleicht noch etwas mehr. Vielleicht wird ein Song zu einem Teil von dir, wenn er so tief in dir verwurzelt ist. Ich traf jeden Ton und sang jedes Wort von »The Lighthouse« und verschwendete nicht mehr Gedanken daran als ans Atmen.
Bünde. Saiten. Anschlag. Song. Atmen. Vier Abende die Woche. Mittwoch bis Samstag.
»Lustig, dass wir die gleichen Arbeitszeiten haben«, sagte er. »Mittwoch- bis Samstagabend.«
»Ich habe um diese Tage gebeten«, sagte ich. »Es sind die besten Schichten.«
Jonah lächelte. »Auf jeden Fall.«
Meine Brust zog sich zusammen, und Tränen brannten hinter meinen geschlossenen Lidern. Nach sechs Monaten sollte ich mich daran gewöhnt haben, wie die Erinnerungen mich einholten. Kleine Bruchstücke von Gesprächen. Kleine Fetzen des gemeinsamen Lebens.
Kleine Augenblicke.
Jonah.
Ich weinte jetzt, aber das Publikum liebte es. Die Zuhörer erwarteten das. Tränen gehörten zur Show. La Fille Submergée nannten sie mich. Die Ertrunkene.
Ich weinte gerade genug, um den Song stärker zu machen, ohne ihn unterbrechen zu müssen. Das jedenfalls hatte mir eine Frau mal auf der Damentoilette des Bon Bon – meinem Samstagsgig – gesagt. Die Tränen und das stockende Luftholen seien Teil der Erfahrung.
Sie hatte eine Erfahrung, wenn sie mich singen hörte.
Wie widerwärtig ist das bitte, wollte ich ihr sagen. Jonah ist tot, und ich mache eine Erfahrung daraus.
Ich beendete den Song, und Applaus übertönte mein gemurmeltes Danke. Ich rutschte vom Barhocker und stakste vorsichtig von der Bühne, mehr als bereit für den Drink nach dem Auftritt.
»Du klangst gut heute, Süße«, sagte Big E, als ich mich auf den für mich reservierten Platz an der Ecke des Tresens setzte. Der Barkeeper hatte einen kurz geschorenen, rotblonden Bart und einen perfekt rasierten Kopf. Sein richtiger Name war Mike Budny, aber alle nannten ihn Big Easy oder Big E. Er erinnerte mich an Hugo, den Bodyguard des Pony Club in Las Vegas: nach außen hin groß und einschüchternd, aber innen drin weich wie Butter.
»Wann lädst du mal Freunde ein, damit sie dich spielen hören?«, fragte er. »Oder jemanden aus der Familie?«
Immer, wenn ich im Le Chacal spielte, versuchte Big E, mir persönliche Informationen zu entlocken. Er machte sich offen Sorgen um nicht und hörte nicht auf, nach irgendwelchen Hinweisen auf meine Vergangenheit zu suchen.
»Hey, willst du mich ausquetschen?« Ich sah ihn aus zusammengekniffenen Augen an. Das beleuchtete Regal mit den Schnapsflaschen hinter ihm blendete mich. »Ich sollte dich Sherlock nennen.«
»Du nennst mich Sherlock«, sagte er ruhig. »Du erinnerst dich nur nie daran.«
Ich lachte schnaubend und nippte an meinem Drink. »Meine Familie ist beschäftigt«, brachte ich mühsam artikuliert hervor. »Und du bist mein Freund.« Ich warf ihm ein schwaches, scherzhaftes Lächeln zu. »Du hörst mich immer spielen. Was brauch ich mehr?«
»Viel, Süße«, gab Big E düster zurück. »Du brauchst viel mehr. Du brauchst Hilfe.«
Hilfe.
Bei all seiner Neugier und obwohl er sich nicht sehr subtil in meine Angelegenheiten einmischte, hatte er dieses Wort noch nie benutzt. Seit ich aus Las Vegas weggezogen war und jeden Kontakt abgebrochen hatte, hatte ich es nicht gehört.
Ich brauche Hilfe.
Ich schniefte, kippte den Whiskey runter und schob ihm das Glas über die Theke zu. »Wenn du mir helfen willst, dann gib mir noch einen.«
»Das ist der Letzte«, sagte Big E und schenkte mir einen Fingerbreit Whiskey ein. »Ich geb dich nicht auf, Kacey.«
Ich hob den Drink, als würde ich auf ihn trinken, und nahm einen Schluck. Dabei knallte ich mir das Glas gegen die Zähne, dass es wehtat, und ruinierte damit vollends den »Ich krieg das geregelt, vielen Dank auch«-Eindruck, den ich erwecken wollte.
»Aua. Mist.«
»Alles okay?«, fragte eine Stimme links von mir. Ein junger, gut aussehender Typ mit tätowierten Armen und zurückgegeltem Haar hatte sich auf den Barhocker neben mir gesetzt. »Das klang schmerzhaft.«
»Alle Zähne heil«, murmelte ich und nippte an meinem Drink.
»Das ist gut«, sagte der Typ. »Du hast ein schönes Lächeln.«
Ich schnaubte. »Ist das so?«
»Eigentlich weiß ich es nicht. Die Ertrunkene lächelt nicht, aber ich würde gern eine Chance kriegen, das zu ändern.« Er zeigte ein gewinnendes Lächeln und hielt mir die Hand hin. »Ich bin Jesse.«
»Kacey.« Ich gab ihm die Hand und versuchte dann, sie zurückzunehmen, aber er hielt sie fest.
»Schöne Tattoos«, sagte er und betrachtete die dornigen Ranken, die in den weiten Ärmel meiner schulterfreien Bluse hineinkrochen. »Wo sind die her?«
»Ich kann mich nicht erinnern«, log ich und zog meine Hand zurück.
Big E beobachtete uns, während er mit einem weißen Lappen ein Glas polierte. Typen versuchten halbwegs regelmäßig, bei mir zu landen. Sie hatten in etwa die Chance eines Schneeballs in der Hölle, mit mir nach Hause zu kommen oder mich auf ein Date einzuladen, aber ich ließ sie es versuchen. Ihren schlechten Anmachen zuzuhören oder auch ihren ehrlichen Versuchen, mich kennenzulernen, erinnerte mich an eine andere Zeit. Eine andere Frau. Eine, die gelacht und geflirtet hätte und mit einem Typen wie Jesse ins Bett gegangen wäre.
Die Frau, die ich vor Jonah gewesen war.
Das hohle Wrack, das ich jetzt war, war angewidert von dem Gedanken, von einem Mann berührt zu werden. Aber manchmal luden sie mich auf einen Drink ein. Und da Big E sich in letzter Zeit wirklich albern verhielt, was meinen Whiskey-Konsum anging, setzte ich mich ein bisschen aufrechter hin und schenkte Jesse meine Version eines Lächelns – ein leichtes Zucken der Lippen. Ich tat so, als wäre ich an den Tattoos interessiert, die seine ansehnlich muskulösen Unterarme bedeckten, und innerhalb von Minuten hatte ich einen neuen Drink vor der Nase, und wir verglichen Tätowierungen. Ich war stockbetrunken und sehr, sehr leichtsinnig.
Ich zeigte Jesse die kleinen schwarzen Sterne auf meinem Mittel- und Ringfinger. »Das war mein erstes. Ich hab’s aus San Diego. Pacific Beach.« Ich zeigte ihm den Mittelfinger. »Den Finger hab ich mit Absicht ausgesucht. Ein fettes Fick dich! an meinen Dad.«
»Hübsch.«
Ich fuhr mit dem Finger die Ranken an meinem Arm hinauf. »Die sind auch aus einem Laden in San Diego.«
»Du erinnerst dich ja doch«, sagte Jesse und lachte.
»Lad mich auf noch einen Drink ein, Süßer, und ich erinnere mich an alles, was du willst.«
Ich hätte mich gewunden, wäre ich die Adressatin eines so schmalzigen, unechten Flirtversuchs gewesen, aber das ist das Schöne am Betrunkensein – es ist so viel leichter, auf alles zu scheißen. Allerdings ist das auch das einzig Schöne daran, und das ist die Wahrheit.
Jesse zahlte noch eine Runde. Ich wurde betrunkener, und wir verglichen Tattoos wie Soldaten Kriegsverletzungen. Er hob sein dunkelblaues T-Shirt hoch und zeigte mir seine hübsch definierten Brust- und Bauchmuskeln, obgleich er, was mich anging, auch mit Malen und Geschwüren hätte bedeckt sein können. Er drehte sich auf dem Hocker um und zeigte mir den kupferroten Football-Helm der Saints auf seinem rechten Schulterblatt.
»Das war mein erstes«, sagte er. »Vom Jake’s oben in der Canal Street.« Sein glasiger Blick schweifte zu meinem nackten rechten Schlüsselbein. »Zeig mir noch eins, Kacey«, sagte er mit einer Stimme, die er wahrscheinlich für verführerisch hielt. Und in einem anderen Leben hätte sie auch in meinen Ohren so geklungen, und ich hätte mich auf seinen Schoß gesetzt, bis Big E uns wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses rausgeworfen hätte.
Ich spielte mit und fuhr mit dem Kinn über die nackte Haut meiner Schulter. »Kann ich nicht«, sagte ich. »Nicht, ohne etwas auszuziehen.«
Jesses blaue Augen trübten sich. »Damit würde ich fertigwerden.«
»Mmmh«, sagte ich und schloss die Augen, da der Raum sich um mich drehte. Es war nicht okay, ihm etwas vorzumachen. Ich sollte aufhören. Da ist nichts, was ich ihm geben könnte.
»Da ist nichts«, murmelte ich – die Worte fielen von dem Zug meiner Gedanken, der im Schneckentempo durch mein whiskeygetränktes Hirn zuckelte. »Hier sollte ich eigentlich eins haben.« Ich berührte wieder mit dem Kinn die Stelle an meiner nackten Schulter. »Aber ich hab nie eins ausgesucht. Ich bin weg, bevor ich mein Tattoo von Teddy bekommen habe.«
Bei dem Namen zuckte ich zusammen, und ich redete weiter, um ihn in einem Meer bedeutungsloser Worte zu ertränken. »Ich wusste nicht, was ich wollte, also hab ich die Stelle freigelassen. Ich habe nichts mitgenommen. Ich habe nichts. Weil ich weg bin. Ich hätte bleiben sollen, aber ich bin weg.«
Tränen traten mir in die Augen. Mein Ruf als die Ertrunkene hin oder her – anzufangen zu heulen, während man gerade abgeschleppt wird, ist ein ziemlicher Abturner. Jesse rieb sich über die Lippe. Er war selbst nicht gerade nüchtern und unsicher, wie er weiter vorgehen sollte.
»Hey, kein Problem. Also …« Sein Lächeln war übertrieben strahlend. »Magst du Football?«
Big E beugte sich mit seiner Körpermasse über die Theke und sah nun eher wie ein Rausschmeißer in einem Motorradclub aus als wie der Barkeeper einer Jazzkneipe. »Sie ist durch, Mann«, sagte er zu Jesse. »Kapiert?«
Jesse nickte und rutschte mit einer verdrießlichen Miene vom Barhocker. Er hatte zwanzig Dollar investiert, um mich mit Whiskey der obersten Kategorie weich zu kochen, aber mit Big E legte er sich nicht an. Das tat kaum jemand.
Der Barkeeper sah jetzt mich an, und seine Züge wurden weich unter dem rostfarbenen Bart. »Ich ruf dir ein Taxi, Süße?«
Ich nickte und flüsterte: »Danke.«
Big E bat seine Hilfskraft, kurz für ihn einzuspringen, und schaffte mich und meine Gitarre durch die halbdunklen Räume des Le Chacal nach draußen. Unsere kleine Donnerstags-Routine.
Die Nacht in New Orleans war kühl und windig, das Neonschild des Le Chacal hell vor der Backsteinfassade. Ich versuchte, ein wenig Würde aufzubieten, während wir auf das Taxi warteten, aber der Gehweg kippte ständig unter meinen Füßen weg. Noch ein Drink, und ich könnte das Bewusstsein verlieren. Ich fragte mich, was dann passieren würde. Würde ich in Jonahs Limousine aufwachen?
»Bring mich dahin, Big«, lallte ich. »Wo er ist. Das ist der einzige Ort, wo ich sein will.«
»Teddy?«
»Nein.« Ich schüttelte den Kopf und wurde dann still. »Vielleicht. Ich vermisse ihn auch. Ich vermisse sie alle. Aber ich bin abgehauen und … das ist das Ende der Geschichte.«
Big E packte mich fester um die Taille, als das Taxi vor uns hielt. »Du bist aus Las Vegas hergekommen, oder? Ich glaube, das hast du mal gesagt.«
»Und?«
Er ignorierte meine Frage, nannte dem Taxifahrer meine Adresse und half mir auf den Rücksitz. Da war etwas an Big Es ruhiger Miene, was mir nicht gefiel. Obwohl ich völlig breit war, merkte ich, dass er etwas im Schilde führte.
»Was? Willst du Rufus davon erzählen? Damit er mich nicht mehr auftreten lässt?«
»Niemals«, sagte Big E. Er beugte sich durch die offene Tür. »Aber ich hab’s dir gesagt, Süße, ich geb dich nicht auf.«
Er machte die Tür zu und klopfte auf das Dach des Taxis, um dem Fahrer zu signalisieren, dass er losfahren sollte. Ich ließ mich in den Sitz zurücksinken. Ein vages Gefühl von Unruhe durchströmte mich.
Das French Quarter war eine Ansammlung verschwommener Flecken hinter den Scheiben des Taxis, irgendwann abgelöst von den dunkleren Reihen kleiner Häuschen im Seventh Ward, meinem Viertel.
Las Vegas war braun gewesen. Beige. Blassgelb und hellblau. New Orleans trug die Farben von Zeit und lebendiger Geschichte. Abblätternde Farbe, rot und weiß. Und überall Grün: der grünbraune Fluss, das Grün der Bayous, grüne, mit Feuchtigkeit gesättigte Luft. Grüne Pflanzen und Büsche und Bäume mit herabhängenden Zweigen.
Ich stolperte den kurzen Weg zu meiner Eingangstür hinauf. Ich brauchte drei oder vier Anläufe, um den Schlüssel ins Schloss zu kriegen, weil die Veranda dunkel war.
Jonahs Whiskey-Lampen waren längst durchgebrannt.
In meinem kleinen Haus fiel ich auf die Couch, meine Tasche und die Gitarre landeten mit einem scharfen Klang auf dem Boden. Ich ließ den Kopf an die Rückenlehne sinken und schloss die Augen.
Man findet überall Schönheit. Auch in den Dingen, die einem am meisten Angst machen …
Keuchend wachte ich auf. Auf meiner eigenen Couch, nicht auf Jonahs. Keine hässliche orange-grüne Wolldecke auf meinen Schultern, keine Glaskunst auf dem Wohnzimmertisch. Die Uhr an der Wand sagte, dass ich zwanzig Minuten weg gewesen war. Zwanzig Minuten, die mich nüchterner gemacht hatten. Vielleicht hatten das auch Jonahs Worte bewirkt, die mir in den Ohren klangen.
Schönheit in den Dingen, die einem am meisten Angst machen.
Am meisten Angst hatte ich davor, den Schmerz reinzulassen. Oder rauszulassen. Er war ja schon in mir. Er wohnte in mir. Ich musste ihn tief drinnen halten, ihn ertränken, damit ich nicht in winzige Scherben zerbrach.
Ich ging in die Küche, um mir einen Schlaftrunk zu machen. Man hatte diesen typischen kleinen Häuschen in New Orleans den passenden Namen Shotgun-Haus gegeben: In alten Zeiten konnte man mit einer Schrotflinte durch die Eingangstür zielen und bis zur Hintertür durchschießen. Die Zimmer des kleinen Hauses waren einfach hintereinander aufgereiht: Wohnzimmer, Küche, Schlafzimmer, Bad. Eine gerade Linie bis zur hinteren Veranda. Ein einfacher Weg, den man leicht entlangstolpern konnte. Ein wichtiges Detail im Zuhause einer Frau, die rund um die Uhr betrunken war.
Ich öffnete einen Schrank, in dem mehr Flaschen standen als Lebensmittel. Mein Schlaftrunk war Wodka auf Eis mit einem Spritzer – einem winzigen Spritzer – Wasser. Ich trug das Glas in mein Schlafzimmer.
Wie überall im Haus standen im Schlafzimmer Secondhand-Möbel. Stücke, die ich bei Garagenverkäufen gefunden hatte, nachdem ich in New Orleans gelandet war. Alles zusammen hatte diesen Shabby-Chic, mit dem in Einrichtungshäusern ständig geprahlt wurde. In meinem Fall war es allerdings eher schäbig als schick.
Ich brauchte eine Couch, um darauf zu sitzen – und manchmal zu schlafen, wenn ich es nicht ins Schlafzimmer schaffte –, also kaufte ich eine Couch. In Orange. Ich brauchte einen Sessel, also kaufte ich einen Sessel. Er war blau. Der Teppich auf den Hartholzdielen war bunt. Sogar von außen war mein Häuschen seegrün mit himmelblauen Zierleisten und einer weinroten Tür. Überall Farben, wie im Rest der Stadt. Außer an einem Ort.
Ich schlurfte ins Schlafzimmer und machte die kleine Lampe auf meinem Nachttisch an. Meine Bettdecke war weiß, und das Universum, das Jonah für mich gemacht hatte, lag genau in der Mitte: eine dunkle, blau und schwarz schimmernde Kugel mit leuchtenden Sternen darin. Ein schwarzes Loch im Zentrum eines weißen Universums, das mich einsaugte. Die Kugel nahm das blassgelbe Licht der Lampe auf. Der Planet in ihrer Mitte schimmerte rot und grün.
»Es war ein guter Abend heute«, sagte ich und zog die Schuhe aus. Ich verlor das Gleichgewicht, fing mich aber wieder. Nur ein bisschen von dem Wodka spritzte auf mein Handgelenk. »Vierhundert Dollar mit Trinkgeld. Der Laden war voll. Du hättest es sehen sollen.«
Im Bad stellte ich meinen Drink auf das Waschbecken, ging zur Toilette und wusch mir dann die Hände. Mein Spiegelbild war ein grausiges Durcheinander aus verschmierter Wimperntusche, strähnigem Haar und blasser Haut.
Jonah würde dich kaum wiedererkennen.
Dieser Gedanke entsprang einem Teil von mir, der es hasste, was aus mir geworden war. Einem sturen Selbsterhaltungstrieb, der versuchte, mich aus meinem Rauschzustand zu reißen. Aber das klappte nie.
»Jonah würde mich überall wiedererkennen«, gab ich bissig zurück und schnappte mir den Drink. Ich kippte ihn runter, während ich ins Schlafzimmer zurückging. Die Eiswürfel klirrten, als ich das Glas auf den Nachttisch stellte. Der Alkohol lief kalt in meinen Bauch und schwappte dort mit dem ganzen Rest herum, den ich heute tagsüber und abends zu mir genommen hatte … oder auch während der Tage und Abende der letzten Monate.
Der Raum drehte sich jetzt schneller. Ich hatte den idealen Punkt erreicht, wo der Alkohol mich schnell einschlafen lassen würde, und die Träume, die ich hatte, so schlüpfrig wurden, dass ich sie beim Aufwachen nicht würde festhalten können.
Ich prüfte, ob in dem Flachmann in der Nachttischschublade genug war, um den nächsten Morgen anzugehen – oder den frühen Nachmittag, je nachdem, wie lange ich schlief. Es war leicht, sich auf einer Party oder nach einem Auftritt abzuschießen. Ich musste es wissen – ich hatte es nach jedem Konzert mit Rapid Confession gemacht. Aber es ist eine Wissenschaft, ständig betrunken zu sein und trotzdem zu funktionieren.
Mehr oder weniger.
Ich funktionierte mehr oder weniger. Ich hatte Jobs, bei denen es nicht erforderlich war, nüchtern zu sein. Ich hielt mich an meine Routine, und dazu gehörte, vorm Schlafengehen einen Absacker zu trinken, zu prüfen, ob der Morgenflachmann gefüllt war, und mich dann neben das Universum zu legen und Jonah von meinem Tag zu erzählen.
Ich legte mich auf das Bett. Mein Körper fühlte sich an, als wäre er tausend Kilo schwer. Ich ließ den schmerzenden Kopf auf die weiße Bettdecke sinken und rollte mich um die Kugel herum zusammen, zog das Universum an meine Brust und wiegte es an meinem Herzen.
»Rufus, der Besitzer … sagt, sie wollen mich öfter als einmal die Woche im Le Chacal. Es hat sich rumgesprochen. Aber ich habe eine Routine, oder? Vier verschiedene Clubs an vier Abenden. Ich will mich nicht zu sehr an einen Laden binden.« Ich schloss kurz die Augen, als die Scham mich überflutete. »Aber ich kann nicht mehr. Ich kann so nicht weitermachen. Es bringt mich um. Ich muss aufhören, oder? Aber ich weiß nicht, wie.«
Hilf mir, Jonah.
»Big Easy … Ich hab dir von ihm erzählt, oder?« Ich schniefte und wischte mir die Nase am Ärmel ab. »Er ist der Barkeeper im Le Chacal. Erinnerst du dich? Ich nenne ihn manchmal Sherlock, weil er ständig etwas über mich herausfinden will. Er fragt nach Freunden oder meiner Familie. Macht sich Sorgen um mich. Er will wissen, wo ich herkomme oder wen … wen er anrufen soll. Er will jemanden anrufen. Das weiß ich. Er denkt, ich brauche Hilfe.«
Ich schloss die Augen, um die Worte laut zu hören, und versuchte, sie mit allem anderen zu verdrängen.
»Es gibt niemanden, den man anrufen könnte. Sie würden sich nur Sorgen machen. Es würde ihnen das Leben versauen.«
Was für ein absoluter Schwachsinn. Henry und Teddy und Beverly machten sich höchstwahrscheinlich jetzt schon Sorgen.
Ich richtete meinen trüben Blick auf die Glaskugel. Wie immer ging von ihr diese ungeheure Sogwirkung aus. Ich fühlte mich verloren in den Weiten voller Sternenstaub und den strahlenden Wirbeln, die den einsamen Planeten umringten. Ich suchte dort nach Jonah und hielt die Kugel fester in den Armen, während die Tränen unbeachtet flossen.
Unaufhörlich.
»Es tut mir so leid«, flüsterte ich, und meine Stimme war ein weinerliches Krächzen. »Ich bin abgehauen. Habe deine Mom … und Teddy allein gelassen. Ich wollte das nicht. Leute sollten nicht einfach abhauen, das weiß ich. Ich sollte es besser wissen als jeder andere. Aber ich konnte nicht bleiben. Und es tut mir wirklich leid. Dass ich abgehauen bin und dich enttäuscht habe. Ich bin wirklich die Ertrunkene. Ich ertrinke, Jonah. Ich brauche dich. Bitte, komm zurück …«
Mein Magen verkrampfte sich, so anstrengend war es, die Trauer zurückzuhalten. Ich hatte solche Angst davor, was passieren würde, wenn ich ihr erlag.