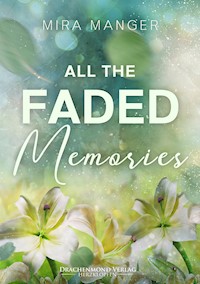
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Drachenmond Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Herzdrachen
- Sprache: Deutsch
Stephen und Lou: eine bewegende Liebesgeschichte in Seattle, der berühmten Emerald City. Romantisch, wahrhaftig und berührend. Lou kommt für ihren großen Traum, als Journalistin für die Emerald Post zu schreiben, nach Seattle. Zunächst fällt es ihr schwer, Anschluss in der großen Stadt zu finden, und als sie den Auftrag für ein exklusives Interview mit dem gefeierten Kriegshelden Stephen Renner bekommt, dem vor Kurzem die Medal of Honor für einen Militäreinsatz verliehen wurde, wittert sie ihre Chance auf beruflichen Erfolg. Der wortkarge Stephen ist eine harte Nuss, doch Lou lässt nicht locker, sodass er ihr kurzerhand einen Deal anbietet: Sie hilft ihm bei der Renovierung seiner Lagerhalle für den Veteranenverband, und im Gegenzug bekommt Lou ihre Story. Doch Stephens Geschichte ist eng mit ihrer eigenen verwoben, und der tief verletzte Ex-Soldat geht Lou unter die Haut – mehr, als ihr lieb ist. Plötzlich kommen Lou Zweifel an ihrem Job und den dunklen Seiten des Journalismus. Wer will sie sein? Und was ist damals in Kabul wirklich passiert?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 448
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
All the faded Memories
MIRA MANGER
Copyright © 2023 by
Drachenmond Verlag GmbH
Auf der Weide 6
50354 Hürth
https://www.drachenmond.de
E-Mail: [email protected]
Lektorat: Nina Bellem
Korrektorat: Michaela Retetzki
Layout Ebook: Stephan Bellem
Charakterillustration: Sasu Art / Saskia Weigelt
Umschlagdesign: Schattmaier Design
Bildmaterial: Shutterstock
ISBN 978-3-95991-759-9
Alle Rechte vorbehalten
Inhalt
Triggerwarnung
Playlist
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Epilog
Danksagung
Drachenpost
Triggerwarnung
Dieses Buch beinhaltet sensible Themen wie
mentale Gesundheit (Posttraumatische Belastungsstörung, Depressionen, Flashbacks),
Schilderung von Kriegserlebnissen, Verlust (Tod eines Familienmitglieds)
und familiäre Problematiken
Für dich
Weil du mir mit jedem Tag und jedem Atemzug fehlst.
Ich hoffe, es geht dir gut, da, wo du bist.
Playlist
The Chainsmokers – High
Loveless – Middle of the Night
Dido – Thank You (Slowed + Reverb)
Paramore – I’m Not Angry Anymore
A Day To Remember – Resentment
A Day To Remember – Mindreader
Beartooth – Disease (The Blackbird Session)
Being As An Ocean – Brave
Imagine Dragons – Follow You
My Chemical Romance – The Ghost Of You
Green Day – Boulevard Of Broken Dreams
You Me At Six – Glasgow (Orchestrated Version)
Machine Gun Kelly – Papercuts
Yungblud – Mars
Boston Manor – Liquid
Kapitel1
LOU
Nass. Das ist der erste Eindruck, den ich von Seattle habe. Die Rain City macht ihrem Namen alle Ehre und zeigt sich von ihrer besten Seite, als ich in Queen Anne aus dem Taxi steige und dabei prompt in eine Pfütze trete.
»Shit.« Ich erschaudere, denn das eiskalte Wasser sickert in meine dünnen Sneakers und durchnässt meine Socken.
»Daran werden Sie sich gewöhnen, Miss«, meint der Taxifahrer, der mit mir ausgestiegen ist, und wuchtet meinen riesigen Koffer aus dem Wagen.
»Da bin ich mir noch nicht so sicher.« Missmutig spanne ich meinen Regenschirm auf und krame die Geldbörse aus meiner klammen Jacke, um den Fahrer zu bezahlen.
Nachdem das Taxi weg ist, bleibe ich ein wenig verloren am Straßenrand stehen und sehe mich in meinem neuen Wohnviertel um. Es ist keine schlechte Gegend: Mein neu renoviertes, voll möbliertes Apartment liegt mitten in Queen Annes Südhangviertel, abgeschirmt vom Lärm der Großstadt, aber immer noch zentral. Kein Wunder, schließlich hätte mein Dad mich niemals allein in eine scheinbar unsichere Gegend wie Downtown oder Medrona ziehen lassen. Dass er mir hier draußen eine Wohnung mietet, passt zu ihm.
Mit einem leisen Seufzen nehme ich meinen Rollkoffer an mich und laufe die Straße hinauf, wo sich mehrere dreistöckige Mehrfamilienhäuser mit flachen Dächern aus hellem Backstein aneinanderreihen. Sie alle sind von ordentlichen Vorgärten gesäumt, in diesen frühen Morgenstunden ist hier niemand zu sehen.
Das ist also dein neues Zuhause, Lou, denke ich, als ich vor einem der Wohnkomplexe mit der Hausnummer 330 W Olympic Place Unit stehen bleibe. Ich zerre meinen Koffer die Betonstufen hinauf und nehme den Schlüssel aus meiner Tasche, den mein Dad bereits letzte Woche bei einem Termin in Seattle von der Maklerin bekommen hat. Mein Herz pocht einige Takte schneller gegen meinen Brustkorb, als ich die Haustür aufschließe und den Aufzug nach oben in die dritte Etage nehme. Hier gibt es nur ein Apartment mit der Nummer 404, das ich in wenigen Augenblicken beziehen werde. Mit klopfendem Herzen öffne ich die Tür.
Sie mündet in ein helles Wohnzimmer, das von einer großen cremefarbenen Couch dominiert wird. Es hängen sogar Bilder an den in Anthrazit gestrichenen Wänden, und auf dem Sideboard am Fenster steht ein Blumentopf mit weißen Orchideen, sodass ich mir eher vorkomme, als wäre ich in einem Hotelzimmer angekommen und nicht in einem Apartment. Trotzdem fühle ich mich hier auf Anhieb wohl. Ich stelle meinen Koffer an der Garderobe ab und gehe hinüber zum Fenster, das einen atemberaubenden Blick auf die verregnete Elliot Bay und die ferne Skyline der Stadt freigibt.
»Mensch, Dad«, murmele ich in mich hinein, einmal mehr überwältigt davon, was mein Vater alles für mich macht.
Auch Küche, Bad, Ess- und Schlafbereich sind hell und modern gehalten, und obwohl ich meiner tollen Wohnung in Brooklyn noch eine ganze Weile nachtrauern werde, kann ich mich nicht beschweren.
Den zusammengefalteten Zettel auf dem gläsernen Esstisch entdecke ich erst nach meinem zweiten Rundgang durch mein neues Reich. Das recycelte Papier erkenne ich sofort, es stammt aus dem Notizheft meines Vaters, das er immer in der Innentasche seiner Sportsakkos dabeihat. Als ich den Zettel aufklappe, schiebt sich ein breites Lächeln auf meine Lippen.
Liebe Lou,
ich hoffe, du lebst dich schnell in Seattle ein und kommst deinen alten Dad ab und zu in New York besuchen. Viel Erfolg für deinen neuen Job, auch wenn ich weiß, dass du ihn großartig machen wirst. Ich bin stolz auf dich, Junemoon.
Dad
Plötzlich sind meine Augen ziemlich feucht. Automatisch nehme ich mein Handy aus meiner Hosentasche und wähle seine Nummer über die Kurzwahl. Es klingelt ein paarmal, ehe sich eine vertraute Stimme am anderen Ende der Leitung meldet.
»Hey, Lou. Dein Dad ist gerade in der Maske und kann nicht sprechen. Alles okay? Bist du gut in Seattle angekommen? Soll ich ihm etwas ausrichten?«
»Hi, Christina.« Inzwischen ist die Assistentin meines Vaters so etwas wie ein Familienmitglied für mich geworden, trotzdem hätte ich jetzt lieber mit Dad gesprochen als mit ihr.
»Ich bin gut angekommen, danke. Wie geht es ihm? Hat er seine Tabletten genommen?«
»Na klar, Süße. Dafür sorge ich, das weißt du doch. Ihm geht’s gut, aber momentan jagt er mal wieder von einem Termin zum nächsten. Du kennst das ja.«
»Mhm. Hat er was gegessen?«
»Natürlich. Es ist mein Job, ihn am Leben zu erhalten.« Sie lacht, ich erwidere es nicht, sondern seufze nur.
»Ja klar. Tut mir leid.«
»Das muss es nicht. Du machst dir eben Sorgen um deinen Dad, jetzt, wo du weg bist. Das verstehe ich gut.«
»Danke. Könntest du ihm bitte –«
Im Hintergrund ertönt ein lauter Gong und jemand ruft Christina etwas zu.
»O Mist, ich muss los.«
»Grüß Dad von mir. Meinst du, er schafft es, mich heute zurückzurufen?«, frage ich hoffnungsvoll, auch wenn ich die Antwort eigentlich schon kenne.
»Er versucht es, nach der Show hat er noch einen Interviewtermin im Four Seasons. Aber ich schreibe es in seinen Kalender.«
»Okay, danke. Bis dann.«
»Bis dann.«
Wir legen auf. Um das dumpfe Gefühl der Einsamkeit zu vertreiben, das sich nun an mir festbeißt, schalte ich meine Playlist an, nehme meinen Koffer mit in mein neues Schlafzimmer und mache mich ans Auspacken.
Es ist Freitag, bereits am Montagmorgen wird mein neuer Job in der Onlineredaktion der Emerald Post beginnen, eine der renommiertesten Zeitungen der Stadt. Seit ich ein kleines Mädchen war, weiß ich, dass ich Journalistin werden und packende Storys schreiben will, die die Menschen berühren, die etwas in ihnen auslösen. Selbst wenn das bedeutet, ganz allein ans andere Ende des Landes zu ziehen. Nach meinem Abschluss an der Yale beginnt für mich jetzt ein neues Leben, hier in Seattle, einer Stadt, von der ich noch nicht weiß, wie ich sie finde. Ohne Dad, ohne meine Freundinnen und Freunde.
»Das gehört eben zum Erwachsenwerden dazu, Junemoon«, murmele ich in mich hinein und stopfe einen Arm voll Socken in die Kommode neben dem unberührten Boxspringbett. Dabei versuche ich, all die Zweifel, die Sorge und die Angst, von jetzt an allein in einer fremden Stadt zu leben und keinen Anschluss zu finden, entschieden beiseitezuschieben.
* * *
Am Montagmorgen regnet es immer noch. Nachdem ich mich am Wochenende häuslich in meinem neuen Apartment eingerichtet, ewig mit meiner besten Freundin Lien telefoniert und die Nachbarschaft erkundet habe, wird es jetzt ernst, denn mein erster Arbeitstag in der Redaktion steht bevor. Auf dem Weg zur Bushaltestelle friere ich; in Seattle ist der Sommer im September anscheinend schon vorbei und der Herbst hält Einzug in Washington. Der dünne Pullover und die Lederjacke, die ich trage, sind auch heute wieder im Handumdrehen durchnässt, denn der Wind pustet mir den Regen trotz Schirm erbarmungslos aus allen Richtungen entgegen. Glücklicherweise erwische ich einen früheren Bus in Richtung Stadtzentrum und kann mich ins Trockene flüchten. Gerade als ich auf einem der abgewetzten Sitze im hinteren Teil des Fahrzeugs Platz genommen habe, vibriert mein Handy.
»Jetzt rufst du an?« Es ist mein Dad, der das ganze Wochenende nichts von sich hat hören lassen. Hastig nehme ich seinen Anruf entgegen.
»Hey, Dad.«
»Lou! Schatz! Es tut mir leid, aber …«
»… früher ging’s nicht. Schon klar«, beende ich seinen Satz, wobei ich mich bemühe, nicht allzu vorwurfsvoll zu klingen.
»Wie war dein erstes Wochenende in Seattle? Bist du schon auf dem Weg zur Arbeit? Wie gefällt dir die Wohnung?«
Im Hintergrund ist Straßenlärm zu hören, und wie immer, wenn Dad mir so viele Fragen auf einmal stellt, weiß ich, dass er mich zwischen zwei Terminen anruft und nur wenig Zeit hat. Es möchte eben jeder ein Stück von David Archer abhaben – so war es schon immer.
»Ja, ich bin gerade auf dem Weg. Die Wohnung ist großartig, danke, Dad. Ich denke, ich werde mich hier gut einleben. Nur an das Wetter muss ich mich erst noch gewöhnen; seit ich hier bin, regnet es in einer Tour. Seattle muss ein verdammt gutes Abwassersystem haben, New York wäre bei dieser Regenmasse schon längst abgesoffen.«
Dad lacht, ein tiefer, vibrierender Ton, den ich schon jetzt vermisse. »Hier scheint die Sonne, wenn du’s genau wissen willst. Bist du schon aufgeregt?«
»Ein bisschen.«
»Das brauchst du nicht. Sie werden dich lieben, Junie.«
»Hoffentlich.«
»Ganz sicher. Hör zu, ich muss leider auch schon wieder los. Wollte mich nur kurz vergewissern, ob alles in Ordnung ist.« Am Klang von Dads Stimme höre ich, wie schwer es ihm fällt, mich so schnell wieder abwürgen zu müssen. Inzwischen müssten wir beide eigentlich daran gewöhnt sein.
»Schon gut, Dad.« Wie so oft mache ich ihm sein Gewissen leichter.
»Erzähl mir unbedingt, wie dein erster Tag war. Ich wünsche dir viel Erfolg.«
»Mach ich. Bis dann, Dad.«
»Ciao, Junie.«
Als wir auflegen, muss ich ein paarmal tief durchatmen, um wieder richtig Luft zu bekommen. Mein Vater und ich haben eine enge Beziehung. Besonders, seit meine Mutter nicht mehr Teil unseres Lebens ist. Nicht mehr in derselben Stadt zu leben wird härter, als ich erwartet habe.
In der Nähe der Universität steige ich aus und werfe einen Blick auf die Uhr. Es ist Viertel nach acht, erst um neun werde ich in der Redaktion erwartet, was bedeutet, dass ich noch einiges an Zeit totschlagen muss. Ich beschließe, dass es für eine Sightseeingtour noch zu früh ist, und schlendere die belebte Avenue hinab, auf der die Geschäfte allmählich öffnen und die Stadt langsam zum Leben erwacht. Mit einem Mal wird der Regen stärker und verwandelt sich binnen Sekunden in einen Sturzbach, begleitet von einem starken Windstoß, der mir beinahe den Schirm aus der Hand reißt und meine Haare durcheinanderwirbelt.
Fluchend rette ich mich unter die Markise eines Cafés, aus dessen offener Tür der köstliche Geruch von frisch gemahlenen Kaffeebohnen strömt. Obwohl ich heute Morgen schon einen Kaffee aus der neuen Maschine hatte, überlege ich nicht lange, schüttele meinen triefnassen Schirm aus und betrete das warme, trockene Lokal.
Zu dieser frühen Stunde sitzen hier nur ein paar Anzugträger, die wie ich vor einem Meeting oder einem Auswärtstermin noch Zeit haben. Vom Tresen her dringt leise Jazzmusik in den Raum, und wie von selbst lasse ich mich an einen der freien Tische sinken.
Das Café ist minimalistisch, aber modern eingerichtet, überall entdecke ich Pflanzen und Bücherregale an den nackten Backsteinwänden. Der Mann hinter dem Tresen, ein großer Kerl mit Karohemd und Basecap, fängt meinen Blick auf, wirft sich das Geschirrtuch über die Schulter und kommt auf mich zu.
»Guten Morgen. Was darf’s sein?«
Mir fällt auf, dass seine Augen sehr blau sind. Rasch ziehe ich die Karte zu mir. »Einen Cappuccino bitte.«
»Kommt sofort.«
»Danke.«
Der Barista entfernt sich wieder und ich unterdrücke ein Seufzen. Manchmal haben Cafés eine seltsam beruhigende Wirkung auf mich, besonders an einem regnerischen Montag, kurz bevor ich meinen ersten Arbeitstag antreten werde. Wie in Trance sehe ich hinüber zum Tresen und beobachte, wie der Mann – offenbar der Besitzer des Cafés – meinen Cappuccino zubereitet. Dabei ist er ganz in seinem Element, und für einen kurzen Moment beneide ich ihn, dass er den ganzen Tag Jazz hören und friedlich Milch schäumen kann. Er muss sich nicht dem Stress einer neuen Stelle und einer neuen Stadt aussetzen und kann das tun, was er liebt, ohne dass jemand ihm sagt, was er zu tun und zu lassen hat.
Hör auf, so sentimental zu sein, Lou, sage ich mir streng. Du willst diesen Job bei der Emerald Post mehr als alles andere. Du willst Journalistin werden, das wolltest du schon immer. Einen Tag in diesem Café, und du würdest dich zu Tode langweilen. Du brauchst den Stress und den Druck. Du bist wie dein Vater.
Doch was, wenn nicht? Was, wenn es ein Fehler war, nie über eine andere Karriere nachgedacht, nie andere Möglichkeiten in Betracht gezogen zu haben? Ich bin mit einem Tunnelblick durch die Yale gejagt, habe für die Yale Daily News geschrieben und nur Kurse belegt, die mich auf ein Leben als Journalistin vorbereiten. Nie habe ich einen Blick über den Tellerrand gewagt, habe mich nie treiben lassen, und genau das ist es, was ich in diesem Moment bitter bereue.
»Hier bitte, Miss.«
Ich zucke zusammen, als der Barista den Kaffee vor mir abstellt.
»Danke«, murmele ich, ohne ihn anzusehen, und ziehe die heiße Tasse näher an mich heran. »Könnte ich bitte einen Blaubeer-Muffin dazu haben?«
»Na klar.«
Als er geht, versenke ich den Löffel in dem cremigen Milchschaum und nehme mehrere tiefe Atemzüge, um mich wieder zu beruhigen.
Das sind nur die Nerven, nichts weiter. Du bist für die Pressearbeit gemacht. Dad hat recht, du wirst das schon schaffen. So wie immer.
Einige Minuten und einen Blaubeer-Muffin später hat sich mein wummernder Herzschlag wieder etwas verlangsamt, trotzdem ändert das nichts an der Tatsache, dass ich am liebsten gekniffen und den ganzen restlichen Tag in diesem Café verbracht hätte. Doch mir bleibt keine Wahl, inzwischen ist es zehn vor neun und es wird höchste Zeit, sich auf den Weg zu dem gläsernen Gebäude der Emerald Post am Ende der Straße zu machen, das ich schon von der Bushaltestelle aus sehen konnte. Mit dem dumpfen Gefühl in der Brust, dass es jetzt kein Zurück mehr gibt, stehe ich auf, zahle und verlasse den Ort, der an diesem Morgen mein sicherer Hafen war.
Kapitel2
STEPHEN
Es wird ein ruhiger Montag im Café, sodass ich es ausnahmsweise einmal schaffe, zeitig zu schließen. Als ich am frühen Abend das Rolltor des Ladens runterziehe und abschließe, biegt schon Cam um die Ecke, Henry, ihren weißen Schäferhund, an der Leine. Meine beste Freundin winkt, ich winke zurück. Henry kommt freudig auf mich zu und schnuppert an meinem Bein, wie immer in freudiger Erwartung auf etwas Essbares.
»Na du?« Ich gehe in die Hocke, um meinem flauschigen Freund die Ohren zu kraulen. »Wie geht’s dir, Kumpel?«
Henry winselt leise und leckt mir über die Wange, was mir als Antwort genügt.
»Mir geht’s auch gut, danke«, meldet sich Cam zu Wort und tätschelt mir scherzhaft den Kopf. Ihre dunklen Locken wehen ihr ins Gesicht, als uns eine kühle Brise erfasst. »Ruhige Schicht gehabt?«
»Ja, war wenig los, für eine Doppelschicht echt entspannt.«
Ich richte mich auf und schließe meine Freundin kurz in die Arme. »Können wir dann?«
Cam hebt eine sorgfältig nachgezogene Augenbraue. Wie so oft scheinen mich ihre dunklen Augen zu durchleuchten. »Erst will ich meinen Wegproviant.« Fordernd streckt sie die Hand aus.
»Klar. Wie konnte ich das vergessen?« Ich greife in meinen Rucksack und hole eine braune Papiertüte heraus, in der sich die übrig gebliebenen Panini und Muffins aus der Auslage befinden. Cam verzieht ihre Lippen zu einem breiten Grinsen, als ich ihr die Tüte reiche.
»Perfekt. Auch eins?« Ohne meine Antwort abzuwarten, reicht sie mir ein Panino mit Seranoschinken, während sie sich selbst eins mit Ziegenkäse schnappt und die Tüte wieder in meinem Rucksack verschwinden lässt.
In gemütlichem Tempo setzen wir uns in Bewegung und schlendern die 15th Avenue hinab, wie fast jeden Abend. In den knapp zwei Jahren, seit ich das Renner’s betreibe, hat es nur wenige Tage gegeben, an denen mich Cam nicht zu einem abendlichen Spaziergang mit Henry abgeholt hat, wenn ich die Spätschicht hatte. Diese Spaziergänge genießen wir beide sehr, wir können reden, unseren Tag Revue passieren lassen und einfach füreinander da sein. Abwechselnd enden unsere Runden entweder bei ihr oder bei mir und, je nach unserer Stimmung, bei einem Glas Gin, einer Flasche Bier oder einer Tasse Kakao.
Die schweren Regenwolken, die seit den frühen Morgenstunden über der Stadt hängen, brechen allmählich auf, und die Abendsonne hüllt die nassen Straßen in ein warmes Licht.
»Und, hast du heute irgendwas Interessantes erlebt? Skurrile Kundschaft gehabt?«, fragt Cam, wissbegierig wie immer, zwischen zwei Bissen ihres Paninos.
»Nicht wirklich«, entgegne ich, wobei ich kurz an die hübsche junge Frau denke, die heute Morgen zu meinen ersten Kundinnen und Kunden gehört hat. »Heute war es leer, nicht mal der Geheimagent war da.«
Cam lacht, als ich meinen britischen Stammgast mit Hut, Mantel und Aktenkoffer erwähne, der immer dasselbe bestellt und tatsächlich ein wenig geheimnisvoll wirkt.
»Wie schade. Eigentlich kommt er doch jeden Mittag, oder?«
»Vielleicht hatte er eine Mission«, sage ich grinsend.
»Meinst du, er hat die Lizenz zum Töten?« Cam schneidet eine Grimasse.
»Ganz sicher.«
»Ich glaube auch.«
»Und wie war dein Tag so?«
»Total stressig«, klagt sie und verzieht das Gesicht. »Hassan, mein Kollege aus der Abteilung, ist kindkrank, deshalb musste ich ihn heute Morgen bei seinen Auswärtsterminen vertreten. Er hat letztes Jahr einige der härteren Fälle übernommen, und teilweise war ich ein bisschen erschrocken über die Zustände in seinen Familien.« Cam schüttelt den Kopf, sodass ihr die Locken ins Gesicht fallen. »Hast du Gin da? Ich denke, heute ist ein Gintag.«
»Natürlich, für dich immer.«
Cam ist Sozialarbeiterin beim Jugendamt Downtown, und dem nach zu urteilen, was sie mir manchmal erzählt, kann ihr Job verdammt hart sein. Aber sie lebt dafür, denn jedes Kind, jede Familie, die sie unterstützen und auf den richtigen Pfad führen kann, ist ein Lichtblick für unser eigentlich so reiches Land, das Kinderarmut und Arbeitslosigkeit gern mal unter den Teppich kehrt.
»Da fällt mir ein … ich muss dir noch was beichten, Stephen.«
Ich stöhne. »Was ist es diesmal? Hast du etwa wieder irgendeine Onlinepetition mit Abofalle unterschrieben, aus der ich dich raushauen muss? Ich hab dir gesagt, ich mache das nicht mehr, Cam.«
»Nein, das ist es nicht. Es tut mir leid, ich kann dir im Oktober nicht bei der Renovierung helfen. Da bin ich in D.C., Fortbildung, zwei Wochen lang. Hab heute erst davon erfahren. Sorry.« Reumütig blickt sie zu mir hinauf. »Ich weiß, ich hab es dir versprochen.«
»Schon gut«, entgegne ich, auch wenn diese Nachricht meine Pläne für die aufwendige Renovierung der neuen Lagerhalle ziemlich durcheinanderbringt. »Ich kriege das schon allein hin, mach dir keine Gedanken.«
»Ich könnte Juan und Diego fragen, ob sie dir helfen«, bietet Cam an, worüber ich nur den Kopf schüttele. Ihre beiden ewig plappernden Brüder stehen sehr weit unten auf meiner Liste von Leuten, mit denen ich die Halle renovieren möchte.
»Sie machen das bestimmt gern.«
»Nicht nötig, ich kriege das schon hin.«
»Aber …«
»Camila. Es ist okay.« Ich grinse sie an, eine für mich seltene Geste, die ihr zeigen soll, dass es wirklich in Ordnung ist. »Lass es gut sein. Der Job geht vor.«
Sie seufzt. »Na gut.«
Es entsteht eine Pause, in der wir beide unsere Panini aufessen und den Cowen Park betreten, dessen Durchquerung der kürzeste Weg zu meiner Wohnung ist. Cam lässt Henry von der Leine und er saust kläffend los, um in den Büschen nach Eichhörnchen zu suchen.
»Freust du dich auf die Selbsthilfegruppe? Fühlst du dich bereit dafür?«, fragt sie mich nach einer Weile.
Ich schlucke. Der Gedanke, nach so vielen Jahren Therapie nun an dem Punkt zu sein, selbst Menschen helfen zu können, macht mich stolz, trotzdem habe ich Angst zu versagen, ein schlechter Leiter zu sein. Die Selbsthilfegruppe zu leiten wird etwas ganz Neues für mich sein, und es wäre gelogen zu sagen, dass es mich nicht nervös macht.
»Ja, schon. Trotzdem mache ich mir auch Sorgen, dass ich vielleicht doch nicht der Richtige dafür bin, weißt du?«
Cam und ich sind schon so viele Jahre befreundet, dass es mir nichts mehr ausmacht, ihr mein Herz auszuschütten. Wir kennen uns seit der Highschool und haben einiges gemeinsam durchgemacht.
»Mach dir keine Sorgen, du wirst das großartig machen«, entgegnet sie lächelnd. »Das weiß ich. Du hast so lange darum gekämpft und bist so weit gekommen. Wenn jemand der Richtige für diesen Job ist, dann du, Stephen.«
»Danke«, murmele ich, ehrlich dankbar für ihren Zuspruch.
»Schließlich würde man dir sonst auch nicht dieses Ding verleihen.«
Ich stöhne. »Lass uns bitte nicht über dieses Ding reden.«
»Noch zwei Tage, oder?« Cams mitleidiger Tonfall ist kaum zu ertragen.
»Ja. Und ich versuche immer noch herauszufinden, ob man das Ganze irgendwie abblasen kann. Kann man dem Präsidenten einen Korb geben?«
Sie wirft mir einen strengen Blick zu. »Dein Land will dir für deine Dienste danken, Stephen. Nimm diesen Dank an. Eine größere Ehre gibt es nicht.«
Aber ich will das alles nicht, hätte ich am liebsten gebrüllt, denn plötzlich durchzuckt mich eine rasende Wut. Ich will nichts davon. Nicht den Dank des Präsidenten, keinen Silver Star und erst recht keine verdammte Medal of Honor.
Denn ich verdiene sie nicht.
Cam scheint zu spüren, dass ich nicht weiter darüber sprechen will, denn sie wechselt wieder das Thema. »Wenn du mit der Selbsthilfegruppe startest, wirst du im Café kürzertreten, oder?«
Ich nicke. »Ja, Oliver und Liza werden ab Oktober mehr Schichten übernehmen, und ich stelle eine neue Aushilfe ein. Liza traue ich inzwischen sogar zu, den Laden morgens aufzumachen, dann kann sie sich mit Oli abwechseln.«
»Cool, ich mag sie.« Cam grinst. »Obwohl ich immer noch denke, dass sie auf dich steht.«
»Tut sie nicht«, entgegne ich geduldig. »Sie ist gerade mal einundzwanzig. Sie studiert noch, Cam.«
»Na und?«
Ich schnaube. »Ist das dein Ernst? Ich bin neunundzwanzig, Mann.«
»Neunundzwanzig und sehr attraktiv.«
»Da fühle ich mich aber geschmeichelt«, murre ich, womit ich Cam zum Lachen bringe.
»Du bist wirklich ein alter Griesgram, weißt du das?«
»Genau deswegen hast du mich doch so gern.«
Kapitel3
LOU
Wenn ich eine Sache an meinem neuen Job unterschätzt habe, dann ist es der Lärm. Auch im Büro der Yale Daily News, der Studierendenzeitung der Yale, ist es ab und an schon mal laut geworden, aber das war nichts im Vergleich zum stetigen Geräuschpegel, der in der Redaktion der EmeraldPost herrscht. Es ist meine zweite Woche hier, und an die lautstarken, nie abebbenden Diskussionen auf den Fluren, die in Kombination mit dem Rattern der Kopierer und dem ständigen Klingeln der Telefone ein penetrantes Gemisch in meinen Gehörgängen verursachen, muss ich mich definitiv noch gewöhnen.
Mein kleines Büro, das ich mir mit dem Praktikanten Wesley teile, ist eher ein Kabuff als ein richtiger Arbeitsplatz, doch immerhin hat es ein großes Fenster, aus dem man auf die 15th Avenue hinabblicken kann. Mein Schreibtisch wackelt, egal wie viele gefaltete Zettel ich unter die Beine stopfe, und die Arbeitsplatte aus dunklem Holz ist über und über mit Tassenringen bedeckt, denn anscheinend hatte die Person, die vor mir hier saß, eine ernste Koffeinsucht. Langsam beginne ich zu begreifen wieso, denn in meiner ersten Woche hier habe ich gleich sechs Überstunden gemacht, und mehr werden folgen.
Als meine beste Freundin Lien mich gestern Abend gefragt hat, wie es mir bisher bei der EmeraldPost gefällt, hätte ich ihr am liebsten gesagt, dass ich etwas anderes erwartet habe und maßlos enttäuscht bin. Dass sie mich bisher nur Ratgeber für die bunten Seiten der Onlinezeitung schreiben lassen und ich noch bei keinem einzigen Redaktionsmeeting dabei war. Aber dann hätte ich mir eingestehen müssen, dass es ein Fehler war, New York zu verlassen. Dass ich mich – wie Lien selbst – bei der New York Times hätte bewerben sollen, vielleicht hätten wir beide dort Fuß fassen können, so wie es eigentlich seit dem Studium unser Traum gewesen ist. Bis ich einen anderen Weg eingeschlagen und nach Seattle gegangen bin.
»Nur um jetzt in dieser Abstellkammer zu sitzen und über Hausmittel für Husten zu schreiben«, murmele ich verbittert in mich hinein. Wesley hebt den Kopf und blinzelt über seinen Bildschirm zu mir herüber.
»Was hast du gesagt?«
»Gar nichts«, knurre ich. Toll, jetzt bin ich auch noch neidisch auf meine beste Freundin. Gerade als ich mich wieder meinem sinnlosen Ratgeber widmen möchte, klopft jemand an den Türrahmen unseres Büros, denn selbst eine Tür gibt es nicht. Ich blicke auf. Auf der Schwelle steht eine junge Frau, etwa in meinem Alter, die dunkelbraunen Haare fallen ihr in Wellen bis zum Kinn. Sie trägt einen mintgrünen Hosenanzug, der zwar gewagt ist, ihr aber ausgesprochen gut steht. Sie lächelt, und ganz automatisch lächele ich zurück. Die Fremde betritt das Büro.
»Wesley, mach’s dir im Konferenzraum gemütlich, ich will meinen Schreibtisch zurück.« Sie schnippt mit den Fingern in Richtung des Praktikanten, der daraufhin sofort aufspringt.
»Natürlich, Miss Irwin«, murmelt er, packt seine wenigen Habseligkeiten zusammen und schlurft aus dem Raum. Als Wesley weg ist, lässt sich die Frau auf seinen Platz fallen und stößt ein tiefes Seufzen aus.
»Hi, ich bin Mia«, stellt sie sich mir vor. »Und du musst Louise Archer sein, richtig? Die Neue?«
»Genau, aber Lou ist mir lieber.« Ich schlucke meine Verwirrung über die letzten Sekunden hinunter. Dass dieses Büro eigentlich schon jemand anderem gehört, wusste ich nicht, vor dieser Mia möchte ich jedoch nicht uninformiert wirken. Sie scheint zu merken, was in mir vorgeht, denn ihr Lächeln wird breiter.
»Keine Sorge, ich beiße nicht. Ich hatte Urlaub und bin erst seit heute wieder da. Solange durfte Wesley an meinem Platz sitzen.«
»Verstehe.«
Mia mustert mich aufmerksam. »Archer … Moment mal. Bist du etwa die Tochter von David Archer? Der Host der Archer Tonight Show?« Ihre Augen weiten sich.
»Ja, die bin ich«, gebe ich ungerührt zurück, denn seit ich dreizehn Jahre alt bin, werde ich spätestens bei der Erwähnung meines Nachnamens so gut wie immer auf meinen Dad angesprochen, und inzwischen ist es mir nicht mehr unangenehm, die Tochter des berühmtesten TV-Hosts der Ostküste zu sein.
»Wow.« Mia wirkt ehrlich beeindruckt. »Ist ja cool. Ich glaube, hier hat noch nie ein Promi gearbeitet.«
Damit bringt sie mich zum Lachen, auch wenn es ein nervöses Lachen ist. »Ich bin kein Promi. Mein Dad ist einer, ich halte mich da raus. Die große Bühne war noch nie mein Ding.«
Mia schmunzelt. »Okay, du hast mich überzeugt. Du bist kein Promi. Höchstens ein Quasipromi, weil dein Daddy in ganz Amerika bekannt ist.«
»Wie du meinst. Na dann, herzlich willkommen zurück.« Wenig elegant wechsele ich das Thema. Allmählich entspanne ich mich etwas, Mia scheint nett zu sein, und ehrlicherweise bin ich erleichtert, dass mich hier endlich mal jemand wahrnimmt.
»Danke. Und dir herzlich willkommen bei der Emerald Post. Wie gefällt es dir bis jetzt?«
Und da ist sie wieder, diese eine Frage.
»Ganz gut«, lüge ich, doch darin war ich schon immer eine Niete. »Es ist nur bisher etwas … eintönig?«
Mias Lächeln verblasst. »Ich weiß, was du meinst. Okay, erste Lektion: Du musst dich hier durchbeißen, sonst gehst du unter. Das habe ich schon an meinem allerersten Tag gelernt. Warst du schon bei einem Redaktionsmeeting dabei?«
Ich schüttele den Kopf, woraufhin meine neue Kollegin nur die Augen verdreht. »War ja klar. Dann komm mal mit, wir hauen jetzt auf den Tisch.«
* * *
Ich bin erleichtert, dass Mia nicht wirklich auf den Tisch haut, aber ein kurzes Gespräch zwischen ihr und unserer Chefredakteurin Zafrina später finde ich mich plötzlich mit den anderen Mitarbeitenden im Konferenzraum wieder und lausche der Besprechung, über welche Themen in der nächsten Ausgabe berichtet werden soll. Dabei fällt mir auf, dass Mia sehr präsent ist und ein gutes Gespür für spannende Themen hat. Sie brennt für diesen Job, das sieht man gleich.
»Was ist mit der Sache um diesen Stephen Renner?«, fragt Hugh, ein rothaariger Kollege aus der Sportredaktion. »Er hat vor knapp zwei Wochen vom Präsidenten bei einer Zeremonie in Washington die Medal of Honor erhalten. Wir könnten ihn um ein Interview für den Lokalteil bitten, denn bisher hat er dazu keine Interviews gegeben.«
»Ja, weil er keine zulässt«, entgegnet Zafrina ungeduldig. »Ich war bei der Verleihung vor Ort, er wollte kein Statement abgeben.«
»Vielleicht ja jetzt.« Hugh zuckt mit den Schultern. »Einen Versuch wär’s wert. Wenn er zusagt, wird das eine riesige Story für uns.«
Zustimmendes Gemurmel setzt ein, und ich sehe mich um. Jeder hier am Tisch scheint genau zu wissen, wer dieser Stephen Renner ist und was es mit der Medaillenverleihung auf sich hat, nur ich nicht. Kurz überlege ich, einfach nachzufragen, entscheide mich aber doch dagegen, schließlich möchte ich nicht sofort als die Neue mit den unpassenden Fragen in die Geschichte eingehen.
Zafrina seufzt. »Na schön, wer möchte die Story übernehmen oder es zumindest versuchen?«
Gerade öffne ich den Mund, um mich als Freiwillige zu melden, als Mia mir zuvorkommt. »Ich mach das!«, ruft sie, und in ihren dunklen Augen blitzt eine Entschlossenheit auf, die mich beeindruckt.
Zafrina nickt. »Gut. Dann fang direkt an, Irwin, wir haben wie immer keine Zeit zu verlieren. Archer, übernimm bitte den bezahlten Artikel über das Spendenfestival in Cascade, ebenfalls für den Lokalteil«, fügt sie an mich gewandt hinzu. »Die Veranstalterinnen haben das Material schon geschickt, ich leite es dir weiter.«
»In Ordnung, danke.«
Die Runde löst sich auf, ich folge Mia zurück in unser Büro. Dort angekommen, wirft sie einen prüfenden Blick über die Schulter, und als auf dem Flur niemand zu sehen ist, vollführt sie einen kleinen Freudentanz, der mir ein Lachen entlockt.
»Was ist denn mir dir los?«
»Das wird meine erste große Story!«, jubiliert sie und reibt sich die Hände. »Endlich. Ich muss sofort loslegen.« Sie eilt zu ihrem Schreibtisch, lässt sich auf den knarzenden Drehstuhl fallen und tippt in rasender Geschwindigkeit auf die Tastatur ein. Ich tue es ihr gleich, wenn auch mit weitaus weniger Enthusiasmus.
Kurz vor der Mittagspause springt Mia plötzlich auf, rennt raus zum Kopierer und kehrt kurz darauf mit einem Stapel dicht bedruckter Blätter im Arm zurück. Ihre Wangen sind gerötet, und in ihren Augen steht noch immer dieses Strahlen, um das ich sie beneide.
»Was hast du vor?«, frage ich, als sie die Papierseiten kurzerhand in eine Mappe stopft und nach ihrem Blazer greift, der über der Stuhllehne hängt.
»Ich gehe zu Renner und bitte ihn um ein Interview.« Ihre Stimme vibriert vor Stolz, obwohl ich hinter ihrer coolen Fassade eine Spur Nervosität wahrnehme. Zumindest glaube ich das, Mia und ich kennen uns schließlich kaum.
»Das heißt, du hast die Interviewfragen schon fertig?«
Sie schnaubt. »Ich bitte dich, natürlich. Jetzt muss er nur noch zustimmen.«
»Hast du denn schon einen Termin mit ihm?« Jetzt bin ich wirklich die Neue mit den unpassenden Fragen, denn Mia schnaubt erneut.
»Noch nicht. Aber das Café liegt nur ein paar Gebäude weiter, deshalb versuche ich es gleich mit einem persönlichen Gespräch. Dann kann er sich gar nicht erst rausreden.«
»Café?«, wiederhole ich verständnislos, doch Mia rauscht schon an mir vorbei.
»Keine Zeit! Ich habe ein Interview zu führen.« Mit diesen Worten ist sie verschwunden und lässt mich ratlos in unserem Büro zurück.
Nachdem sie weg ist, versuche ich mich wieder dem bezahlten Werbeartikel zu widmen, den ich von Zafrina zugewiesen bekommen habe, aber es fällt mir schwer, mich zu konzentrieren. Ich bin Mia nicht böse, dass sie mir bei dem Interview mit dem Medaillentyp zuvorgekommen ist, trotzdem bin ich inzwischen neugierig, was es mit der Geschichte auf sich hat. Also verkleinere ich den Tab mit meinem Artikel und öffne die Suchmaschine. Hugh hat davon gesprochen, dass der Artikel mit Stephen Renner im Lokalteil erscheinen soll, weshalb ich kurzerhand die Wörter Stephen Renner Seattle in die Suchleiste eingebe. Schon bei der obersten Meldung werde ich fündig. Lebender Held:Ex-Soldat wird Medal of Honor verliehen, lautet die Schlagzeile der Seattle News Online. Ich klicke darauf. Die Seite lädt ein paar Sekunden, und als der Artikel erscheint, springt mir das Bild eines Mannes ins Auge, den ich irgendwo schon einmal gesehen habe. Ein markantes Gesicht mit gleichzeitig sanften Zügen, stechend blauen Augen und haselnussbraunem Haar, das halb unter einem Barett der Army verdeckt ist.
Und dann verknüpft mein Hirn die Zusammenhänge.
Der Mann auf dem Foto ist niemand Geringeres als der Barista, der mir am Morgen meines ersten Arbeitstags vor zwei Wochen meinen Cappuccino gemacht hat. Meine Neugier ist geweckt und ich lese den wenige Tage alten Artikel.
Es ist offiziell – dem ehemaligen Staff Sergeant Stephen G. Renner (29) wird am 3. September die Medal of Honor verliehen. Renner, der zuvor in Syrien stationiert war, war ein Squad Leader in Unterstützung der Operation Wild Frontier in Kabul, Afghanistan. Ihre Mission in der Nacht vom 10. November 2014 war die Säuberung von zwölf Gebäudeblocks, wo sechs oder mehr Aufständische vermutet waren. Für seine Taten erhielt er bereits einen Silver Star (die vierthöchste Auszeichnung der US-Streitkräfte). Diese Trophäe wird nun nach erneuter Begutachtung hochgestuft, wodurch ihm die Ehre zuteilwird, die Medal of Honor verliehen zu bekommen, die höchste und ehrenvollste militärische Auszeichnung der amerikanischen Regierung. Die Medal of Honor wird bei einer offiziellen Zeremonie vom Präsidenten der Vereinigten Staaten im Namen des Kongresses verliehen. Renner hat seinen Militärdienst 2018 beendet und führt seitdem ein Café namens Renner’s in Seattle.
Unter dem Text ist ein zweites Foto abgebildet, das Renner 2016 bei der Verleihung des Silver Stars zeigt. Ein Ex-Soldat, der ein Café führt?
»Das nenne ich mal einen Berufswechsel«, murmele ich und klicke auf das Foto, um es zu vergrößern. Renner ist ein attraktiver Mann, und sicher ist Mia nicht die einzige Journalistin, die sich dieser Tage um ein Interview mit ihm reißt. Die Verleihung der Medaille ist knapp vierzehn Tage her, sicher belagert die Presse sein Café inzwischen rund um die Uhr.
Armer Kerl.
Plötzlich bin ich erleichtert, dass Mia der Job zugefallen ist und nicht mir. Obwohl ich auf der Yale dafür bekannt war, auch den wortkargsten Leuten ein Statement aus der Nase zu ziehen – diesen Renner mit Fragen nach seiner Medaille zu durchlöchern wäre mir unangenehm gewesen, auch wenn ich nicht sagen kann warum. Zumal mir das Thema Militär und Krieg mehr nahegeht als manch anderen. Sofort droht mich eine Welle an ungebetenen Erinnerungen zu überwältigen, die ich hastig dorthin zurückschiebe, wo sie hergekommen sind: weit, weit nach hinten in die Verdrängung.
Ein letztes Mal sehe ich auf das Bild von Renner, dann schließe ich den Tab und wende mich wieder meinem Artikel zu.
Kapitel4
STEPHEN
»Gib ihnen Hausverbot«, wiederholt Cam stur, nachdem ich meinem Ärger über die Belagerung Luft gemacht habe. Seit Tagen kreuzen diese verdammten Presseleute in meinem Laden auf und verschrecken die Kundschaft. Geier und Ratten, alle miteinander. »Und wenn sie sich nicht daran halten, rufst du eben die Cops.« Durch meine AirPods klingt Cams Stimme blechern. Es ist ungewohnt, den Abend nicht mit ihr zu verbringen, aber sie wird gleich mit ihren Brüdern essen gehen. Wenigstens habe ich so mal wieder Zeit, um unter der Woche zu joggen.
»Ich kann doch nicht jedem von ihnen einzeln Hausverbot erteilen«, beschwere ich mich und verlangsame mein Lauftempo, als ich im Cowen Park ankomme. Es ist fast zwei Wochen her, seit ich dieses verdammte Stück Gold verliehen bekommen habe, und seit fast zwei Wochen müssen Oliver und Liza die Spätschichten übernehmen, weil ich es nicht mehr länger als bis zur Mittagszeit in meinem eigenen Café – meinem eigentlichen Safe Space – aushalte.
Ganz toll.
»Klar kannst du, es ist dein Laden. Hör mal, ruf mich zurück, wenn du mit Laufen fertig bist, okay? Du schnaufst voll laut in den Hörer.«
Ich verdrehe die Augen. »Verstanden. Bis dann.«
»Bis dann, Superstar«, flötet sie, gefolgt von einem schadenfrohen Lachen. So viel Mitgefühl bekommt man also von der besten Freundin.
»Leck mich, Suarez.«
Wir beenden das Gespräch und ich schalte meine Musik wieder ein – das aktuelle Album von A Day To Remember. Auch wenn ich die höchste aller militärischen Ehrungen natürlich nicht ausschlagen konnte, der Medienrummel um mich, den die Verleihung ausgelöst hat, ist so ziemlich das Letzte, was ich jetzt gebrauchen kann. Schließlich bin ich kein verdammter Held, nur will mir das niemand glauben.
Ich beschleunige mein Lauftempo, um endlich den Kopf frei zu bekommen, und nehme eine ausgedehnte Route zu meiner Wohnung. Hier in Roosevelt klingt der von Sirenen durchzogene Lärm der Innenstadt gedämpft, mehr wie ein friedliches Hintergrundrauschen. In der kleinen Seitenstraße angekommen, in der mein Wohnhaus ganz am Ende liegt, begrüßen mich die vier Jungs aus der Nachbarschaft, die wie jeden Abend auf dem Platz vor meinem Haus Basketball spielen.
»Hey, Sir«, ruft der kleinste von ihnen und passt mir den Ball zu.
»Hey.« Ich fange ihn auf, dribbele ein paarmal auf dem unebenen Asphalt und passe ihn zurück zu dem Jungen. Gerade will ich die Haustür aufschließen, als einer seiner Mannschaftskollegen das Wort ergreift.
»Sir? Entschuldigen Sie.«
Ich drehe mich um. »Ja?«
Plötzlich wirkt der Junge verlegen. Sein Freund stößt ihm den Ellbogen in die Seite. »Sind Sie … na ja, sind Sie dieser Typ, dem der Präsident die Kriegsmedaille verliehen hat? Ich hab Sie im Fernsehen gesehen!«
Oh, verdammt. Dieser Medienrummel ist das Schlimmste, was mir jemals passiert ist.
»Waren Sie im Krieg?«, plappert der mit dem Ball wissbegierig drauflos. »Haben Sie Menschen getötet? Wie bei Call of Duty?«
Mir wird heiß, obwohl der Abend kühl ist.
Haben Sie Menschen getötet?
Haben Sie?
Haben Sie?
Haben Sie?
»Nein. Da müsst ihr mich verwechseln«, nuschele ich, schließe die Tür auf und stemme mich mit der Schulter dagegen. Die alten Scharniere kreischen auf, als ich ins dunkle Treppenhaus verschwinde, weg von den Jungs, weg von ihren verdammten Fragen.
In meiner winzigen Dachgeschosswohnung, deren Wohnraum nur aus einem einzigen Zimmer besteht, merke ich, dass ich zittere. Wie in Trance sperre ich die Tür hinter mir zu, sichere sie mit der Kette und presse den Rücken fest gegen das Holz, um einen Gegendruck zu spüren. Ich korrigiere: Die Verleihung ist das Schlimmste, was mir jemals passiert ist.
Abgesehen von Kabul und allem, was danach kam.
Es ging mir gut, ich war okay. Doch jetzt kommt alles wieder hoch. Ich hasse es, jeden Tag aufs Neue an den Einsatz erinnert zu werden. Dazu gezwungen zu werden, einen Blick zurückzuwerfen auf das Leben, das ich hinter mir gelassen habe. Hinter mir lassen musste. Ich hasse es, dafür öffentlich geehrt zu werden, obwohl ich nichts so sehr vergessen will wie das, was im November 2014 geschehen ist. Auch nur eine Sekunde darüber nachzudenken schnürt mir die Luft ab, zerquetscht mir die Kehle.
Mein Blick fällt auf den Esstisch, wo das verdammte Ding immer noch liegt und mich zu verhöhnen scheint. Seit der Verleihung habe ich die Medaille nicht angerührt, ich ertrage ihren Anblick nicht mehr. Mit wenigen Schritten bin ich am Tisch, hebe die sternförmige Trophäe an ihrem Seidenband mit zwei Fingern an, als wäre sie giftig, und stopfe sie in die Schublade der Kommode neben meinem Bett.
Besser.
Aus den Augen, aus dem Sinn.
Ein, zwei Atemzüge später kann ich endlich wieder richtig atmen. Ich ziehe die Laufschuhe aus, schäle mich aus dem Hoodie und dem verschwitzten Shirt darunter und stopfe beides in den Wäschekorb. Wie immer, wenn ich mich ablenken will, lasse ich meinen Tag im Café genau Revue passieren, gehe jede einzelne Bestellung durch und versuche mich an die Leute zu erinnern, die da gewesen sind. Das Café ist mein Rückzugsort, mein Safe Space – und genau den nehmen mir die Presseleute einfach weg, ohne daran überhaupt einen Gedanken zu verschwenden. Und wenn, dann ist es ihnen egal. Sie vertreiben mich von dem Ort, der für mich Heimat und Normalität bedeutet, die Manifestation meines Lebens nach der Army.
Mit einem abfälligen Schnauben öffne ich den Kühlschrank, hole das letzte Bier heraus und schlurfe auf den Balkon, von dem aus ich die Space Needle und die neblige Silhouette des Mount Rainier sehen kann. Hinter der Skyline der Stadt zeigt sich der Himmel bereits in satten Rosa- und Orangetönen, ein schöner Anblick, bei dem meine aufgeschäumten Emotionen endlich ruhiger werden.
Früher, als ich noch die Uniform trug und ein Einsatz dem nächsten folgte, habe ich jeden Abend in den Himmel geschaut und mich gefragt, wie viele Sonnenuntergänge ich wohl noch sehen würde, bevor ich in die Luft fliege. Meinen Dienst bei der Army zu quittieren war die beste Entscheidung meines Lebens, und trotzdem fühle ich mich jeden Tag aufs Neue schuldig deswegen. Wegen ihr. Wegen ihm. Und weil ich an seiner Stelle noch hier bin – der größte Fehler, den das Schicksal jemals gemacht hat.
* * *
Erst spät am Abend fällt mir ein, dass ich völlig vergessen habe, Cam zurückzurufen. Als ich mein Handy aus der Hosentasche nehme, habe ich eine Nachricht von ihr und eine Mail von Sebastian, meinem Therapeuten, der mich an unsere morgige Sitzung erinnert. Dabei ist es schon Jahre her, seit ich einen Termin bei ihm vergessen habe, aber seitdem schickt er mir immer eine Erinnerung. Ich markiere die Mail als gelesen, was Sebastian durch die aktivierte Lesebestätigung mitbekommen wird. Das muss reichen.
Im Bett öffne ich Cams Nachricht.
Cam: Bist du okay? (22:03)
Unwillkürlich muss ich lächeln. Cam kann zwar eine ganz schöne Nervensäge sein, trotzdem ist sie immer für mich da.
Ich: Ja. Tut mir leid, dass ich vergessen habe zurückzurufen. Morgen, okay? (22:34)
Ihre Antwort lässt nicht lange auf sich warten.
Cam: Na klar. Schlaf gut, Superstar. (22:35)
Ich: Wenn du mich weiterhin so nennst, überlege ich mir das mit dem Zurückrufen noch mal. (22:35)
* * *
Am nächsten Morgen hängt dichter Nebel über der Stadt. Obwohl Oliver heute das Café für mich öffnet, stehe ich trotzdem früh auf, denn ich habe den ersten Termin bei Sebastian. Auch wenn ich diese Therapie schon seit fast drei Jahren mache, sträube ich mich jedes Mal aufs Neue dagegen, das viktorianische Gebäude in Downtown zu betreten, in dessen Erdgeschoss die Praxis liegt.
Mein Therapeut öffnet mir, Sekunden nachdem ich geklingelt habe. Dr. Sebastian Merlock, der mich bei unserer allerersten Sitzung dazu aufgefordert hat, ihn bei seinem Vornamen zu nennen, ist ein großer Mann mit dunklem Haar, breiter Kinnpartie und freundlichen blauen Augen. Wie immer trägt er einen schwarzen Pullover und Anzughosen mit ordentlicher Bügelfalte. Er lächelt, als er mir die Praxistür öffnet.
»Guten Morgen, Stephen. Wie geht’s Ihnen heute?« Sebastian tritt zur Seite, um mir Platz zu machen.
»Gut, danke.« Ich schiebe mich an ihm vorbei in die Praxis. »Und selbst?«
»Hervorragend.« Er führt mich durch den Flur zum Behandlungszimmer, ein großer, heller Raum, in dem ich schon alle möglichen Emotionen durchlebt habe, die ein Mensch fähig ist zu fühlen. »Bitte, setzen Sie sich.«
Sebastian deutet auf die beiden Ledersessel, von denen ich immer den rechten wähle. Ich nehme Platz, und der Psychotherapeut tut es mir gleich. Auf dem steinernen Beistelltisch, der wie eine kleine Barriere zwischen den Sesseln steht, liegt sein in Leder gebundenes Notizbuch, das wohl alle Geheimnisse seiner Patientinnen und Patienten enthält. Daneben steht eine Box mit Taschentüchern, die ich bisher glücklicherweise nur selten gebraucht habe, auch wenn es manchmal sicher gutgetan hätte, während einer Sitzung einfach loszuheulen.
»Wie läuft das Geschäft?«, eröffnet Sebastian unser Gespräch subtil.
»Gut. Sehr gut.« Wie immer zu Beginn einer Sitzung bin ich seltsam verkrampft – obwohl Sebastian und ich uns schon so lange kennen, brauche ich jedes Mal ein paar Minuten, um in seiner Gegenwart aufzutauen. Er weiß das, weshalb wir stets mit belanglosem Small Talk einsteigen.
»Was hatten Sie heute Morgen zum Frühstück?«
»Nichts, nur schwarzen Kaffee. Sie wissen doch, dass ich nicht frühstücke, Doc.«
Auf Sebastians Lippen erscheint ein mildes Lächeln. »Stimmt.«
»Und was hatten Sie?«
»Cornflakes. Mit Zuckerüberzug.«
»Sehr gesund.«
Sein Lächeln wird breiter. »Hey, Sie sind hier derjenige, der haufenweise Kuchen und Törtchen in seinem Café verkauft. Das ist auch nicht gerade eine ausgewogene Ernährung.«
»Aber ich backe alles selbst«, halte ich dagegen und merke, wie ich mich allmählich entspanne. »Und zwar ausschließlich mit Rohrzucker und Dinkelmehl. Ich verkaufe keine Herzinfarkte.«
»Das glaube ich Ihnen. Ihre Zimtschnecken sind wirklich gut, ich finde, Sie könnten mir mal wieder eine davon mitbringen.«
»Danke. Das mach ich.«
»Gern, ich freu mich drauf. Also, wie haben Sie die Verleihung verkraftet, Stephen?«
Ich beiße mir auf die Zunge, sodass ein scharfer Schmerz in meinem Hirn ankommt. Nun geht es also ans Eingemachte.
Gar nicht? Kaum? Schlecht?Ich weiß es nicht.
Bevor ich diese Therapie angefangen habe, hätte ich niemals gedacht, dass es so verdammt schwer ist, über seine Gefühle zu sprechen.
»Es geht so«, entgegne ich leise.
»Wie haben Sie sich gefühlt, als der Präsident Ihnen die Medaille verliehen hat?«
Beschissen? Schuldig? Miserabel?
»Ich, ähm, ich war sehr angespannt.«
»Weil Sie immer noch denken, Sie verdienen diese Ehrung nicht?«
Ich nicke, denn plötzlich ist es in meinem Hals so eng, als würde ich nur noch durch einen Strohhalm atmen. Vor Sebastian muss ich mich nicht verstecken, ich kann ihm alles sagen, was in mir vorgeht, trotzdem quittiert mir meine Stimme den Dienst. Der Doc macht sich eine Notiz in seinem Buch und blickt wieder zu mir auf.
»Ich denke, wir sollten daran arbeiten, dass die vielen negativen Emotionen, die für Sie noch an der Verleihung hängen, auf lange Sicht nicht mehr so quälend für Sie sind. Wo bewahren Sie die Medaille bislang auf?«
»In der Kommode neben meinem Bett. Ihr Anblick ist so ungewohnt.«
»Vielleicht sollten Sie sie aufhängen. Kaufen Sie sich einen Bilderrahmen und hängen Sie die Medaille an die Wand. Möglicherweise hilft das.«
Ich schnaube. Sebastian hatte in der Vergangenheit schon einige merkwürdige Ideen, die hier ist bei Weitem seine albernste. Allein der Gedanke, das Ding irgendwo aufzuhängen, wo jeder es sehen kann, verursacht mir Übelkeit.
»Nein.«
»Nein?«
»Ich möchte nicht an die Operation erinnert werden. Eigentlich an gar nichts aus meinem Einsatz.«
Der Psychotherapeut nickt. »Das weiß ich, Stephen. Aber wir wollen doch an einen Punkt kommen, an dem Sie Ihre Vergangenheit nicht mehr so sehr verdrängen. Sie müssen sich damit auseinandersetzen. Die Einsätze sind ein Teil von Ihnen, Sie müssen lernen, damit zu leben, auch wenn es Ihnen noch schwerfällt. Wir machen stetige kleine Fortschritte, finden Sie nicht? Inzwischen sind Sie doch sogar schon so weit, anderen Veteranen in der Situation zu helfen, in der Sie selbst früher waren. Sie haben den Schein als Gruppentherapeut gemacht und werden bald Ihre eigene Selbsthilfegruppe leiten. Darauf können Sie sehr stolz sein.«
»Ich weiß. Das bin ich auch.«
»Und ich ebenfalls. Die Medal of Honor könnte Ihr symbolischer Abschluss sein, Stephen. Haben Sie darüber mal nachgedacht? Sie könnten die Verleihung als Punkt am Ende Ihres Lebensabschnitts als Soldat sehen.«
Der Gedanke gefällt mir, auch wenn ich keine Ahnung habe, wie ich jemals wirklich mit alldem abschließen soll.
»Ich versuche es«, murmele ich dennoch.
»Gut.« Sebastians lässt seinen Blick aufmerksam über mein Gesicht schweifen, wie so oft, wenn er versucht, meine Gefühle zu erraten.
»Doc?«
»Ja?« Über Sebastians Nase erscheint eine kleine Falte. Er hasst es, wenn ich ihn so nenne, aber er hat längst aufgegeben, mich zu korrigieren.
»Meinen Sie, ich bin so weit? Um die Gruppe zu leiten.« Diese Frage brennt mit seit Wochen auf der Zunge. Seit feststeht, dass ich im Oktober meine erste Selbsthilfegruppe leiten werde, habe ich Angst zu versagen, die anderen Veteranen zu enttäuschen, alle zu enttäuschen.
Sebastian klappt sein Notizbuch zu und sieht mich mit gerunzelter Stirn an. »Hätte ich Ihnen sonst dazu geraten, den Therapeutenschein zu machen? Natürlich sind Sie so weit. Und die Gruppe zu leiten wird Sie selbst auch noch einmal ein ganzes Stück voranbringen, da bin ich mir sicher.«
»Danke.« Wie immer ist es mir unangenehm, von ihm gelobt zu werden, aber der Doc zählt zu den wenigen Personen auf der Welt, aus deren Mund ein Lob etwas ganz Besonderes ist. »Wenn ich Fragen habe, kann ich damit zu Ihnen kommen?«
»Natürlich. Sie können immer zu mir kommen, Stephen. Das wissen Sie.«
»Ja, ich … danke, Doc.«
»Nicht dafür. Machen wir weiter. Wie schlafen Sie derzeit?«
Kapitel5
LOU
Als Mia am nächsten Morgen kurz nach mir unser Büro betritt, sieht sie aus, als wäre jemand gestorben.
»Was ist passiert?«, frage ich, bevor mir in den Sinn kommt, dass so eine Frage vielleicht unangebracht ist. Schließlich kennen wir uns erst gerade mal einen Tag.
»Er hat mich rausgeworfen.« Sie lässt sich auf ihren quietschenden Schreibtischstuhl fallen und vergräbt das Gesicht in den Händen.
»Renner?«, hake ich vorsichtig nach.
»Nein, der Weihnachtsmann! Natürlich Renner.«
»Oh. Das tut mir leid.«
»Ich habe versagt.« Mia stöhnt und schält sich aus ihrer nassen Regenjacke, denn Seattle versinkt an diesem Morgen mal wieder im Dauerregen. Mit hängendem Kopf streckt sie die Hand aus, um ihren Computer hochzufahren. »Zafrina wird mich auslachen.«
»Niemand wird dich auslachen«, entgegne ich streng. »Du hast ein Interview nicht bekommen, na und? Passiert jedem mal. Dann ziehst du eben weiter zur nächsten Story.«
»So läuft das hier aber nicht. Wenn so etwas öfter passiert, wirst du irgendwann einfach nicht mehr rausgeschickt und versauerst am Schreibtisch. Sieh dir Hugh an, dem ist genau das passiert, und so will ich nicht auch enden. Dann werde ich nie mehr an die großen Storys kommen. Und ich will an die Spitze.« Mia betont das letzte Wort so theatralisch, dass ich lachen muss.
»Verstehe. Deine nächste Story wird ein riesiger Erfolg, ganz sicher.«
Sie seufzt. »Danke. Ich muss die ganze Zeit daran denken, wie dieser Typ mich einfach aus seinem Laden geworfen hat. Das ist mir noch nie passiert.«
»Na ja, das ist sein gutes Recht«, räume ich schulterzuckend ein. »Wenn er kein Interview geben will, kannst du ihn nicht zwingen.«
»Dann ist er ein egoistischer Mistkerl! Die ganze Stadt reißt sich um ein Interview mit ihm. Sein Café war voll von Journalisten und er hat alle weggeschickt. Er ist richtig wütend geworden.«
»Würde ich auch, wenn man mir einfach so auflauert.«
Mia wirft mir einen verachtenden Blick zu. »Ich bitte dich, Lou, wo bleibt denn dein journalistischer Ehrgeiz? Guter Journalismus bedeutet auch, die Leute ab und an zu ihrem Glück zu zwingen.«
Da bin ich anderer Meinung, doch das behalte ich lieber für mich. Okay, ja, ich war bei der Yale dafür bekannt, stille und zurückgezogene Leute zu einem Interview zu überreden, aber nicht, weil ich ihnen aufgelauert und ein Gespräch erzwungen habe, sondern vielmehr, weil ich ihnen die Bestätigung gab, die sie brauchten – dass jemand ihre Geschichte hören will. Dass ich ihre Geschichten hören will. Und vielleicht würde dasselbe ja auch bei Renner helfen. Allerdings bin ich nicht gerade scharf darauf, Mia zu belehren, also zucke ich nur mit den Schultern und widme mich wieder meiner Arbeit.
»Hast du Lust, später zusammen zum Mittagessen zu gehen?«, fragt Mia irgendwann über den üblichen Redaktionslärm hinweg, der vom Flur in unser Büro dringt. »Du bist doch neu in der Stadt, oder? Dann kennst du hier sicher noch nicht viele Leute.«
Ich blicke von meinem Computer auf. »Um genau zu sein, noch überhaupt niemanden«, sage ich, obwohl es mir plötzlich unangenehm ist, das vor Mia zuzugeben. »Also ja, sehr gern.«
»Super.« Sie strahlt. »Um die Ecke gibt es einen tollen Mexikaner, der hat die besten Tacos der Stadt und ein günstiges Mittagsmenü.«
»Klingt gut.« Ich erwidere ihr Lächeln mindestens genauso breit.
* * *
Gegen Mittag lässt der Regen allmählich nach, und Mia und ich kommen trocken zu dem Restaurant am Ende der 15th Avenue, von dem sie gesprochen hat.
»Also, du warst auf der Yale?«, fragt sie, als wir uns an einem der freien Tische in der Nähe der Fensterfront setzen, wo der Regen in feinen Rinnsalen das Glas hinabläuft. Ich nicke.
»Ja, ich komme aus New York, also war der Weg nicht weit.«
»Und wie ist es so, auf ein Ivy League College zu gehen?« Mias Gesicht nimmt einen träumerischen Ausdruck an, als sie die legendären amerikanischen Elitehochschulen erwähnt. »Ich wollte schon immer nach Harvard, seit ich zwölf war. Als damals die Absage kam, hab ich einen Tag lang nur geheult.«
Ich schmunzele, und kurz durchzuckt mich ein scharfer, wehmütiger Schmerz, als ich an meine Collegezeit zurückdenke. Ich habe es geliebt, zu studieren, und wenn ich ganz ehrlich bin, vermisse ich es schrecklich. Ich vermisse Lien, Pete und Amy, genau wie die anderen aus der Redaktion der Studierendenzeitung. Mein Team, mein Fels in der Brandung.
»Es war eine gute Zeit, aber letztendlich ist die Yale ein College wie jedes andere.« Ich halte meinen Bericht knapp, um mich nicht weiter mit diesem überraschend schmerzhaften Thema auseinandersetzen zu müssen. »Wo bist du denn gewesen?«
»Hier in Seattle, ich war auf der University of Washington«, erzählt sie und reicht mir die laminierte Karte. »Ich war Teil einer Studentenverbindung, der Alpha-Omega-Alpha-Schwesternschaft. Manchmal habe ich das Gefühl, das Studium gar nicht richtig genossen zu haben, weil ich so verbissen war. Alles, was ich wollte, war, einen Job bei der Emerald Post zu bekommen. Dafür habe ich mir den Arsch aufgerissen, Tag und Nacht habe ich für die Student Life und sämtliche Käseblätter der Stadt geschrieben. Und letztendlich hat es sich gelohnt, klar, aber manchmal ist dabei eben der Spaß auf der Strecke geblieben.« Sie seufzt. »Das ist wohl der Preis.«





























