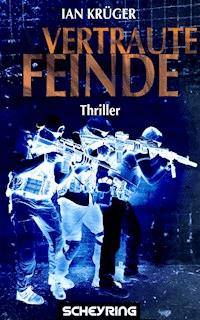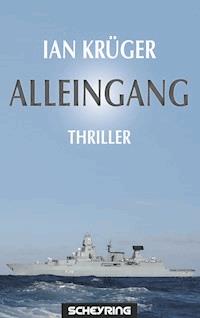
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Scheyring Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Jan Steiger
- Sprache: Deutsch
Sinai, Ägypten: Ein unglaublicher Fund auf 50 Meter Wassertiefe. CIA und BND ermitteln auf Hochtouren. Ein perfide geplanter Terroranschlag gegen den Westen scheint unaufhaltbar. Der erste Jan-Steiger-Roman. Spannend, brisant und hochaktuell.
Es beginnt als Urlaub in Ägypten: Während eines Tauchgangs macht der junge Marineoffizier Jan Steiger eine brisante Entdeckung. Nachdem er seine Vorgesetzten in Deutschland informiert hat, beruft die jüngst gewählte Bundesregierung eine Krisensitzung ein. Nahezu zeitgleich erhält die amerikanische CIA erste Hinweise über eine mögliche Anschlagsplanung gegen den Westen. Die Amerikaner ermitteln auf Hochtouren. Dabei gerät ein undurchsichtiger Tycoon ins Fadenkreuz der Geheimdienste. Im Hintergrund setzt derweil die Terror-Organisation 'Die Basis' unbeirrt ihre Planungen Schritt für Schritt in die Tat um. Der BND, durch Steigers frühe Warnung zeitlich im Vorteil, versucht gegen bürokratische Hürden das scheinbar Unaufhaltsame abzuwenden. Der Bundeskanzler steht vor einer folgenschweren Entscheidung … (LIB-294)
Pressestimmen
»Ein echter Page-Turner, zugleich gespenstisch tagesaktuell und bis in die Details hinein gespickt mit Insider-Wissen: ›Alleingang‹ von Ian Krüger ist ganz nah dran am ›Krieg gegen den Terror‹ – nicht zuletzt am deutschen Beitrag.« Yassin Musharbash, Autor von »Radikal«
» ... ›Alleingang‹ ist ein spannend und flott geschriebener Thriller, der den Vergleich mit den Standardwerken des Genres nicht zu scheuen braucht. Lebendig gezeichnete Charaktere, häufige Perspektivwechsel und mehrere parallel laufende, miteinander verknüpfte Handlungsstränge lassen keine Langeweile aufkommen. ... « Markus Tiedke in Y – Das Magazin der Bundeswehr
Geschenktipp auf dem Seefahrerblog von Peter Gross
Buchvorschlag auf augengeradeaus.net von Thomas Wiegold
»Marineoffizier zwischen Terror und Bürokratie« Buchempfehlung in Loyal – Das Magazin für Sicherheitspolitik, April 2015
»Gute deutschsprachige Thriller gibt es wenige. ›Alleingang‹, das Erstlingswerk von Ian Krüger, ist definitiv einer davon. Top recherchierte Fakten, eingebettet in eine packende Story, machen das Buch zur faszinierenden Lektüre. ...« unterwasser-Buchtipp Juli 2015
» ... Ein beängstigender Plot, authentische Charaktere sowie schnelle Szenenwechsel garantieren Spannung bis zur letzten Seite. Auch regt das Buch angesichts der aktuellen politischen Diskussion in Bezug auf den militanten Islamismus/Jihadismus zum Nachdenken an. Mit Steiger und Wolff hat der Autor Ian Krüger ein professionelles sympathisches Team geschaffen, dem wir hoffentlich noch öfter begegnen werden. Lesenswert!« Henning Hoffmann in Die Waffenkultur – Ausgabe 21 – März/April 2015
» ... Ähnlich wie bei der amerikanischen Serie ›Homeland‹ sind das rasante Erzähltempo und der permanente Wechsel der Schauplätze (Berlin, Ägypten, USA, Schleswig-Holstein) jene ästhetischen Prinzipien, nach denen der Roman bestens funktioniert und durchkomponiert ist, und woraus er seinen Thrill generiert. Angesichts des komplexen Figurenarsenals ist die Personenauflistung samt ihrer Funktion ebenso nützlich wie das nautische Glossar.« Sven Weidner in mare No. 109, April/Mai 2015
Buchvorstellung und Interview wetnotes Nr. 21 / Januar 2016
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 507
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Ian Krüger
ALLEINGANG
Thriller
SCHEYRING VERLAGNEUSS
Die Handlung und alle handelnden Personen sind frei erfunden. Jegliche Ähnlichkeit mit lebenden oder realen Personen wäre rein zufällig.
Korrekturen Stand 11/2015 ©Scheyring Verlag, Neuss 2014 Lektorat: Fabian Schamoni Autorenfoto: privat Umschlagfoto: Ann-Kathrin Fischer, Marine, mit freundlicher Genehmigung Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Sämtliche, auch auszugsweise Verwertungen bleiben vorbehalten.
Meinen Eltern, stets in Gedenken
Die Gewalt lebt davon, dass sie von den Anständigen nicht für möglich gehalten wird.
Jean-Paul Sartre
Personen
Dr.
Karl Steinberg
–
Chef des Kanzleramts
Sayed al-Hauari
–
Mastermind, die
Basis
Milan Nedic
–
Waffenhändler
Jan Steiger
–
Marineoffizier im Urlaub
Nidal al-Suri
–
Kapitän, die
Basis
Rasul Khan
–
Kommandoführer, die
Basis
Hisham Hamad
–
Oberst, ägyptischer militärischer
ND
Jörn Rickmers
–
Fregattenkapitän, Kommandeur
KSM
Omar Hussein
–
Tauchlehrer in Sharm el Sheikh
Scott MacKenzie
–
Fallführer,
NCS
/
CIA
Mirko Wolff
–
Hauptfeldwebel,
AMK
Stephan Seitz
–
Kommandant der Korvette
Erfurt
Paul Otersen
–
Kommandant der Fregatte
Sachsen
Dirk Jochum
–
Vizepräsident
BND
/
mil. Zweig
Prolog
In der nicht allzu fernen ZukunftNa'ama Bay, Sharm El SheikhSinai-Halbinsel, Ägypten
Vor wenigen Stunden hatte sich die Sonne als orangefarbener Feuerball über dem Meer erhoben, und obwohl der Winter langsam Einzug hielt, schien es, als habe sie nichts von ihrer Kraft eingebüßt. Es war noch immer angenehm warm in Sharm El Sheikh. In Na'ama Bay, dem beschaulichen kleinen Naturhafen von Sharm El Sheikh, einem pulsierenden Touristenort an der Südspitze der ägyptischen Sinaihalbinsel, herrschte reges Treiben.
Auch wenn Ägypten seine politische Stabilität längst noch nicht wiedergefunden hatte, war es Militär und Geheimdiensten doch gelungen, für Stabilität und Sicherheit auf der südlichen Sinaihalbinsel zu sorgen. Der Tourismus war eine der wichtigsten Einnahmequellen des Landes, und diese Region spielte dabei eine herausragende Rolle.
Der neue ägyptische Präsident agierte im Innern des Landes noch immer vorsichtig und ging nur bedingt auf die Forderungen der Opposition ein. Nach außen bemühte er sich, die inneren Spannungen in seinem Land als Teil eines »postrevolutionären Entwicklungsprozesses« kleinzureden. In Kairo und Alexandria wurden nachts noch immer regelmäßig Ausgangssperren verhängt. Im touristischen Süden des Landes indes herrschte Ruhe.
Vorerst.
Bekannt für den Fischreichtum und die schillernden Farben seiner Tauchreviere, hatte Sharm, wie es Tauchtouristen der Einfachheit halber nannten, dieses Jahr endlich wieder zahlreiche Urlauber angezogen. Zuvor hatten die politischen Unruhen bei Ägyptens Besucherzahlen zu massiven Einbrüchen geführt. Doch dies hatte auch positive Konsequenzen: Großfische und Meeressäuger waren in größeren Zahlen in die nördlichen Gewässer des Roten Meeres zurückgekehrt. Die Populationen der Rochen und Schildkröten waren wieder angewachsen und die Riffe hatten sich zum Teil sichtbar erholt.
Die meisten Gäste in Sharm stammten aus Russland, Großbritannien, den Niederlanden, Deutschland und der Schweiz. Viele genossen es sichtlich, für ein paar Tage dem nasskalten Klima ihrer Heimat entflohen zu sein.
Am heutigen Tag hatte die Stadt Sharm zu einem Hafenfest geladen und Dutzende von arabischen Händlern hatten ihre Stände auf dem langen Sandstrand, in unmittelbarer Nähe des Wassers, aufgebaut. Einige der Händler waren von weit her gekommen und hatten große Wüstenzelte, wie die Beduinen sie seit Jahrhunderten verwenden, aufgeschlagen. In einfachen Steinöfen wurde Fladenbrot gebacken. Es duftete nach einer Melange der exotischen Aromen des Nahen Ostens: nach den kräftigen arabischen Kaffeesorten, nach Myrrhe, Apfeltabak, Zimt und diversen frisch geernteten Kräutern. Westliche Touristen saßen zusammen mit Ägyptern bei einem Glas Tee auf samtenen Kissen und rauchten die Haschischa, die traditionelle Wasserpfeife der Araber. Eine große Tauchschule feierte ihr dreißigjähriges Bestehen und bot am Strand für einen Tag kostenlose Schnuppertauchkurse an. Kinder spielten ausgelassen zwischen Zelten und Verkaufsständen. Paare machten Urlaubsfotos und an den Souvenirständen fand ein reges Feilschen um die dort angebotenen Waren statt.
Die Pier, ein etwa 250Meter langer, aus massiven Holzbohlen gezimmerter, vier Meter breiter Steg, ragte weit in die Bucht hinein. Hier lag eine wahre Armada von Tauchgastschiffen ordentlich nebeneinander vertäut. Viele Kapitäne hofften im Zusammenhang mit dem Hafenfest auf Laufkundschaft.
Die ersten, vereinzelten Rufe verhallten ungehört. Doch es dauerte nicht lange, und sie wurden zahlreicher und lauter. Wortfetzen drangen von der Pier der Taucherboote herüber. Dann veränderten sich die Stimmen, Männer redeten aufgeregt auf Arabisch und zeigten auf das Meer, welches ruhig das Sonnenlicht reflektierte. Frauen begannen ängstlich nach ihren Kindern zu rufen. Vom Lärm alarmiert, wandten sich viele Besucher des Festes nun dem Wasser zu.
Viel war nicht zu sehen, außer einem weißen Schiff, dessen schäumende Bugwelle seine hohe Geschwindigkeit verriet. Ein dumpfer Knall, wie von einer Kanone, lenkte nun die Aufmerksamkeit der Touristen auf das Meer. Kurz darauf war ein weiterer Knall zu hören.
Die Menschen auf der Pier, dem Geschehen weitaus näher, zogen sich langsam zurück, die Augen weiter aufs Wasser gerichtet. Binnen Sekunden hatte sich das Ereignis an Land herumgesprochen und Veranstalter wie Gäste standen neugierig am Strand, um das seltsame Schauspiel zu beobachten.
Vor dem Hafen, weit draußen auf dem Meer, befand sich ein graues Kriegsschiff, das aber nicht näher zu kommen schien. Es sah fast so aus, als habe das Kriegsschiff dem weißen Taucherschiff nachgestellt. Die Yacht näherte sich nun immer schneller der Pier. Ein Ausweichen kam nicht mehr infrage.
Einige Jugendliche lachten noch, gingen ein paar Schritte ins flache Wasser, um besser sehen zu können, zeigten mit dem Finger auf das Schiff, das unbeirrt seinen Kurs zu halten schien.
Doch langsam begann ihre Neugier einem ersten Unbehagen zu weichen. Dann vernahmen sie mehrere Schüsse. Offensichtlich handelte es sich um Gewehrfeuer. Die Yacht wurde von einem großen Schlauchboot verfolgt.
Blitzartig schlug die Stimmung auf der Pier um. Wer konnte, rannte in Richtung Hafen. Einige Ägypter, Crews der anderen Tauchboote, sprangen auf der Innenseite der Pier ins Wasser, um dem drohenden Aufprall zu entgehen. Andere blickten weiter wie gelähmt auf das nahende Schiff, anstatt ihr Heil in der Flucht zu suchen. Endlich wandten sich auch die Menschen am Strand um und begannen, zu ihren Hotelanlagen zu laufen. Panik setzte ein. Wer im Weg stand, wurde niedergetrampelt. Die Ersten erreichten noch ihre Hotels.
1
Im Sommer zuvorLondon Underground, Victoria LineVauxhall CrossLondon, UK
»Next station Vauxhall Cross«, ertönte es blechern aus den Lautsprechern. Mit immer noch hoher Geschwindigkeit fuhr der Zug der Victoria Line in den tristen Bahnhof ein. Die Bremsen quietschten und die Bahn kam rasch zum Stehen. Zusammen mit vielen anderen Pendlern erhob sich der Mann mit dem dunklen Regenmantel und drängte sich zügig nach draußen auf den Bahnsteig. In der linken Hand hielt er eine Laptoptasche, in der rechten einen kleinen Regenschirm.
»Sir! Sie haben etwas vergessen! Ihre Tasche! Sir!« Angestrengt versuchte eine junge Frau, dem Mann hinterherzukommen. Sie hielt dabei eine flache, dunkelbraune Aktentasche wedelnd über ihren Kopf.
Doch der Mann mit dem Regenmantel war bereits im Gedränge verschwunden.
Kurz bevor er das Gelände des MI6– oder auch »Six«, wie der britische Auslandsgeheimdienst SIS nach wie vor genannt wurde – betrat, durchfuhr es ihn: Seine Aktentasche! Er musste sie vergessen haben.
Der Adrenalinausstoß seines Körpers signalisierte höchste Aufregung. Nervös blickte er sich um. Er spürte, wie ihm der Schweiß ausbrach.
Die Tasche!
Verdammt!
In der Bahn liegen gelassen…
Um Gottes Willen!
Was konnte er tun?
Nichts…
Den Verlust melden und sich einen Anschiss einholen?
Das war's dann, Adam…
Innendienst! Mit viel Glück keine Suspendierung…
Idiot!
Verdammter Mist!
Obwohl es nun zu spät war, musste er die Nachricht aus Washington zumindest mündlich überbringen, bevor es morgen mit Sicherheit in der Sun zu lesen sein würde. Das hieß, wenn der Finder den Datenträger aufmerksam durchforstete…
Doch Adam Quinn, Außendienstmitarbeiter des Secret Intelligence Service MI6, sollte sich irren. Nicht die Sun veröffentlichte das vertrauliche Dossier, sondern der Guardian war es, der den Artikel zwei Tage später brachte. Allerdings ohne die Herkunft der Informationen zu nennen.
Die Finderin, eine Studentin aus Kapstadt, hatte sich an dem regnerischen Nachmittag bei einem Tee intensiv dem Verschlüsselungsmechanismus des Dokuments gewidmet. Es handelte sich um ein Programm, das sie in seinen Grundzügen kannte. Für jeden Normalsterblichen hätte es eine unüberwindbare Hürde dargestellt. Doch Johanna de Villiers, IT-Studentin und Programmiererin im letzten Semester, sah es als eine Herausforderung an, den Mechanismus zu knacken. Nach drei Stunden war sie am Ziel. Sie brauchte nicht lange, um zu begreifen, dass diese Nachricht es wert war, der Öffentlichkeit präsentiert zu werden.
Die Redakteure des Guardian, einer liberalen und vor allem verantwortungsbewussten Institution der britischen Medienlandschaft, hatten sich nach langer Diskussion dazu entschieden, eine stark verkürzte Version des Inhaltes zu veröffentlichen. Die Schlagzeile:
US considers dodgy candidate for Syrian presidency1
verfehlte ihre Wirkung nicht.
Was die Journalisten nicht wissen konnten:
Ursprünglich sollte der amerikanische Wunschkandidat erst in sechs Wochen bei einem geheimen Treffen in Washington D.C., zu dem nur ein paar erlesene westliche Vertreter eingeladen worden waren, vorgestellt werden.
Doch Her Majesty's Government hatte MI6 beauftragt, Informationen über die amerikanische Vorgehensweise im Vorfeld zu beschaffen. Man hatte, was den jungen syrischen Staat betraf, eben auch eigene Interessen. Das Prekäre daran war nicht der Umstand der vorzeitigen Veröffentlichung, sondern die Tatsache, dass Quinn die Informationen von einem amerikanischen CIA-Mitarbeiter quasi gekauft hatte – zum Preis eines zugegebenermaßen opulenten Abendessens. Und genau dieser Umstand belastete nun die historisch gewachsene »besondere Beziehung«, die amerikanische und britische Geheimdienste seit dem Zweiten Weltkrieg pflegten.
Israel würde den Kandidaten, dem der Geruch einer antisemitischen Gesinnung anhing, niemals akzeptieren. So viel stand fest.
Nun aber konnten die USA den Israelis ihre Pläne nicht mehr schonend beibringen. Der Geist war aus der Flasche.
2
BundeskanzleramtSpreeuferBerlin, DeutschlandHeute
»Mein lieber Herr Doktor Steinberg!« So nannte der Kanzler seinen Kanzleramtschef nur, wenn er sich aufregte.
»Der Artikel im Guardian gibt es uns schwarz auf weiß. Kaum ist ein Ende des Bürgerkriegs in Syrien in Sicht, da preschen die Amerikaner vor und bringen ihren Wunschkandidaten ins Spiel. Natürlich an allen vorbei. Und dann eine solche Figur. Natürlich ein Exilsyrer. Es würde mich wundern, wenn den Mann in Syrien überhaupt jemand kennt. Sie werden es nie lernen! Ein Politiker in dieser Position muss vom Volk akzeptiert sein!«
Der Bundeskanzler war sichtlich irritiert.
»Haben Sie etwas anderes erwartet?«, fragte Steinberg lakonisch.
Der Kanzler legte seinen Kopf zur Seite und antwortete:
»Ehrlich gesagt: ja. Ich dachte, man hätte in Washington aus Afghanistan und Irak seine Lehren gezogen. Zudem überrascht mich der frühe Zeitpunkt, wir haben noch nicht einmal ein syrisches Parlament.«
»Hm.«
Dr.Karl Steinberg war nachdenklich:
»Die Genfer Verhandlungen…«
»…haben bislang nichts wirklich Wesentliches erbracht…«, vollendete der Kanzler den begonnenen Satz.
Steinberg zuckte resigniert mit den Schultern und argumentierte:
»Die Amerikaner machen, was sie wollen, weil sie es können.«
»Das ist wohl so. Aber deswegen müssen wir noch lange nicht tatenlos zuschauen. Bitte veranlassen Sie ein Treffen des Rates in einer Stunde. Der Zeitpunkt ist gekommen. Wir sollten nun langsam handeln.«
Kanzleramtschef Dr.Karl Steinberg zog die Augenbrauen hoch:
»In einer Stunde? Dann können…«
»…nicht alle teilnehmen – ich bin mir dessen bewusst.«
»In Ordnung, ich leite das in die Wege.«
»Danke.«
»Selbstverständlich. Ich brauche Ihnen wohl nicht zu sagen, dass die Amerikaner versuchen werden, ihre Interessen in jedem Fall durchzudrücken?«
»Nicht unbedingt – wir müssen eben überzeugend sein. Der amerikanische Präsident ist kein Dummkopf, er wird vernünftigen Argumenten Gehör schenken. Wir haben die Vorarbeit zu einem geheimen Gipfeltreffen nicht umsonst vor einigen Monaten begonnen. Die momentane Situation war, mit Abweichungen, absehbar und nun scheren die Amerikaner aus und schützen nach dem üblichen Muster ihre Interessen.«
»Die möchten verständlicherweise nicht sehen, dass die neue syrische Regierung den Russen wieder einen großen Kriegshafen im Mittelmeer zur Verfügung stellt«, wandte Dr.Steinberg ein.
»Das möchten wir ja auch nicht, aber wir benötigen in dieser Region zunächst eine perspektivisch stabile Regierung, in der die Masse der syrischen Bevölkerung repräsentiert ist und in der die Islamisten nur eine kleine Minderheit bilden. Ein seriöses Gipfeltreffen zu diesem Thema an einem neutralen Ort könnte, vorausgesetzt, es sind alle wesentlichen Parteien vor Ort, die Weichen für weitere Gespräche stellen«, entgegnete der Bundeskanzler.
»Und die Gespräche in Genf?«
»Sie wissen doch, dass sich die syrische Opposition für einen neutralen Ort im Nahen Osten ausgesprochen hat.«
»Und ausgerechnet Ägypten hat sich bereiterklärt, die Patenschaft für das Gipfeltreffen zu übernehmen«, stellte Dr.Steinberg ungläubig fest.
»Ja, die Syrer haben nach einem Ort im Orient verlangt, wie ich es erwartet habe, und die junge ägyptische Regierung, die bemüht ist, Normalität zu demonstrieren, hat die Lage erkannt und sich gleich angeboten.«
»Was sagt denn der BND dazu? Man hört doch nach wie vor nicht viel Gutes aus Ägypten«, meinte Dr.Steinberg.
»Der BND sagt, dass das ägyptische Militär im Sinai den Daumen draufhat und Sicherheit für einen überschaubaren Zeitraum gewährleisten kann. Der Ort ist hermetisch abgeriegelt. Das BKA schickt ein Vorauskommando hin, das noch einmal genauer hinschaut.«
»Das akzeptiere ich fürs Erste, gestatten Sie mir aber, dass ich skeptisch bleibe.« Dr.Steinberg machte sich aufrichtige Sorgen um seinen Kanzler.
»Wir werden sehen, mein lieber Steinberg, wir werden sehen…«
Der Kanzleramtschef wandte sich zum Gehen.
»Ach, Steinberg?«
»Ja?«
»Sein Sie so gut und bringen Sie mir doch bitte eine Tasse Tee.«
Dr.Steinberg zog zunächst die Augenbrauen hoch, lächelte dann aber in sich hinein, nickte und schloss leise hinter sich die Tür.
3
Sechs Jahre zuvorWaziristan, Nordwest-PakistanGrenzgebiet zu Afghanistan
Der Raum war halbdunkel und feucht. Sayed wusste, er befand sich in einer Art Souterrain. Durch einen knappen Spalt zwischen Dach und Erdreich, den man offenbar bewusst offen gelassen hatte, konnte er das dichte Buschwerk sehen, das diesen Teil der überwiegend unterirdisch angelegten Bunkeranlage bedeckte. Auf ein Fenster hatte man beim Bau des Komplexes verzichtet. An die Wand gelehnt standen verkleidete Bretter, die offenbar angefertigt worden waren, um diese Öffnungen bei Nacht zu verschließen.
Das mit Stahlbeton gepanzerte Dach über ihm war mit Rasen und Sträuchern bepflanzt. Er hatte es bei seiner Ankunft nicht als solches wahrgenommen, nachdem man ihm die Binde von den Augen genommen hatte. Die Anlage, in der er sich befand, schien ein perfekt getarntes Bunkersystem zu sein, das über eine Vielzahl von weit verzweigten Gängen verfügte und aus der Luft nicht zu erkennen war.
Auf seinem langen, beschwerlichen Weg hierher hatte er furchtbare Dinge zu sehen bekommen. Noch in der Khyberregion im Nordwesten Pakistans waren sie an den Überresten eines Weilers vorbeigekommen. Drei Häuser waren nahezu vollständig zerstört worden, dreiunddreißig Menschen hatten den Tod gefunden. Auf seine Frage, was passiert sei, hatte sein Führer geantwortet:
»Das waren die Amerikaner, sie machen Werbung für uns.« Der Führer schnaubte durch die Nasenlöcher, es klang wie ein unterdrücktes Lachen. Dann führte er weiter aus:
»Das ist das Werk einer Drohne. Die Kuffar2 nennen sie Reaper. Sie haben den Scheich in einem der Häuser vermutet. Aber der ist ihnen stets eine Nasenlänge voraus.« Der Mann lachte. »Nach solchen Aktionen stehen die Freiwilligen bei uns Schlange.«
Sayed nickte. Er schwieg und dachte nach. Eigentlich wusste er über diese Angriffe bestens Bescheid, aber es war schon ein Unterschied, hierüber lediglich gelesen zu haben oder die Folgen nun in der Realität zu sehen und dem Gestank von verbranntem Menschenfleisch ausgesetzt zu sein.
Die Amerikaner verwendeten unbemannte Flugzeuge, sogenannte Drohnen, um von ihnen aus ferngesteuerte Raketen auf Häuser zu feuern, in denen sie Mujaheddin3 vermuteten. Dabei starben regelmäßig viele Unschuldige, was den Hass der Zivilbevölkerung schürte.
Sein Führer riss ihn wieder aus seinen Gedanken:
»Bald, sehr bald wird Pakistan wieder frei sein! Wir erhalten von der Bevölkerung sehr viel Unterstützung. Die Marionetten in Islamabad beweisen tagtäglich, wie inkompetent sie sind…«
Diese Worte klangen Sayed noch in den Ohren, während sie ihren Weg durch das unwegsame Gelände fortsetzten.
Er erinnerte sich. Vor einigen Jahren hatten heftige Monsunregenfälle den Fluss Indus über die Ufer treten lassen und große Teile Pakistans überschwemmt. Es war die größte Flutkatastrophe, die es jemals auf dem indischen Subkontinent gegeben hatte. Die Tehrik-i-Taliban, die größte Talibanbewegung in Pakistan, hatte durch ihre Hilfsaktionen viele Sympathien im Lande gewonnen.
Im weiteren Verlauf der Reise hatte Sayed die Schönheit unberührter Natur erfahren. Klare Seen, Pinienwälder, Haine voller Apfel- und Orangenbäume und um ihn herum die schneebedeckten Wipfel der Berge.
»Dies ist das Swat-Tal. Früher war die Region das Traumziel frisch vermählter Hochzeitspaare«, hatte sein Führer ihm gesagt. »Wir befinden uns nun im Islamischen Emirat. Abdul Shakeer Khan wird die Natur erhalten, aber die Menschen werden sich umstellen müssen. Aufgrund der Scharia herrscht hier wieder Recht und Ordnung – nicht so wie in Islamabad!«
Davon, dass er die Wahrheit sprach, hatte sich Sayed in den vergangenen Tagen überzeugen können. Sie hatten mehrere Leichen an Bäumen oder an Straßenlaternen baumeln sehen. Der süßliche Geruch von Verwesung hatte in der Luft gehangen.
»Das wird die Menschen lehren, dass wir keine leeren Drohungen aussprechen. Wer mit den Marionetten in Islamabad kooperiert, muss sterben!«
Noch vor gut drei Jahren, als der öffentliche Druck zu groß geworden war, hatte die pakistanische Regierung eine Vielzahl regulärer Infanterieeinheiten ins Swat-Tal entsendet. Nach einer zermürbenden Offensive konnten Teile des Gebietes von der pakistanischen Armee zurückerobert werden. Doch die Angst unter den dort lebenden Menschen war geblieben. Wie lange würden die Regierungstruppen bleiben? Was käme nach einem Truppenabzug?
Die pakistanischen Taliban hatten sich letztendlich als die zäheren Kämpfer erwiesen und das Gebiet innerhalb weniger Monate zurückgewonnen. Mit ihnen hatte die Scharia, das fundamentalistische islamische Rechtssystem, wieder Einzug gehalten. Die Bemühungen der pakistanischen Streitkräfte, das Swat-Tal aus den Händen der Taliban zu befreien, waren gescheitert.
Allah sei Dank!
Nach einem weiteren Tag hatte sich Sayed eine Augenbinde aufsetzen müssen und kurz darauf hatten sich unbemerkt Männer zu ihnen gesellt. Wie viele es waren, wusste er nicht. Er hatte nur ihre Schritte vernommen. Einen halben Tag später waren sie endlich an ihrem Ziel angekommen.
Zwei Wachen, die ihn seit seiner Ankunft im Lager auf Schritt und Tritt begleitet hatten, standen hinter ihm und schwiegen. Er sah sich in dem trostlosen, muffigen Raum um. Der Lehmboden war festgetreten. Inventar gab es nicht, aber in einer Ecke konnte er eine Feuerstelle ausmachen. Er fragte sich, wann man hier ein Feuer entzünden würde und wohin der Rauchabzug wohl führte. Aus Sicherheitsgründen würde man den Rauch des Nachts vermutlich umlenken, wenn die Temperatur sank und die Öffnungen verschlossen waren. Er wusste, dass Wärmebildkameras heutzutage in der Lage waren, auch noch aus größten Höhen kleinere Temperaturveränderungen festzustellen.
Es war so kühl, dass er fröstelte. Nach einer intensiven und stellenweise unangenehmen Durchsuchung – man hatte ihn sogar geröntgt – hatte er sich umziehen müssen. Außer einem langen, dicken Baumwollgewand trug er nur noch Sandalen, darunter war er nackt.
Die Zeit schien stillzustehen.
Ob es wohl jedem Besucher so erging?
Vermutlich.
Sicherheit hatte oberste Priorität.
Das war zu erwarten gewesen.
An der Wand hing ein Spiegel, dem die Feuchtigkeit bereits arg zugesetzt hatte. Gedankenverloren betrachtete Sayed sein zerfurchtes Gesicht. Es hatte durchaus etwas Sympathisches. Wenn er lächelte, wurde dies von Frauen und Kindern gleichermaßen geschätzt. Doch ließ er seine dunklen Augen in den tiefliegenden Höhlen funkeln, dann machte sich bei seinem Gegenüber schnell ein Gefühl des Unwohlseins breit. Sayed war zwar nicht sonderlich groß und eher drahtig als muskulös, aber das hatte in seinem Leben nie eine Rolle gespielt. Seit seinem sechzehnten Lebensjahr war er ein echter Mujahed, der seine Vorstellungen mit Intelligenz und gezielter Gewalt durchsetzte. Allah war groß und seine Gesetze waren über jeden Zweifel erhaben. Einer Interpretation, wie sie von vielen sogenannten Reformern gefordert wurde, bedurfte es nicht. Reformer waren Schwächlinge, ungerade Menschen, wie er sie nannte. Oft vom Westen korrumpiert, wollten diese Menschen den Islam verfälschen.
Nach einer Zeit, die ihm wie eine Ewigkeit vorkam, öffnete sich im hinteren Teil des Raumes eine Tür und ein Lichtstrahl fiel hinein. Ein bärtiger Mann mit einem Turban, wie die Paschtunen ihn trugen, nickte ihnen zu. Sayed fühlte die Hände seiner beiden Begleiter auf seinem Rücken, wie sie ihn sanft in Richtung Tür schoben. Dabei ließen sie keinen Zweifel daran, dass sie ihn augenblicklich töten würden, sollte er sich gegenüber seinem Gastgeber einen Fehler erlauben.
Der Raum, den sie nun betraten, war hell erleuchtet, überall brannten Kerzen. Als er seinen Fuß in den Raum setzte, stutzte er. Er blickte zu Boden.
Der Boden war hier mit kostbaren Teppichen ausgelegt, die vermutlich aus dem Iran stammten. Innerhalb weniger Sekunden hatte Sayed sein Umfeld erfasst. An einer Wand hing ein großes gesticktes Banner, auf dem ein dunkler Reiter abgebildet war, der zu Pferde mit einer großen schwarzen Flagge durch die Nacht ritt. Darunter stand in eleganten arabischen Lettern geschrieben:
Ritter unter dem Banner des Propheten
An der gegenüberliegenden Wand erkannte er eine Karte mit den Umrissen der afghanischen Stadt Kandahar. Im hinteren Bereich entdeckte er ein kleines Bücherregal. Sein Hirn hatte Mühe, die vielen Eindrücke zu verarbeiten.
Ein flacher Holztisch aus dunklem Tropenholz stand in der Mitte des Raumes vor einem Diwan. Auf dem Tisch befanden sich ein Schachspiel und eine Ausgabe des Koran. Das heilige Buch war aufgeschlagen.
Hinter dem Tisch saß ein Mann aufrecht auf einem thronartigen Holzstuhl, seine Hände auf die Armlehnen gelegt. Die Augen halbgeschlossen, strahlte er eine außergewöhnliche Ruhe aus.
Rasch kniete Sayed nieder.
»Sei willkommen, mein Bruder! Bitte erhebe dich wieder!«
»Scheich!«
»Ich freue mich, dass es Allah gefallen hat, uns heute hier zusammenzuführen!«
»Allahu Akbar!4«
»Allahu Akbar!«
»Du hast eine lange Reise hinter dir. Bist du durstig oder verspürst du Hunger?«
»Ihr seid sehr gütig, ich fühle mich geehrt, dass Ihr mich empfangt, mein Scheich!«
»Du sollst uns willkommen sein, wir werden später noch Gelegenheit haben, zusammen zu speisen!«
Sein Gastgeber bedeutete ihm mit der rechten Hand, er solle Platz nehmen. Dann schloss der Scheich die Augen.
Für einige Sekunden herrschte absolute Stille.
Sayed zwang sich, nicht zu lange in das Gesicht seines Gegenübers zu blicken, denn das galt als unhöflich. Kurz schaute er auf und sein Blick streifte das Angesicht des Scheichs.
Es war nicht zu übersehen, dass der Mann gezeichnet war. Die Augen waren tief umrändert, die Wangen eingefallen und seine Haut aschfahl. Auch glaubte Sayed, Schweißperlen auf seiner Stirn festgestellt zu haben. Ein dünner schwarzer Bart fiel dem Mann bis auf die Brust. Sayed wusste, dass die Haare gefärbt waren, um Gesundheit und Kraft vorzutäuschen. Ein makellos gebundener weißer Turban bildete einen starken Kontrast zum dunklen Gewand der Paschtunen, das der Mann mit besonderer Würde trug.
Erinnerungen an früher wurden in ihm wach, als dieser Mann noch eine »Woodland« Camouflage-Jacke bevorzugt hatte. Diese tarnfarbene Feldjacke der Amerikaner hatte ihm jahrelang einen martialischen Ausdruck verliehen.
Auch stellte er fest, dass der Scheich stark an Gewicht verloren hatte.
Für ihn unerwartet öffnete der Scheich plötzlich die Augen.
Sayed erschrak und für eine Sekunde glaubte er, sein Gegenüber habe ihn während der ganzen Zeit beobachtet und in seinen Gedanken gelesen.
»Du weißt, dass die Regeln es normalerweise nicht zulassen, dass man mich besucht.«
»Ja, Herr!«
»Wir, die Basis, sind aktiv. Wir haben über 20000 Kämpfer weltweit unter Waffen. Doch wir haben uns lange zurückgehalten. Es gilt, die Kraft auf einen bestimmten Punkt zu konzentrieren, und es sind intelligente Brüder wie du, die mir Hoffnung geben.«
Sayed schwieg und verneigte sich.
»Du hast einen kühnen Plan gefasst.« Der Scheich neigte den Kopf und es schien, als zollte er seinem Besucher Respekt.
»Wenn Ihr es sagt, Scheich.«
»Ich habe mit Ayman lange darüber gesprochen und er war von deinem Plan sehr angetan. Er sagt, er kenne dich noch von früher.«
»Von früher, Scheich?«
»Damals in Naga Hammadi – das ägyptische Militär tötete über einhundert Brüder und Schwestern.«
Sayed hielt inne. Gedanken schossen durch seinen Kopf. Dr.Aiman az-Zawahiri, die rechte Hand des Scheichs, ein Kinderarzt und Landsmann, kannte ihn? Er konnte es sich kaum vorstellen. An die brutale Beendigung der Demonstration, bei der seine kleine Schwester und seine zwei Cousins den Tod gefunden hatten, würde er sich jedoch immer wieder erinnern.
»Ihr seid sehr gütig, Scheich.«
»Du hast damals Steine auf die Soldaten geworfen, bis ältere Muslimbrüder sich deiner annahmen und dich mitnahmen und somit vor der sicheren Gefangennahme und anschließenden Folter retteten.«
Sayed spürte sein Herz vor Erregung stärker schlagen. Mit einem Mal begann die Vergangenheit vor seinem inneren Auge wieder aufzuleben.
Ein Durcheinander an wehenden weißen Kleidern von Menschen, die flohen, das beißende Tränengas in den Augen… Weinend hatte er sich damals über den Leichnam seiner kleinen Schwester gebeugt, bis kräftige Männer ihn mitgeschleift hatten. Es waren jedoch keine Sicherheitskräfte gewesen, sondern Muslimbrüder in weißen Gewändern und Sandalen. Hier hatte er zum ersten Mal ihre direkte Bekanntschaft gemacht.
Der Scheich schien bis ins Detail über sein Leben informiert zu sein.
Natürlich, was dachtest du denn? Dass jeder, der ihm einen Plan für eine Operation präsentieren möchte, einfach so vorgelassen wird?
Die Stimme des Scheichs riss ihn aus seinen Gedanken.
»Dennoch würde ich dir gerne einige Fragen stellen.«
Es war keine Kritik.
Noch nicht.
Seine Kehle schnürte sich zusammen. Sayed verneigte sich tief.
»Du hast mit einem Ungläubigen Geschäfte gemacht, einem orthodoxen Christen, diesem Serben… War das unbedingt notwendig?«
Sayed spürte, wie sich sein Magen verkrampfte. Obwohl mit weicher Stimme formuliert, traf ihn die Frage, die ein Vorwurf war, wie ein Fausthieb. Er riss sich zusammen und blickte demütig auf den Boden.
»Scheich, wenn Ihr erlaubt… der Feind unseres Feindes muss nicht unser Freund sein, aber ich dachte, der Serbe könnte zu einem vorübergehenden Verbündeten werden. Zudem war er der Einzige, der unsere Anforderungen im vorgegebenen Zeitrahmen erfüllen konnte. Ich habe zudem eine falsche Fährte in den Libanon gelegt.«
Bedächtiges Nicken.
»So sei es denn. Ich vertraue auf dein Urteilsvermögen, auch wenn ich einen anderen Weg bevorzugt hätte – es dürfen keine Spuren zurückbleiben!«
»Ihr habt recht, doch es wird nichts geben, das man nachverfolgen könnte.«
Einige Sekunden herrschte Stille. Dann ergriff der Gastgeber erneut das Wort.
»Meine Erfahrungen in technischen Dingen sind begrenzt, aber ich mache mir natürlich meine Gedanken. Sag', sind diese Behälter wirklich dicht?«
»Wir werden Spezialbehälter verwenden, es kann nichts schiefgehen. Wir haben sie intensiv getestet. Außerdem haben wir großzügig geplant, alles ist doppelt vorhanden. Wir wollten das Risiko so gering wie möglich halten.«
Der Scheich lehnte sich ein wenig nach vorn und blickte ihn prüfend an.
»Könnten die Behälter in einer solchen Tiefe nicht unter Umständen verloren gehen?«
»Nicht von selbst.«
»Hmm.« Der Scheich zögerte. Schließlich sagte er:
»Dann ist es recht.«
Der Scheich rieb sich mit beiden Händen über die Augen. Er wirkt erschöpft, fast schwach, dachte Sayed.
»Euch allen sei gesagt: Seid kühn bei der Ausführung eures Planes, doch hütet euch davor, den Gegner zu unterschätzen!«
»Wir werden ihn nicht unterschätzen, mein Scheich.«
»Möge Allah euch beistehen!«
»Allahu Akbar!«
»Allahu Akbar!«
Der Scheich hob den rechten Zeigefinger und seine dunklen Augen wurden kalt und entschlossen, für einige Sekunden schien er seine Energie zurückgewonnen zu haben:
»Es ist an der Zeit, dass die Welt wieder spürt, wie mächtig wir sind! Ihr werdet ein neues Zeichen setzen!« Eine neue, jüngere Generation bereitet sich vor, den Kampf in die Städte zu tragen. Unsere Brüder verfügen über Ausbildungen, die sie den westlichen Universitäten zu verdanken haben. Wir werden die Ungläubigen mit ihren eigenen Waffen schlagen! Der Westen soll erzittern! Wir werden seine Arroganz bestrafen und ihn dort treffen, wo der Schmerz am größten ist: In der Heimat seiner Krieger!«
»So ist es!«, entgegnete Sayed und verneigte sich wieder.
»Ihr habt hart gearbeitet und ich unterstütze euer Vorhaben. Nun ist es an Euch, dem Islam erneut zu weltweitem Ruhm zu verhelfen.«
Sayed schluckte, er war gerührt und auch stolz über das Vertrauen, das der Scheich ihm entgegenbrachte.
»Und nun wollen wir etwas essen…«, sagte der Scheich und klatschte in die Hände. Sayed sah, wie im hinteren Teil des Raumes ein Vorhang zur Seite gezogen wurde und sich eine kleine Nebentür öffnete. Nachdem sie sich erhoben hatten, bemerkte er, dass er einen ganzen Kopf kleiner war als sein Gastgeber.
4
Ravna-Gora-Gebirge120km südlich von BelgradSerbien
Ein Teil des Gebäudes war bereits aus der Ferne gut zu erkennen. Insbesondere nachts, wenn die hellen Mauern angestrahlt wurden, erhob sich das Gebäude herrschaftlich über das kleine Tal. Dieser Effekt war erwünscht und war den leistungsstarken Halogenscheinwerfern geschuldet, die zahlreich bei den umfangreichen Sanierungsarbeiten der Villa in den Rasen eingelassen worden waren.
Das Anwesen befand sich auf einem vorgelagerten Berg des Ravna-Gora-Gebirges, etwa eine Autostunde von der Hauptstadt Belgrad entfernt. Es war größtenteils von dichtem Mischwald umgeben. Eine Schneise im Baumbestand ließ Platz für eine Zufahrtsstraße und erlaubte vorbeifahrenden Autofahrern einen flüchtigen Blick auf die majestätische Villa.
Unerwünschte Besucher wurden von einer vier Meter hohen Betonmauer ferngehalten, an der in regelmäßigen Abständen hochauflösende Kameras mit Restlichtverstärkern jede Bewegung dokumentierten. Hinter der Villa befand sich ein Hubschrauberlandeplatz. Eine dichte Hecke verdeckte die Sicht auf einen geparkten französischen Dauphin-Helikopter.
Milan Nedic stand in der Küche seiner Winterresidenz – seiner »Festung«, wie er sie nannte – und trank Kaffee. Die mit einem dünnen blauen Ring versehene Kaffeetasse wies am Boden ein kleines Hakenkreuz auf. Das Service stammte aus dem Vermächtnis seines Großonkels, der es einst einem kroatischen Kollaborateur abgenommen hatte. Es war halb sechs Uhr morgens.
Er fuhr sich mit der Hand durch die graumelierten Haare, die bereits perfekt lagen, obwohl er gerade erst aufgestanden war. Über einem blauen Pyjama trug er einen anthrazitfarbenen Bademantel eines italienischen Modedesigners. Am vierten Finger seiner rechten Hand prangte ein auffälliger Siegelring.
Nedic blickte aus dem Fenster in den dichter werdenden Nebel. Colette, eine junge Französin, mit der er sich seit zwei Tagen vergnügte, lag noch im Bett und schlief.
Der Serbe bevorzugte die frühen Morgenstunden, um die geschäftliche Korrespondenz zu erledigen. Sie bestand ausschließlich aus E-Mails – in diesem Fall speziell verschlüsselte E-Mails.
»Diesen Code kann selbst die amerikanische NSA nicht knacken!«, hatte Sergej nicht ohne Stolz behauptet. Noch vor einem Jahr hatte er für den russischen technischen Geheimdienst FAPSI gearbeitet.
Bei dem horrenden Preis, den er dem Russen gezahlt hatte, war das nur recht und billig. In seinem Geschäft bildeten sichere Kommunikationswege eine Grundvoraussetzung für den Erfolg.
Mit der Kaffeetasse in der Hand ging er in sein Arbeitszimmer, das einer Mischung aus antiquarischer Bibliothek und hochmodernem Kommunikationszentrum glich.
Hohe Decken waren mit aufwendigen Stuckelementen verziert. In einem offenen, mit Marmor umrahmten Kamin glimmte noch etwas Asche. Ein großer Perserteppich bedeckte einen Teil der Fliesen, die ursprünglich aus einem alten toskanischen Bergkloster stammten. Unter einem großen Eichenholzschreibtisch befanden sich hinter der Vertäfelung leistungsstarke, moderne Computer.
Auf einem Sekretär brannte eine Petroleumlampe, deren schwacher Schein die Bibliothek in ein warmes Licht hüllte. Die Stimmung wurde nur vom gelegentlichen Flimmern der Bildschirmschoner, die über die Flachbildschirme wanderten, gestört.
An einer Wand hing ein großes Ölgemälde. Es stellte auf dramatische Weise eine Kampfszene aus einer historischen Schlacht dar. Bei genauerem Hinsehen konnte man erkennen, dass es sich um die legendäre Schlacht auf dem Amselfeld handelte. Nur Nedic und einige wenige Eingeweihte wussten, dass es das Original des berühmten serbischen Künstlers Adam Stefanovic war. Eine exakte Kopie, im Jahr 1991 von einem französischen Spezialisten angefertigt, hing stattdessen im Nationalen Kunstmuseum in Belgrad.
Diese Schlacht zwischen Serben und Türken war für ihn, wie für viele andere Serben, der Inbegriff des serbischen Kampfes gegen die Osmanen.
Den serbischen Helden, Fürst Lazar, betrachtete Nedic als sein Vorbild. Mehr noch, Lazar war für ihn eine Ikone. Als Anführer der serbischen Streitmacht hatte Lazar vor der Schlacht die Wahl gehabt zwischen einem irdischen und einem himmlischen Reich. Er hatte sich für das ewige Leben entschieden. Da er einen Märtyrertod starb, wurde er noch heute von der serbisch-orthodoxen Kirche als Heiliger verehrt.
Und das zu Recht, dachte Nedic.
Die Unabhängigkeit des Kosovo war ein Frevel und die Unterstützung des sogenannten »Westens« nichts anderes als ein Versuch, Serbien noch weiter zu demütigen und zu schwächen. Dann hatte die serbische Regierung auch noch den Antrag gestellt, in die EU aufgenommen zu werden. Der Beitritt war jetzt nur noch eine Frage der Zeit. Seit kurzem war Serbien offizieller EU-Beitrittskandidat. Eine Katastrophe!
Er wollte sich gar nicht ausmalen, was sich noch alles ändern würde, und er war davon überzeugt, dass die meisten seiner serbischen Landsleute genauso dachten wie er.
In Gedanken versunken saß er über seinem Posteingang. Er hatte soeben einige Anweisungen nach Paris gesendet und malte sich gerade aus, wie er Colette später auf seine ganz spezielle Art wecken würde, als ein Telefon auf seinem Schreibtisch leise klingelte.
Die verschlüsselte Leitung, dachte er. Ungehalten griff er nach dem Hörer.
»Ja?«
»Drazen hier, entschuldige die frühe Störung. Ich hoffe, ich habe dich nicht geweckt.«
»Nein!«, antwortete Nedic gereizt. Mit Jovanovic hatte er nicht gerechnet.
»Du hast gesagt, du willst sofort unterrichtet werden«, erklärte sich der Anrufer zögerlich.
»Das habe ich. Also, ich höre?«, sagte Nedic, der seine Ruhe wiedergefunden hatte.
»Ich wollte nur wie gewünscht Bescheid geben.« Jovanovic räusperte sich. »Unsere Maschine aus Angola ist sicher in Lissabon gelandet.«
»Gut, sonst noch was?«
»Allerdings. Du wirst es nicht glauben: Der zweite Teil der Zahlung aus unserem jüngsten Geschäft im nördlichen Sudan…«, er machte eine Pause, »…wurde bereits gestern am späten Nachmittag überwiesen.«
Nedic dachte nach.
Sudan? Unmöglich, jetzt schon?
»Die Ware kann unmöglich schon an ihrem Bestimmungsort sein«, sagte Nedic. Und dachte: So schnell können sie die Ladung unmöglich kontrolliert haben.
»Wenn ich's dir doch sage! Das Geld wurde komplett überwiesen.«
»Hmm… na schön. Sonst noch was?«
»Nein, nichts weiter, ich dachte nur… Du hast gesagt…«
»Ich weiß. Danke!«, sagte Nedic knapp und legte auf.
Nedic war ungehalten, irritiert, wusste aber eigentlich nicht, warum. Er hatte Jovanovic vor zwei Wochen explizit angewiesen, ihn genauestens über die Abwicklung des letzten Geschäfts zu informieren. Direkte Sorgen machte er sich nicht, der Kunde war ihm jedoch nicht völlig geheuer.
In einem Business, in dem es meistens um große Summen ging und in dem Diskretion ein Understatement war, sollte sich zwar keine der beteiligten Parteien zu sehr über das Geschäft hinaus für die andere interessieren; manchmal konnte es allerdings wichtig sein, zu wissen, wo die eigene Ware letztendlich eingesetzt wurde. Bei allzu kritischen Verwendungszwecken fühlten sich westliche Geheimdienste je nach politischer Lage bemüßigt, Nachforschungen anzustellen. Das konnte dann zu einem späteren Zeitpunkt unangenehm werden und zusätzliche Arbeit verursachen.
Milan Nedic zählte bei weitem nicht zu den Großen seiner Branche. Das Massengeschäft überließ er anderen, etwa Leuten wie dem Russen Victor Bout, der den thailändischen Sicherheitsbehörden vor einigen Jahren in die Falle gegangen war. Nedic war eher für seine besonderen Beziehungen bekannt und stand im Ruf, Dinge rasch liefern zu können, die nicht den üblichen Anforderungen entsprachen.
Das Geschäft mit Zimbabwe war bequem und einfach gewesen. Man kannte sich schon länger. Der andere Auftrag hingegen, eine verhältnismäßig kleine, wenn auch brisante Lieferung in den nördlichen Sudan, war in jeder Hinsicht unkonventionell. Er dachte an den libanesischen Auftraggeber, der seinerzeit an einen seiner Agenten in Antwerpen herangetreten war. Antwerpen war heute eher als Drehscheibe für den Handel mit Diamanten bekannt als, wie noch in den 60er- und 70er-Jahren, für Söldner und illegalen Waffenhandel. Häufig ließen sich diese beiden Dinge jedoch auf angenehme und praktische Art und Weise miteinander verbinden.
Er konnte sich noch genau an die detaillierten Wünsche des Kunden erinnern. Ungewöhnlich war der Auftrag bereits aufgrund des geringen Volumens. Was die Ware selbst betraf, so waren die Forderungen ebenfalls exotisch gewesen. Die meisten Kunden verlangten, insbesondere auf dem afrikanischen Kontinent, Sturmgewehre vom Typ Automat Kalaschnikow, eine Waffe, die fälschlicherweise noch immer von vielen AK47 genannt wurde. Seit 1972 existierte eine modernere Version in einem etwas leichteren Kaliber, das AK74. Seine Kunden bevorzugten häufig diese Version, da sich das Gewehr im Dauerfeuer leichter kontrollieren ließ und in puncto Präzision deutlich besser abschnitt als sein Vorgänger.
Dieser Kunde nun hatte keine Kalaschnikows gewollt, sondern englische Sturmgewehre der Marke Enfield. Nedic hatte sich damals über die Bestellung gewundert. Bei einem derartigen Preis hätte er österreichische Waffen von Steyr oder deutsche Ware von Heckler & Koch empfohlen. Doch sein Kunde hatte sehr konkrete Vorstellungen gehabt.
Seit langem einmal hatte er wieder seine guten Kontakte spielen lassen müssen, um Teile der gewünschten Ausrüstung zu beschaffen. Allerdings war er über einen vertrauenswürdigen Zwischenhändler, der seinerseits ebenfalls Strohmänner einsetzte, an die Waffen gekommen. Was die Briten betraf, so durfte man sich keine Fehler erlauben. Das Vereinigte Königreich war für seine hervorragenden Geheimdienste bekannt.
Auch über die Gewehre hinaus hatte der Kunde ausgefallene Wünsche gehabt. Claymore-Antipersonenminen waren beispielsweise ein Teil des Anforderungskatalogs gewesen.
Nedic musste lächeln. Die internationale Staatengemeinschaft versuchte seit langem vergebens, Antipersonenminen mit einem Bann zu belegen. Besonders die heuchlerischen Amerikaner weigerten sich hartnäckig, den entsprechenden Vertrag zu unterzeichnen. Daran hatten auch die US-Demokraten nichts geändert.
Selbst die Liefermodalitäten waren ungewöhnlich. Für den Kunden beinhaltete die Umladung auf kleine Boote ein zusätzliches Risiko. Seit dem Anstieg der Piraterie am Horn von Afrika patrouillierten die Marinen diverser Nationen in diesen Gewässern. Die europäischen Marinen nannten ihren Einsatz Atalanta, NATO-Einheiten bildeten den Ocean Shield. Dies hatte eine Eindämmung und Verlagerung der Aktivitäten der Seeräuber zur Folge. Keine zwanzig Seemeilen südlich der sudanesischen Küste gab es immer wieder Zwischenfälle, die nicht aufgeklärt wurden, dachte Nedic, während er sich Kaffee aus einer silbernen Kanne nachgoss.
Erst vor kurzem hatte er über Beziehungen erwirken können, dass die serbische Regierung seiner eigenen Fluglinie wieder Starterlaubnis gab. Seine Radovan Air machte vieles möglich, in diesem Fall hatte er sie aber bewusst nur begrenzt eingesetzt. Aus Vorsicht war er auf einen kleinen, privaten afrikanischen Carrier ausgewichen. Besitzer der Airline waren zwei weiße Südafrikaner, die keine Fragen stellten. Die Ware war von Europa aus auf eine Sandpiste an der libysch-tunesischen Grenze geflogen worden. Nachdem sie dort umgeladen worden war, war sie weiter an die sudanesische Küste geflogen worden. Nach einer erneuten Umladung hatten sie seine »Associates« mit einem schnellen Küstenmotorschiff in internationale Gewässer verbracht, wo sie von einem anderen Schiff aufgenommen worden war. Hierzu waren lediglich GPS-Koordinaten ausgetauscht worden. Der Kunde hatte darauf bestanden, die Ware auf See selbst zu übernehmen.
Nedic hatte von seinem Auftraggeber einen unverschämt hohen Preis verlangt. Der hatte ohne mit der Wimper zu zucken zugesagt und die geforderte üppige Anzahlung sofort überwiesen. Und das, ohne zuvor Proben sehen zu wollen. Das hatte seinen Agenten Jovanovic in Belgien seinerzeit stutzig gemacht. Vertrauen konnte man nur Leuten, die man kannte. Mit diesem Libanesen hatte sein Unternehmen bislang noch nie zu tun gehabt. Also hatte er versucht, sich über ihn und seine Geschäfte vorab zu informieren.
Mehr als einige lose Kontakte zur früheren terroristischen Organisation Fatah al-Islam, was im Libanon nicht ungewöhnlich war, brachte diese Hintergrundabklärung des Libanesen nicht hervor. Unterschwellig hatte Nedic jedoch eine dunkle Ahnung, mit wem er es zu tun hatte. Daher hatte er die Anweisung gegeben, unverzüglich auf die komplexen Lieferwünsche des Kunden einzugehen, bei den Zahlungsmodalitäten jedoch Vorsicht walten zu lassen. Er wollte sich nichts nachweisen lassen.
Der Sudan war ein wunderbares Land, um Geschäfte abzuwickeln, dachte er. Die Macht war nicht klar verteilt. Seit der Teilung in Norden und Süden herrschte insbesondere im Südsudan noch immer weitgehend Chaos. Der Hafen im Norden, Port Sudan, war für das Geschäft im Norden von höchster Bedeutung, und einmal mehr hatte er sich den Umstand zunutze gemacht, dass man Menschen und deren Dienste kaufen konnte. Im Sudan war alles nur eine Frage des Preises.
Der Rest seines Kaffees war derweil kalt geworden. Er fuhr sich durch die Haare und warf einen raschen Blick auf seine Rolex Submariner. Gleich halb acht. Er stand auf und beschloss, sich nicht mehr über die prompte Zahlung seines Kunden zu wundern, Jovanovic hatte mit Sicherheit alles unter Kontrolle. Stattdessen, so dachte er sich, war es allmählich an der Zeit, sich seiner zarten Colette zu widmen. Er liebte zierliche Frauen und genoss es, ihnen Schmerzen zu bereiten.
5
EckernfördeDeutsche OstseeküsteHeute
Es hatte wieder angefangen zu regnen. Ein böiger Wind wehte mit fünf Beaufort aus Nordost und Möwen kreischten über der grauen Förde. Auf dem Wasser hatten sich weiße Schaumkronen gebildet. Der Sand war vom Regen klebrig und schwer.
Dem Wetter zum Trotz trug der Ausbilder kurze Hosen und braune Hanwag-Wanderstiefel. Auf einem grünen Fleece-Pullover prangte ein dunkelblauer Sägezahnfisch vor einem Fallschirm, der mit Eichenlaub umrahmt war. Zwei kurze Balken auf dem Ärmel gaben Aufschluss über den Dienstgrad.
Er brüllte die Soldaten an:
»Was seid ihr, Männer?«
Die durchnässten Männer antworteten im Chor:
»Diamanten, Herr Oberleutnant!«
»Und was macht man mit Diamanten, Männer?«
»Schleifen, Herr Oberleutnant!«
»Das ist richtig!«
Das Gesicht des Ausbilders war nass. Regentropfen liefen an seinem Kinn entlang in den Ausschnitt seines hochgestellten Fleece-Kragens. Alle Männer waren bis auf die Haut durchnässt.
»Und, wollt ihr geschliffen werden?«, donnerte der Ausbilder weiter.
»Jawohl, Herr Oberleutnant!«
»Kein Problem, Männer – das könnt ihr haben!«
»Ein Sprint runter zum Wasser, das sind nicht mal vierhundert Meter, der Erste kann sich ins Wochenende verabschieden. Die letzten drei pumpen Serien. Los!«
Völlig entkräftet stolperten die Männer dem Wasser entgegen.
Die Temperatur war im Laufe des Nachmittags rasch gefallen. In wenigen Tagen begann der kalendarische Winter.
OLZS5 Steiger war seiner Schar weit voraus und wartete auf die Ankömmlinge. Langsam schüttelte er den Kopf. Er brüllte:
»Mann, Mann, Mann! So wird das nichts… und ihr wollt zur Elite gehören? Dann macht mal hinne! Viel Zeit habt ihr nicht mehr, bald stehen Evaluierungen an!«
Ein Mann trat auf ihn zu und stammelte: »Herr Leutnant…«
»Leutnant?«, donnerte Steiger mit gespielter Entrüstung, »das war ich vor drei Jahren, Herr Maat!«
»Verzeihung, Herr Oberleutnant!« Der Mann war völlig fertig. »Es… es ist Althans. Er lässt sich nicht helfen.«
Steiger schaltete sofort, aus seinem Gesicht sprach ehrliche Besorgnis.
»Schauen wir mal, kommen Sie!«
Etwa vierzig Meter hinter ihnen lag ein Mann auf dem Bauch, das Gesicht im Sand. Ihm näherte sich ein weiterer Ausbilder. Steiger warf Oberbootsmann Tettow einen raschen Blick zu, doch dieser, die Lippen zusammengepresst, schüttelte nur den Kopf.
Steiger wandte sich dem im Sand liegenden Soldaten zu, hockte sich neben ihn und flüsterte leise, sodass die anderen ihn nicht hören konnten:
»Althans, stehen Sie gefälligst auf und reihen Sie sich ein. Sie haben den heutigen Tag fast überstanden!«
Althans hob langsam den Kopf. Sein Gesicht glich einem Totenschädel. Seine Augen tränten. »Ich… ich kann nicht mehr…«, sagte er leise.
Steiger runzelte die Stirn. Dann sagte er ruhig:
»Althans, nichts übereilen, überlegen Sie sich das gut, wenn Sie jetzt hinschmeißen, dann war es das!«
Der Mann schüttelte den Kopf und mit zusammengepressten Zähnen stammelte er: »Ich… kann nicht mehr und… und bitte um meine Ablösung!« Althans wischte sich mit seinen sandigen Händen die Tränen aus dem Gesicht und damit nur noch mehr Sand in die Augen.
Steiger kannte das. Der Mann war total erschöpft, wütend, enttäuscht und frustriert, dass sein Körper sich seinem Geist zu verweigern schien.
Dabei war es in Wahrheit umgekehrt. Es war der Geist, der nicht mehr in der Lage war, den Körper weiter anzutreiben. Althans hatte aufgegeben. Das war's.
Steiger nickte langsam. Hier war nichts mehr zu machen. Er winkte zwei weitere Anwärter heran.
»Helfen Sie dem Kameraden auf!«
Die übrigen Männer traten herbei und die Gruppe versammelte sich am unteren Ende des Strandes. Die letzte Anweisung hatte sich angesichts des aktuellen Ausfalls erledigt. Dies war kein Parcours für Egoisten. Die Ausbilder wollten Teamgeist sehen.
Steiger ließ alle Männer noch einmal antreten.
»Stillgestanden!«
Die Männer rissen sich zusammen.
»Frisch seht ihr nicht gerade aus, Männer!«, rief er den nunmehr sechzehn Soldaten zu. Ein allgemeines Drucksen war die Reaktion. Müde Blicke endeten im Nichts, die Gesichter von Erschöpfung gezeichnet.
»Althans ist damit auf eigenen Wunsch raus!« Er machte bewusst eine Pause und ließ die Tatsache, dass einer von ihnen nicht wiederkehren würde, auf sie einwirken.
»Glaubt bloß nicht, euch könne das nicht passieren!«, rief er den Männern zu.
Die Drohung verfehlte ihre Wirkung nicht. Obwohl viele der Männer aussahen, als würden sie im Stehen einschlafen, sickerten die Worte in ihr Unterbewusstsein. Ein mattes »Jawohl, Herr Oberleutnant« kam ihnen noch über die Lippen.
»Drei von euch haben heute geschwächelt!«, stichelte er weiter. »Einen hat's erwischt, ich bin gespannt, wen es als Nächstes trifft. Die Betroffenen wissen Bescheid, denke ich!«
Unsichere Blicke, die Männer zitterten am ganzen Körper.
»Wir werden jeden Einzelnen von euch im Auge behalten!«, setzte Steiger nach. »So und nun ab ins Wochenende, das habt ihr euch verdient. Wegtreten!«
Die Männer schleppten sich wortlos in die Duschräume der nahe gelegenen Kaserne. Die Ablösung ihres Kameradens lastete schwer auf ihren Gemütern.
Der von allen Anwärtern gefürchtete »Psycho-Freitagslauf« hatte den Männern wieder einmal stark zugesetzt, dachte Steiger. Das war Sinn und Zweck der ganzen Veranstaltung. Man musste aussieben, wenn man den hohen Standard in der Kompanie aufrechterhalten wollte.
Auch Steiger wollte endlich raus aus den schlammigen, sandigen, kalten Klamotten. Er hatte einige Schürfwunden vom Sand und sein Körper schrie nach einer ausgiebigen warmen Dusche. Natürlich war auch er hundemüde. Doch das konnte er nicht zeigen, schließlich war er Vorbild für die Männer.
Oberleutnant zur See Jan Steiger war kein Unmensch. Im Gegenteil. Es bereitete ihm keine Freude die Männer derart zu schinden, doch er wusste, dass es lebensnotwendig war.
Es galt, eine gnadenlose Auslese zu treffen, die Spreu vom Weizen zu trennen, wie es so schön hieß. Die Absolventen würden es der Ausbildungskompanie eines Tages danken, wenn sie im Kampfeinsatz die Haut eines Kameraden oder ihre eigene retten konnten. Schweiß in der Ausbildung ersparte Blut im Gefecht. Dieser Grundsatz verlor seine Gültigkeit auch nach Jahrhunderten nicht.
Hinzu kam, dass diese harte Ausbildung ausschließlich Freiwilligen zuteil wurde. Jedem Soldaten stand es jederzeit frei zu gehen. Nach der »Ablösung«, ein Wort, das ungleich sanfter als »Versagen« oder »Aufgeben« klang, wurde der Mann dann wieder in seiner alten Einheit aufgenommen. Das war keine Schande. Innerhalb der Flotte wusste man um die Härten dieser Ausbildung.
Um Obermaat Althans tat es ihm leid. Althans war als Funker aus der Flotte zu ihnen gestoßen. Als Marathonläufer war er zwar ein hervorragender Ausdauersportler, aber vielleicht etwas zu filigran. Vor allem mental hatte er sich als wenig belastbar erwiesen. Zu häufig hatte er Entscheidungen hinausgezögert – im Ernstfall konnte das tödlich sein. Das Ausbilderteam war schon länger auf den Mann aufmerksam geworden. Über die Wochen hatte sich bei Althans eine permanente Angst vor der Herausforderung des nächsten Tages eingeschlichen. Der Mann hatte angefangen, an sich zu zweifeln, und war stellenweise unkonzentriert gewesen. Der permanente psychische Stress hatte ihm letztendlich das Genick gebrochen.
Doch Steigers Gedanken an Althans verflogen schnell und als er sich nach der Dusche abtrocknete, war er im Geiste bereits ganz woanders. Seit fast einem Jahr hatte er keinen Urlaub mehr gehabt und den heutigen Abend würde er mit Packen und Urlaubsvorbereitungen verbringen.
OLZS Jan Steiger war kein gewöhnlicher Soldat. Er gehörte vielmehr zu einer kleinen, verschworenen Gemeinschaft von Spezialisten, über deren Einsätze die deutsche Marine generell nicht viel verlauten ließ.
Steiger war Offizier in der Kampfschwimmerkompanie der Marine. Sah man ihn in Zivil auf der Straße, dachte man zunächst an einen Berufssportler. Er hatte die Statur eines Boxers oder Schwimmers. Obwohl er für seine Größe von 1,88Metern sehr muskulös war, bewegte er sich geschmeidig. Seine dunkelblonden Haare trug er kurz geschnitten. Sein Gesicht hatte etwas Kantiges und seine graublauen Augen schienen stets wachsam zu sein. Für sein Alter strahlte Steiger eine bemerkenswerte Ruhe und Gelassenheit aus.
An sich war es nicht üblich, dass Offiziere die Ausbildung von Anwärtern übernahmen. An diesem Freitag jedoch war Steiger kurzfristig für einen verletzten Kameraden eingesprungen. Oberbootsmann Lorenz war ein erfahrener Ausbilder, der sich beim Fallschirmspringen am Wochenende auf dem Flugplatz in Hartenholm bei der Landung mit einem privaten, kleinen Flächenfallschirm den rechten Knöchel verstaucht hatte. Lorenz würde sich die nächsten Tage einige dumme Sprüche in der Kompanie anhören müssen.
Als Steiger mit seinem Mountainbike auf das Haupttor zufuhr, summte er fröhlich vor sich. Er dachte an das türkisblaue Wasser, die Korallenriffe und die ausgefallene tropische Fauna und Flora, die ihn erwarteten.
Zwei Wochen Urlaub hatte er seinem Vorgesetzten abgerungen. Seine Kameraden hielten ihn zwar für verrückt, dass er den Urlaub wieder im bzw. unter Wasser verbringen wollte, aber so war er nun mal. Seit er denken konnte, fühlte sich Steiger im nassen Element wohl.
–
Die Einwohner des beschaulichen kleinen Ostsee-Ortes Eckernförde, in dem im Sommer viele Deutsche ihre Ferien verbrachten, hatten sich über die Jahrzehnte daran gewöhnt, an Freitagen des Öfteren bis auf die Haut durchnässte Soldaten in Tarnanzügen im Wald oder am Strand herumrennen zu sehen. Nicht selten trugen die jungen Männer zu mehreren lange Baumstämme auf ihren Schultern. Manchmal waren es auch große Felsbrocken, die sie umständlich vor sich her schleppten. Ihre Gesichter sahen dabei immer gleich aus: leidend.
Oftmals sah man sie auch unter der Woche in blauen Trainingsanzügen mit olivgrünen Rucksäcken und schwarzen Wollmützen auf dem Kopf in den Feldern und Wäldern von Eckernförde. Im Gegensatz zu den Einheimischen konnten sich die Touristen darauf keinen rechten Reim machen.
Wieder andere Soldaten wurden meist im Monat September von den Gästen der Butterdampfer gemeldet, die ungläubig berichteten, sie hätten von der Bordwand aus Taucher im Wasser gesehen, die mit Gepäck im Schlepptau die Küste entlanggeschwommen seien.
Die Kurgäste hatten sich nicht geirrt: Es handelte sich dabei um angehende Kampfschwimmer, die eine wesentliche Bewährungsprobe ihrer langen, entbehrungsreichen Ausbildung absolvierten: das Dreißig-Kilometer-Abschluss-Schwimmen von Olpenitz nach Eckernförde.
Bereits seit Jahrzehnten waren die Kampfschwimmer in Eckernförde eine Institution.
Beheimatet waren sie in Gebäuden, deren rote, ausgeblichene Backsteine auf ein hohes Alter hindeuteten. Doch der erste Eindruck trog. Die Kasernenanlagen waren aufwendig renoviert worden. An der Zufahrt zum hinteren Teil des Kasernentrakts deutete ein Wappen auf die Truppenteile hin, die hier stationiert waren. Das Wappen zeigte ein gerades Schwert vor einem geflügelten Anker auf einem strahlend blauen Schild.
An den einzelnen Gebäuden waren hellblau gestrichene Holzschilder angebracht, auf denen die Namen diverser Städte Norddeutschlands in Messingbuchstaben geschrieben standen. Sie gaben Auskunft über die Heimat der unterschiedlichen Truppenteile.
Eine Vielzahl von Mythen rankte sich um diese kleine Truppe wie auch um die Minentaucher, von denen naturgemäß etwa die Hälfte der Wahrheit entsprach. Sicher jedoch war, dass jeder »KS« (Kampfschwimmer) und jeder »MiTa« (Minentaucher), wie sie sich selbst nannten, innerhalb der Bundeswehr wie auch im Ausland ein hohes Ansehen genoss – und das aus gutem Grund.
In schier endlosen körperlichen und mentalen Strapazen wurden diese Männer zunächst immer und immer wieder auf Nerven- und Charakterstärke geprüft. Erst nachdem Tauglichkeit und Leidensfähigkeit des Aspiranten zweifelsfrei ermittelt worden waren, konnte ein Mann die Ausbildung antreten, von der so viele junge Soldaten träumten. Das Motto:
»Lerne leiden, ohne zu klagen«
wurde in Eckernförde jeden Tag gelebt. Erfahrene Kampfschwimmer sprachen davon, dass es galt, den Schalter umzulegen, wollte man die Strapazen der Ausbildung ertragen. Man musste stumpf sein und den permanenten Schmerz ignorieren können – erst dann hatte man eine reelle Chance.
Die Kompanie bildete nicht nur hervorragende Schwimmer und Taucher aus, sie stellte der Flotte auch sorgfältig ausgebildete Infanteristen, Einzelkämpfer, Sprengmeister, Fallschirmjäger und in nicht wenigen Fällen auch Präzisionsschützen zur Verfügung. Viele der Kampfschwimmer waren hochqualifizierte Rettungssanitäter und verfügten über sämtliche Führerscheine, deren Erwerb das Militär anzubieten hatte. Sie gehörten zusammen mit dem Kommando Spezialkräfte des Heeres (KSK) und einigen anderen Einheiten zur Elite der deutschen Streitkräfte.
Die Ausbildung selbst wurde ständig angepasst. Bei Bekleidung, Waffensystemen, Tauchausrüstung und Technik, Fallschirmen, elektronischen Kommunikations- und Navigationssystemen, Booten und deren Antriebssystemen gab es ständig neue Entwicklungen, die nach mehrfachen Tests unter unterschiedlichsten klimatischen Bedingungen Einzug in die Ausrüstung hielten.
Um den hohen physischen Leistungsstandard zu halten, änderte sich das Trainingspensum auch nach der Aufnahme in die Kompanie nur marginal. Man trainierte effizienter, schlief mehr und konnte ab und zu auch einmal richtig feiern. Einsätze und Wettkämpfe taten ihr Übriges, die Truppe auf Trab zu halten.
Früher waren die Kampfschwimmer zusammen mit den Minentauchern auch »Waffentaucher« genannt worden. Diese Bezeichnung war heute überholt, mittlerweile zählten die Einheiten zusammen mit der Boardingkompanie zum sogenannten KSM, dem Kommando Spezialkräfte Marine.
6
Fort MeadeHauptquartier der National Security Agency (NSA)6Maryland, USA
»Haben Sie das? Ich will das ganze Gespräch! Übersetzt! Und eine sofortige Identifizierung des Angerufenen! Und zwar bis gestern!«
Dave Levine, technischer Leiter Auswertung/Naher Osten, war aufgeregt. Sie hatten die Spur wiederaufgenommen. Ein libanesischer Kontakt, dessen Stimme sich mit der Audiosignatur eines mutmaßlichen Logistikers des Terrornetzwerks die Basis deckte, hatte vor rund acht Wochen eine Nummer in Belgien angewählt. Leider hatte das Gespräch nur eine Minute und neunzehn Sekunden gedauert. Nicht wirklich lange genug, um mit Sicherheit eine Übereinstimmung der Stimmsignaturen feststellen zu können.
Die Kollegen von der belgischen Sureté waren sehr kooperativ gewesen und hatten die angerufene Nummer rasch identifiziert. Der belgische Telefonanschluss war auf die Filiale einer bosnischen Import- und Exportfirma angemeldet gewesen. Von diesem Anschluss aus hatte der Mann, der zuvor von dem Libanesen angerufen worden war, eine Nummer in Serbien angewählt. So viel immerhin wussten sie.
Der junge Auswerter, der die Aufregung seines Vorgesetzten teilte, schüttelte langsam den Kopf.
»Mist…«
»Was? Was ist Mist?«, wollte Levine wissen.
»Ich kann nichts hören.«
»Was? Wieso?«
»Wir haben hier ein fast zweiminütiges Gespräch zwischen dem Anschluss in Antwerpen und der serbischen Nummer, aber ich kann nichts hören, der Typ muss eine geschützte Leitung verwenden.«
»Das gibt's nicht, das würde bedeuten, die stehen regelmäßig in Kontakt. Diese Scheißkerle! Geben Sie her!«
Levine setzte sich einen Kopfhörer auf.
Doch er hörte nur ein dumpfes Rauschen.
»Mist!«
Sein Mitarbeiter schaukelte auf seinem Stuhl, biss sich auf die Unterlippe und nickte nur, als wolle er sagen: Sie sagen es, Chef!
»Identifizieren Sie wenigstens die Nummer des Angerufenen.«
»Der Anschluss liegt in Serbien, Chef.«
»Und wenn er in der Antarktis läge – ich will verdammt nochmal wissen, wer da spricht! Verstanden?«
»Chef, unsere Beziehungen zu Serbien sind seit der Anerkennung des unabhängigen Kosovo…«
Levine fiel seinem Untergebenen ins Wort:
»Hören Sie, Matt, es ist mir gelinde gesagt scheißegal, wie gut oder wie schlecht unsere Beziehungen zu Serbien sind – wenn einer dieser Handtuchschädel7 eine serbische Import- und Exportfirma anruft, die wir seit knapp zwei Jahren mit illegalen Waffentransporten in Verbindung bringen, dann ist das eine wertvolle Information, der wir nachgehen müssen. Wir sind die NSA und nicht die verdammte Heilsarmee!«
»Eine bosnische Firma, Chef!«
»Was?« Levine war irritiert.
»Es ist eine bosnische, keine serbische Firma, und ich sage ja nur, dass das nicht einfach wird.«
Levine presste die Lippen zusammen und schwieg. Dann sagte er: »Leiten Sie die Anfragen sofort in die Wege. Unsere kroatischen Freunde schulden uns noch einen Gefallen. Vielleicht können die uns weiterhelfen, setzen Sie alle Hebel in Bewegung. Ich zähle auf Sie, Matt!«
Levine verließ das Büro. Heftig knallte die Tür ins Schloss.
7
Hafen von SafagaRotes MeerÄgypten
Kapitän Nidal al-Suri war mit sich und seinem Werk zufrieden. Der gebürtige Syrer schwitzte, sein Kaftan war von Seesalz, Schweiß und Maschinenöl verdreckt und seine Hände schmerzten. Doch das war jetzt unwichtig. Er blickte über die verrostete Außenpier, an der alte Autoreifen zum Abfendern der anlegenden Schiffe befestigt waren. Das Wasser im Hafenbecken strahlte in einem hellen Blau.
Die Hände hinter seinem Rücken verschränkt, wanderte er die Pier auf und ab. Er war stolz, dass er den Zeitplan eingehalten hatte. Und doch plagte ihn die Sorge, möglicherweise etwas Wichtiges vergessen zu haben. Seine Aufmerksamkeit war einzig und allein dem Schiff gewidmet, das an der Pier festgemacht war.
Durch seine große Oberfläche dem Wind ausgesetzt, zurrte es wie ein träges, großes Tier an den Festmacherleinen. Der böige Wind drückte den Rumpf immer wieder ein wenig von der Pier weg, soweit es die Leinen erlaubten, und ließ das Schiff sanft hin und her schaukeln. Ließ der Wind für einige Sekunden nach, zogen die Leinen das Schiff wieder an die Pier heran. Kleine Wellen, die zwischen der Pier und Bordwand durchliefen, schlugen dabei mit glucksenden Geräuschen gegen den Schiffsrumpf.
Mit wachen Augen inspizierte Nidal jede Kante, jedes Detail. Es schien, als wollte er das Schiff mit seinen Augen durchleuchten, während er die Pier abschritt.
»Das Schiff ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Planung!«, hatte man ihm zu verstehen gegeben.
Ganz in Weiß, mit einem leicht hochgezogenen Bug, passte sich das Schiff bei einer Gesamtlänge von knapp 30Metern dem klassischen Design der Tauchsafariboote an, wie sie im Roten Meer häufig anzutreffen waren.
Anders als in diesen Breiten üblich, war das Schiff kein klassischer Verdränger, sondern ein sogenannter Halbgleiter. Das bedeutete, das Schiff konnte Geschwindigkeiten erreichen, die deutlich über seiner sogenannten Rumpfgeschwindigkeit lagen. Auch war es nicht aus Holz konstruiert, sondern aus Glasfaserkunststoff (GFK), der überall mit Kevlarmatten verstärkt war. Das sparte enorm Gewicht und ermöglichte sowohl eine höhere Beschleunigung als auch eine deutlich höhere Endgeschwindigkeit.
Mit zwei Oberdecks und einer offenen Brücke, einer sogenannten Flybridge, boten die Taucherboote ihren Gästen reichlich Platz zum Sonnen und zum Schlafen. Nidal wusste, dass, wenn es während der Sommermonate in den Kajüten nachts zum Schlafen zu heiß wurde (nur selten ließen sich die Klimaanlagen fein regulieren), viele Taucher an Oberdeck flüchteten, um von dem eisigen Gebläse keinen Schnupfen zu bekommen. Eine Erkältung bedeutete, dass man nicht tauchen konnte. Dies hatte er in den zehn Monaten gelernt, in denen er als Skipper auf einem anderen, älteren Taucherschiff in Hurghada gefahren war.
Über dem zweiten Deck des Schiffes war im hinteren Teil ein kleines Sonnendach geriggt. Das hinderte die Gäste zwar daran, nachts den Sternenhimmel zu sehen, spendete mittags aber angenehmen Schatten.
Eine Kombüse befand sich auf Höhe des ersten Decks weiter vorne, eine Durchreiche verband sie mit der dahinter gelegenen Messe. In der Messe hielt man sich, wenn nicht gerade gegessen wurde, in aller Regel nur bei schlechtem Wetter auf oder wenn, was nur wenige zugaben, einen die Seekrankheit erwischt hatte. Nidal dachte daran, wie bei starkem Seegang vermeintlich »müde« Taucher kreidebleich in den Salon gekrochen kamen und sich in eine der salzverkrusteten Polstergarnituren warfen, bis die sogenannte Oberflächenpause beendet war und sie durch einen Folgetauchgang »erlöst« wurden.
Nidal al-Suris Magen knurrte. Vor lauter Arbeit und Termindruck hatte er völlig vergessen zu essen. Seinen Söhnen musste es ähnlich gehen.
»Mohammed!«, rief er zum Schiff herüber.
Ein gedämpftes »Ja?« war die Antwort.
Der Junge ist bestimmt im Maschinenraum, dachte er.
»Bereite uns eine Mahlzeit, damit wir etwas im Bauch haben, wenn wir später ablegen.«
»Ja, Vater.«
Nun ließ er seinen Blick weiter über die dunkel getönten, trapezförmigen Seitenfenster wandern. Sie gaben dem Schiff ein schnittiges Aussehen.
Um ein halbwegs »ägyptisches« Design zu erhalten, hatte er seinerzeit vorgeschlagen, sich bei der Werft als im Dienste eines reichen Privatiers mit Beziehungen zur Familie eines ranghohen Generals stehend vorzustellen. Das war vor der Revolution gewesen. Ganz wie bei einem Auftrag eines kommerziellen Tauchunternehmens, hatte er eine renommierte Werft ausgewählt, die für Geld eine entsprechende Qualität lieferte. Geld war für die Basis kein Problem. Auch wenn westliche Geheimdienste oft und gerne das Gegenteil behaupteten.
Mit der Einhaltung des Zeitplans hatte die Werft allerdings ihre liebe Not gehabt. Das hatte er einkalkuliert, man war schließlich nicht in Deutschland oder in der Schweiz. Außerdem gab es andere, wichtigere Kunden, die auf möglichst schneller Lieferung ihrer Schiffe bestanden und auch bevorzugt bedient wurden.
Eine namhafte Tauchschiffflotte hatte einmal sogar das gesamte Material mitsamt eines Teils der Werftarbeiter aus Alexandria in den etwas südlich von Hurghada gelegenen Hafen von Safaga einfliegen lassen, um direkt vom Ort des Stapellaufes die Ziele im südlichen Roten Meer anfahren zu können. Die Arbeitskosten hatten dabei allerdings die wesentliche Rolle gespielt, denn Alexandria war schon lange berühmt für seine kompetenten Werften und daher auch deutlich teurer als Hurghada oder Safaga.
Für ihn war allerdings entscheidend, dass die Aufsicht der Behörden, wie sie im Hafen von Alexandria praktiziert wurde, hier im Süden de facto nicht existierte. Die Werften sahen zum Teil aus wie das sprichwörtliche Chaos, und da man sich nahezu ausschließlich auf Taucherschiffe spezialisiert hatte und eines dem nächsten glich, wurden keine Fragen gestellt. Insbesondere dann nicht, wenn man ein wenig Geld fließen ließ.
Doch sein Schiff war kein gewöhnliches Safarischiff und dieser Umstand machte ihn besonders stolz. Unter dem Vorwand, reiche Westeuropäer schneller an die begehrten Riffe tief im Süden des Roten Meeres zu bringen, verfügte es nicht, wie so oft, über eine einzelne Standardmotorisierung, sondern über zwei starke Turbodieselaggregate von jeweils 1300PS. Der Ingenieur, der den Einbau der Diesel beaufsichtigt hatte, schätzte, dass das Schiff bei ruhiger See an die 27Knoten laufen konnte, möglicherweise sogar mehr.
Auf der Taucherplattform unter dem Achterdeck