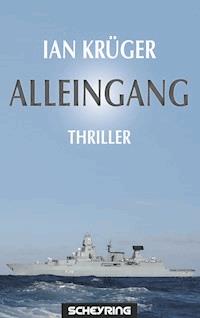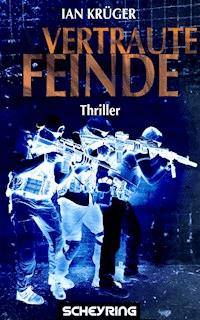
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Scheyring Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Jan Steiger
- Sprache: Deutsch
Hochmotiviert, kampferprobt und skrupellos: Ein Dutzend Söldner setzt sich auf verschiedenen Wegen in Richtung Äquator in Bewegung. Auftrag und Hintermänner: unbekannt. Sein zweites Abenteuer führt Jan Steiger in die Schattenwelt der privaten Sicherheitsfirmen.
Was führt zwei skandinavische Geschäftsleute inkognito nach London? Welche Dienstleistungen bietet die schwer zugängliche Firma M.S. Ltd.? Findet auf dem abgelegenen Bauernhof in den Ardennen wirklich ein harmloser Firmenausflug statt? Während Steiger und Wolff in der Karibik ihren alten Freund Omar Hussein bei der Suche nach antiken Schätzen unterstützen, tritt in Europa nach dem Hinweis eines aufmerksamen Zeugen die belgische Sûreté auf den Plan. Die ersten Ermittlungen fördern Spuren nach Amerika, Südafrika und Australien zutage. Doch erst nachdem sich der britische MI5 einschaltet, lichtet sich langsam der Nebel und die Umrisse einer unfassbaren Aktion quer über den Atlantik werden sichtbar. Schon bald sehen sich Steiger und Wolff einem gerissenen und skrupellosen Widersacher gegenüber, der zugleich merkwürdig vertraut erscheint. Wer verfolgt welches Ziel? Wem können die beiden Freunde trauen? Im neuen Abenteuer täuscht der Schein oft auf eine gefährliche Weise … (LIB-393)
Pressestimmen
»Ian Krüger bereichert das Genre des deutschsprachigen Thrillers mit einer Erzählweise auf dem Niveau von Jack Higgins und Frederick Forsyth.« Henning Hoffmann in Die Waffenkultur – Ausgabe 41 – Juli/August 2018
»Prädikat: Lesenswert!« Kampfschwimmer-Association e.V.
»In bester 'Die-Hard'-Manier ...« Markus Tiedke in Intranet aktuell der Bundeswehr – September 2018
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 478
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Ian Krüger
VERTRAUTE FEINDE
Thriller
SCHEYRING VERLAG NEUSS
Die Handlung und alle handelnden Personen sind frei erfunden. Jegliche Ähnlichkeit mit lebenden oder realen Personen wäre rein zufällig.
Originalausgabe
© Scheyring Verlag, Neuss 2018
Autorenfoto: privat
Coverfoto: privat
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Sämtliche, auch auszugsweise Verwertungen bleiben vorbehalten.
Datenkonvertierung: Zeilenwert GmbH
ISBN: 978-3-944977-39-3
www.scheyring.de
»Söldner und Hilfstruppen sind unbrauchbar und gefährlich; und wenn einer seinen Staat auf Söldnertruppen stützt, so steht er niemals fest und sicher, denn sie sind uneinig, ehrgeizig, disziplinlos und untreu …«
Niccolo Machiavelli (1469 – 1527), Der Fürst
Personen
Jan Steiger
–
Marineoffizier, Zeitverwender beim BND
Mirko Wolff
–
Stabsfeldwebel, Dauerverwender beim BND
Omar Hussein
–
Unternehmer und Schatzsucher
Samirah Hussein
–
Ehefrau von Omar
Robbe Van Leuven
–
Stv. Leiter für Analyse, belgische Sûreté
Lotte De Bruyn
–
Ermittlerin, belgische Sûreté
Robert T. Burke
–
Direktor im britischen MI5
Jeremy Horne
–
CEO von M.S. Ltd.
Erik Borg
–
Auftraggeber
Mats Nygard
–
Auftraggeber
Trevor Kendrick
–
Söldner/Tauchergruppe
Matt Pearce
–
Söldner/Tauchergruppe
Hank Rijkaard
–
Söldner/Tauchergruppe
Wilbur Rhodes
–
Söldner/Tauchergruppe
Jake Sanderson
–
Söldner und Ex-SEAL
Amjad Raschid
–
Planer
Bulan
–
Kommandoführer
Mirza Omerovic
–
Kommandoführer
Chet Croquer
–
Deputy Director Operations, CIA
Helen D’Angelo
–
Personenschützerin
Jason Cardasis
–
Pilot des Rettungshubschraubers
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titel
Impressum
Personen
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Kapitel 72
Kapitel 73
Kapitel 74
Kapitel 75
Kapitel 76
Kapitel 77
Kapitel 78
Kapitel 79
Kapitel 80
Kapitel 81
Kapitel 82
Kapitel 83
Kapitel 84
Kapitel 85
Kapitel 86
Kapitel 87
Kapitel 88
Kapitel 89
Kapitel 90
Kapitel 91
Kapitel 92
Kapitel 93
Kapitel 94
Kapitel 95
Kapitel 96
Kapitel 97
Kapitel 98
Kapitel 99
Kapitel 100
Kapitel 101
Kapitel 102
Kapitel 103
Kapitel 104
Kapitel 105
Kapitel 106
Kapitel 107
Kapitel 108
Kapitel 109
Kapitel 110
Kapitel 111
Kapitel 112
Epilog
Über dieses Buch
Danksagung
Der Autor
Anmerkungen
Prolog
Vor vier Jahren
Lincoln Laboratory
Massachusetts Institute of Technology (MIT)
Cambridge, Massachusetts
USA
Timothy McDermid war zufrieden. Genau genommen war er mehr als zufrieden. Er war überglücklich. Und zugleich ein wenig stolz.
Er erinnerte sich. »Willkommen im geschützten Bereich der Fakultät, Tim!«, hatte ihn Professor Kramer, Leiter der Engineering Systems Division, vor einigen Monaten begrüßt. Damals hatte McDermid unter vielen Bewerbern den Zuschlag für eine hochinteressante Projektarbeit bei einer externen Firma erhalten.
Heute nun hatte der junge Student der technischen Eliteuniversität MIT sein Projekt fristgerecht beendet. Professor Kramer hatte bereits angedeutet, dass er für seine »hervorragende Arbeit« die Bestnote erhalten würde. Und nicht nur das. Die Firma Reffcor Inc., die das Projekt ausgeschrieben hatte, würde ihm direkt nach seinem Master eine Festanstellung in der Entwicklung neuer Sicherheitssysteme anbieten.
McDermid jubelte innerlich.
Eine erneute Sicherheitsüberprüfung durch das FBI machte ihm keine Sorgen. Sollte sich die Festanstellung bewahrheiten, könnte er den nagenden Kredit über vierzigtausend Dollar, den er für die Studiengebühren aufgenommen hatte, innerhalb kürzester Zeit zurückzahlen.
Die in Los Angeles beheimatete Firma Reffcor Inc. war dafür bekannt, dass sie regelmäßig Federal Government Contracts erhielt. Aufträge der US-amerikanischen Bundesregierung waren in der Sicherheitsindustrie sehr beliebt, denn der Staat zahlte immer. Auch waren die Aufträge in aller Regel hoch dotiert, und wenn sie gegen Ende den veranschlagten Kostenrahmen auch noch sprengten, geschah dies selten zum Schaden der Unternehmen. Innerhalb der letzten acht Jahre hatte sich Reffcor so zu einem Schwergewicht im Bereich Sicherheitstechnik entwickelt.
Heute war Freitag. McDermid fuhr seinen nach neuesten Erkenntnissen der Kryptologie geschützten Computer herunter. Er nahm den USB-Stick ab und steckte ihn in die Hosentasche – ein glatter Bruch des strengen Sicherheitsprotokolls. Doch er wollte Sonntag zu Hause noch ein wenig an der Aufbereitung seiner Inhalte feilen. Schließlich hatte er in der kommenden Woche einen Vortrag vor anderen Studenten zu halten und er wollte sein Projekt ansprechend darstellen.
Jede Minute nutzen, dachte McDermid.
Im Übrigen war der Stick mit einem komplexen Passwort geschützt. Und wer würde bei einem sechsundzwanzigjährigen Studenten einen USB-Stick mit derartigen Nischeninformationen in der Hosentasche vermuten? Interessierten diese überhaupt irgendjemanden? Es handelte sich ja lediglich um die Planung elektrischer Systeme für einen Schutzraum. Der zudem, seines Wissens nach, noch gar nicht existierte.
Schon zu Beginn des Projekts hatte sich McDermid sehr über einige Vorgaben des Auftraggebers gewundert. Dass derart wenig Platz zu den beiden Seiten des Raumes blieb, war seltsam. McDermid hatte es einfach akzeptiert. Genauso wie den Umstand, dass die elektrischen Leitungen von Flüssigkeitsbehältern umgeben waren. Auch bei einer Zunahme des Umgebungsdrucks auf bis zu vierzig Atmosphären musste die vollständige Funktionsfähigkeit der Schiebetüren sowie aller elektrischen Systeme gewährleistet sein.
Dies ließ ihn vermuten, dass es sich um einen Panic Room handeln musste. Also einen Schutzraum, wahrscheinlich auf einem Schiff. Doch er hatte es vermieden, dem Mitarbeiter von Reffcor Fragen zu stellen.
Im Moment war es ihm ohnehin egal. Denn mit einem Glücksgefühl im Bauch dachte er an den späteren Abend. Um acht Uhr würde er sich wieder mit Florence treffen, einer unglaublich attraktiven Studentin, die an der benachbarten Harvard-Universität französische Literatur studierte. Es war ihr drittes Date und McDermid spekulierte darauf, dass es heute nicht bei einem Abendessen bleiben würde.
Diesmal hatte sie das Restaurant ausgesucht. Keines, das man in einem kulinarischen Führer fand. Stattdessen plante Florence offenbar, in lockerer Atmosphäre zu speisen und zog das unkomplizierte Ambiente eines deftigen Studentenlokals weißer Tischwäsche und steifen Kellnern vor.
My kind of girl, dachte McDermid.
Also trafen sie sich im O’Sullivans. Hier servierte man die besten Burger der Stadt und natürlich O’Sullivans Bier.
Ein weiterer Vorteil: Wir sind von dort in drei Minuten bei mir zu Hause …
Er wartete bereits eine Viertelstunde an dem kleinen Tisch in einer gemütlichen Ecke, als Florence das Restaurant betrat.
Wow! Sie sieht umwerfend aus!
Die enge Jeans betonte ihre wohlgeformten, schlanken Beine. Ihre leicht aufgeknöpfte Bluse beflügelte seine Phantasie. Und offenbar nicht nur seine.
Eine Gruppe von Studenten, der Statur nach allesamt Footballspieler, saß direkt am Eingang. Sie schenkten Florence, seinem Date, etwas mehr Aufmerksamkeit, als ihm lieb war. Ein großer Typ nahm auch gleich seine Baseballmütze ab und forderte Florence manierlich auf, an seinem Tisch Platz zu nehmen. Für eine Sekunde hielt McDermid, der zögerlich ein Winken andeutete, den Atem an.
Doch Florence nahm dem Typ die Baseballmütze aus der Hand und setzte sie ihm wieder auf den Kopf: »Sorry Jungs, kein Bedarf. Mein Freund sitzt dort drüben.«
Die übrigen Studenten kommentierten ihre Reaktion mit Gejohle und zogen ihren düpierten Kommilitonen auf.
McDermid atmete tief durch.
Als Florence zu seinem Tisch kam, erhob er sich. Ihr dunkelblondes Haar fiel ihr bis auf die Schultern und ihre tiefblauen Augen strahlten. Sie küsste ihn sanft auf den Mund, hängte ihre Handtasche an die Stuhllehne und fragte kokett: »Na, was kannst du für den Verlauf des Abends empfehlen?«
Das Essen kam schnell und war noch schneller verspeist. Die drei Bier verfehlten ihre Wirkung nicht. McDermid war sich zunächst nicht sicher, ob er ihr vielversprechendes Lächeln vielleicht überinterpretierte. Doch seine Intuition sollte sich als richtig erweisen.
Nach dem vierten Bier hatte er ihr zögerlich, allerdings nicht ohne Stolz, von seinem Projekt erzählt. Er freute sich, dass sie sich für seine Arbeit interessierte. Als er geendet hatte, fragte sie: »Nehmen wir noch einen Kaffee bei dir?«
War da ein Funkeln in ihren Augen? Oder bilde ich mir das nur ein?
»Nichts lieber als das!«
Von da an lief alles wie von selbst.
Bevor er sich Gedanken machen konnte, ob seine Wohnung auch wirklich präsentabel war, hatte er bereits die Haustür aufgeschlossen und sie schon halb ausgezogen. Ihre Hände fanden, was sie suchten und bevor er sich versah, saß sie bereits auf ihm und er genoss den besten Sex dieses Jahres.
Als sich beide erschöpft in die Laken fallenließen, sagte sie nach einer Weile: »Ich glaube, ich muss mal für kleine Mädchen …«
Er wollte ihr noch den Weg ins Badezimmer erklären, doch sie drückte ihren Zeigefinger auf seine Lippen. »Schhht! Ich finde mich schon zurecht, bin gleich wieder da.«
Sie gab ihm einen Kuss und stahl sich aus dem Bett. En passant griff sie nach ihrer Handtasche, holte ein Schminktäschchen hervor und orientierte sich in dem halbdunklen Raum. Mondlicht fiel durch ein Kippfenster. Sie huschte an einer arg vernachlässigten Kochzeile vorbei um die Ecke. Hier stand auf einem altmodischen Sekretär ein MacBook.
»Mach dir doch Licht, Babe!«, rief McDermid aus dem Schlafzimmer.
»Nicht nötig!«
Lautlos zauberte sie eine Mikrofestplatte aus ihrem Schminktäschchen und schloss diese an das MacBook an. Dann scannte sie das Zimmer nach seinem Rucksack. Ihr Auftrag bestand darin, jedes nur erdenkliche Speichermedium der Zielperson zu kopieren.
Florence Villeneuve hieß in Wirklichkeit Nora Saxon und sie war nicht fünfundzwanzig, sondern achtundzwanzig Jahre alt. Sie studierte auch nicht französische Literatur, sondern verdankte ihre ausgezeichneten Sprachkenntnisse ihrer französischen Mutter. In Connecticut und Montpellier aufgewachsen, konnte sie den französischen Akzent an- und abschalten, wann immer sie wollte. Fakt war: Amerikanische Männer standen auf den Akzent, fühlten sich überlegen à la: Ich erklär dir die Welt, Kleines … und danach lege ich dich flach!
Es funktionierte immer.
Auch lebte sie nicht in Boston, sondern in New York. Denn dort befand sich ihre Agentur. Nora Saxon war eine der teuersten Prostituierten Amerikas. Sie war exzellent ausgebildet und darauf spezialisiert, Informationen zu beschaffen, die man nirgendwo kaufen konnte.
Dort, an der Tür!
Mit geschickten Handgriffen durchsuchte sie den Rucksack.
Nichts.
Sie biss sich auf die Unterlippe und sah sich um.
Die Schubladen?
Wieder nichts!
Auf dem Weg ins Bad stolperte sie mit ihrem linken Fuß über seine Jeans.
Die Hose?
Binnen Sekunden hatte sie die Taschen durchsucht und einen USB-Stick gefunden.
In der Hosentasche, nicht zu glauben! Was für ein Geek!
Zufrieden steckte sie den Stick in die Festplatte und wagte einen vorsichtigen Blick in Richtung Schlafzimmer. Dort war alles ruhig. Rasch betätigte sie die Spülung im Bad, drehte kurz den Wasserhahn auf und zerknüllte ein Handtuch. Dann begab sie sich zurück zum Sekretär.
Ihre Mikrofestplatte verfügte über ein israelisches »Break-in-Program« samt automatischem »no-log« Kopieralgorithmus. Das Aufleuchten einer winzigen blauen Diode bestätigte, dass sämtliche Dateien, die sich auf dem Computer und auf dem Stick befanden, kopiert worden waren. Und das, ohne Spuren in den Verlaufsordnern zu hinterlassen.
Den Stick beförderte sie zurück in die Hosentasche und den Laptop schloss sie vorsichtig.
Vielleicht war es das. Oder ich komme noch einmal wieder …
Als sie zurück unter die Bettdecke kroch, konnte sie seine Hand in ihrem Schritt fühlen. Ihre Lippen fanden seine.
»Du hast ja Appetit …«
McDermid grinste bestätigend.
Das ist der beste Tag meines Lebens!
Dachte er.
1
Vor fünf Jahren
National Intelligence Support Team (NIST)1
Provincial Reconstruction Team (PRT)
Kunduz
Afghanistan
Die Entscheidung für den Einsatz war kurzfristig gefallen. Hauptmann Tom Retzlaff vom Militärischen Abschirmdienst MAD hatte bei der Überprüfung eines afghanischen Arbeiters einen Hinweis erhalten. Möglicherweise war er brisant. Eine konkrete Gefährdung für die einhundertfünfzig Soldaten des Lagers konnte nicht ausgeschlossen werden.
Allerdings gestalteten sich die nötigen Nachforschungen außerhalb des Camps für den MAD etwas kompliziert. Daher hatte Retzlaff die Information umgehend an seinen Kameraden, Oberstleutnant Achim Seifert vom BND, weitergeleitet. Seifert, ein gemütlicher Endvierziger, war früher einmal Kompaniechef einer Jägerkompanie gewesen. Er hatte reichlich Einsatzerfahrung und war ein umgänglicher, pragmatischer Zeitgenosse.
Nur wenige Länder leisteten sich zwei Geheimdienste im Einsatzland. Im Grunde war dies auch nicht nötig. Hier paarte sich vielmehr mäßiger Reformeifer mit mangelhafter Bedarfsanalyse und einer seltsamen gesetzlichen Grundlage. Zwei Dienste – das bedeutete: zwei Apparate mit aufwendigen Strukturen und langen Befehlsketten. Laut Seifert reichte bereits eine Hierarchie, um der Arbeitsebene das Leben schwerzumachen. Wenigstens waren Retzlaff und er, trotz der beiden unterschiedlichen Behörden, nach zwei Monaten gemeinsamer Arbeit ein eingespieltes Team und auch privat befreundet.
Der Hinweis selbst hatte zunächst wie andere vermeintlich wertvolle Hinweise auch geklungen. Eine Tatsache ließ dann allerdings aufhorchen: Der Tippgeber kannte offenbar den genauen Zeitpunkt, an dem ein großer deutscher Konvoi das Lager verlassen sollte. Das war ungewöhnlich und sprach für den Wert seiner Informationen. Den genauen Ort sowie die Modalitäten eines angeblichen Anschlags auf den Konvoi wollte der Informant allerdings nur persönlich und gegen entsprechende Bezahlung mitteilen.
»Vielleicht können wir uns etwas Verstärkung besorgen. Allein würde ich da heute ungern rausfahren.«
Seifert erinnerte sich an einen der letzten Green on Blue Angriffe. Zwei afghanische und vier amerikanische Kameraden waren getötet worden, als afghanische Soldaten ohne Vorwarnung auf ISAF-Truppen gefeuert hatten. Eine besonders unnötige Art, ums Leben zu kommen …
Nicht selten hatten sich vermeintliche Informanten in der Vergangenheit auch als Selbstmordattentäter erwiesen.
»Fragen wir doch die Wollmützen von der Task Force 47.«
»Hm, unsere Jungs vom Kommando Spezialkräfte sind zurzeit draußen und die machen immer so ein Tamtam. Aber wie wäre es mit den Herren von der Marine? Davon laufen auch gerade ein paar herum.«
»Kampfschwimmer? Ist mir sehr recht, mit denen kann man arbeiten.«
»Und wir brauchen ja auch nicht viele.«
»Ich kenne einen jungen Oberleutnant, Steiger heißt der, glaube ich, ein gerader Typ. Macht einen ganz vernünftigen Eindruck. Ich frage mal nach.«
Eine halbe Stunde später fuhren zwei SSA Wölfe – gepanzerte Mercedes G-Klasse Geländewagen in der Y-Version – eine staubige Ausfahrtsstraße entlang. Oberleutnant zur See Jan Steiger und fünf seiner Kameraden hatten sich kurzerhand bereit erklärt, den Geheimdienstlern etwas Feuerkraft zur Seite zur stellen. Die Marinesoldaten waren bis an die Zähne bewaffnet und komplett aufmunitioniert. In den Fahrzeugen wurde es daher reichlich eng.
Sie waren deutlich früher als vereinbart am RV2 angekommen. Böse Überraschungen waren so leichter zu vermeiden. Die Männer saßen ab und erkundeten sorgfältig das Terrain. Es galt, insbesondere sogenannte IEDs3 rechtzeitig auszumachen und das Gelände auf mögliche Hinterhalte abzuklopfen.
»Sprengfallen können euch den ganzen Tag versauen.« So hatte es ein Ausbilder auf dem Counter-IED-Lehrgang einmal trocken ausgedrückt. Bei einem halbwegs gut geplanten Sprengstoffanschlag kam man bestenfalls mit Verstümmelungen davon. Häufig war aber der Tod die Folge.
Die Taliban hatten, was Sprengfallen betraf, stetig dazugelernt. Dies bekam die Bundeswehr während des Afghanistaneinsatzes über die Jahre schmerzhaft zu spüren. Der Hauptfeldwebel hatte es damals auf dem Lehrgang treffend kommentiert: »Knacken lässt sich so ziemlich jede Panzerung. Es ist nur eine Frage der Sprengstoffmenge.«
Oberbootsmann Werner kam mit zwei Kameraden von den Sondierungen zurück und meldete: »Nichts, Jan. Sieht sauber aus.«
»Gut. Wir haben auch nichts gefunden. Dann sucht euch einen netten Beobachtungsposten, ihr kennt ja das Prozedere. Wir beide machen die sichtbare Absicherung.«
Zwanzig Minuten später kündigte eine Staubwolke ein Fahrzeug an. Es näherte sich ein weißer Toyota Hilux, wie sie zu Tausenden in Afghanistan herumfuhren. Steiger fragte sich, ob es außer weißen Pick-ups auch noch andere Autos in diesem kargen, harten Land gab.
Zügig bog der verstaubte Hilux ein und kam etwa vierzig Meter vor einem der Wölfe auf der sandigen Piste zum Stehen. Die Handzeichen der Marinesoldaten waren unmissverständlich gewesen.
Ein kleiner, drahtiger Mann mit harten Zügen stieg aus dem Wagen. Oberstleutnant Seifert tippte auf einen Usbeken. Unsicher schaute sich der Mann nach allen Seiten um. Er trug den üblichen Shalwar Kameez4 und darüber eine dunkle Weste. Eine beigefarbene Pakol-Mütze bedeckte sein Haupt. In Antizipation einer Leibesvisitation hob der Mann die Hände und zog seine Unterwäsche hoch, so dass die Soldaten Brust, Bauch und Rücken sehen konnten. Anschließend überprüfte Oberbootsmann Werner noch einmal sorgfältig die Kleidung und sämtliche Taschen. Er trat zurück und gab Entwarnung.
»Sauber!«
Der Informant konnte die vier übrigen Soldaten nicht sehen, die unweit entfernt und perfekt getarnt im Gestrüpp verborgen waren. Er konnte auch nicht ahnen, dass zwei mit EOTech-Visieren ausgestattete G36-Gewehre permanent auf ihn zielten. Steiger und Werner entfernten sich vorsichtig. Die Gegend dabei weiter scannend, überließen sie die Verhandlungen den Männern vom Geheimdienst.
Das Geschäft war schnell abgeschlossen. Soweit Steiger sehen konnte, war eine kleine Landkarte übergeben worden. Zudem hatten amerikanische Dollars den Besitzer gewechselt. Ihr Empfänger war mit den Worten »Tascha Kor5« freundlich lächelnd in seinen Toyota Pick-up gestiegen und wieder davongefahren.
»Wenn die Informationen stimmen, dann frage ich mich immer noch, woher die wissen, wie unsere Konvois fahren«, sagte Retzlaff und schüttelte ernüchtert den Kopf.
»Wir werden sehen«, entgegnete Seifert und wandte sich zu Steiger: »Von uns aus können wir los, Herr Oberleutnant.«
Steiger machte eine Bewegung mit dem rechten Arm und rief: »Aufsitzen!«
Die restlichen vier Kameraden pellten sich aus ihren Verstecken. Eine Minute später befanden sich die Soldaten auf dem Weg zurück ins Lager. Sie fuhren nicht schnell, da man sonst Sprengfallen noch leichter übersehen konnte. Auch nahmen sie aus Sicherheitsgründen nicht denselben Weg zurück zum Camp, auch wenn die andere Route einen größeren Umweg darstellte. Man konnte nie wissen.
Sie hatten gerade einen Hügel hinter sich gelassen und sich einem Waldstück genähert, da hörte Steiger von hinten:
»Jan?«
»Jep!«
»Sascha und ich müssten mal pinkeln!«
Steiger rollte die Augen. »Wir sind hier mitten im Indianerland! Aber okay, dann gib das mal per Funk an die Jungs durch, wir halten da vorne.«
Als Oberbootsmann Werner ausstieg und seine Hose öffnete, hörte er die Schüsse. Es war das charakteristische dunkle »TACK-TACK-TACK« der Kalaschnikow-Sturmgewehre, ein Klang, der sich über die Jahre tief im Unterbewusstsein aller deutschen Soldaten eingeprägt hatte. Dazwischen mischten sich die Töne eines stärkeren Kalibers.
Steiger hatte die Schüsse ebenfalls gehört. »Die Schüsse gelten nicht uns, sie sind zu weit entfernt. Wir fahren weiter.«
Kurze Zeit darauf hörte man auch leichtere Waffen. Aus den einzelnen Schüssen und Feuerstößen war nun ein regelrechter Gefechtslärm geworden.
»Moment mal …« Steiger konzentrierte sich. Er lauschte angestrengt.
Die zwei Geheimdienstler näherten sich. »Was geht da vor sich?«
»Das eben war ein russisches MG. Klingt nach einem Feuergefecht zwischen Taliban und ISAF-Truppen, sehr wahrscheinlich unseren Kameraden«, stellte Steiger fest.
Er hatte den Satz kaum beendet als es im Funkgerät von Hauptmann Retzlaff rauschte.
»… stützung … Hinter … aten … zwei Mann tot …«
Retzlaff, der die Pinkelpause für eine Zigarette genutzt hatte, ließ die Kippe in den Straßenstaub fallen und trat sie aus. »Verdammte Berge! Der Empfang hier ist zum Kotzen!«
»Vielleicht ist es auch weiter weg, als wir denken?«
»Nein, das ist in der Nähe«, kommentierte ein junger Bootsmann, der aussah, als würde er durch keine Tür passen.
»Die Schüsse decken sich mit dem, was wir über Funk hören.«
Steiger nickte langsam. »Es sieht ganz so aus!«
»Und Sie wollen da jetzt mittenrein, nehme ich an?« Seifert runzelte die Stirn.
»Für mich hört sich das nach einem Notruf an, Herr Oberstleutnant. Wir sind vermutlich am nächsten dran. Ferner sind wir dafür ausgebildet und, wie es der Teufel will, auch ausgerüstet.«
Seifert überlegte einen Moment, schließlich sagte er: »Verstanden, Herr Oberleutnant. Sie sind die Spezialkräfte, Ihre Show! Bei mir ist das schon zu lange her. Retzlaff?«
Hauptmann Retzlaff schluckte. »Klar, wir sind dabei!«
Steiger nickte kurz. »Sascha, gib mir mal die Funke, wir müssen die JOC6 informieren!«
Hauptmann Retzlaff nahm seinen Kollegen Seifert zur Seite. »Das könnten unsere Fallschirmjäger mit diesem Journalisten sein. Du weißt schon, dieser Rothe.«
»Rothe, die ZDF-Geschichte, stimmt. Mann, das hat jetzt gerade noch gefehlt.«
Nachdem Steiger den Vorfall im Lager gemeldet hatte, kehrte er zurück. »Herr Oberstleutnant, Herr Hauptmann, die Talibärte scheinen im Moment unweit von hier stark beschäftigt zu sein. Möglicherweise mit unseren Fallschirmjägern. JOC ist informiert. Sie schicken einen Konvoi mit BAT7, aber bis die hier sind, kann das noch mindestens eine halbe Stunde dauern.«
Beide nickten.
»Sie sind bewaffnet mit zwei G36 Sturmgewehren, reichlich Munition und P8 Pistolen, korrekt?«
»Korrekt.«
»Ballistische Westen?«
»Wir tragen leichte Westen drunter, privat beschafft.«
»Gut, muss reichen! Wann waren Sie das letzte Mal auf dem Schießstand?«, fragte der junge Offizier ziemlich forsch.
»Vor zwei Wochen, zusammen, PS1, PS2 und PS38«, antwortete Retzlaff.
Steiger rollte innerlich die Augen. Friedensübungen für Stabssoldaten, damit sie nicht vergessen, wo sich das gefährliche Ende der Waffe befindet …
»Was haben Sie früher gemacht?«, wollte Steiger als Letztes wissen.
»Panzergrenadier, Instandsetzung«, antwortete Retzlaff.
»Ich bin gelernter Jäger, aber das ist lange her …«, ergänzte Seifert vorsichtig.
»Sehr gut, wir können jede Unterstützung brauchen. Wir werden jetzt versuchen, den Gegner aufzuspüren und die Fallis9 rauszuhauen.« Steiger verzog dabei keine Miene. Für einige Sekunden herrschte absolute Stille.
Dann schüttelte Seifert langsam den Kopf. Als Heeresoffizier war er eine umfassende Befehlsausgabe gewohnt. Aber angesichts der Umstände, der Professionalität der KSler und deren Ortskenntnisse sagte er nur etwas verhalten: »Ich habe in meiner Karriere zwar noch keine derartige Ansage von einem Junioroffizier bekommen. Aber denn man tau, Herr Oberleutnant!«
»Check!« Steiger drehte sich um. »Sascha, Tom, parkt die Wölfe um, da sieht man sie sofort! Danach sammeln!«
Während sich die Soldaten absprachen, überprüften die beiden Geheimdienstler ihre Waffen und zurrten ihre Schutzwesten zurecht. Seifert keuchte innerlich unter dem Gewicht der Ausrüstung, doch er ließ sich nichts anmerken. Steiger befahl schließlich allen, noch einen ordentlichen Schluck aus den Wasserflaschen in den Fahrzeugen zu nehmen. Es war wichtig, nicht zu dehydrieren. Binnen Minuten war der Trupp anschließend im Gestrüpp verschwunden.
Schüsse aus leichten Waffen waren jetzt nur noch vereinzelt zu hören. Das Einzige, was nicht abebbte, war das Hämmern des Maschinengewehrs, garniert mit Garben der Kalaschnikows.
»Die Talibärte haben ein PKM10«, kommentierte ein Kampfschwimmer in sein Mikro.
»Check!«, bestätigte Steiger. Auch er hatte das russische MG sofort identifiziert. Man wollte sich nicht unbedingt auf der gefährlichen Seite davon befinden.
Vorsichtig arbeiteten sich die Soldaten vor. Oberbootsmann Sascha Herzog ging point11 und gab Entdeckungen per Handzeichen an die Kameraden weiter.
Sie hatten sich aufgefächert und jeder konzentrierte sich auf seinen Sektor, Gewehr im low ready. Retzlaff war vorletzter und Seifert deckte nach hinten ab.
Mit Geduld und äußerster Konzentration schritten die Männer voran. Dichtes Buschwerk und dünner Baumbestand waren eine gefährliche Kombination. Infanteristen hassten Reisig. Trockenes Holz, das auf dem Boden lag, war laut, wenn es brach. Laut genug, um den Gegner zu warnen. Schlimmstenfalls gab man sogar seine exakte Position preis.
Vorsicht war also das Gebot der Stunde. Behutsam arbeiteten sie sich durch das Gestrüpp, verbogen Äste, um sie nicht zu brechen. Andererseits wussten die Männer, dass die Zeit lief. Den Schüssen nach zu urteilen, saßen hier Kameraden richtig in der Klemme.
Herzog spähte vorsichtig nach Sprengfallen. Die Männer orientierten sich ausschließlich akustisch an den Schüssen, die jedoch deutlich weniger wurden. Es kam ihnen vor wie eine Ewigkeit.
Nicht mehr lange, und unsere Kameraden werden überrannt …
Nach einer Distanz von etwa vierhundert Metern machte Oberbootsmann Herzog endlich eine geballte Faust und hielt sie nach oben. Dies bedeutete: »Halt!«
Es folgten weitere Signale: »Sechs Talibärte – ein MG, direkt vor uns – weitere fünf links, längs verteilt – keine Absicherung nach hinten.«
Ein L-förmiger Hinterhalt, dachte Steiger. Wie aus dem Lehrbuch.
Keine Absicherung nach hinten?
Nicht wie aus dem Lehrbuch!
Scheinen sich sehr sicher zu fühlen.
Steiger bedeutete Herzog, zu warten.
Die Männer schlossen vorsichtig auf. Die unter Beschuss liegenden Kameraden konnten sie aus ihrer Position nicht sehen. Sie lagen jetzt gut einhundert Meter hinter den Taliban. Steiger teilte seine Leute in zwei Gruppen, die sich seitlich halten sollten. Retzlaff und Seifert würden nach hinten dichtmachen, falls ungeladene Gäste auftauchten.
In diesem Moment gingen Steiger tausend Dinge durch den Kopf. Er und seine Männer würden vor Gericht gestellt werden. Ein Ermittlungsverfahren war ihnen mindestens sicher. Mittlerweile zahlte die Truppe wenigstens den Anwalt. Trotzdem taten sie das Richtige, denn diese Taliban waren gerade dabei, ihre Kameraden zu töten.
Er schob die Gedanken beiseite und flüsterte in sein Mikro: »Seht zu, dass ihr keinen von unseren Heereskameraden erwischt. Und jetzt: volle Konzentration!«
Geschmeidig lösten sich drei seiner Männer vom Trupp und bewegten sich konzentriert nach links. Die Taliban feuerten vereinzelte Schüsse. Ein drahtiger, ausgemergelt wirkender Mann mit langem rötlichem Bart war offenbar der Anführer. Mit kehliger Stimme rief er einem seiner Leute etwas zu. Der griff nach unten und förderte eine größere Waffe zutage, die aussah wie eine RPG712. Der Taliban überprüfte das Gerät und legte an.
Steiger beobachtete ihn durch sein Leuchtpunktvisier genau. Er konnte seinen eigenen Puls spüren. Aber er war zu sehr Profi, als dass er sich aus der Ruhe bringen ließ.
Steigers Taliban konzentrierte sich offenbar voll auf sein Ziel. Er schien nicht zu ahnen, dass auch er selbst sich im Fadenkreuz eines Gegners befand.
Die Männer neben Steiger gaben jetzt ihre Ziele per Funk durch. Der nach links ausgewichene Trupp meldete ebenfalls Feuerbereitschaft und seine anvisierten Ziele. Es musste unter allen Umständen vermieden werden, dass zwei oder mehrere Kameraden auf dieselbe Person schossen.
Steiger zählte herunter: »3-2-1-Feuer!«, hauchte er in sein Mikro.
Es erklang ein kurzes, kontrolliertes Staccato. Innerhalb von sechs Sekunden hatten die Kampfschwimmer acht Gegner ausgeschaltet.
Die Taliban wussten nicht, was sie traf. Sie hatten noch nicht einmal Zeit, ihre Brüder zu warnen. Der Gegner musste sie in die Zange genommen haben. Das konnte nicht sein! Zwei Taliban weit vorne rannten, obwohl verletzt, geistesgegenwärtig davon. Allerdings in die falsche Richtung. Oberbootsmann Werner sorgte dafür, dass sie keine ISAF-Truppen mehr behelligen würden.
Danach wurde es still. Es bewegte sich nichts. Niemand sprach ein Wort. Der beißende Geruch von Nitrozellulosepulver hing in der Luft.
»Meldung!«
Über Funk kam:
»Pitt, bin okay.«
»Matze dto.«
»Sascha dto.«
»Tom dto.«
»Chris dto.«
Steiger blickte nach hinten. Retzlaff und Seifert gaben ihm den Daumen hoch.
»Gut. Langsam vorgehen und sichern! Ich versuche, Kontakt zu unseren Jungs auf der anderen Seite herzustellen.«
Er funkte jetzt auf einer anderen Frequenz. »Oberleutnant Steiger mit sieben Kameraden. Nicht schießen! Wir nähern uns aus der Richtung der Taliban. Verstanden?«
Es rauschte im Äther.
Steiger wiederholte seinen Anruf.
Dann ertönte mit einiger Klarheit: »Hauptmann Ehlert, mit sechs Fallschirmjägern und einem Zivilisten. Wir freuen uns, dass sie da sind, Herr Oberleutnant!«
»Sind Sie okay, haben Sie Verluste?«
»Positiv, zwei Kameraden tot, drei Verletzte, einer davon schwer.«
Steiger und seine Kameraden sahen sich an. Dann blickten sie auf die Taliban, die sie soeben getötet hatten. Es war kein schöner Anblick. Aber keiner der Männer empfand Mitleid. Das hier war Krieg, egal wie man es in Deutschland nannte.
»Wir nähern uns jetzt Ihrer Stellung und kümmern uns um Ihre Verletzten. Nicht schießen! Bitte bestätigen!«
»Wir haben verstanden.«
Der Trupp ging weiter und Steiger erkannte, rund hundertzwanzig Meter entfernt, einen deutschen Soldaten. Der Flecktarnanzug Wüste war sehr charakteristisch und hob die Deutschen deutlich von ihren internationalen Kameraden ab. Die Männer gingen aufeinander zu.
»Torsten Ehlert.«
»Jan Steiger.«
Ehlert war verschwitzt, sein Gesicht war verschmutzt und sein Smock war voller Blut der toten Kameraden. Er schien unendlich erleichtert.
»Es tut gut, euch zu sehen. Wir haben den Hinterhalt zu spät erkannt, wir sind da voll reingelaufen. Und zum Schluss hatten wir fast keine Munition mehr. Die müssen gewusst haben, dass wir hier patrouillieren. Tja, und … Kai und Olli haben’s nicht geschafft, verdammt!« Der Hauptmann wischte sich eine Träne aus dem Auge.
Steiger kannte das. »Wir sind froh, dass wir helfen konnten. Es war ein Zufall, dass wir in der Nähe waren. Um deine Männer tut es mir aufrichtig leid, das ist … Scheiße …«
Ehlert hatte sich abgewendet und rieb sich die Augen.
Ein Mann näherte sich zaghaft – etwa Mitte vierzig, die langen Haare zu einem Zopf gebunden. Er trug eine randlose Brille und eine dunkelblaue Schutzweste mit dem Aufdruck »PRESS«. Seine Stimme war tonlos. »Mein Name ist Christian-Alexander Rothe, ich bin Journalist beim ZDF. Ich gebe zu, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll …«
»Kein Problem, Herr Rothe. Ruhen Sie sich erst einmal aus. Mit etwas Glück kommt gleich Unterstützung, dann wird man Sie von hier abholen und ins PRT13 fahren. Übrigens sehr mutig von Ihnen, als Zivilist hier draußen …«
»Oh, na ja, ich … Die Männer, ich kannte sie nun auch schon seit drei Wochen … und von einem Moment auf den anderen … Ich …«
Der Mann war durch das Erlebte sichtlich gezeichnet. »Ich … möchte mich gerne bei Ihnen allen bedanken!« Dann versagte seine Stimme.
»Machen Sie sich keinen Kopf darüber. Aber vielleicht können Sie ja, zurück in Deutschland, etwas über die wahren Zustände hier schreiben. Vielleicht kommen Sie auch zu dem Schluss, dass hier Krieg herrscht«, nutzte Steiger die Gelegenheit.
Der Journalist hatte sich auf einen umgefallenen Baum gesetzt und nahm einen Schluck Wasser. Er starrte ins Leere.
Steiger wandte sich ab und begab sich zu den anderen Soldaten. Die übrigen Fallschirmjäger hatten sich mit ihren Kameraden von der Marine kurzgeschlossen. Die Stimmung war sowohl von Erleichterung als auch von einer tiefen Trauer um die gefallenen Kameraden geprägt.
»Sascha, Matze, wie steht es um die Verletzten?«
»Die sind erst einmal stabil. Aber wir müssen ins Camp, hier können wir nichts mehr für sie tun.«
»Verstanden. Umland weiterhin sichern! Es könnten noch weitere Taliban in der Nähe sein. Ich werde jetzt Meldung absetzen. Dann sollten wir rasch zurück zu den Wölfen verlegen und warten, bis der Konvoi da ist. Wir müssen vorher aber noch alles dokumentieren.«
»Check!«
Zum Hauptmann der Fallschirmjäger gewandt: »Torsten, der Konvoi wird eure Toten mitnehmen.«
»Wir haben sie bereits bedeckt. Unser Funker und unser Rettungssanitäter …«
»Ja, Sascha sagte mir das schon. Um eure Verletzten kümmern wir uns.«
»Ich weiß. Danke!«
Steiger wandte sich an seine Kameraden: »Wenn der Konvoi eingetroffen ist, direkt nach Hause. Wir wollen keine Minute zu viel an diesem Ort verbringen.«
»Check!«
2
Vor vier Wochen
Am Rehkitzsteig
Berlin Wilmersdorf
Deutschland
Korvettenkapitän Jan Steiger, sechsunddreißig, war Single. Jedenfalls im Moment. Dabei konnte er sich über einen Mangel an weiblicher Aufmerksamkeit nicht beklagen. Sein Problem war anders gelagert: Steiger war Meister im Beenden von Beziehungen. Schnell, allzu schnell hatte er an den meisten Frauen etwas auszusetzen. Seine Freunde kommentierten das mit den Worten: »Gemalt bekommst du keine, Jan!«
Doch sie alle verstanden gar nichts. Die Problematik war so simpel wie faktisch. Neue Frauen reichten eben nicht an seine heimliche Liebe heran: Meghan Caoilainn14 O’Reilly aus Irland.
Steiger hatte Meghan während eines knapp dreijährigen Schulaufenthaltes in West-Irland kennengelernt. Doch damals hatte er nur Rugby im Kopf gehabt. Wie sehr ihm die Tochter der Freunde seiner Eltern gefiel, war ihm erst später klargeworden. Lange hatte er sich über sich selbst geärgert, über sein eigenes Unvermögen, ihr seine Zuneigung zu gestehen.
Vor zwei Wochen hatte Meghan ihre Doktorarbeit verteidigt. So hatte Steiger kurzerhand beschlossen, sich für einen Besuch anzumelden und der promovierten Historikerin zu gratulieren.
»Im Ernst? Du kommst nach Dublin?« In ihrer Stimme schwang Überraschung, aber auch echte Freude mit.
»Jep. Ich habe mir gedacht, vielleicht strahlt deine frisch besiegelte Weisheit auch gleich auf mich ab …«
»Jan Steiger, du bist ein Blödmann! Aber ich freue mich wahnsinnig, wenn du mich besuchen kommst. Auch wenn du bisher nicht gerade der fruchtbarste Boden für meine Weisheiten warst.«
»Egal. Dafür sehe ich gut aus. Ich dachte, intelligente Frauen stehen auf sportliche, schlicht gefaltete Gemüter.«
»Da muss ich dich enttäuschen, Jan. Frauen schätzen eine gesunde Mischung aus Intellekt und physischer Attraktivität.«
»Uh, oh … I’m in trouble …«
»Das werden wir sehen! Wie lange bleibst du?«
»Ich habe mal fünf Tage gebucht.«
»Nur fünf Tage? Ich muss aber auch Vorlesungen halten, das weißt du?«
War das eine Schutzbehauptung? Wollte sie ihn vielleicht doch nicht sehen? Oder hatte sie zwischenzeitlich einen Freund?
»Um die Zeit schlafe ich noch. Außerdem war ich seit über einem Jahr nicht mehr in Dublin. Ich hatte vor, auch Liam und Patrick einen Besuch abzustatten …«
»… der dann wieder in einem klassischen Saufgelage endet? Ich erinnere mich noch gut an eure alte Rugby Crew.«
»Nein, keine Sorge. Es hat sich einiges geändert, ich …«
»… lass mich raten, du trinkst heute noch mehr als früher?«
»Nein … ich … ich freue mich einfach, dich wiederzusehen, Meghan.«
Mann! Ist gerade Anti-Jan-Tag?
»Ich freue mich auch, Jan. Sehr. Wann kommst du?«
Das klingt schon besser!
»Ich lande morgen mit Aer Lingus Flug 331 um 17:30.«
»Ich hole dich ab.«
Au ja!
»Das brauchst du nicht! Ich kann mir auch ein Taxi nehmen.«
Bitte hol mich ab!
»Kommt nicht in Frage, ich werde da sein. Ich habe mittlerweile auch ein eigenes Auto.«
»Respekt, das wusste ich gar nicht.«
»Du weißt so vieles nicht, Jan …«
»Bis morgen dann!«
»Bis morgen, ich freue mich!«
»Ich mich auch!«
So, Keule. Das war’s. Und diesmal nicht kneifen, du Pfeife!
3
Glasnevin District
Dublin
Irland
Der erste Tag war hervorragend gelaufen. Sie hatten sich am Flughafen umarmt. Nicht zu lange und nicht zu kurz. Und sie hatte ihm einen sanften Kuss auf die Wange gegeben. Sie hatte gelächelt. Mit ihren leuchtend grünen Augen. Dann waren sie in Meghans Lieblingskneipe, The Ol’ Barnacle, Fisch essen gewesen und hatten im Duke in Erinnerungen geschwelgt und etwas getrunken. Dann hatte Meghan ihn erneut umarmt und ihm erklärt, sie werde ihn jetzt zu seinem alten Mannschaftskameraden Liam Connolly fahren. Noch vor Liams Tür hatte Steiger eine dritte Umarmung registriert. Sie hatten sich für den nächsten Tag zum Mittagessen in einem schönen Restaurant in der Nähe der Universität verabredet. Frühstück war ausgeschlossen, da Meghan in der Uni zu tun hatte. Von seiner Seite aus war es ohnehin unrealistisch.
Für dieses Mittagessen plante Steiger seinen Coup.
Liam Connolly, Ende dreißig, Versicherungsmakler und ehemaliger Rugbyspieler, war fassungslos. »Meghan? Immer noch? Du hast es ihr noch immer nicht gesagt? Oh, Mann! Und du willst bei mir pennen? Kein Problem, Jan, aber weshalb bekennst du dich ihr nicht einfach mal? Ich fasse es nicht!«
Steiger hob beschwichtigend die Hände. »Der Zeitpunkt war noch nicht perfekt. Ich bin doch gerade erst angekommen. Was hätte ich denn sagen sollen? Etwa: ›Hey, schön, dass du mich abholst und, ähm, und übrigens: Ich bin seit fünfzehn Jahren in dich verknallt und möchte bei dir übernachten?‹«
»Ohne das ›Ähm‹ und den letzten Halbsatz: ja, so in etwa.«
»Ach Liam, du verstehst das nicht. Ich habe morgen dafür einen Tisch reserviert, und … Mann, wie soll ich’s dir erklären, es muss sich irgendwie ergeben.«
»Also, Jan: Es gab keinen Grund, ihr nicht wenigstens mal etwas anzudeuten. Das hätte sie verdient gehabt. Ich vermute aber stark, du bekommst morgen auch nichts gebacken! Daher, mein Lieber, trinken wir jetzt auf dein typisch deutsches Unvermögen, deine Gefühle zu erklären!« Connolly zauberte eine Flasche zehn Jahre alten Bushmills Whiskey hervor.
»Mit dem trinke ich auf alles, was du willst.«
»Berichte dann mal von deinem letzten Abenteuer am Sinai!15 Und erzähl mir nicht, du wärst nicht dabei gewesen, die Zeitungen waren voll von der Aktion.«
Steiger lächelte matt. »Über meinen Beruf kann ich nicht reden, gieß lieber ein …«
Die Nacht wurde deutlich länger als geplant.
4
Cabot Square
Canary Wharf, East London
England
Es war Ende Oktober. Nebelschwaden zogen durch die Londoner Innenstadt. Die grellen Kegel der Straßenlaternen erreichten kaum den nassen, kalten Asphalt. Gerade hatte wieder ein leichter Nieselregen eingesetzt. Bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt konnte man den Atem der Fußgänger sehen, die achtlos aneinander vorübereilten.
Inmitten des Treibens bewegten sich zwei Männer zügig. Etwa Ende dreißig und gut gekleidet, wirkten die Männer wie die typischen Geschäftsleute, die diesen Teil Londons überwiegend bevölkerten. Zielstrebig näherten sie sich dem Gebäudeeingang eines imposanten weißen Hochhauses am Ende des Cabot Square nahe der berühmten Canary Wharf. Auf einem blankpolierten Messingschild war neben einigen anderen Firmennamen die schlichte Buchstabenkombination
M.S. Ltd.
eingraviert. Nachdem der größere von beiden, ein wahrer Hüne, den Klingelknopf gedrückt hatte, öffnete sich langsam die schwere Doppeltür. Im Innern des Gebäudes erhob sich über den Männern eine große Halle. Die Decke konnte man allenfalls erahnen. Glas, Stahl und Marmor prägten das geräumige Foyer. Es roch geradezu nach Geld und Macht.
Gefühlte fünfzig Meter vom Eingang entfernt befand sich, von unten in sanftes Licht gehüllt, der runde Empfangstresen. Besetzt war er von einer bildhübschen jungen Frau, die eher an ein Model als an eine Concierge erinnerte.
»Guten Tag, wir haben einen Termin bei Maritime Solutions.«
»Guten Tag, wen darf ich melden?«
»Mein Name ist Mats Nygard und das ist mein Kollege, Herr Erik Borg.«
»Ah ja, Sie werden bereits erwartet. Ich bringe Sie zum Aufzug. Ach, und wundern Sie sich bitte nicht, der Aufzug hat keine Tasten. Man wird Sie holen. In Ordnung?«
»Kein Problem.«
»Hier entlang, bitte.«
Die junge Dame war aufgestanden und begleitete sie zum Lift in einem entlegenen Winkel des Foyers. Die Männer schätzten ihre Größe auf einen Meter achtzig. Mit einer lässigen Bewegung ließ sie ihre Chipkarte durch den Kartenleser gleiten. Lautlos öffneten sich zwei Messingtüren. Die Concierge hatte recht. Über Tasten verfügte dieser Aufzug nicht. Lediglich ein Irisscanner sowie ein elektronisches Fingerabdruckfeld waren erkennbar. Der Aufzug war nahezu komplett mit Spiegeln ausgekleidet. Ein verchromter Handlauf bot den Besuchern eine Möglichkeit, sich festzuhalten.
Nachdem sich die Türen lautlos geschlossen hatten, geschah erst einmal nichts. Einer der Männer blickte nach oben. Zwei hochauflösende Kameras meldeten vermutlich jedes Detail an eine Sicherheitszentrale weiter.
Nach kurzer Zeit setzte sich der Lift in Bewegung. Binnen Sekunden öffneten sich die Türen wieder und die Männer betraten eine Eingangshalle. Der Blick aus einem Flurfenster verriet, dass sie sich mindestens im siebten oder achten Stock befanden. Der Ausblick auf die Canary Wharf war bemerkenswert.
Der Mann, der sich Nygard nannte, sah sich um. Eine khakifarbene lederne Garnitur war um einen Marmorclubtisch gruppiert, auf dem eine Karaffe mit Wasser stand. Acht schwere Kristallgläser waren auf den Kopf gestellt. Unter einer Gewächshauslampe blühte eine üppige Platane. An der rechten Wand hing eine vergrößerte Fotografie, dezent und geschmackvoll eingerahmt. Es handelte sich um ein Gruppenfoto, rund ein Dutzend Soldaten waren abgebildet. Sie trugen Camouflage-Kampfanzüge und große olivfarbene Rucksäcke. Die meisten hatten Tarnfarbe im Gesicht. Einige hielten ihre Gewehre in den Händen, andere trugen sie an einem Sling vor ihrem Körper. Ihre Hände auf den Schultern von Kameraden, grinsten die Männer fast übermütig in die Kamera. Offenbar war das Bild in einer tropischen Gegend aufgenommen worden. Im Hintergrund war dichter, üppiger Regenwald zu erkennen. Die Aufnahme war schon etwas älter. Nygard schätzte sie anhand der Ausrüstung auf die späten neunziger Jahre.
Am oberen Rand in der linken Ecke prangte ein kleines Wappen. Es zeigte einen Dolch, der von unten durch zwei stilisierte Wellen stach. Darunter stand geschrieben:
BY STRENGTH AND GUILE16
Die Eingangshalle war durch eine milchige Glaswand von den sich anschließenden Räumen getrennt. Nachdem sich eine verstärkte Sicherheitstür geöffnet hatte, betrat ein athletisch wirkender Mann den Vorraum. Er winkte die beiden Gäste zu sich und stellte sich höflich vor. »Guten Tag, Gentlemen, James MacLean, wenn Sie mir bitte folgen wollen.«
Der Mann schloss die Tür hinter ihnen und sie bemerkten, dass sie sich in einer Art Schleuse befanden. Sie vernahmen ein klickendes Geräusch, ähnlich dem Verschluss einer alten Spiegelreflex-Kamera.
»Nacktscanner«, raunte Nygard seinem Kollegen Borg zu.
MacLean lächelte verlegen. »Reine Routine, wir gehen natürlich davon aus, dass Sie keine Waffen tragen. Dennoch, Sie verstehen das sicher …«
»Selbstverständlich«, entgegnete Nygard in makellosem Oxford-Englisch.
»So, nun aber …«
Ein kleines grünes Licht vor ihnen signalisierte, dass die zweite Tür geöffnet werden konnte. MacLean ging voraus und sie betraten einen mäßig beleuchteten, langen Flur. An den Wänden hingen Ölgemälde, auf denen Portraits britischer Soldaten unterschiedlicher Jahrhunderte zu sehen waren. Nygard glaubte im Vorbeigehen Wellington, den Sieger von Waterloo, auf einem Bild erkannt zu haben.
Der Flur mündete schließlich in einen Konferenzraum, der sich hinter einer hohen Tür aus Mahagoniholz verbarg. Der Raum war, bis auf eine Anrichte und eine Glasvitrine, in der ein Modell des berühmten Segelschiffes H.M.S. Victory17 ausgestellt war, eher karg eingerichtet. An einem langen Tisch saßen zwei Männer in dunklen Anzügen. Sie erhoben sich rasch, als die Gäste eintraten.
»Herr Nygard, Herr Borg, herzlich willkommen!«
»Ich bin Jeremy Horne und das ist mein Direktor für operative Angelegenheiten, Craig Buxton. James haben Sie ja bereits kennengelernt.«
Zum ersten Mal deutete sich so etwas wie ein Lächeln auf den Gesichtern der beiden Gäste an. Sie hatten kurz zuvor einen Blick ausgetauscht.
»Mats Nygard und Erik Borg, angenehm.«
Der Mann, der sich als Jeremy Horne vorgestellt hatte, wirkte drahtig und trug kurze graue Haare. Horne war achtundfünfzig Jahre alt und hatte sechzehn davon im legendären SBS, dem Special Boat Service der britischen Streitkräfte, gedient. Nach einer anschließenden Verwendung beim MI6, dem Auslandsgeheimdienst Großbritanniens, hatte er sich entschlossen, dem Circuit beizutreten. So wurde die private Sicherheitsindustrie im britischen Commonwealth genannt. Nur zwei Jahre später gründete er seine eigene Firma Maritime Solutions Ltd. Sein Jahreseinkommen überstieg das Gehalt der meisten Investmentbanker Londons.
Sein Partner, der Amerikaner Craig Buxton, war physisch das genaue Gegenteil. Bei einem Gewicht von sechsundneunzig Kilogramm, davon einige zu viel in der Bauchgegend, hatte Buxton Arme wie ein Bodybuilder und Hände wie Schraubstöcke. Die verbliebenen Haare zu einer Glatze rasiert, erinnerte er eher an einen Türsteher als an einen Geschäftsmann. Horne hatte Buxton seinerzeit am »freien Markt« rekrutiert. Buxton, fünfundfünfzig, hatte vor vier Jahren im Rang eines Commander die Development Group, die bekannte Antiterroreinheit der US-Navy SEALs, verlassen und war nach einigen Querelen mit der Führung in den vorzeitigen Ruhestand gegangen.
Die beiden Parteien studierten sich gegenseitig.
Mats Nygard machte mit seinen wachen hellbraunen Augen einen intelligenten Eindruck. Seine dunkelblonden Haare trug er nahezu schulterlang. Er wirkte zäh. Hohe Wangenknochen und ein Mephistobart sorgten dafür, dass insbesondere Frauen sich stets an ihn erinnern konnten.
Erik Borg war knapp zwei Meter groß und von robustem Knochenbau. Auch der tadellos sitzende Anzug konnte die ihm innewohnende Urkraft nicht verbergen – sie wirkte wie angeboren. Die blonden Haare trug er deutlich kürzer, ein heller Vollbart verdeckte sein kantiges Kinn.
»Wir würden uns freuen, wenn Sie sich für uns entscheiden und wir zu einem für beide Parteien vorteilhaften Abschluss kommen können«, eröffnete Horne das Gespräch.
»Das werden wir sehen, Mr. Horne.«
5
The Exchange Restaurant
Westmoreland Street
Dublin
Irland
Jan Steiger hatte sich nochmals die Zähne geputzt und ein dezentes Eau de Cologne von Armani aufgetragen. Ein hellblaues Oberhemd zu einem dunkelblauen Jackett, Slacks und ein paar elegante Chelsea Boots komplettierten seine heute besonders gepflegte Erscheinung.
Ja, er war nervös.
Der Saal des bekannten Restaurants war von angenehmem Licht durchflutet. In der Mitte stand ein großer Tisch mit üppigen Blumensträußen in stilvollen Porzellanvasen. An den Wänden hingen antike Landkarten irischer Städte. Steiger identifizierte Cork, Belfast und Limerick. Die Tische trugen feine Tischwäsche und die Kellner Livree.
Steiger saß bereits am Tisch und schaute immer wieder auf seine Sinn UX Automatikuhr.
Mann, du bist zu früh!
Von Meghan keine Spur.
»Wünschen Sie vielleicht einen Aperitif, Sir?«
Er überlegte.
Gestern Abend war schon heftig …
Egal.
»Einen Sherry bitte.«
»Dry, Medium Dry, Cream oder Rich Cream, Sir?«
»Cream, bitte.«
»Sehr wohl.«
Steiger sah sich um und ließ die Umgebung auf sich wirken. Ein junges Paar saß am Nachbartisch, die meisten anderen Gäste waren vermutlich Geschäftsleute.
Die Uhr zeigte zwanzig nach eins.
Dann endlich betrat Meghan den Raum. Ein Blickfang. Ihre langen roten Haare wehten offen. Den Mantel hatte sie locker über den Arm geworfen. Sie trug eine Bluse und darüber einen grauen Pullover mit V-Ausschnitt.
Kaschmir, dachte Steiger.
Um ihren Hals entdeckte Steiger einen goldenen Anhänger mit einer kleinen Harfe18.
»Oh Jan, bitte entschuldige die Verspätung! Es tut mir wahnsinnig leid.«
Steiger erhob sich. »Hallo Meg, schön dich zu sehen, ich bin auch gerade erst gekommen«, log Steiger und umarmte seinen Schwarm.
Sie küsste ihn auf die Wange.
Sie sieht hinreißend aus. Ich atme ihr Parfum.
»Da bin ich ja beruhigt, wir hatten noch ein spontanes Dozentenmeeting. Es war wichtig, wir besprechen gerade die Syllabus für das nächste Semester.«
»Hey – gar kein Problem!«
Sie wirkt etwas abgehetzt, aber gut gelaunt.
Ein Kellner erschien wie auf Knopfdruck, nahm den Mantel entgegen und überreichte zwei Menükarten, eine Weinliste sowie den bestellten Sherry.
Meghan fixierte Steiger über die Menükarte hinweg und fragte keck: »Ein Sherry, du bist doch schon länger hier, nicht?«
»Ähm, fünf Minuten, maximal!«
Sie lächelte und schüttelte langsam den Kopf. »Na gut, wie komme ich denn zu der Ehre, dass du mich in dieses außergewöhnliche Lokal entführst?«
»Ganz einfach, ich …«
Weiter kam er nicht.
»Ich habe übrigens etwas, das ich dir zuerst erzählen muss!«, fiel ihm Meghan ins Wort. »Eigentlich ist es eine Überraschung.«
»Eine Überraschung? Na, da bin ich ja mal gespannt.« Steiger blieb souverän. Er setzte ein neugieriges Lächeln auf.
Meghan machte ein verheißungsvolles Gesicht. Steiger glaubte, eine leichte Rötung auf ihren Wangen festgestellt zu haben. »Ich möchte dir später noch jemanden vorstellen.«
Sie hatte die Worte kaum ausgesprochen, da spürte Steiger, wie sich ein flaues Gefühl in seinem Magen ausbreitete.
Jemanden?
»Aha … so? Nun … gut.«
»Ja, jemand ganz Besonderes.«
»Soso?« In Steigers Kopf schrillten sämtliche Alarmglocken.
Einen älteren Professor, ihren Doktorvater, oder vielleicht einen harmlosen Kollegen, versuchte er, sich zu beruhigen.
»Weißt du, Jan, es gibt kaum einen Menschen auf der Welt, der mich so gut kennt wie du und dem ich derart vertraue.«
»Hm. Wir sind wirklich schon sehr lange befreundet …« Steiger war wie gelähmt. In seinem Bauch zog sich alles zusammen.
»Ich habe jemanden kennengelernt, Jan. Ich glaube, ich bin verliebt!«
Verdammte Axt!
»So? Ähm, na das ist … also das ist doch toll, Meghan. Ich freue mich für dich …«
Heuchler!
»Ja? Das ist lieb von dir. Er holt mich nachher ab, weißt du, vielleicht können wir noch etwas trinken gehen, er …«
»Seit wann kennst du ihn?«
Die Frage kam schnell, mechanisch, fast kalt. Doch Meghan bemerkte in ihrer Euphorie nichts.
»Seit fünf Wochen. Ich habe ihn auf einer Party meiner besten Freundin, du kennst ja Deirdre, getroffen.«
»Ja. Verstehe. Und, ähm, was macht er so?«
»Er ist, also das ist echt interessant, er ist Weinhändler. Stell dir das vor!«
»Weinhändler?« Steiger war jetzt völlig neben der Spur.
»Ja, aber im großen Stil. Seine Mutter ist Italienerin und sein Vater Engländer. Der Papa sitzt für die Tories im Parlament, kannst du’s glauben? Na ja, aber er ist nicht so steif wie sein Vater, er schlägt eher nach seiner Mutter. Ihre Familie besitzt Weingüter in der Toskana, spannend, nicht?« Meghan lachte.
»In der Tat!« Steigers Welt brach gerade langsam in sich zusammen. Verzweifelt versuchte er, sich nichts anmerken zu lassen.
Meghan schwärmte weiter: »Er ist kultiviert, charmant – und sehr sportlich. Er spielt Cricket!«
Cricket? Steiger machte innerlich ein schmerzverzerrtes Gesicht.
»Du wirst ihn mögen, da bin ich mir sicher. Politisch ist er eher liberal, aber so sind die Italiener halt.« Meghan lachte. Sie hatte offensichtlich nicht die leiseste Ahnung, was gerade in Steiger vorging. »Er heißt übrigens Fabio!«
Von da an ging es steil bergab. Meghan erzählte nun begeistert über den geplanten Urlaub mit Fabio. Natürlich in Italien. Ihre Muscheln verspeiste Meghan im Nu, während Steiger lieblos an seinem Cordon bleu herumsäbelte.
»Was machst du für ein Gesicht, Jan? Ist etwas nicht in Ordnung?«
»Wie? Nein alles bestens, ich freue mich wirklich sehr für dich, ähm, euch! Nur muss ich, also, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, ich muss leider schon früher zurück nach Deutschland. Dienstlich hat sich kurzfristig etwas ergeben, weißt du.«
»Och Jan, jetzt bist du gerade mal vierundzwanzig Stunden im Land, und da musst du schon wieder los?«
»Du hast ja recht, Meg, aber du kennst ja das mit dem Dienst.«
Sie zog eine Grimasse. »Ja, du bist Soldat, ich weiß. Für mich wäre das nichts.«
Das Essen war schnell beendet. Sie hatten gerade ihre Jacken angezogen, als ein Mann in einem gutsitzenden Nadelstreifenanzug erschien. Die gepflegten schwarzen Haare berührten fast seine Schultern.
»Meghan, Dear, wie schön, dich zu sehen!«
Die Worte schmerzten.
Fabio und Meghan umarmten sich innig. Ihr Kuss war länger, als es sich Steigers Auffassung nach in der Öffentlichkeit ziemte. Seine Augen verengten sich. Konzentriert durchleuchteten sie den Eindringling. Steiger registrierte jedes Detail.
Der Kerl war selbstbewusst. Insbesondere, was den Umgang mit Frauen betraf. Souveränes Auftreten. Teure Klamotten. Brauner Gürtel, braune Schuhe. Rahmengenähte Allen Edmonds. Der Siegelring verkündete Oxford. Das feine Tuch in der Westentasche hatte Paisleymuster. Paul Smith? Unsportlich sah er auch nicht gerade aus. Auch wenn er nur Cricket spielte. Im Geiste schniefte Steiger verächtlich.
»Fabio, darf ich vorstellen, das ist …«
»Hey – du must Jan sein! Habe schon viel von dir gehört! Fabio, angenehm!« Das Lächeln entblößte eine Reihe makelloser weißer Zähne. Fabio streckte ihm seine Hand entgegen.
Manikürte Fingernägel, ich glaub’s nicht …
An seinem linken Handgelenk prangte eine Bulgari Octo. Steiger gab ihm die Hand etwas fester als normal, er hätte sie ihm gerne gebrochen. Oder das Handgelenk. Oder beides. Er hätte den Kerl auch mit einem Hieb bewusstlos schlagen und durchs Fenster schmeißen können. Aber das half wohl jetzt auch nichts mehr.
»Hallo! Jan, sehr angenehm.«
Sein Gegenüber schien die innere Ablehnung sofort zu spüren. »Jetzt, wo ich Meghans besten Freund kennengelernt habe, können wir zusammen doch etwas trinken gehen, nicht? Im Kehoe’s sitzt man gut, um diese Zeit dürfte sich ein angenehmes Publikum dort herumtreiben.« Fabios Augen funkelten teuflisch.
Meghan stimmte begeistert zu. »Oh ja, das Kehoe’s ist cool! Komm doch noch mit, Jan! Bitte, mir zuliebe …«
»Du Meghan, ich würde ja gerne, aber ich hatte mich noch bei Patrick angekündigt, ich muss dann auch schon wieder fliegen. Ich nehme die 22:00 Uhr Maschine. Es tut mir so leid, vielleicht ein anderes Mal?«
Meghan setzte einen Schmollmund auf. »Können wir dich wenigstens zum Flughafen bringen?«
»Das ist wirklich überhaupt kein Problem!«, bestätigte Fabio.
»Das ist nett, aber macht euch keine Umstände, Patrick hat das schon klargemacht.« Steiger lächelte, so gut es ging.
Die Verabschiedung war herzlich. Zum Schluss drückte ihm Meghan einen dicken Kuss auf die Wange.
Als Fabio ihm die Hand zum Abschied reichte, konnte Steiger ein diskretes Lächeln in dessen Gesicht ausmachen, welches eindeutig Triumph widerspiegelte. Routiniert führte Fabio Meghan die Treppen herunter zum geparkten Wagen, einem dunkelgrünen Bentley Continental GT.
Steiger sah den beiden nach.
Toller Tag.
Er konnte sich nicht einmal für Meghan freuen. Der Typ war ein Armleuchter. Ein privilegierter. Beides nervte. Aber wenn er ganz ehrlich war, musste Steiger zugeben, der Kerl hatte was. Das war das Problem.
In trübe Gedanken versunken warf Steiger seinen Kurzmantel über und schlenderte die Straße entlang. Er spekulierte auf ein Taxi, um sich zu seinem Kumpel Patrick Murphy fahren zu lassen. Doch es wollte partout keins auftauchen. Stattdessen fing es an, zu regnen. Erst leicht, aber nach ein paar Minuten schüttete es wie aus Eimern. Der Regen lief ihm in den Kragen. Innerhalb von Minuten war er komplett durchnässt.
Doch das machte jetzt auch nichts mehr. Der heutige Abend konnte ohnehin nur auf eine Weise enden. Gott sei Dank mangelte es in Irland nicht an gutem Whiskey.
6
Cabot Square
Canary Wharf, East London
England
»Können wir Ihnen etwas anbieten, eine Tasse Tee oder vielleicht Kaffee?«
»Wasser, bitte!«
Während MacLean nach einer Karaffe mit Mineralwasser griff, nahm Jeremy Horne den Gesprächsfaden wieder auf: »Wir haben verstanden, dass Sie besondere Wünsche haben, die, sagen wir, von den üblichen Gepflogenheiten in unserem Geschäft etwas abweichen.« Sein Ton war sachlich, entbehrte jedoch nicht einer gewissen Bestimmtheit.
»Wenn Sie das so sehen wollen.«
Horne blickte kurz zu Buxton herüber und fuhr dann fort: »Ihren Angaben zufolge würden die Männer nicht für einen staatlichen Akteur arbeiten. Vielmehr sind die Auftraggeber Privatiers, die sich wiederum für einzelne Individuen interessieren. Ist das so in etwa richtig?«
»Das ist korrekt. Wir würden es aber bevorzugen, nicht weiter ins Detail zu gehen.«
Horne wirkte darüber etwas unzufrieden, gab sich aber jovial. »Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Uns ist klar, dass unsere Leute weniger in einer beratenden Funktion tätig werden, sondern eine, sagen wir, aktivere Rolle spielen sollen. Es ist nur so, dass wir schon gerne wüssten, inwieweit diese Rolle möglicherweise den Interessen Großbritanniens …« Er kam nicht dazu, den Satz zu beenden.
»Wir denken nicht, dass die Funktionen, die Ihre Männer ausüben sollen, den Interessen des Vereinigten Königreiches zuwiderlaufen. Im Fall einer Übernahme wären sie ohnehin unsere Männer«, erwiderte Nygard. Seine Aussage hatte etwas Definitives.
»Das möchten wir gerne glauben. Dafür müssten wir allerdings weitere Angaben bezüglich des Auftrags bekommen«, insistierte Buxton. »Wenn Sie beispielsweise Operateure zur Sicherung einer geheimen Bohrinselplattform benötigen, dann ist das so und wir fragen auch nicht weiter nach.«
»Meine sehr verehrten Herren, mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen«, blieb Nygard hart. »Wenn Sie das nicht akzeptieren können, ist jede weitere Verhandlung reine Zeitverschwendung.« Er stand auf und wandte sich an seinen Kollegen: »Erik?«
Horne schaltete sofort. »Nicht doch, Sie können mir glauben, selbstverständlich verstehen wir Sinn und Zweck von Geheimhaltung und Vertraulichkeit. Bitte haben Sie nur Verständnis, dass wir hier gesetzlichen Normen unterliegen …«
»… die im Vereinigten Königreich recht liberal formuliert sind«, wandte Nygard ein.
»Also gut.« Jeremy Horne schien entschlossen, den Auftrag um jeden Preis an Land zu ziehen. »Ich bin mir sicher, dass wir das haben, was Sie benötigen. Lediglich was die Zahlungsmodalitäten betrifft, würden wir uns gerne noch einmal rückversichern.«
Bingo, dachte Nygard.
Borg ergriff das Wort, nachdem er eine dünne lederne Aktentasche vor sich auf den Tisch gelegt hatte. »Auch wir würden uns freuen, wenn es zu einer Einigung zwischen uns käme. Wir benötigen zwölf Operateure, echte Shooter mit maritimem Spezialkräfte-Hintergrund.«
»Darauf sind wir spezialisiert«, entgegnete Horne mit einer Mischung aus Stolz und leichter Vermessenheit.
Borg fuhr fort: »Wir wissen, dass alle maritimen Spezialeinheiten die klassische Kampfschwimmerrolle in ihrer Ausbildung praktizieren. Wir wünschen aber, dass mindestens vier der Männer noch kürzlich mit solchen Aufgaben betraut waren. Diese vier müssen absolut up to date sein.«
Horne nickte. »In Ordnung.«
»Wir akzeptieren ausschließlich Veteranen. Jeder muss an mehreren Kommandoeinsätzen teilgenommen haben. Die Altersgrenze liegt bei maximal achtunddreißig Jahren und wir nehmen nur Unteroffiziere, keine Offiziere.«
»Verstanden. Was weiter?« Horne war von den sehr konkreten Forderungen seiner Klienten unmerklich etwas überrascht.
»Etwas Wichtiges: Wir nehmen die Auslese vor. Wir haben das Recht, jeden Mann ohne Angabe von Gründen abzulehnen. Das Honorar ist für jeden Einzelnen siebenstellig. Für Ihre Firma gibt es eine Ablösesumme bzw. einen Bonus, wie Sie es genannt haben. Den seinerzeit vereinbarten Betrag. Der Auftrag ist naturgemäß geheim, die Gefährdungslage ist hoch. Aus Gründen der operativen Sicherheit werden Einzelheiten den Männern erst nach Projektbeitritt bekanntgegeben. Ich denke, das verhält sich bei anderen Kunden ähnlich. Nach Übernahme der Männer in unsere Dienste wird jedweder Kontakt zu Ihrer Firma gekappt.«
»Und woher wissen wir, dass Sie über die nötigen Mittel verfügen?«, fragte Buxton nach.
Darauf offensichtlich vorbereitet, schob Borg seinem Gegenüber einen Zettel zu. »Rufen Sie die Bank an, deren Name und Nummer sich auf dem Zettel befinden. Das Institut sollte Ihnen gut bekannt sein, da Ihr Unternehmen meines Wissens nach ebenfalls dort Konten unterhält. Man wird Sie nach einem Kennwort fragen. Geben Sie den fünfstelligen Nummern- und Buchstabencode an, dann werden Sie mit einem Prokuristen namens Henri Meurteuille verbunden. Monsieur Meurteuille wird Ihnen bestätigen, dass sich fünf Millionen Pfund bereits auf einem Konto befinden, zu dem ausschließlich Ihre Firma Zugang hat – sobald wir Ihnen den dazugehörigen Code aushändigen.«
»Also Zahlung per Akkreditiv?«, fragte Horne.
»Besser noch, Sie haben Zugriff auf ein Drittel des Geldes, bevor Sie die eigentliche Leistung erbringen.«
»Timeo Danaos et dona ferentes!19«, fiel Horne dazu scherzhaft ein.
Nygard lächelte. »Das brauchen Sie nicht, solange Sie nicht versuchen, uns zu übervorteilen.«
Soso, Latein verstehst du also auch, warst bestimmt auf einer Privatschule, Bürschchen, dachte Horne und blickte vorsichtig zu seinem Partner Buxton herüber. Der zuckte nahezu unmerklich mit den Schultern. Daraufhin nickte Horne MacLean zu. »Jim, überprüfe das bitte.«
MacLean nahm den Zettel an sich und verließ den Raum.
Zu seinen skandinavischen Gästen gewandt, erklärte Horne: »Jim hat zwar auch einen militärischen Hintergrund, aber er verfügt über einen MBA der London School of Economics.«
Nygard nickte darüber etwas gelangweilt.
»Wenn Sie die Frage gestatten, weshalb wollen unbedingt Sie das Personal auswählen?«, wollte Buxton wissen. »Wenn Sie uns in die Rahmenbedingungen des Auftrags einweihen, stellen wir Ihnen ein maßgeschneidertes Team zusammen, das Sie garantiert nicht enttäuschen wird.«
»Wir haben unsere Gründe und auch dieser Punkt ist für uns nicht verhandelbar«, stellte Borg nüchtern fest.
»Schauen Sie, wir wissen in der Regel immer, mit wem wir es zu tun haben«, befand Horne. »Wir kennen Sie nicht. Die Empfehlung aus der Schweiz war nicht besonders, wie soll ich es ausdrücken, wertig?«
»Es ist nicht nötig, dass Sie unsere Auftraggeber kennen. Wir arbeiten für vermögende Personen, die es bevorzugen, keine Fragen zu beantworten. Haben wir so eine Vertragsgrundlage?«
Horne zögerte, dann legte er beide Hände auf den Tisch und fixierte Nygard. »Nein meine Herren, ich fürchte, die haben wir nicht.«
Zum ersten Mal zeigten die beiden Gäste eine Gefühlsregung: Sie waren sichtlich überrascht. Buxton beobachtete die Skandinavier und schwieg.
Borg fragte: »Wie dürfen wir das verstehen?«