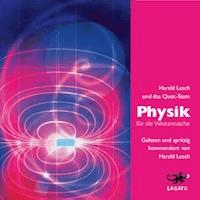Kapitel 1
Die Krisen derGegenwart
»Unsere Zeit«, die Gegenwart, ist wie keine andere von ökologischen Krisen gezeichnet. Schon vor der Corona-Krise, und vermutlich noch lange nach ihr, dominiert das Wort »Krise« die täglichen Nachrichten.
Laut Wikipedia bezeichnet eine Krise im Allgemeinen einen Höhepunkt oder Wendepunkt einer gefährlichen Konfliktentwicklung in einem natürlichen oder sozialen System, dem eine massive und problematische Funktionsstörung über einen gewissen Zeitraum vorausging, die eher kürzer als länger andauert. Die mit dem Wendepunkt verknüpfte Entscheidungssituation bietet in der Regel sowohl die Chance zur Lösung der Konflikte als auch die Möglichkeit zu deren Verschärfung. Dass es sich hierbei um einen Wendepunkt handelt, kann jedoch oft erst festgestellt werden, nachdem die Krise abgewendet oder beendet wurde. Nimmt die Entwicklung hingegen einen dauerhaft negativen Verlauf, so spricht man von einer Katastrophe.
So weit, so gut. Dann machen wir doch mal einen Spaziergang durch das Gruselkabinett moderner Gesellschaften, die sich so sicher sind, dass alles immer verfügbar ist: Energie, Materie und Umwelt.
Die Krise der Energie
Im Westen, in den industrialisierten Gesellschaften, die am deutlichsten von der Globalisierung profitieren, sind wir Meister darin, ökologische Katastrophen zu verdrängen. Das fällt uns (noch) leicht, denn wir lösen die Katastrophen mit unserem Lebensstil woanders aus. Dieses »Woanders« ist meistens weit weg, irgendwo in Afrika, Südamerika oder Asien. Manchmal auch auf den Ozeanen zwischen den Kontinenten. Wie wir das tun? Nun, indem wir mit unserem Lebensstil in einem Ausmaß Energie verbrauchen, wie man es sich kaum vorzustellen vermag. Nur um mal einen Eindruck zu gewinnen: Wer auf einem Fahrradergometer zehn Stunden lang 100 Watt gestrampelt hat, hat gerade einmal eine Kilowattstunde an Energie freigesetzt. Die Deutschen verbrauchen jeden Tag und pro Person aber über 100 Kilowattstunden an Energie!
In dieser Energiemenge steckt alles, was wir tun: wie wir heizen, wie wir uns bewegen, wie wir kommunizieren, die Industrieproduktion, alles. Unsere Art des Wohnens, Essens, Trinkens und Reisens macht »Energiesklaven« nötig. Denn diese Energiemenge holen wir aus Kohle, Öl und Gas, inzwischen auch aus Sonne, Wind und Biomasse. Letztere Energiequellen sind heimisch, die Anlagen stehen bei uns im Land. Aber die fossilen Ressourcen, die holen wir aus der ganzen Welt zu uns. Diese fossilen Ressourcen sind vor rund 300 Millionen Jahren entstanden, in den Erdzeitaltern Karbon und Perm, durch Ablagerung und Pressung der Biomasse (alles, was damals gelebt hat) im Erdboden. Im Vergleich dazu ist es atemberaubend, wie schnell wir den gespeicherten Kohlenstoff, den wir seit rund 200 Jahren aus dem Boden wieder herausholen, verbrauchen: Wofür die Natur über eine Million Jahre zur Herstellung gebraucht hat, das verbrauchen wir in einem einzigen Jahr. Unser Energiehunger ist enorm, angefacht zu Lande, zu Wasser und in der Luft durch unsere Mobilität, Produktivität und ein sich stetig hebendes Wohlstandslevel. Seit Jahrzehnten gibt es keine Einschränkungen mehr im Energieangebot, deshalb verbrauchen wir ungebremst und unreflektiert immer mehr.
Hätten wir seit 1973 jedes Jahr eine Ölkrise mit mehreren autofreien Sonntagen erlebt, dann wären unsere Autos heute sicher deutlich leichter, kleiner und insgesamt sparsamer – vielleicht hätten wir sogar weniger. Allein die Vorstellung, Mitte der siebziger Jahre hätte mehr als ein Fünftel aller Pkw-Neuzulassungen aus riesigen allradgetriebenen Luxuslimousinen (SUVs) bestanden, wäre angesichts der damaligen Ölpreise nachgerade unvorstellbar.
Es ist also gerade die scheinbar grenzenlose Verfügbarkeit der Ressourcen, die unseren Energieverbrauch immer weiter hat anwachsen lassen. Man könnte es zugespitzt auch so formulieren: Wir haben Energie-Adipositas, wir sind energetisch »verfettet«. Als Physiker kann ich mir eine kleine Rechnung nicht verkneifen: Bei einem ungebremsten Energiewachstum von vier Prozent jährlich (wie bisher, vor der Corona-Pandemie) und dem derzeitigen Energieumsatz von zehn Billionen Watt (1013) – der Gesamtenergieverbrauch der Menschheit geteilt durch die Anzahl der Sekunden eines Jahres –, wird es nur rund 800 Jahre dauern, bis die Leuchtkraft der Sonne (1026 Watt) erreicht sein wird. Das ist natürlich physikalisch unmöglich, aber es zeigt unseren Energiehunger.
Dabei sind die wirklich großen Menschenmengen bis jetzt noch gar nicht an der globalen Energieorgie beteiligt. Indien und China liegen pro Kopf noch bei etwa 30 beziehungsweise 70 Kilowattstunden pro Tag und pro Person. Wenn diese beiden Länder einmal den westlichen Lebensstil praktizieren, dann werden globale Wachstumsraten von vier Prozent pro Jahr weit überschritten.
Obwohl also die Aussichten wirklich bedrückend sind, hat man seit Längerem nichts mehr von der Energiekrise gehört. In Deutschland hat sich trotz intensiver technischer Entwicklungen, Optimierungen und Effizienzsteigerungen der sogenannte Endenergieverbrauch seit 30 Jahren nicht mehr verringert. Die Geräte, Maschinen, Strukturen werden zwar immer sparsamer, aber wir setzen dafür immer mehr davon ein. Letztlich leben wir auf einem dermaßen luxuriösen Energieniveau, dass wir es unter keinen Umständen aufrechterhalten können. Alle, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, wissen das. Niemand macht sich da irgendwelche Illusionen. Wir verbrauchen zu viel Energie. Aber was passiert? Nichts! Die nächste Stufe der Energiekrise, die Katastrophe, ist längst unser normaler Dauerbegleiter geworden. Und über das Normale, das Sowieso, spricht man nicht.
Bei vielen meiner Vorträge und Gespräche zum Thema Energie stellte sich heraus, dass die meisten das Thema Energie überhaupt nicht mit einer kritischen oder gar katastrophalen Entwicklung verbinden. Das wir so viel Energie verbrauchen, wird uns gar nicht klar. Es bedrückt uns nicht, denn wir bezahlen einfach dafür. Energie wird gekauft, vor allem diese besonders hochwertige Form, die elektrische Energie. Und die ist eben da, die kommt aus der Steckdose, immer und zuverlässig, nicht zu viel und nicht zu wenig, in der richtigen Menge und Form, normalerweise als 230-Volt-Wechselspannung, für unsere Herde in unseren Hochleistungsküchen sogar als 400 Volt. Auch unsere Bewegungsenergie, sei es zu Lande, zu Wasser oder in der Luft, kaufen wir ein. Wer Geld besitzt, besitzt auch Energie – so das Prinzip. Deutschland ist reich, kann sich genügend Stoffe leisten, die sich in Bewegungsenergie oder elektrische Energie umwandeln lassen. Und weil das so ist, erkennen wir das Krisenhafte gar nicht. Die obengenannte Kilowattstunde kostet für den Kunden nur 30 Cent. Für zehn Stunden Radeln bei 100 Watt bekämen Sie nur 30 Cent! Wobei das meiste davon Steuern und Abgaben sind. Die Produktion selbst bezahlen wir mit nur wenigen Cent.
Und dann das noch: Seit zwei Jahrzehnten verbrauchen wir mit Computern aller Art immer mehr elektrische Energie. Diese sogenannte Digitalisierung hat sich in sämtlichen Lebensbereichen inzwischen so sehr ausgebreitet, dass sie einen nicht unwesentlichen Teil unseres Energieverbrauches darstellt. Dank des World Wide Web, des sogenannten Internets, sind heute Milliarden Menschen miteinander vernetzt. Und die globalen Kommunikationsströme, soziale Plattformen, digitale Unterhaltungsindustrien und viele andere Anwendungen, Steuerungs- und Kontrolldienstleistungen verbrauchen massenhaft Energie. Eine Studie hat ergeben, dass das Internet im Jahr 2012 4,6 Prozent des weltweiten Stromverbrauchs ausgemacht hat.1 Damit wäre das Internet im internationalen Ländervergleich Platz sechs hinter China, den USA, der EU, Indien und Japan. Das liegt auch daran, dass immer mehr Geräte mit dem Internet verbunden werden. Es gibt smarte Textilien wie Kopfkissen, die vibrieren, wenn Menschen nachts schnarchen, Kühlschrank-Kameras, die erfassen, welche Lebensmittel im Kühlschrank liegen und ob deren Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist, oder eine vernetzte Kaffeetasse, die die Temperatur von Getränken misst und sie gegebenenfalls warm hält. Seit 2018 gibt es sogar eine Dusche mit Sprachassistent. Durch dieses sogenannte Internet of Things rechnen Experten mit einem Mehrenergieaufwand von 70 Terawattstunden pro Jahr in der EU.2 Das sind mehr als zehn Prozent der derzeitigen Bruttostromerzeugung in Deutschland und mehr Strom, als Deutschland gerade mit Wind- und Solarkraft erzeugt.
Den meisten Strom verbrauchen in den letzten Jahren aber Videostreaming-Angebote. Sie erzeugen einen immensen Datenverkehr. Bei einer Stunde Netflix mit Full-HD-Auflösung werden etwa drei Gigabyte Daten übertragen – eine 30-Watt-Lampe kann mit der dafür benötigten elektrischen Energie circa 36 Minuten brennen. Dazu kommt natürlich noch der Verbrauch des Laptops, Computers oder Fernsehers und gegebenenfalls eines Bildschirms. Die allgemeine Erwartung ist, dass die immer intensivere Digitalisierung in vielen Ländern den Verbrauch an elektrischer Energie drastisch erhöhen wird.
Nur dann, wenn es weltweit gelingt, den Energieverbrauch so schnell wie möglichst vollständig durch erneuerbare Energiequellen zu decken, führt dieser Energiehunger nicht zur Katastrophe einer massiven Erhitzung des Klimas. Allerdings sind wir sogar im hochentwickelten, reichen Deutschland weit davon entfernt, unseren Primärenergiebedarf durch erneuerbare Energien zu decken. In Zahlen ist es weniger als ein Fünftel, den Rest besorgen fossile Quellen und die Kernenergie. Man kann sich leicht vorstellen, wie schwer es für ärmere Länder sein wird, die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erfüllen.
Die Krise der Materie
Dass die Ressourcen auf der Erde begrenzt sind, wurde von einer breiten Öffentlichkeit erstmals 1972 durch einen aufrüttelnden Bericht wahrgenommen. Damals erschien im Auftrag des Expertengremiums »Club of Rome« die Studie Die Grenzen des Wachstums, die zeigte, wie die Menschheit die Umwelt überfordert. Seitdem ist die Diskussion um die Endlichkeit von Rohstoffen und die fatalen Folgen der Umweltzerstörung nicht mehr abgeebbt – und trotzdem steigt unser Rohstoffverbrauch immer noch stetig an.
Ein Forscherteam vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) in Leipzig hat sich genauer angesehen, wie es derzeit um die Verfügbarkeit der wichtigsten Ressourcen auf der Erde steht. Neben den Klassikern Kohle, Erdöl und Erdgas untersuchten die Forscher vor allem erneuerbare Ressourcen. Mit dabei: die Milch- und Fleischproduktion, der Fischfang, die Ernten bei Getreide und Gemüse, das Grundwasser. Hinzu kamen in der Betrachtung unter anderem die Entwicklung der Fläche an Ackerland, der Einsatz von Dünger, die Siedlungsdichte, das Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum. Insgesamt betrachteten die Forscher die Daten von 27 Ressourcen, die zentral für das Überleben unserer Gesellschaften sind. Das Ergebnis der Berechnungen, in die Zahlen aus zahlreichen nationalen und internationalen Datenbanken einflossen: 21 der betrachteten Ressourcen haben ihren Peak schon überschritten.
Überraschend ist, dass dies nicht bei den fossilen Energieträgern eingetreten ist, sondern vor allem bei Ressourcen, die mit der Produktion von Nahrungsmitteln zu tun haben und die als »erneuerbar« gelten. »Peak« bedeutet in diesem Fall nicht unbedingt, dass zum Beispiel die Fläche an Ackerland in Zukunft abnimmt, sondern dass neue Flächen nicht mehr in der Größe und Geschwindigkeit erschlossen werden wie früher. Sprich: Wachstum gibt es durchaus noch, allerdings ist es gebremst und schwächer als früher. Manchmal herrscht auch Stagnation, wie bei den Anbauflächen für Weizen oder Reis. Beinahe unheimlich ist, dass bis auf die Fläche von Ackerland (die schon 1950 ihren Wachstumshorizont erreichte) alle Peaks mit großer Wahrscheinlichkeit um das Jahr 2006 herum aufgetreten sind. Die Grenzen des Wachstums haben aber keineswegs nur die Länder des globalen Südens überschritten. Auch in Großbritannien beispielsweise nimmt der Ertrag in der Landwirtschaft pro Hektar ab, weil die Böden durch Jahrhunderte immer intensiverer Landwirtschaft ausgelaugt sind.
Der US-Umweltforscher Lester Brown hat in seinem Buch Voller Planet, leere Teller dargelegt, wie Ackerflächen und sauberes Wasser weltweit knapper werden. Eine Erklärung für die beobachteten Peaks könnte sein, dass sich auch das Bevölkerungswachstum global abgeschwächt hat. Allerdings führen Wirtschaftswachstum und steigender Konsum in Schwellenländern dazu, dass trotz eines geringeren Bevölkerungswachstums die Nachfrage nach Lebensmitteln, Energie und Ressourcen unvermindert steigt.
Zwar ist theoretisch jede Ressource ersetzbar: Wenn das Öl zu Ende geht, könnten Autos zum Beispiel auch mit Erdgas fahren, fehlt der Stahl, kann man Autos auch aus Carbon bauen. In der Biologie stimme das aber nicht, so die Studie. Man könne etwa die Gesamtmenge an Getreide nicht einfach durch Reis ersetzen – das liegt alleine schon wegen der unterschiedlichen klimatischen Anbaubedingungen auf der Hand. Jeder einzelne Rohstoff muss also in einem nachhaltigen Gleichgewicht gelassen werden, wenn auch noch unsere Nachfahren genug Nahrung haben sollen.
Da die Anzahl der Menschen und ihre Nachfrage nach Lebensmitteln schneller wächst als die Ernten, Fischfänge und Ackerfläche, könnte man sich fragen, warum es heute trotzdem weniger Hunger auf der Welt gibt als vor zwanzig Jahren. Offenbar geht die Menschheit mit den Ressourcen, die sie gewinnt, effizienter um. Es gehen heute weniger Nahrungsmittel bereits vor dem Konsum verloren. In der Tat ist das eine der Hoffnungen für die Zukunft. Zwar sind die Möglichkeiten für weiteres Wachstum begrenzt, wenn aber zum Beispiel die Verschwendung von Lebensmitteln reduziert wird, kann am Ende die auf den Tellern verfügbare Menge an Lebensmitteln noch um einiges steigen. Rund ein Drittel der Nahrungsmittel gehen heute zwischen Feld und Verkauf verloren oder landen bei den Verbrauchern im Müll.
An einer sehr wichtigen anderen Ressource lässt sich das Krisenhafte der Materieverfügbarkeit leicht ablesen: Denken wir mal über Trinkwasser nach!
Wir in Deutschland können uns kaum vorstellen, was es bedeutet, wenn Wasser zum Luxusgut wird. Bei uns ist Wasser zum Trinken immer da. Wenn keine Flaschen im Haus sind, dann drehen wir eben den Wasserhahn auf. In anderen Ländern sieht das völlig anders aus. Der Thinktank »World Resource Institute« (WRI) hat untersucht, wie es um die Wasserressourcen in 189 Staaten steht, und dazu Daten aus den Jahren von 1960 bis 2014 ausgewertet. Laut ihrer Studie lebt ein Viertel der Weltbevölkerung in Regionen, denen Wassermangel droht. Besonders stark betroffen sind demnach Staaten im Nahen Osten und Nordafrika, in denen es ohnehin sehr trocken ist. Am schlimmsten ist die Lage in Katar, Israel und im Libanon. Insgesamt leiden 17 Staaten an extrem hohem Wasserstress. Die Forscher verglichen, wie viel Wasser genutzt wird und wie viel nachkommt. In den am stärksten betroffenen Ländern beanspruchen Landwirtschaft, Industrie und Gemeinden jährlich mindestens 80 Prozent des zur Verfügung stehenden Wassers. Gibt es in diesen Regionen zusätzliche Dürren, kommen die Reserven an ihre Grenzen, warnt das WRI. Besondere Sorge bereiten den Forschern die knappen Wasserreserven in Indien. Mit 1,3 Milliarden Einwohnern hat der Staat mehr als dreimal mehr Einwohner als die restlichen 16 Staaten mit extrem hohem Wasserstress zusammen. Und da Dürren durch die Klimakrise weiter zunehmen, könnten Nachrichten über Wassermangel künftig noch häufiger werden.
Zu den Staaten mit extrem hohem Wasserstress kommen noch weitere Staaten mit »lediglich« hohem Risiko hinzu. Dort werden jährlich zwischen 40 und 80 Prozent der verfügbaren Wasserressourcen entnommen. Insgesamt lebt damit sogar ein Drittel der Weltbevölkerung in Gegenden mit extrem hohem oder hohem Wasserstress. Deutschland landet im Ranking übrigens in der mittleren Kategorie auf Platz 62. Hierzulande werden laut der Studie 20 bis 40 Prozent der Wasserreserven genutzt. Allerdings gibt es auch Regionen in Deutschland, in denen der Wasserstress hoch ist. Das betrifft einen breiten Streifen, der sich von Norden über Bremen, Hannover, Leipzig und Stuttgart nach Süden zieht.
In den nächsten Jahrzehnten wird sich die Lage noch verschärfen, denn in den letzten 50 Jahren hat sich die entnommene Grundwassermenge mehr als verdoppelt. In Anbetracht der wachsenden Weltbevölkerung und des zunehmenden Wohlstands gibt es keinen Grund anzunehmen, dass der Wasserbedarf in den nächsten Jahren wieder sinkt, ganz im Gegenteil.
Sogar auf elementarem Level kann man unseren gefährlichen Rohstoffhunger beobachten, etwa beim Phosphor. Phosphor ist eine wichtige Grundlage allen irdischen Lebens. Ohne Phosphor funktioniert kein biologischer Organismus, keine Zelle, keine Pflanze, kein Tier, und es ist ein entscheidender Bestandteil in Pflanzendüngern. Für Phosphor gibt es keine Alternative. Es ist ein echtes chemisches Element und lässt sich durch nichts ersetzen oder reproduzieren. Gewonnen wird es aus Mineralien wie Apatit. Etwa 160 Millionen Tonnen Phosphat werden im Moment auf der Welt pro Jahr abgebaut. Die weltweiten Vorräte würden theoretisch etwa 100 Jahre reichen, wenn man beim heutigen Verbrauch bliebe. Doch Phosphatdünger dürfte schon schneller, in rund 20 Jahren, knapp werden. Grund dafür ist, dass der geförderte Phosphor zunehmend an Qualität verliert, es also aufwendiger und damit teurer wird, ihn von Verunreinigungen zu befreien. Mit der wachsenden Weltbevölkerung und dem steigenden Nahrungsbedarf wird zudem die Nachfrage nach Phosphor steigen.
Gewaltige Düngemittelmengen ermöglichten erst die Bevölkerungsexplosion der letzten Jahrzehnte und den Wohlstand in den Industrienationen. Weltweit erzielt die Landwirtschaft nur durch den intensiven Einsatz von Phosphatdüngern die notwendigen Ernteerträge für die knapp acht Milliarden Menschen, die inzwischen auf der Erde leben. Aber durch maßlose Verschwendung von Düngemitteln und vielen Alltagsprodukten landen große Mengen Phosphor unwiederbringlich in den Ozeanen. Heute werden etwa 80 Prozent des geförderten Phosphors zu Düngemitteln verarbeitet, doch es entstehen auch neue Konkurrenzen dort, wo man Phosphor anders nutzen und einsetzen kann, wie beispielsweise zur Herstellung von Batterien für Elektroautos.
Die weltweiten Konsequenzen der bevorstehenden Phosphorverknappung sind leicht prognostizierbar: Die Preise für Düngemittel werden explodieren und dadurch die Getreideproduktion massiv verteuern. Lebensmittel werden zum Luxusartikel. Es scheint nur eine sinnvolle Strategie zu geben, um dem drohenden Phosphatmangel zu begegnen: Gerade dort, wo keine natürlichen Phosphatgesteine vorhanden sind, werden Recycling und Einsparen immer wichtiger. Der lebenswichtige Rohstoff fällt in hohen Mengen im Abwasser an, denn Tier und Mensch scheiden Phosphor aus. Mit neuen, modernen Methoden kann man bis zu 90 Prozent des Phosphors aus dem Abwasser und Klärschlamm zurückgewinnen. Gerade in Ländern mit intensiver Landwirtschaft und Tierhaltung wird ein regelrechter Phosphatüberschuss produziert – in Form von Gülle. Und die Recyclingverfahren von Phosphor sind bekannt und funktionieren gut.
So könnte man immer weiter machen, mit vielen anderen Rohstoffen, Elementen und Materialien. Fast alle unsere Nutz- und Versorgungskreisläufe sind »auf Kante genäht« und verdrängen die grundlegende Tatsache, dass von allem nur endlich viel da ist. Und je geringer die Reserven werden, umso schwerer wird es, sie zu heben, zu bergen, an die Oberfläche zu bringen.
Schon im Jahr 2010 fragte Andrew Revkin, Umweltjournalist bei der New York Times: »Was kommt zuerst: Peak-Alles oder Peak-Wir?« Es ging ihm um die Frage, ob der Ressourcenverbrauch der Menschheit und die damit einhergehende Umweltzerstörung erst aufhören zu wachsen, wenn die Weltbevölkerung stagniert (was für Mitte dieses Jahrtausends vorhergesagt wird), oder ob wir unseren Ressourcenhunger schon vorher irgendwie in den Griff kriegen.
Es gibt objektive biologische Grenzen, die den Ressourcenverbrauch begrenzen. Wenn eine Ressource »erneuerbar« ist, bedeutet das noch lange nicht, dass sie unerschöpflich ist. Zwar kann die Menschheit das Wachstum durch neue Technologien wieder beschleunigen oder neue Ressourcen verfügbar machen, zum Beispiel durch neu gezüchtete Getreidesorten, die signifikant höhere Ernten ermöglichen; ähnlich wie neue Technologien immer neue Ölvorkommen erschließen. Die gigantischen Schieferöl-Reservoire in den USA zum Beispiel waren vor zehn Jahren technologisch schlicht unzugänglich. Aber wie die Erdölförderung zeigt, kommen diese Technologien meist mit einem hohen Preis, ökonomisch und ökologisch. Und den Peak selbst machen die neuen Technologien nicht obsolet – aufgeschoben ist nicht aufgehoben.
Die Krise der Materie kann nur dann gelöst werden, wenn Rohstoffe nicht schneller verbraucht werden als sie entstehen. Um dies zu gewährleisten, müssen Kreislaufprozesse zum Normalverfahren werden, die rohstoffschonend, energiesparend und somit über ihre Zeit hinaus nachhaltig wirksam werden, überall auf der Welt. Wir können Rohstoffe nur in dem Maße und in der Geschwindigkeit aus der Umwelt entnehmen, in der sie auch wieder entstehen oder zurückgewonnen werden können. Weil wir davon aber meilenweit entfernt sind und wir unsere materiellen Abfälle stattdessen in alle drei Dimensionen gepumpt haben, rennen wir der Katastrophe entgegen.
Die Krise des Klimas
Kommen wir jetzt zum Elefanten in der Teufelsküche der Katastrophen, dem Klimawandel. Wobei, Wandel klingt so positiv, erinnern Sie sich noch: Wandel durch Annäherung? Brandt und Bahr und die guten alten Zeiten der 60er und 70er des 20. Jahrhunderts. Aber gerade damals wurde der Stoff in die Atmosphäre gepumpt, der uns heute die Erde heiß machen könnte, sie auf jeden Fall gerade global erwärmt. Damals vor über 50 Jahren hätten alle es wissen können und haben es vielleicht sogar gewusst, aber sie haben nichts getan, was uns heute helfen könnte. Das Klima und seine Folgen, das ist die Mutter aller Katastrophen, nicht für die Erde, aber für uns.
Klima gibt es eigentlich gar nicht, es ist eine Erfindung der Statistik. Klima ist das über drei Jahrzehnte gemittelte Wetter. Wie kann eine statistische Größe in eine kritische, ja sogar katastrophale Lage geraten? Eine merkwürdige Situation, dass sich die ganze Welt inzwischen damit auseinandersetzt, wo das doch eigentlich nur ein statistischer Mittelwert ist.
Fangen wir also mal vorne an, am Anfang. Das Klima hat mit dem Wetter zu tun. Wetter ist das atmosphärische Geschehen über unseren Köpfen. Ob es regnet oder schneit, die Sonne scheint, der Wind nur weht oder gar stürmt, das ist das Wetter. Der Volksmund hat sich dafür Bauernregeln ausgedacht, die das Wetter schon einmal über Zeiträume länger als einen Tag beschreiben: »Ist der Mai kühl und nass, füllt’s dem Bauern Scheun und Fass.« Aber auch Begriffe wie die Hundstage im Sommer zwischen Ende Juli und Ende August, die Eisheiligen für die letzten Frostnächte im Frühjahr oder der Siebenschläfer am 27. Juni, der angeblich darüber entscheidet, wie das Wetter in den darauffolgenden sieben Wochen werden wird. Bei all diesen Bezeichnungen werden traditionelle Erfahrungen der Landbevölkerung in Begriffen und Schlagwörtern zusammengefasst.
Der Begriff Klima geht da viel weiter, er bezeichnet das Wetter von Jahrzehnten und beschreibt damit die großräumigen Veränderungen von Wetterereignissen. Klima enthält die Schwankungen des Wetters, die Langzeitperspektive. Und genau hier zeigen sich die für uns Menschen katastrophalen Anzeichen. Wir sind nämlich in unseren Klimazonen im allgemeinen gut an das zwar mit Jahreszeiten wechselnde, aber ansonsten doch eher stabile Wetter angepasst. In Norwegen ist es normalerweise kühler als in Sizilien. In der Sahara regnet es normalerweise weniger als in Großbritannien. Und wenn es in Moskau 20 Grad hat, während es in Madrid schneit, dann kann man das nicht als normales europäisches Wetter bezeichnen. Die moderne Häufung von extremen Wettereignissen wie monatelangen Dürren oder wochenlangen Regenfällen, häufigen Stürmen und starken Temperaturschwankungen innerhalb weniger Tage verweist darauf, dass die Luftströmungen im Austausch zwischen Atmosphäre, Flüssen, Meeren und Kontinenten aus den Fugen geraten zu sein scheinen.
Die Gründe kennen wir inzwischen: Die Steigerung der Konzentration der Gase Kohlendioxid und Methan in der Atmosphäre haben zu einer globalen Erwärmung geführt. Die Temperatur der Erde wird zunächst von der Sonne bestimmt, ihre sichtbare Strahlung erwärmt die Erde. Ohne die Atmosphäre hätte unser Planet trotzdem nur eine Temperatur von ca. minus 18 Grad Celsius. Einige Moleküle in der Atmosphäre verfügen über die Eigenschaft, effizient die Wärmestrahlung der Erdoberfläche zu absorbieren und quasi als Wärmelampe sowohl in den Weltraum als auch zurück auf die Erdoberfläche zu strahlen. Erst durch diesen wärmenden Effekt der Atmosphäre erreicht die Erde im Durchschnitt plus 15 Grad Celsius. Ohne den menschlichen Einfluss auf die atmosphärische Zusammensetzung sind es vor allem der Wasserdampf und das auf natürlichem Wege auftretende Kohlendioxid, die für diese Erwärmung sorgen. Der weitaus größte Teil der Atmosphäre, zu 79 Prozent bestehend aus Stickstoff und zu knapp 21 Prozent aus Sauerstoff, hat mit diesem sogenannten Treibhauseffekt nichts zu tun, denn die Moleküle dieser Elemente absorbieren die Wärmestrahlung nicht. Nur die sehr kleinen Konzentrationen an treibhausaktiven Gasen sind also für die wärmende Wirkung der Atmosphäre verantwortlich.
Leider erhöhen sich diese kleinen Konzentrationen aber stetig, und zwar wegen dem, was wir auf der Erde so treiben. Der menschengemachte Anteil lässt sich heute eindeutig anhand von Kohlenstoffanalysen der Luft beweisen. Er stammt nämlich aus fossilen Ressourcen, also Kohle, Erdöl und Erdgas, die wir für unsere Mobilität, die Industrie, elektrischen Strom, Heizung und anderes seit über 200 Jahren in immer größerer Menge verwenden und verbrennen. Der Kohlenstoff in diesen Stoffen wurde vor vielen Millionen Jahren im Boden als Sediment abgelagert und enthält deshalb keinen radioaktiv zerfallenden Kohlenstoff der Sorte 14C mehr. 14C zerfällt mit einer Halbwertszeit von 5.730 Jahren in Stickstoff. Nach zehn Halbwertszeiten ist davon fast nichts mehr enthalten, nach einigen Millionen Jahren gar nichts mehr. Außerdem stammt der Kohlenstoff in den fossilen Ressourcen aus der Fotosynthese von Pflanzen der Erdurzeit. Und die Fotosynthese, also die Verwandlung von Sonnenlicht, Wasser und Kohlenstoff in Zuckermoleküle und Sauerstoff, bevorzugt das leichteste stabile Kohlenstoffisotop 12C anstelle des ebenfalls stabilen 13C. Mit anderen Worten: Aus den Analysen der Anteile der verschiedenen Kohlenstoffisotope lässt sich ohne jedes Wenn und Aber nachweisen, dass sich die Luftzusammensetzung seit Beginn der Industrialisierung durch die menschliche Verbrennung von Kohle, Öl und Gas drastisch geändert hat und zwar in Richtung deutlich erhöhter Kohlendioxidkonzentrationen. Damit hat sich die Treibhauswirkung der Atmosphäre natürlich verstärkt – mehr »Wärmelampen«-Moleküle ergeben mehr Wärme.
Die katastrophale Perspektive dieser Entwicklung ergibt sich nun leider aus der Kombination des menschengemachten Einflusses auf das Klima und der Reaktionsnetzwerke der Natur. So finden wir heute praktisch alle Bereiche der Natur erheblich und nachhaltig durch die globale Erwärmung beeinflusst, in meist nicht mehr umkehrbaren Veränderungen, die für uns Menschen gar nicht gut aussehen. Ein paar Beispiele:
1. Aufgrund erhöhter Luft- und Wassertemperaturen schrumpfen Eisflächen überall auf der Welt: Arktis und Antarktis sowie Gletscher auf Grönland, im Himalaya, den Anden und den Alpen. Schrumpfende Eisflächen werden zu Wasser, und dieses Wasser bedroht einerseits Küstenstädte, fehlt aber andererseits kommenden Generationen, die auf stetiges Trinkwasser aus Gletschern angewiesen sind.
Dazu kommt ein Rückkopplungseffekt: Eis ist weiß, Wasser aber ist dunkel – Eis reflektiert Sonnenstrahlung, Wasser absorbiert Sonnenstrahlung. Geringere Reflektivität bei gleichzeitigem Anstieg der Energieabsorption erhöht die Temperatur weiter, was zu stärkerer Eisschmelze führt, die dann die Temperatur weiter erhöht. Und so weiter und so fort. Tendenz Katastrophe!
2. Der seit vielen Jahrtausenden durchgefrorene Permafrostboden in Sibirien, Nordamerika und Skandinavien taut bei höheren Temperaturen auf. Dabei tritt Methan aus der Erdoberfläche und steigt auf in die Atmosphäre. Methan hat zwar eine geringere Aufenthaltsdauer in der Atmosphäre als Kohlendioxid, ist aber circa 25-mal effektiver für den Treibhauseffekt. Mehr Methan in der Atmosphäre bedeutet also mehr Erwärmung, weil der Treibhauseffekt stärker wird. Höhere Temperaturen bedeuten mehr auftauende Permafrostböden, das bedeutet mehr Methan …
3. Die globale Erwärmung erwärmt auch die Ozeane. Noch wird etwa 90 Prozent der Effekte der globalen Erwärmung durch die Ozeane gepuffert. Bei immer weiter ansteigenden Wassertemperaturen können die Ozeane allerdings immer weniger Kohlendioxid aufnehmen. Also wird es noch wärmer, was auch die Meere immer wärmer werden lässt.
Das aufgelöste Kohlendioxid lässt übrigens die Meeresgewässer immer saurer werden, was alle Lebewesen im Wasser mit Kalkschalen, unter anderem ökologische Netzwerke wie Korallenriffe, zerstört. Eine verheerende kleine »Nebenwirkung«.
Neben diesen drei Phänomenen (Eisschmelze, Tauen des Permafrosts und Meereserwärmung) ließen sich noch etliche andere Prozesse beschreiben, die alle die gleiche Katastrophenstruktur besitzen: Immer beginnt es mit menschlichen Einflüssen und materiellen Einträgen in natürliche Kreisläufe. Diese natürlichen Prozessketten reagieren und verstärken die Manipulationen der Menschen zu immer stärkeren Effekten. Das Ganze muss, wenn es so weiterläuft, in einer Katastrophe enden.
Im Endeffekt läuft unsere »number of days above deadly threshold« (»Anzahl der Tage über der tödlichen Grenze«) langsam ab. In einer bahnbrechenden Untersuchung haben Wissenschaftler 2017 gezeigt, wie bei einem Weiter-wie-bisher-Szenario die Welt in den nächsten 50 bis 70 Jahren aussehen wird: Weite Teile des Planeten werden so warm werden, dass die Zahl der tödlichen Tage so stark anwächst, dass dort niemand mehr leben kann. Betroffen davon ist praktisch der gesamte Gürtel um den Äquator, in einer Breite von je rund 2.000 Kilometern nach Norden und Süden. Diese Szenarien orientieren sich an grundlegenden physikalischen Grenzen für die Fähigkeit unseres Körpers, seine Temperatur durch Schwitzen bei circa 37 Grad Celsius halten zu können. Diese sogenannte Kühlgrenztemperatur ist eine absolute Grenze, die von der Lufttemperatur und der Luftfeuchtigkeit abhängig ist. Ist es relativ trocken, so wie in Wüsten, dann kann die Lufttemperatur über 50 Grad sein, das kann man überstehen. Mit steigender Luftfeuchtigkeit wird die Transpiration durch Schwitzen allerdings immer schwieriger, die Kühlgrenztemperatur sinkt bei 50 Prozent Luftfeuchtigkeit auf 35 Grad. Höhere Temperaturen sind für alle Menschen tödlich, aber bereits bei geringeren Temperaturen beginnt das Sterben. In 2003 sind in der Sommerhitze in Europa 70.000 Menschen mehr als normal verstorben, obwohl wir weit unter der Kühlgrenztemperatur lagen. Hier zeigen sich die sehr drastischen Konsequenzen der globalen Erwärmung am »eigenen Leib« der Menschheit. Wir werden diesen Sprung zur Heißzeit nicht aushalten.
Die Klima- und Sozialforschung spricht schon längst von Kipppunkten, von Momenten ohne Wiederkehr. Wenn es uns nicht gelingt, uns von den Klippen des Scheiterns wieder zu entfernen, werden alle diese Mechanismen uns in den Abgrund eines völlig unberechenbaren Klimas stürzen. Dürren, Hungersnöte, Wasserknappheit, Kriege – alles, was das apokalyptische Herz begehrt.
Die Krise des Lebens
War da noch was? Leider ja … Wir stehen längst mitten in einer weiteren Krise, die mindestens ebenso weitreichend und dramatisch ist wie die Klimakrise: der drastische Rückgang der biologischen Vielfalt. Die Vielfalt des Lebens in allen seinen Formen schrumpft mit einem ungeheuren Tempo.
Gehen wir auch hier erst mal einen Schritt zurück: Die biologische Vielfalt, auch »Biodiversität« genannt, umfasst sowohl die Vielfalt an Arten als auch die genetische Vielfalt innerhalb der einzelnen Tier- und Pflanzenarten und zusätzlich die Vielfalt von Lebensräumen. Alle drei Bereiche sind eng miteinander verknüpft und wirken aufeinander ein – verschwinden Ökosysteme, geht auch die Artenvielfalt zurück; gibt es innerhalb einer Art nicht genügend genetische Vielfalt, könnten ihre Mitglieder durch eine einzige Krankheit ausradiert werden; stirbt eine Art, bricht im schlimmsten Fall ein komplettes Ökosystem zusammen, das auf sie angewiesen ist (etwa weil seine Mitglieder sich von dieser Art ernähren). Solange es besteht, macht dieses Netzwerk der biologischen Vielfalt die Erde zu einem einzigartigen, bewohnbaren Raum, auch für die Menschheit.
Es gibt keine konkreten Zahlen darüber, wie viele Arten auf unserer Erde wirklich existieren. Einem 2019 veröffentlichten UN-Bericht zufolge gibt es geschätzt acht Millionen Tier- und Pflanzenarten weltweit, von denen allerdings etwa eine Million vom Aussterben bedroht sind. Experten sprechen bereits vom sechsten Massenaussterben der Geschichte. Frühere Aussterbeereignisse der Erdgeschichte, auch Faunenwechsel genannt, löschten zwischen 60 und 95 Prozent aller Arten aus. Es dauert Millionen von Jahren, bis sich Ökosysteme von solchen Ereignissen erholen.
Aber brauchen wir all diese Vielfalt überhaupt, reichen uns nicht die paar Pflanzen und Tiere, die wir essen? Wir vergessen oft einige ganz grundlegende Tatsachen unseres Lebens. Die belebte Natur stellt nämlich das Fundament für Leben, wie wir es kennen, überhaupt erst bereit. Zunächst wären da die sogenannten Basisleistungen: Sie stellen die »unterstützenden« Prozesse in der Natur dar und bilden die Voraussetzung für alles andere. Dies umfasst unter anderem den Wasser- und Nährstoffkreislauf oder den Abbau organischer Substanzen durch Kleinstlebewesen und Mikroorganismen (Bodenbildung). Vor allem die Photosynthese zählt zu dieser Kategorie – wohl der bedeutendste biochemische Prozess der Erde. Durch ihn bilden nicht nur Pflanzen ihre Biomasse, die wiederum den meisten tierischen Lebewesen einschließlich des Menschen als Nahrungs- und Energiequelle dient. Bei der Photosynthese entsteht auch Sauerstoff, der erst die Entwicklung höherer Lebensformen auf der Erde ermöglicht hat.
Darauf bauen dann andere essenzielle Ökosystemleistungen auf: Bestäubende Insekten etwa sind für die Reproduktion von Pflanzen unerlässlich und sichern unsere Nahrungsmittelproduktion. Gesunde Wälder und Ozeane sind Kohlenstoffsenken, gesunde Ökosysteme an Ufern schützen uns vor Überschwemmungen und so weiter.
Die Lebensgrundlagen gegenwärtiger und zukünftiger Generationen hängen daher direkt von einem guten Zustand der Ökosysteme ab. Werden Ökosysteme oder ihre Bestandteile nachhaltig geschädigt, geht damit auch eine Gefährdung der von der Natur bereitgestellten Ökosystemleistungen einher.
Biologische Vielfalt gilt darüber hinaus als Versicherung für die Herausforderungen der Zukunft: Je ausgeprägter die Vielfalt an Genen, Arten und Lebensräumen ist, desto besser kann sich die Natur an veränderte Lebensbedingungen anpassen. Besonders in Zeiten des Klimawandels ist es im wahrsten Sinne des Wortes überlebenswichtig, dieses Anpassungspotenzial aufrechtzuerhalten.
Da lebende Organismen in dynamischen Ökosystemen interagieren, kann das Verschwinden einer Art weitreichende Auswirkungen auf die Nahrungskette haben. Es ist unmöglich, genau zu wissen, welche Folgen ein Massenaussterben für den Menschen hätte. Relativ klar benennen lassen sich allerdings die Hauptursachen für den Verlust der Biodiversität: Da sind zum einen die Landnutzungsänderungen (zum Beispiel Abholzung, intensive Monokulturen, Urbanisierung) und die direkte Ausbeutung der Ressourcen etwa durch Jagd und Überfischung. Der Klimawandel mit seinem Anpassungsdruck und die daraus resultierende Veränderung der Arten und der Invasion von Fremdarten gehören ebenfalls dazu. Zudem sind Umweltverschmutzung zu Wasser, zu Lande und in der Luft durch giftige Abfälle aller Art und die intensive Nutzung von Pestiziden und Insektiziden Killer der biologischen Vielfalt.
Mit anderen Worten: unsere Art zu leben tötet Leben. Das ist keine Krise, das ist eine Katastrophe, denn auch wir Menschen sind Lebewesen. Der drastische Rückgang der biologischen Vielfalt bedroht uns direkt.
Die Krise des Realismus
Ich sehe Sie jetzt vor mir. Sie denken »Was für ein Weltuntergangsszenario! So schlimm wird das schon nicht werden, da gibt es doch Möglichkeiten, vor allem technische Möglichkeiten. Sind wir doch mal Realisten, der Markt, Innovation, Technik und Forschung, das wird uns doch aus dieser Krise führen. Da liegt doch auch eine Chance der Neuerung, der Änderung, des Anfangs, der großen Transformation. Da sind doch Aussichten, gute Aussichten, das sagt uns doch unsere Erfahrung aus den letzten Jahrzehnten«. Überall herrscht die Hoffnung auf die technische Lösung, die große Hilfe, die auf der Wissenschaft begründet all unsere Probleme, Krisen und katastrophenartigen Entwicklungen auflöst.
Wissenschaft und ihre Begleiterin, die Technik, entstammen in ihrer modernen Form der philosophischen Haltung des kritischen Rationalismus, der sich der Aufklärung verdankt. Der kritische Rationalismus besagt: Mithilfe des eigenen Verstandes und der eigenen Vernunft sind die Probleme der Welt erkennbar, erforschbar, berechenbar – und damit kontrollierbar und natürlich ziel- und zweckgerichtet manipulierbar. Das ständige intensive und strengen Regeln folgende Wechselspiel von Experiment und Theorie mit seiner prognostischen Hypothesenstruktur ist der Grund für den überragenden Triumph der Technik – als in Maschinen gegossene Wissenschaft. »Wir wissen, was wir tun!«, ist die Devise. Ja, wir wissen es sogar sehr genau, denn ansonsten könnten wir die künstlichen Materialien, die Maschinen und Prozesskreisläufe, die uns in Energie-, Materie- und Umweltkrisen und Katastrophen geführt haben, gar nicht entwickeln, bauen und regulieren. Es ist ja gerade die unglaubliche Durchschlags- und Erklärungskraft der modernen Wissenschaften wie Physik, Chemie, Biologie, die in ihren technisch umgesetzten Formen genau zu dieser modernen Welt geführt hat. Die Physik regelt die Energie und Materiezufuhr, die Chemie macht die Metamorphosen der Materie in Kunststoffe möglich und die Biologie lässt heute Pflanzen und Tiere so wachsen, wie wir das wollen. Die Erfolge des rational begründeten Wissenschaftsbetriebes sind also der Grund für unsere Probleme.
Aber Achtung: Sie sind der Grund, nicht die Ursache. Die Ursachen für unsere Ressourcenengpässe, aus denen es keinen Ausgang gibt, der liegt in der leider nur unvollständigen Übersetzung der Erkenntnisse über die Natur. Denn Physik, Chemie und Biologie haben längst und immer wieder laut auf die planetaren Grenzen hingewiesen, haben die natürlichen Kreisläufe offengelegt, die ökologischen Konsequenzen zu Lande, zu Wasser und in der Luft der Öffentlichkeit präsentiert. Nur: Gehört haben diese Warnungen sehr wenige.