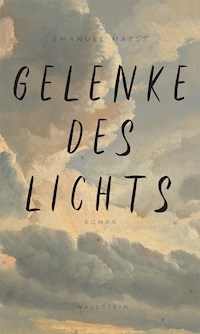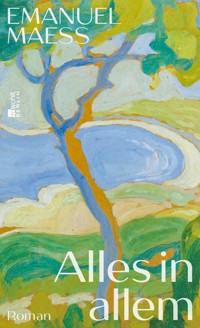
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In manchen Nächten mag es einem vorkommen, als enthielten die erhabenen Landschaften der Nacktheit mehr Wahrheit als ganze Bibliotheken heiliger Bücher. Eine gewöhnungsbedürftige Einsicht für einen Theologiestudenten, der seit einer halben Ewigkeit an einer Dissertation schreibt und mit seiner Freundin in Berlin-Friedenau ein grundberuhigtes, an inneren und äußeren Spannungen armes Leben führt. Die idyllische Behaglichkeit nimmt jedoch ein Ende, als er auf einem Wittenberger Symposion auf die Künstlerin Katharina trifft, die den verschlafenen Theoretiker im Lauf einiger Wochen in ein Mysterium des sinnlichen Selbstverlustes und ein ganz leibhaftiges Offenbarungsgeschehen hineinzieht. Die Begegnung sprengt all seine Begriffe und lässt die alten Götter um ihn auferstehen. Abgestürzt in eigene und hauptstädtische Abgründe, vorbei an Neuköllner Esoterikerinnen, hedonistischen Subkulturen und anderen zeitgenössischen Routinen urbaner Selbstoptimierung, bahnt er sich einen spirituell-heiteren Erkenntnisweg bis ins griechische Delphi. Dort, in der Mitte der Welt, erwartet ihn Katharina. Eine so sprachmächtige wie feinsinnige Annäherung an die Liebe und das Erotische, ein Roman von sinnlich-ironischer Leichtigkeit und gedanklicher Tiefe – ein Lobgesang auf die Zärtlichkeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 488
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Emanuel Maeß
Alles in allem
Roman
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, März 2023
Copyright © 2023 by Rowohlt · Berlin Verlag GmbH, Berlin
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München
Coverabbildung Spyros Papaloukas, Bucht von Aegina, 1923, Öl auf Karton, 24 x 20 cm, Sammlung der B. & M. Theocharakis Foundation for the Fine Arts and Music
ISBN 978-3-644-01354-4
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Der Urgrund jagt sie alle.
Eckhart von Hochheim
1
Wer nach Sonnenuntergang über die Dünen ihres Rückens wanderte, beging oft den Fehler, nicht früh genug an die Heimkehr zu denken. Verständlicher Leichtsinn in dieser schönsten aller Wüsten; die Gegend wirkte so vertraut, dass man den Eindruck gewinnen konnte, endlich angekommen zu sein. Als habe sie der Wind aufgeworfen, hoben sich immer wieder erhabene Bögen aus dem Grund, während Licht und Schatten eine Harmonie entfalteten, die keine Geraden kannte und sich stattdessen für die Verbindlichkeit und Anmut von Rundformen entschieden hatte. Abgeschliffene Kuppeln, leichthin überwehte Gräben, dann auch vereinzelt schroffere Höhenzüge, doch selbst die Vorsprünge der Schulterblattflügel flossen in gleitenden Linien dahin, eher ein Schwellen von Flugsand als ein Hinweis auf verborgene Härten und Kanten. Das Pilgerauge überflog Haut und Hügel, anatomische Strukturen, die in irgendeinem Grund verschwammen, und gelangte zur Mitte hin zu definierteren Partien um eine langgestreckte vertikale Senke, die sich weit nach Süden zog und erst dort endete, wo ein anderes Geheimnis begann. Man sah sie kurz in der Ebene aufgehen, dann aber in gewandelter Form zwei prominente, längeren Betrachtungen mindestens ebenso würdige Erhebungen durchlaufen, die nun allerdings eine Steppdecke pietätvoll verdeckte. Selbst diese Senke hatte nichts wirklich Geradliniges an sich, schon gar nicht in dieser leichten Schräglage, aber sie war vielleicht das Einzige, das eine klare Richtung nahm und nicht wie die Umgebung in sich selbst aufging. Denn alles andere war wie in einem Kreis geborgen, in Ellipsen, ovalen Speichen, Kurven und Windungen, darüber ein allbeherrschendes Konkavmotiv. Sah man genau genug hin und verfügte noch über ausreichend geistige Wachheit, sich einen Reim darauf zu machen, hätte man angesichts dieser Formen in längeres Nachdenken geraten können. Auch wenn man von der Seite darauf schaute, ergab sich ein dominanter Konkavschwung, ihr leichtes Hohlkreuz zeigte sich selbst im Liegen. So wie Platon im Timaios dem Tetraeder das Element Feuer, dem Dodekaeder die quinta essentia, den Himmelsäther, zugeordnet hatte, musste es etwas an dieser Form geben, das über die reine Körperlichkeit hinaus fundamentalere Bereiche berührte, vielleicht einen nicht immer ganz zutage tretenden, nur in Ausnahmesituationen abgerufenen Zug nach innen, der einen mit konvexen Hoffnungen vorübergehend ganz aus sich herausriss.
Nicht jene allgegenwärtigen, sich ebenfalls raffiniert aus der Kugel ableitenden Runddesigns von Brust und Gesäß schienen dann das Hinreißendste an einer Frau (an dieser hier sowieso), sondern die Täler, Furchen, Mulden und Gruben, jene inkommensurable Dynamik nach innen gehender Biegen und Krümmungen, ihrer unterschwelligen Spiralformen, Schraubenlinien und Trichter. Ganz zur Geltung kamen sie vermutlich erst durch die Nachmitternachtswärme und flaumweiche Textur ihrer Inhaberin, auch eine leichte Note von Osterlilien spielte ohne eigentlich klaren Ursprung hinein. Denn weder war es ein Parfum, das aufzutragen die nun vorübergehend neben mir Eingeschlafene in den letzten Stunden keine Gelegenheit gehabt hatte, noch roch sie, soweit sich das sagen ließ, von Natur aus nach Blumenladen und Fleurissimo. In Kopf- und Basisnoten vereinigten sich, wahrnehmungsbedingt wahrscheinlich durch mein leichtes Schleudertrauma nach all den ungewohnten Zuwendungen, eher Erinnerungen vom Dorfe, die Heuhaufen meiner Kindheit mit dem Zimt von Mutters lauwarmem Apfelkuchen, Crème fraîche und einem Anhauch süßlicher Schärfe, die sie, bewusst oder unbewusst (wahrscheinlich Ersteres, denn sie kannte mich gut) nicht täglich abwusch. Aber was war es dann, die Bettwäsche, hoteleigenes Raumspray, kam es von draußen? Fast hätte man meinen können, dass sich neben allem, was an Salzen und Pheromonen in einer solchen Nacht herausgeschwitzt worden war, auch ein transpirativer Tau frei gemacht hatte, der irgendwelche ätherischen Wiesen und Gewächshäuser benetzte.
Oder, nicht weniger abwegig, wenn auch um einiges reizvoller: Es handelte sich um eine Dritte, die sich in den letzten Stunden ebenso unauffällig eingefunden wie davongemacht hatte. Möglich wäre es schon gewesen in der sinnlichen Unübersichtlichkeit der Vorgänge, bei der schwankenden Aufmerksamkeit und generellen Unschärfe, gerade hinsichtlich der ja entscheidenden beiden Kontrahenten selbst. Denn weder hätte ich, außer vielleicht noch zu Beginn, klar sagen können, mit wem ich es zu tun gehabt hatte, noch war mir bewusst, ob ich dabei so etwas wie handlungsleitende Funktionen übernahm, also Handelnder oder nur Handlanger gewesen war. Es bedurfte jedenfalls einiger gedanklicher Anstrengung, diese aufgeflogenen und sich noch nicht wieder ganz gesetzten Empfindungen mit der filigranen Rückenpartie dieser mir zur Seite liegenden, durchaus hinlänglich Bekannten zu verbinden. Während diese aber schlief und sich nicht befragen ließ, hätte ich von jener Dritten mit Duftspur gerne mehr erfahren. Die Nacht war noch jung, vielleicht kam sie ja zurück. Ich wusste nichts von ihr, noch weniger als von der nun ermattet Liegengebliebenen, aber sie schien aus einer Gegend zu kommen, in der ich mich gerne öfter aufgehalten hätte, in der es weitaus ehrlicher zuging als in meiner Welt, auch freundlicher, unverstellter, in der einem die Zeit nie lang wurde, wenn es denn so etwas wie Zeit dort überhaupt gab. Im Nachhinein nämlich wäre nur schwer zu sagen gewesen, wie lange sie da gewesen war, zwei, drei Stunden vielleicht, wie lächerlich für das, was sich an Ewigkeiten in ihnen abgespielt hatte. Auch sonst war es ein mir seltsam angemessener Ort oder vielmehr Nicht-Ort, der mir das schon länger entbehrte Gefühl vermittelte, mich wieder einmal sinnvoll und in vollem Umfang in den Ablauf eines interaktiven, im weitesten Sinne sozialen, ja fürsorglichen Geschehens einzubringen. Ich hatte mich selten so gebraucht gefühlt, nützlich, wenn nicht gar unabdingbar für ein Anliegen von größerer Relevanz. Auch mit mir selbst hatte ich abseits meiner mir lange so wesentlich erscheinenden, wohl studienbedingten intellektuellen Hypertrophie, die mich offenkundig für Jahre vom Kern der Dinge entfernt hatte, kaum einmal so viel anfangen können. Fast war es, als würden einem solche Stunden nicht nur allerlei Feierlichkeiten der Oberflächensensibilität erschließen und den erweiterten Sinn von Ohrläppchen, Augenbrauen, Fußknöcheln, Kniekehlen, Beckenkämmen und Handgelenken veranschaulichen, sondern überhaupt erst die zumindest in meinem Fall nicht unbedingt naheliegende Einsicht befördern, dass man mit mehr als einer ruhelosen Großhirnrinde auf die Welt gekommen war. Man gelangte beinahe in die Nähe der Überzeugung, dass jene Körperteile und ihre Funktionen womöglich nur eine praktische Voraussetzung ihrer wirklichen Bestimmung waren, nämlich in einfühlsamer Allumfassung und hoher Steighöhe als Feuerwerkskörper die Weltnacht auszuleuchten, in deren Schatten man sonst relativ besinnungslos dahintrottete.
Die Anwesenheit einer Dritten lag auch deshalb nahe, weil jede andere Frau mit mehr oder weniger leidenschaftlichen Absichten, lustvollen Erwartungen oder fruchtbaren Hoffnungen in solche Stunden gegangen wäre. Nicht diese hier; jegliches Basiswissen über fortgeschrittene, abendländische Intimität, deren grob- und feinmotorische Abläufe sowie die ganze Bandbreite delektabler Fingerfertigkeiten wurden verworfen für etwas, das man am ehesten vielleicht als intensivierte Form der Anschauung und eskalierte Eigentlichkeit erlebte. Es musste sich darüber hinaus um jemanden handeln, dessen äußere Form nicht stabil blieb, sondern im Zuge eines sich immer weiter verdichtenden gemeinsamen Austauschs mal mehr, mal weniger greifbar wurde, sich jedenfalls nicht mehr als Summe seiner Einzelteile und Gliedmaßen, sondern als amorphes Wärmefeld erspüren ließ, das sich mit meinem ebenso aufgelösten Leib zu einem jenseits jedweder ästhetischen Kategorie liegenden, ebenso beachtlichen wie beglückenden Joint Venture verband. All dies hätte normalen Menschen unmöglich sein müssen, aber möglicherweise hatte ich bisher zu gering von ihnen gedacht.
Neben mir jedoch schien die Wüste wieder zu erwachen und schob schon einmal ihren Arm in meine Richtung. Ihr Schlaf konnte so tief nicht sein, der Kopf auf dem Handrücken, die über Hüfte, Schulter und Achsel aufschwingenden Flanken in einer halb gelassenen, halb gespannten Balance haltend. Nichts, das aus sich heraus reizvoll gewesen wäre, aber warum hielt einen die Ansicht dennoch gefangen? Es gab eigentlich nichts zu sehen. Sie war ganz gut in Form, und das Licht der Nachttischlampe hatte sich ebenso gerne zu ihr gelegt wie ich. Die so rätselhafte wie zwingende Souveränität ihrer ganzen Flügelkonstruktion war Ausdruck einer Sprache, die ich nicht verstand, eine so vielsagende wie hermetische Ansammlung von Zeichen und unbeantwortbaren Fragen aus einem Bereich, der untrüglich, nicht korrumpierbar, durch nichts in Zweifel zu ziehen war. Man hätte ihnen folgen müssen, um mehr zu sehen, aber ich wollte nichts überstürzen. Am oberen rechten Rücken ließ sich ein dunkles Fibrom erkennen, das die Erinnerung an die Vergänglichkeit auch dieser blühenden Strukturen wachhielt, als ästhetischer Makel, der dem Ganzen mehr Tiefe und Eigensinn gab und das Überzeitliche erst recht in Szene setzte. Sie hätte es vermutlich jederzeit entfernen lassen können, hatte es wohl aber für richtiger gehalten, keine Unebenheiten zu beseitigen. Man war ganz davon berauscht; so ein kleiner Tribut an die Hässlichkeit baute jemandem wie mir sofort eine Brücke. Denn es war alles andere als leicht, sich einem solchen Rücken zugehörig zu fühlen, ganz abgesehen davon, ob man sich dieser Frau zugehörig fühlte. Erst jetzt schien ich die Kehrseite jener Dinge wirklich wahrzunehmen, die ich soeben noch in einiger Ausführlichkeit in Dunkelheit, Bewegung und haptischer Überlastung in den Händen gehalten hatte. Das Maßgebliche hatte sich ja mehr oder weniger zwischen den Vorderseiten abgespielt, die einen zum anderen hin öffneten. Den Rücken behandelten die Hände wie eine Art Überfluggebiet zwischen Nacken und Po, gegebenenfalls noch als Halte- und Stützfläche für alle möglichen Arten von Hebelwirkungen, bis jegliche Anschauung Sinn und Richtung verlor, sich die Eindrücke vermischten und jede Kartierung irgendwelcher Zonen und Zonenrandgebiete verworfen werden musste, weil sich die Grenzen und Räume aufhoben. Seine Zeitlosigkeit reichte tiefer als es bloße Schönheit je vermocht hätte. Zivilisationen, Ideen, Ästhetiken verwehten, alles Vollendete fiel heim zum Uralten. Was daran für sich einnahm, war so antik wie die Tempel von Paestum und Segesta, nur dass es sich hier quicklebendig und halb zugedeckt in den Laken räkelte. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit … Das erklärte auch das Befremden darüber, wie wenig individuell er erschien, wie wenig er über den sehr eigenwilligen, um nicht zu sagen ausgeprägt individualistischen Menschen sagte, dem er zugehörte, wie sehr er ihn verbarg in all seiner Grazie, wie schmal vor allem sich diese zierliche Gebietskörperschaft ausnahm im Vergleich zu den Himmeln, Höllen und Territorien des Wahnsinns, die diese Frau zu errichten, zu verwalten und zu verteidigen imstande war.
Kurz war mir, als könnte ich das Meer hören. Am Vorabend noch hatten wir bis zum Parnass hinübersehen können, der mir in seiner mythologischen Überhöhung nun ebenso unwirklich erschien wie das Halblicht der letzten Stunden. Vorsichtig, und ohne die Schlafende zu wecken, schlug ich die Decke zur Seite, stand auf, ging zur Terrassentür und blickte nach draußen. Viel war nicht zu erkennen, die Ägäis lag ruhig und finster, kein Mond, kein Wind, kein Wellengang. Ich musste mich getäuscht haben, denn das Meer, das ich selten deutlicher vernommen zu haben glaubte als in den letzten Stunden, wäre selbst bei Sturmfluten kaum von hier zu hören gewesen und war wahrscheinlich nur eine eingebildete Begleiterscheinung jenes Naturerlebnisses, das sich aus der näheren, im Grunde genommen nicht einmal besonders ausschweifenden, viel eher durch Mäßigung und Dezenz geprägten sinnlichen Auseinandersetzung mit dieser Frau ergeben hatte.
Die Tür war halb geöffnet, ich trat hindurch und ging ein paar Schritte nach draußen. Tiefste Dunkelheit, das Meer, von hier oben als solches kaum sichtbar, ruhte glatt gezogen in der Ebene. Nur der Nachtwind wehte den Geruch von Salz, Algen und Kamille über den schütteren Hang, während die vollkommene Schwärze der Umgebung alle Blicke verschluckte. Unser Quartier grenzte zur Terrassenseite hin an die Wildnis, bis auf die Zikaden und ein paar aufgebrachte Fledermäuse umgaben einen Stille und Schummer. Je weiter ich hinauskam, desto mehr verschwammen alle Grenzen im warmen Grund. Eine dichte Wolkendecke hing über dem Land, nicht einmal Sterne, auch keine Straßenbeleuchtung, die Orientierung gegeben hätte. Ich konnte nicht mehr erkennen, wo ich hintrat, hatte nur noch eine grobe Erinnerung daran, wo die Dinge lagen. Hangabwärts eine Trockenwiese mit ein paar dürftigen Olivenbäumen, Strommasten, ein Verteilerkasten, Fahrschneisen im Gras.
Ein Treidelweg führte Richtung Meer, und ich ging ihn ein Stück, weil man dort nicht über Wurzeln stolperte und sicheren Boden unter den Füßen hatte. Selbst meine Arme waren kaum mehr zu erkennen, die Gehrichtung ergab sich aus der Bewegung der Schatten, den die Bäume in den Himmel schrieben. Alles rückte in die Nähe, Entfernungen hoben sich auf. Meer, Kiefernkrüppel und verbranntes Land lagen gleichsam um und in einem. Eingehüllt in samtenes Zwielicht, unheimlicher als in jedem Traum, nahm man im Grunde den ganzen vagen Heidekörper an, watete durch seine träge Masse, überantwortete sich irgendwann diesem namenlosen Nichts und kam dann ganz gut vorwärts. Nachdem die erste Unsicherheit überwunden war, hatte es etwas geradezu Befreiendes, vorübergehend so geschwärzt und ganzheitlich geworden zu sein. Nach einer Weile fühlte es sich ganz natürlich an, rief sogar eine gewisse Behaglichkeit hervor, heimatliche Empfindungen, nicht unähnlich denen der letzten Stunden, auch wenn es daran gelegen haben mag, dass ich mich noch nicht ganz aus unseren Umarmungen gelöst hatte.
Bald fand ich den Hügelvorsprung wieder, auf dem wir uns am Vorabend niedergelassen und über den Korinthischen Golf gesehen hatten. Dessen überragendes Blau war nun einem Dunkelgrau gewichen, ansonsten begnügte er sich mit hintergründigem Schweigen. Erstaunlich, wie so wenig Bewegung in so etwas Gewaltigem sein konnte, das an sich ja die Bewegung selbst war. In Meernähe wurde deutlich, dass man das Ungeheure verdrängen musste, um halbwegs mit ihm leben zu können. Nur so konnte man leichten Sinns darüber hinwegsegeln, seinen Strandkorb ans Ufer rücken und Studien über das Sublime anstellen. Freundlicherweise war es so entgegenkommend, seine Gefahr auch ein wenig zu verschleiern, zumindest tagsüber, wenn seine Brandung etwas Liebliches behielt, die Wellen in berechenbarem Gleichmaß der Küste zurollten, seine Horizonte Geradlinigkeit und seine blaue Transparenz Klarheit und Verlässlichkeit ausstrahlten. Solange der Wind nicht über Land kam, lag sein Geruch wie ein vornehmes Understatement in der Nase, rauschte es dezent dahin und ordnete sich der Stille der Strände unter.
Nachts aber kam einem die See dann doch etwas näher, als man es gewohnt war, und in aller Dunkelheit, die Größenverhältnisse, Distanzen und irgendwann auch den Verstand einebnete, wirkte es, als wollte sie einen auch ein Stück weit für ihre Ziele und Überzeugungen gewinnen, vielleicht sogar abholen, um einmal in Ruhe über alles zu reden. Von hier oben gesehen umgab sie mich von zwei Seiten, es wäre ihr schwer zu entkommen gewesen. Noch wirkte sie einigermaßen gelassen, wohl wissend, dass ich nicht um sie herumkommen würde, aber vielleicht nahm sie nur Rücksicht auf mein zögerliches Naturell. Ich sah hinaus und wartete eine Weile. Am Ende war mir, als ließe sich in Itea drüben noch ein Licht erkennen, wahrscheinlich machten sich die ersten Fischer für ihre morgendlichen Ausfahrten bereit. Die Sicht war schlecht, der Dunst vom Vortag hing noch in der Luft, weiter draußen hatten sich ein paar Nebelschleier ausgebreitet. Es sah nach Regen und aufgrund der anhaltenden Schwüle auch nach Gewitter aus. In der Ferne bellte ein Hund und holte mich wieder in die Welt zurück. Weiter hinabsteigen wollte ich jetzt nicht, weil mir doch ein wenig mulmig war, und so tastete ich mich nach ein paar letzten Blicken über das verschlossene, nun immerhin auch etwas flimmernde Grau vorsichtig wieder auf den Weg zu unserem Zimmer zurück. Die Nachttischlampe brannte noch, das einzige fahle Leuchtzeichen weit und breit, aber irgendwann trat ich endlich aus der Düsternis wieder in menschliche Formen ein und war erleichtert, dass alles noch da war.
Auch Rückenakt und Doppelbett; ob das Licht allerdings reichte, unsere Situation hier zu erhellen, würde sich zeigen müssen. Hellwach, aber etwas benommen, bemühte ich mich, noch einmal den schwankenden Gang der Ereignisse, die verwickelten Verführungsnarrative und die meister*inhafte Manöverführung nachzuvollziehen, die in unser durchwärmtes Lager geführt hatten. Ein paar Zehen ihres linken Fußes lugten unter der Bettdecke hervor und zogen den Sinn dieser Fragen gleich wieder in Zweifel. Bald folgte ich dieser vertrauensschaffenden Maßnahme ins Bett zurück, legte mich sachte zu ihr und wendete mich wieder den nackten Tatsachen zu. Mit metaphysischen Texten tat ich mich leichter, wobei auch dieser hier nach eingehender Betrachtung eine ähnliche Grundtendenz erkennen ließ. Ihr mädchenhaft schmaler, etwas langer Hals entsprach ganz der tänzerischen, ballerinahaften Statur ihres Oberkörpers, der leicht und federnd selbst in Ruhe eine gewisse Grundspannung beibehielt. Als Gewicht, als Masse war dieser Rücken eigentlich nicht da, eher als Übergang, nicht zu den Extremitäten, oder nicht nur, sondern, Sprung über sich hinaus, zu einem anderen Zustand. Schon durch seine ganze äußere Anlage verriet er das Geheimnis dieses, vielleicht auch jedes anderen Körpers, sobald ihn der verlangende Blick der Schwerkraft entband. Auch wenn es alles andere als nahelag, hatte unsere leidenschaftlich engagierte Physis vielleicht weniger Interesse daran gehabt, sich zu behaupten, zu erweitern oder sich selbst zu genießen, als den Status zu wechseln, ihr ganzes Gefüge aufzugeben und sich selbst zurückzulassen. In den Momenten des größten Überschwangs schien ihr der Selbstverlust über den Selbsterhalt zu gehen, eine Spielart der Nächstenliebe, die so nachhaltig verwirrte, dass ich mich glücklich schätzen konnte, noch hier zu sein. Bis auf ein lästig donnerndes Herz ging es mir eigentlich ganz gut.
Als seien ihr derlei Einfühlungsversuche auf Dauer zu distanziert, drehte sie mir den Kopf zu, schlief aber weiterhin so fest, dass ich einer leicht einziehenden Kälte wegen ihre Decke ein wenig nach oben zog. Die ganze Schönheit ihrer Rückseite, das wurde angesichts ihrer Gesichtszüge wieder ausreichend klar, lag ja nicht zuletzt auch an der durch sie verborgenen Vorderseite. Wenn ich daran dachte, wie lange ich ihr Abgewendetsein hatte hinnehmen müssen, wie sehr dies aber auch mich selbst Stück für Stück in die Form brachte, von der ich lange keinerlei Vorstellung gehabt hatte und die mich nun immerhin hier sitzen und hohe Gedanken und Erinnerungen Revue passieren ließ – wenn ich mir dies in all seinen verrückten und keineswegs schmerzlosen Wendungen und Fragwürdigkeiten vor Augen führte, kam ich gar nicht darum herum, erst einmal die Rückseiten der Dinge zu preisen. Denn ohne diese doch ganz erhebliche Anlaufzeit hätte ich wohl ihren Rücken, nicht aber alles Übrige ertragen können, jedenfalls keine Nacht lang.
Noch ein Blick über Hals und Nacken, ihr Haar im braunen Bündel quer über dem Schulterarchitrav. Kurzer Gang durchs Gelände, als schaute ich mich hinter feindlichen Linien um. Kaum zu fassen, dass jene Wellen und Hänge wegen mir in Bewegung geraten waren (und vielleicht auch wieder geraten würden, denn sonst wären wir auf halbem Wege liegen geblieben, das Dunkel draußen rief ja schon nach uns). Ihre nun fast ein wenig unnahbar erscheinenden Hoheitsgebiete streckten sich wieder in Weite und Einsamkeit vor mir aus, eine Lage, an der sich nur etwas ändern ließ, sofern man unsere Saumseligkeit auf einem höheren Niveau fortsetzte. Ich würde sie wecken müssen.
2
Auf manche Begegnungen bereitet einen das Leben vor, ohne dass man viel davon mitbekommt. In den meisten Fällen scheint es dann weniger an unserem Glück als an einer guten Geschichte interessiert und hilft also oft ein bisschen nach. Wenn ich die ersten Spuren, die Katharina in meinen Erinnerungen hinterlassen hat, weit vor unserer ersten Begegnung auszumachen glaube, konstruiere ich dies keineswegs im Nachhinein in die Wirklichkeit hinein. Wenn überhaupt, begriff ich zu wenig von diesen Dingen und erkannte die Konstruktion, die zweifellos da, doch anderen Ursprungs war, nur unvollständig. Man müsste über mehr Aufmerksamkeit verfügen, um in seiner Gegenwart nicht nur Restbestände von Vergangenem, sondern die großzügigen Winke und Bekanntmachungen einer schon an allen Ecken und Enden durchbrechenden neuen Zeit zu bemerken. In meiner damaligen Verfassung allerdings war ich schon vollauf damit beschäftigt, mein eigenes, ziemlich enges Umfeld ausreichend im Blick zu behalten. «Der Jäger ist der wache Mensch», schreibt José Ortega y Gasset in seinen Meditationen über die Jagd. Für eine wirklich wache Existenz jedoch hatte es viele Jahre lang, wahrscheinlich für die Dauer meiner gesamten, kein Ende nehmenden Studienzeit nur selten echten Anlass gegeben, für eine Jagd schon gar nicht. Zudem brachte ich für derart abgründige Passionen, womöglich für Passionen überhaupt, von jeher weder sonderliche Neigung noch Eignung mit.
Ein hoffnungslos lethargischer Student der Theologie im nunmehr achtundzwanzigsten Semester, in einem Alter, in dem Männer noch meiner Vatergeneration auf der Höhe ihres Lebens standen, schrieb ich seit Jahren an einer Dissertation über Idol und Ikone. Zur Frage orthodoxer Bildtheorie und Offenbarung in Lehre und Praxis und kam zu keinem Ende. Immerhin hatte ich mich, möglicherweise beeinflusst von all den mystischen, neuplatonischen und spätbyzantinischen Schriften, in einen Zeitbegriff vorgearbeitet, der das zeitlose, ewige Jetzt (nunc stans) umstandslos auf mein Leben übertrug. Darin belebte ich ein zum Sankt-Nimmerleins-Tag ausgedehntes Provisorium, in dem alles stillstand, Beruf, Beziehung, Lebensentwurf. An sich nicht die schlechteste Art, sich durchs Leben zu mogeln, sobald man sich einmal dazu durchgerungen hatte und die Selbstverabschiedung von der übrigen Welt kein schlechtes Gewissen mehr machte. Es ist erstaunlich, wie unerheblich Tage, Monate und Jahre werden können, wenn man sie von Sinn und Richtung befreit. Sie wirken wie künstlich aufgeblendet; irgendwann geht die Sonne auf, und unversehens, man merkt es kaum, während man schreibt, liest und nachdenkt, wird es wieder dunkler, und man muss die Leselampe auf dem Nachtschränkchen anmachen (ich arbeitete öfter im Bett). Draußen ziehen die Jahreszeiten vorbei, und man wundert sich, mit welcher Mühe dieser Apparat immer wieder angeworfen wird. Im Sommer macht man die Fenster auf, freut sich über die warme Luft und die duftenden Linden, hört die Vögel und, wenn man schön wohnt, die Glocken nahe gelegener Kirchen. Man macht sich alle paar Stunden einen Tee, liest, schreibt, schläft, geht spazieren, trifft, jedenfalls aus dem Blick allumfassender Ruhe heraus, geschäftige und schwer gehetzte Freunde. Selbst solche, die unkonventionell lebten, ja gerade diese, schienen unter ungeheurem Hochdruck zu stehen und sich für Pläne zu verheizen, die mir auch nicht sinnvoller vorkamen als meine Dissertation.
Mein Interesse für das Thema, das ich während einiger Tage auf dem Athos zu Beginn meines Studiums gefasst hatte und das ich in einer damals noch jugendlichen Revolte gegen den postmodernen Niedergang von Wahrheitsbegriffen für einen adäquaten Forschungsgegenstand hielt, war längst erlahmt. Kaum eine Wahrheit, auch nicht die der Ikonen, bleibt Wahrheit, wenn man nur lange genug darüber schreibt und nachsinnt. Auch was meine weiteren Perspektiven betraf, ergab die Arbeit keinen Sinn. Ich arbeitete zwei Tage die Woche als wissenschaftliche Hilfskraft an einem Lehrstuhl für Evangelische Theologie an der Freien Universität Berlin, der Promovenden eine ähnliche Freiheit bei der Themenwahl ließ wie protestantischen Geistlichen bei der Auslegung des Evangeliums. Aber wohin wollte und sollte ich mit einer Arbeit mit ja eher orthodoxem Schwerpunkt, wenn ich einmal damit fertig werden würde? Lehrstellen wurden wie Pfarrstellen zusammengestrichen, daraus würde also nichts werden (wofür man Gottes ewigem Ratschluss am Ende nur dankbar sein konnte).
Meine Freundin Clara, mit der ich in Friedenau inzwischen ähnlich lange zusammenwohnte wie die Dissertation alt war, verließ morgens um halb sieben die Wohnung, um in der Kinderklinik des St. Joseph-Krankenhauses ihren Facharzt in Pädiatrie zu machen. Sie kam am frühen Abend nach Hause, schmierte sich ein paar Brote, versuchte zu entspannen, fiel dann früh ins Bett und war ebenso früh wieder draußen. Um uns nicht gegenseitig ins Gehege zu kommen, lebten wir fast wie in einer WG, jeder in seinem Zimmer. Sie war von einer rührenden Aufmerksamkeit und Sorge, hatte vielleicht keinen ehrfürchtigen, aber doch ehrlichen Respekt vor meiner Arbeit und wollte mich nicht stören. Im Nachhinein erscheint mir die Liebe, die sie zu mir gefasst hatte, sowie das fast unerschütterliche Vertrauen in mich und unsere Zukunft nahezu unbegreiflich und wie ein unverdientes Gnadenwerk, das der Heilige Geist seinem Studiosus im Wein- und Bücherberg abgeworfen hatte. Anders lässt sich das heute nicht mehr erklären, jede andere Frau wäre an mir verzweifelt. Hin und wieder besuchten uns an den Wochenenden Freundinnen von ihr, mal mit, mal ohne Begleitung, aber meist mit frischem Nachwuchs, der jubelnd herumgereicht wurde. Die Vorstellung, dass Clara, Anfang dreißig und im Großen und Ganzen gut beieinander, sich in dieser Hinsicht ebenfalls ernsthafte Gedanken machte, war nicht ganz auszuschließen, auch wenn es unter zeitgenössischen Bedingungen reichlich absurd erschien, bei diesem Unternehmen auf mich, einen untersetzten, mittellosen Ikonenforscher mit Bauchansatz und Haarausfall, zurückzugreifen.
Wir hatten uns noch während des Studiums auf einer Reise nach Israel kennengelernt, die die Evangelische Studentengemeinde in den Semesterferien organisiert hatte und die neben den erwartbaren, gelegentlich auch tief reichenden Kultureindrücken eher befremdliche Empfindungen hinterließ. Abgesehen von der Tatsache, dass ich mich dabei in diese zunächst unscheinbare, ihre volle Schönheit und eigentümliche Sanftmut bald aber immer nachhaltiger entfaltende Medizinstudentin verliebte, blieb mir davon kaum etwas in Erinnerung und wurde mir die besondere Tragweite dieser wenigen Begebenheiten erst später klar. Es musste mit dem Realitätsschock zu tun gehabt haben, all diese märchenhaften Orte, Nazareth, Galiläa, Bethlehem, Kapernaum, das Jordantal, Jerusalem oder den See Genezareth tatsächlich in einer zwar oft exotischen, aber eben alle Phantasie doch unterbietenden Wirklichkeit vor mir zu sehen, wofür das Heilige Land an sich nichts konnte. Vielleicht lag es auch an der Hitze und meinem Reizmagen, die mir diese langen Busfahrten oft unerträglich machten, dass ich, von einer eigenartigen geistigen Taubheit befangen, nie wirklich an die Dinge heranreichte, die zu erleben mich als Theologen eigentlich glücklicher hätten tangieren sollen. Dass auch Katharina schon damals in die Ereignisse mit eingewoben war (am sinnfälligsten und fast schon überdeutlich im Namen des Klosters, in dessen Nähe wir am Sinai übernachteten), war damals natürlich nicht absehbar, wobei ich in der Rückschau die stimmige Motivik und einige seelenlandschaftliche Akzente durchaus bewundernswert finde, in jedem Fall gelungener als alles, was ich mir diesbezüglich hätte ausdenken können.
Am Ende der Reise nämlich hatte es sich unsere Gruppe zum Höhepunkt und Abschluss des Ganzen vorgenommen, zwei Tage ins Gebirge zu fahren und den Mosesberg zu ersteigen, eine Aussicht, die mir angesichts meines sich schon damals ins Unsportliche entwickelnden Halbschwergewichts kaum Freude bereitete und dem HERRN ja wohl auch nicht, hatte dieser doch Mose noch mitgegeben, er möge eine Grenze um den Berg ziehen, ihn heiligen und im Übrigen allen anderen unter Todesandrohungen klarmachen, dass man da oben lieber unter sich bleiben wolle. Schon die Anreise mit dem Bedouin-Bus von Nuweiba durch diese Mondlandschaften von Wüste weckten da ohnehin kaum Begehrlichkeiten, mal hellere, mal aschfarbene, in der Mittagssonne fast schwarze Schutt- und Geröll-Formationen, Talkessel, Sandflächen und Halden, weit weniger eindrucksvoll, als man es im Reiseprospekt gesehen hatte. Plötzlich dann Streckenabschnitte, die an die Grand-Canyon-Gegenden Colorados erinnerten; immerhin irgendein innerer Bezug in diesem saugenden Nichts, das, so lebensfern und lebensfeindlich es sich auch auftat, kaum einen Vergleich zuließ, nicht einmal mit dem Tod, der zumindest eine bedrohliche, erschreckende, vielleicht sogar erregende Präsenz hatte. Es hätte reizvoll sein können, endlich einmal unberührte Natur zu erleben, die diesen inzwischen weitgehend sinnfreien Begriff auch verdient hatte, an Orten, die niemand je betreten, bebaut oder kultiviert hatte. Aber die Unberührbare lag vor uns als verwittertes Zerstörungswerk, eine geborstene, verbrannte und zersprengte Ruinenlandschaft, die, das war deutlich zu spüren, auch unberührt bleiben wollte, unsere Nähe nicht schätzte und die Einsamkeit bei Weitem vorzog (vermutlich, um sich weiter der Selbstauflösung hinzugeben, ohne die Blicke irgendwelcher Zuschauer ertragen zu müssen).
Einmal hielten wir irgendwo an und stiegen aus. Jetzt wurden auch die Entfernungen klarer, die sich aus dem Bus heraus nie ganz klärten, genauso wie alle Vordergründe, die schon bei den eher gemächlichen Geschwindigkeiten völlig verschwanden, womit sich die Gegend fast noch mehr verzehrte, als es durch Sonne und Kälte eh schon geschehen war. Nun aber reinste Luft, nicht einmal Insekten, die sich hierher verirrten. Der Wind, die einzige Bewegung weit und breit, fast ein Anflug von Lebhaftigkeit, fächelte über den Sand und ließ ihn in kleineren Wellen liegen. Flimmernd und zitternd glommen die Horizonte.
Es dauerte eine Weile, bis man nach den touristisch zugerichteten Sehenswürdigkeiten, denen immer etwas Unehrliches und Gemachtes anhaftete, begriff, dass diese Wüste tatsächlich so echt und authentisch war, wie man es gar nicht mehr kannte, und trotz aller Versuche des Reiseleiters, sie zu einer solchen zu machen, auch keine Attraktion im üblichen Sinne darstellte. Die Sonne, unumschränkte Herrscherin dieser verlorenen Breiten, unterwarf sich alles und drückte, was noch aufblicken wollte, erbarmungslos in den heißen Sand. Niemand von uns zehn, zwölf Leuten, ohnehin schon müde und geschafft nach dem Besichtigungsprogramm der letzten Tage, schien imstande, noch etwas Zusammenhängendes zu sagen, zu fühlen oder zu denken. Nicht einmal die ersten zärtlichen Regungen, die sich während jener Tage mit Clara verbanden und die ja auch ein Glühen eigener Größenordnung waren, kamen gegen die sengende Hitze an. Während solche Befindlichkeiten wie groteske Nichtigkeiten von einem abfielen, reichte diese halbe Stunde, um auch den inneren Sinn ins Mineralogische hinauszutreiben und darin eine ähnlich anorganische Leere aufzumachen, wie sie einen hier umgab. Man wehrte sie zunächst ab, ließ sie dann aber widerwillig in sich Platz greifen und führte sie eine Weile mit sich fort, bis man bemerkte, wie wohl sie einem tat und wie sehr man sie in Menschen, Städten, Geisteszuständen und Ideen weitersuchen würde, weil sie einen aus irgendwelchen Gründen überzeugt haben musste.
Am späten Nachmittag erreichten wir das Katharinenkloster. Vielleicht war seine Lage hier gar nicht so absurd, wie es schien, war das Religiöse immer auch ein Dienst an dieser Leere gewesen, die sich andernorts freilich nicht so sehr aufdrängte und erfahren ließ wie hier. Ein paar Zypressen standen um einen trutzigen Festungsbau, verstaubter Ginster, Tamarisken. Die Sonne musste früh hinter den rosa und in der Höhe noch eine Weile fortglühenden Felsen verschwunden sein, die alles düster überragten. Kamele und ein paar Jeeps an den Wegen. Hinter den Mauern dann Oliven-, Mandel- und Zitrusbäume, die Vegetation war zurück, leider auch die Sehenswürdigkeiten, fliegende Händler und Scharen von Touristen. Was musste das hier einsam gewesen sein, als man sich mehrere Tagesmärsche mit den Beduinen durch die Wüste zu kämpfen hatte, umschlossen von jener ins Unendliche reichenden, unwandelbaren Trostlosigkeit.
Wir bekamen eine kurze Führung, für die wir eigentlich zu erschöpft waren. Es öffneten sich Türen mit koptischen Motiven, Intarsien aus Zedernholz und Elfenbein, im Andachtsraum Fayencen und Mosaike, viel ziseliertes Silber und arabischer Marmor, manches noch aus den Zeiten Kaiser Justinians. Mir sagte das wenig, mein Abstand zu diesen Dingen war nicht zu überbrücken, jedenfalls nicht an diesem Abend, wenngleich sich immerhin noch eine Scham über die eigene Unergriffenheit und meinen von Hitze und Müdigkeit beförderten Stumpfsinn einstellte (schwer begreiflich im Nachhinein auch, die berühmte Ikone des Christus Pantokrator verpasst zu haben). Immerhin sahen wir noch einen Ableger des berühmten Dornbusches, im Blitzlichtgewitter weniger Gottes als einer Traube von Fernreisenden, die mit ihren Hochleistungskameras das Halbdunkel zum Leuchten brachten, einen Brombeerstrauch wie auf meinem Berliner Hinterhof, nur eben größer. Wir checkten im Hotel ein, aßen etwas und ruhten aus. Sobald die Sonne weg war, wurde es schnell kühler.
Gegen eins in der Nacht machten wir uns dann mit warmer Jacke, Proviant, Stirnlampe und Walking-Stöcken zum Sinai-Gipfel auf. Ein überdunkelter Geröllpfad, nun glücklicherweise nicht in brütender Tageshitze, führte nach oben, durch die wie größere Geschwüre wirkenden Granitfelsen hindurch. Einige Imbisshüttchen standen am Weg, in denen man Tee oder eine Sprite bekam. Wir passierten Elijas Garten, in dem nach den Schilderungen unseres Führers die Übergabe der Zehn Gebote stattgefunden haben soll, dann eine beschwerliche Steintreppe, die man auch Stufen der Buße nannte und die ein Mönch im sechsten Jahrhundert angelegt hatte (nicht zu verwechseln mit der Treppe zum Paradies des hier ebenso einst ansässigen Asketen Johannes Klimakos, die wahrscheinlich noch schwerer zu ersteigen war). An deren Ende durchquerte man ein Tor des Glaubens und später eines des heiligen Stefan, der darüber wachte, dass die Leute gebeichtet hatten und von nun an barfuß weitergingen, beides für uns Neuzeitler eher ein Grund zum Umkehren, aber Stefans sterbliche Überreste ruhten längst im Beinhaus des Klosters unten. Kein Stein also ohne irgendeine Bedeutung, was der schwermütigen Landschaft noch zusätzliches Gewicht auflud, während ich mich, dessen völlig ungeachtet, noch eine Weile im Halbschlaf befand und das Ganze eher wie ein bewusstes Nachtwandeln erlebte. Leise in mich hinein seufzend, bald schon merklich japsend setzte ich ein Bein vors andere und dachte nichts, sah auch nicht viel, ein paar Lichter im Tal, ansonsten die von der Lampe schwach beleuchteten Steine. Ein wenig hing ich immer hinterher, doch es schien mich niemand zu vermissen. Die anderen waren jedenfalls bald oben an der Kapelle zur Heiligen Dreifaltigkeit und sahen vermutlich schon in die finstere Umgebung hinab, während ich hinaufsah, überhaupt zum ersten Mal auf dieser Wanderung und wahrscheinlich im ersten wirklich wachen Moment, und dann gleich in den unfassbarsten, kolossalsten, maßlosesten, zugleich dunkelsten und funkelndsten Sternenhimmel, den ich je erlebt hatte.
Da bot es sich an, sich mal hinzusetzen und durchzuatmen, eine Decke unterzulegen und eine Rundumschau der sonst so verschwiegenen Gewölbe vorzunehmen, um mich der vielleicht einzigen echten Sehenswürdigkeit auszuliefern, die länger zu denken geben würde. Das Licht über den Städten deckte diese außergewöhnlichen Ansichten wie auch die meisten der daraus folgenden Einsichten zu, und man fragte sich, was geschehen würde, wenn es damit anders wäre. Mir kam es vor, als hätte man mir etwas Entscheidendes vorenthalten, das einer elementaren Information, einer Grundaussage, einem unentbehrlichen erzieherischen Hinweis über das Leben gleichkam. Jedes bloße Wissen um unser Dahintreiben in diesen hohen Räumen blieb so schlicht, als teilte man Waisenkindern alle verfügbaren Daten über ihre Eltern mit, nur eben nicht, was mit den Leuten anzufangen sei und wo man sie finden könne. Schon ein paar Nächte unter diesem Funkelfeld mussten die Wertschätzung nicht nur für das große Ganze, sondern auch für sich selbst erheblich befördern, war man bei aller Kurzatmigkeit doch immerhin Teil dieses denkwürdigen kosmischen Gesamtkonzepts. Dabei hätten jene Himmel einen Astronomen womöglich ebenso kaltgelassen wie mich die heiligen Stätten hier, wie überhaupt all diese charmanten, beweglichen, gewichtigen und gefährlichen Dinge, sobald sie realisiert, theoretisiert und wissenschaftlich frisiert waren, innerhalb kürzester Zeit zu langweilen anfingen. Ich war an dieser Ruhigstellung der Welt viel zu lange schon selbst beteiligt gewesen, um mir darüber noch Gedanken zu machen. Wahrscheinlich bewahrte uns das ganze moderne Forschungswesen am Ende nur davor, dem Wahn und Jubel dieser Höhen allnächtlich ins Gesicht zu sehen, auch wenn es womöglich nur zu unserem Besten geschah.
Wie dem auch sei, über mir stand nun dieses sternengesprenkelte Schwarze Meer, in dem jede Theorie heillos versinken musste. Nachdem ich die Stirnlampe abgenommen und mich ein paar Minuten hinein- beziehungsweise hinauf-, nach einiger Zeit, wenn man darüber nachdachte, auch hinabgesehen hatte wie von einer Empore (denn das All kannte weder oben noch unten, und ich stand ja immerhin auf dem Sinai), fand ich darin dann doch Strukturen wieder, Verdichtungen um Milchstraße, Sternhaufen, Wolken und Nebel, in Horizontnähe sogar sich grün, rötlich und gelb verstrahlende Flächen und Bänder, die mir vorher nie aufgefallen waren und die sich durch den hiesigen Airglow ergeben hatten. Sie hatten zunächst einen gewissen, fast schon selbstgefälligen Hang zur Zurschaustellung, ja schamlose Freude daran, mich allein mit ihren Ausmaßen, der Unzähligkeit und Unregelmäßigkeit all ihrer Fackeln und Gestirne zu überfordern. Nichts, sollte mir das sagen, hatte ich mit dieser galaktischen Lichtergeste gemein. Zu träge, zu halbherzig, ohne jede Ausstrahlung oder gar eigene Umlaufbahn rotierte ich Weißer Zwerg nur um mich selbst, und die Momente nachhaltiger Schöpfungseinsicht und Sphärenharmonie hätte ich alle verschlafen, wenn nicht eine Wanderung zur Unzeit mich dazu gezwungen hätte, einen Morgen lang einmal alle lichtverschmutzten Niederungen zurückzulassen.
Derlei Understatement erachtete man dort oben jedoch als nicht sonderlich zielführend; so hätte man sich unter Sonnen nicht behaupten können. Stattdessen verausgabte, verschwendete, verbrannte sich diese wilde Schar unentwegter Feuerbälle ohne Rücksicht auf Verluste. Alles drängte nach außen, schleuderte sich schonungslos hinaus in den Raum und sah in seinem Überfluss, der luxuriösen Vergeudung seiner Helium- und Plasmakerne, den maßgeblichen Sinn seiner Existenz. Verglühe nach deinem Gesetz, verehre das Dunkle, auf dem du dein gleißendes Vermächtnis niederlegst, halte fernerhin Abstand und überlasse dich dem großen Kreisen. Da es damit alle ähnlich sahen, entstand für den unvoreingenommenen Betrachter der Eindruck einer beneidenswerten Souveränität der Ordnung, in der jeder seinen Platz hatte und sogar so etwas wie Stolz, ja ein von gegenseitigem Respekt getragenes kollektives Glück aufkommen konnte, das am Ende eine frappierende Hoheit und Eleganz an den Firmamenten aufziehen ließ. Es hätte mich nicht gewundert, wenn Mose statt des überlieferten Dornbusches hier nachts diesen Himmel und seinen Gott ersucht hätte, ihn dorthin zu führen, wo er ebenso entflammen konnte wie diese kultivierte Pracht da oben, wie ein Seraph im reinigenden Feuer, der dies ja auch ohne lästige Verbrennungen hinbekam. Immerhin, und damit kehrte ich in die Wirklichkeit zurück, stand ich schon einmal in jenen nicht minder verheißungsvollen Flammen, die Clara unversehens und wohl auch unbeabsichtigt in mir geschürt hatte, und da mir außerdem recht kalt geworden war, machte ich mich wieder auf den Weg, um das letzte Stück des Aufstiegs anzugehen.
Trotz meines empfindsamen Ringens mit den Unendlichkeiten waren kaum mehr als zehn Minuten vergangen. Ich packte meine Sachen, nahm die letzten Höhenmeter, kam noch an ein paar sich müde hinlagernden Kamelen vorbei, die man einigen der Pilger für den Abstieg bereithielt, und fand mich an der leider abgeschlossenen Kapelle bei meiner kleinen Studentengemeinde auf dem Gipfel ein. Anlassgerecht hochgestimmt sahen wir in die langsam aus Nacht und Morgendunst tretenden Felszüge, die zum Horizont hin ein Meer von steinernen, dunkelgrauen Wellen bildeten. Eine andere Gruppe sang, ich glaube sogar Morning Has Broken, zwei junge Frauen meditierten, Smartphones fingen das erste Tageslicht ein. Die Sonne machte das Beste daraus, entzündete einige Wolkenschlieren am Horizont, dann die roten Spitzen der Berge, schließlich auch ein paar Gemüter von uns (meins dagegen noch immer kalt wie meine Ohren, vielleicht musste ich dafür auch allein sein). Es war ganz schön, aber natürlich gab es gewaltigere Landschaften und triumphalere Sonnenaufgänge, die nicht bloß von ihrer Legende lebten. Für ein paar Minuten war die Gegend tatsächlich erträglich und gewann ein gewisses Format, allein schon durch das ewige Licht, das auf die dürftigen, zerschlagenen Gebirgsstöcke fiel und selbst diesen für ein paar Minuten so viele Farben gönnte, dass man sich fragte, ob sich das hier, außer für uns, überhaupt lohnte.
Auf dem Abstieg war ich dann länger mit Clara im Gespräch, die ganz im Moment angekommen, vielleicht sogar aufgegangen war. Irgendwie passten ihre roten Haare, die munteren, tiefbraunen Augen und Sommersprossen auch gut in diese Gegend. Ein paar Wochen nach der Reise wurden wir ein Paar, was vermutlich mit ihrem unüblichen Maß an Wärme und Lebensfreude zu tun hatte, mit dem sich, so dachte ich rückblickend wie vorausschauend, auch die trockensten Wüsten durchqueren ließen (was für den Großteil aller menschlichen, vor allem auf längere Distanz hin angelegten Verhältnisse nicht die schlechteste Voraussetzung war). Angesichts dieser weiten, leeren, bisweilen auch beängstigenden Räume war eine Milde, Gelassenheit und Güte von ihr ausgegangen, die zu sagen schien: Fürchte dich nicht! Und (wie der HERR zu Mose): Ich bin, die ich bin. In ihrem Fall: Tatsächlich die, als die ich erscheine, bin die Ruhe, der offene Blick, das Helle und die Heiterkeit, mein Dasein spannt sich zu einem glücklichen Bogen. Noch auf der Busfahrt zurück, die deutlich vor Augen führte, wie sehr meine eigenen vertrockneten inneren Bestände dieser entsetzlich freudlosen Landschaft draußen glichen, setzte sich daher die Erkenntnis durch, dass sich darin nur mit Clara wieder Gärten und Parkanlagen würden anlegen lassen.
3
Und Gärten wurden es, wenngleich uns die Lebenswirklichkeit über die Jahre auch ziemlich enge Zäune ums Grundstück zog. Bald ließen wir die kleine badische Universitätsstadt am Neckar zurück und fanden (in der Hoffnung, mehr oder weniger nur die Idylle zu wechseln) eine kleine schmucke Altbauwohnung in Berlin-Friedenau. Während sich andere Stadtgegenden mal aufregender, mal anstrengender veränderten, stand die Gründerzeit mit ihren Vorgärten hier auf fast schon ländliche Weise still, ohne dass in nennenswertem Umfang noch etwas gegründet worden wäre, was zu jenem einmal von Uwe Johnson festgehaltenen verförsterten Eindruck führte. Enge Straßen, alte Linden; wer es so gut getroffen hatte wie wir, saß auf seinem Balkon im vierten Stock, über den großen Baumkronen und fast schon im Himmel, blinzelte in die Sonne, hörte den Amseln zu, vor sich eine Kanne Tee, einen Stapel Bücher und eine große, tragende Ruhe, in der man der Stadt für ein paar Stunden den Rücken kehren konnte. An den Wochenenden gingen wir dort viel spazieren, frühstückten auf den Parkbänken am Rüdesheimer Platz, tranken Riesling am Rheingauer Weinbrunnen, holten Brötchen bei Wieslau, Bücher in der Nicolaischen oder im Zauberberg, entwickelten auf regelmäßigen Streifzügen durch die Schrebergartenkolonie Johannisberg sogar allerlei gartenbauliche Perspektiven (ich wollte Austin-Rosen und Karl Foersters dunkle Rittersporn-Stauden, sie vor allem Gemüse und Kräuter pflanzen). Dabei pflegten wir einen ganz bewussten Hang zur Spießbürgerlichkeit, nicht ohne diese hin und wieder selbstironisch zu unterlaufen, um dem anderen zu signalisieren, dass man zur Not auch auf Höhe der Zeit sein konnte.
Für diesen Zug ins Gediegene hatte jeder seine eigenen Gründe. Clara ließ damit eine etwas unruhige Jugend hinter sich und sehnte sich nach Stabilität. Ich dagegen kannte nichts anderes, hatte mich daran gewöhnt und fühlte mich wohl damit. Während sie hinter den Grenzen Friedenaus und auch an ihrem Krankenhaus eine Welt erlebt haben musste, die zerrissener und unsicherer war, arm an Halt und echter Herzlichkeit, bedrohte mich wahrscheinlich eher ein Zuviel an allem, zu viele Leute, Möglichkeiten, Meinungen, Erwartungen, vor allem auch zu viele Fragen, auf die mein Leben bis dato keine Antwort wusste. Friedenau blieb da übersichtlicher als die angesagteren Quartiere, in denen ich es zudem noch immer fünf Grad cooler fand, und für diese Art von Kälte und angesichts immer neuer undurchsichtiger Bartmoden, Körpermodifikationen oder Vorstellungen, wie man eine Hose trägt, war ich vermutlich falsch temperiert. Bei Origenes gibt es irgendeine Stelle, da überlegt er, ob der Begriff der Seele, Psyché, nicht auf «psychesthai», ein Erkalten eines vorher göttlichen, helleren, heißeren Zustands, zurückgeht, so wie bei Sündern die Liebe erkaltet nach Matthäus 24,12. Wenn die Psyche eh kaum mehr als eine kalt gewordene Kruste war, musste man es mit der Coolness auch nicht übertreiben.
Vielleicht tat man gut daran, nicht allzu tief in die Ursprünge unserer über die Jahre gewachsenen Verbundenheit vorzudringen, denn dieser Paarung wohnte im Gegensatz zu meinem Ikonenthema ja doch etwas entschieden Unorthodoxes inne. Solange wir beide noch studierten, hatten sich diese Fragen weniger aufgedrängt, seit einigen Jahren und nach ihrer Approbation jedoch zeichnete sich zumindest für Clara ein deutlich umschriebenes Lebens- und Arbeitsumfeld ab. Welche Assistenzärztin in der Facharztausbildung saß schon lange mit einem Doktoranden der Theologie zusammen, noch dazu einem, der seine Dissertation so verbummelte wie ich? Clara hatte ein weiches Herz, aber keinen weichen Verstand. Wer wusste von ihren inneren Anfechtungen (oder gar ihren äußeren, schien es doch mehr als unwahrscheinlich, dass ich der Einzige war, der ahnen konnte, welchen Glücksgriff man mit ihr tat)?
Obwohl der Krankenhausalltag an den Rand der Erschöpfung ging und Clara kaum noch Gelegenheit für die Kletter- und Tangokurse, Chorproben und Kochabende fand, denen sie noch zu Studienzeiten nachgegangen war, sprang sie noch immer sporadisch als Kindermädchen für ihre Freundinnen ein, sogar ein paarmal als Wahlhelferin, backte Kuchen und Plätzchen für Gemeindefeste. An freien Tagen reiste und wanderte sie gerne, nahm mich überallhin mit. Wenn wir durchs Poitou fuhren, führte sie mich in jede einzelne romanische Kirche, hatte seitenlange Besichtigungspläne ausgearbeitet. Vielleicht dachte sie, sie täte dem Theologen etwas Gutes, aber ihr Chauffeur war eher an Entenlebern, Trüffeln und Bordeaux interessiert, die wir uns abends in den Gasthäusern schmecken ließen.
Auch daheim lag die Planungshoheit bei ihr, und sie organisierte und verwaltete unseren Haushalt ähnlich diszipliniert wie ihre Berufslaufbahn. Ständig stellte sie die Möbel um, schickte mich in Baumärkte und Einrichtungshäuser, kaufte teure Vorhänge und Teppiche. Ein paarmal musste ich sie mit größter Not davon abbringen, das Bad zu sanieren, eine neue Küche einzubauen, einen Wanddurchbruch vornehmen zu lassen, einen Hund anzuschaffen. Wir tickten da ganz anders. Auch wenn sie mir gegenüber nie einen Zweifel darüber aufkommen ließ, wie unabdingbar ich ihr bei alldem war, muss es von außen so ausgesehen haben, als schleppte sie mich aus unerfindlichen Gründen mit. Fand sie in mir die Sicherheit, die ihr auf anderen Schauplätzen ihres Lebens fehlte? Vermutlich brauchte sie jemanden, der ihrer Gegenwart die nötige Schwere verlieh, der nahezu bewegungslos und unverrückbar war, und dafür kam ich gut infrage. Eine Art Anker, der in großer Tiefe die Verhältnisse befestigte, auch wenn dies schon sehr optimistisch formuliert war. An sich nämlich gab es keinen Grund für ihr Zutrauen, und vermutlich war es töricht und Ausdruck meiner wissenschaftlichen Beschränkung, immer nach einem solchen suchen zu wollen.
Auch mit meinem Professor, Dietrich von Staden, einem kurz vor der Pension stehenden Luther- und Melanchthon-Experten, hatte ich Glück, ein angenehmer und verständnisvoller Mann, der überdies und freundlicherweise nach drei Jahren aufgehört hatte, mich nach dem Stand meiner Arbeit zu fragen. Dafür war er auch zu sehr mit den eigenen Sachen beschäftigt. Er musste hohe Erwartungen in mich gesetzt haben, nachdem er mich bei der Diplomprüfung, damals noch mit manchem Charme und Schneid, über Thomas Müntzers Apokalyptik hatte reden hören, aus der ihm eine unübliche spirituelle Empfänglichkeit, wenn nicht gar Ergriffenheit zu sprechen schien. Diese Zeiten waren längst vorbei, wenngleich ich wohl unterschätzte, dass meine inzwischen schon stupende Apathie in Lebens- und Geistesfragen, wie es Verzweiflung und Gottverlassenheit bei manch anderem ja auch taten, so unscheinbar wie verlässlich auf ihren Gegenpol hinarbeitete. Und das sogar mit von Stadens unbeabsichtigter Unterstützung; ich musste ein paar Seminarordner verwalten, ihm gelegentlich mit Recherchen zuarbeiten, eigentlich zu wenig für das, was ich dabei verdiente. Ich nehme an, er sah das als eine Art Promotionsstipendium, wenn ich schon sonst keins bekommen hatte. Wir trafen uns selten öfter als zweimal die Woche, nur während Konferenzen oder Symposien gab es mehr zu tun.
Das letzte Mal begleitete ich ihn auf eine solche Veranstaltung, als er aus Anlass von fünfhundert Jahren Reformation ein internationales Symposion für Lutherforschung in Wittenberg mitorganisierte und nicht nur einen der Plenarvorträge hielt, sondern auch ein Seminar über «Reformation oder Revolution. Luthers Müntzer-Exegese» anbot. Dafür konnte er seinen HiWi einspannen, und es stellte mich auch kaum vor größere Schwierigkeiten. So schrecklich tiefgründig würde es schon nicht werden, wie sollte es anders sein, jeweils drei Stunden an zwei Tagen vor ein paar interessierten Leuten. Die größte Herausforderung bestand darin, das Ganze ins Englische zu übersetzen. Ich erinnere mich noch ziemlich genau daran, denn die erste Welle warmer Apriltage nach einem langen Winter machte das Ganze fast zu einer Art Urlaubsausflug. Ich kannte Wittenberg noch nicht und nutzte jede freie Minute abseits der Veranstaltungen, um Altstadt, Stadt- und Schlosskirche, Luther- und Melanchthonhaus, Cranachhöfe und die Weiten der Elbauen zu erkunden. Im Anflug des Frühlings, einen ausladenden Dämmerhimmel über mir, den Strom und eine grummelnde Elbebrücke zur Seite, deren hohe Rundbögen einem über alle Horizonte hin nachliefen, kam ich bis zu den Stickstoffwerken Piesteritz. Der Reformator und seine Probleme schienen währenddessen weit entfernt. Durch und durch Stadtmensch und Stadtmönch, war der polternde Quergeist bekanntlich schon ein urbaner Intellektueller gewesen, dessen Erweckungserlebnis sich nicht mehr in der Heide, unter den Sternen, in der weiten Schöpfung oder wilden Natur abgespielt hatte, sondern angeblich in einem dunklen Turm, auf dem Lokus sitzend. Der Himmel konnte sich einem auch anders zeigen. Ich jedenfalls verstand Gott eher am Fluss und fand ihn hier irgendwie mehr bio, unverstellter als in den Exerzitien des Gebets oder im Ringen mit meinem störanfälligen Gewissen.
Streng genommen waren weder meine Vorliebe für abendliche Elblandschaften noch Luthers Vorstellungen von der Rechtfertigung an Wittenberg selbst gebunden. Dafür wirkte die Stadt zu zufällig und neben sich stehend, wahrscheinlich machte sie der Mythos eher kleiner als größer. Wenn man sich Lutherstadt nennen musste, war man schon in die Phase musealer Konservierung eingetreten, in der Denkmäler und Kulturerbesiegel die öffentliche Erinnerung wachhalten sollten. Luther hatte, glücklicherweise oder leider, ich hätte beide Standpunkte nachvollziehen können, nicht mehr viel mit uns zu tun. Einen ersten Eindruck bekam man bei der Eröffnungsveranstaltung des Symposions in der Schlosskirche. Die Gäste, deutsche Theologen, aber auch ein paar Amerikaner, Holländer, Schweizer und Koreaner, mochten dieses Vorurteil zwar nicht gleich bestätigen, denn sie waren noch mit Leidenschaft dabei, mit leichter Nähe zum Kultischen, in der üblichen, rührenden Überschätzung ihrer Forschungsinhalte für die Welt. Die Begrüßungsrede hielt sich im Rahmen des Erwartbaren, freudvoll, herzlich, historisch, mit dem Bild Luthers als Reformers eher denn als Reformators, der die alten Wege aufbrach, Freiheit, Fortschritt und die Zukunft vor Augen. Um dies wieder ein wenig einzufangen, dann Erinnerungen an die Ernsthaftigkeit der Ursprünge, an Verfehlungen, Übertreibungen, falsche Orthodoxien. Bemerkenswerterweise saßen etliche jüngere Leute auf den hinteren Bänken, möglicherweise wie ich angereistes Begleitpersonal, auch einige Musiker eines Orchesters auf Konzertreise, dazu noch Studenten aus Halle und Erfurt.
Die Vorträge an den Folgetagen sind mir sachlich nicht mehr in Erinnerung geblieben, und ich nehme an, dass das unbewusst, zumindest teilweise, auch ihr Zweck gewesen war. Die Thesen waren meist so in den Diskursen versteckt, dass keiner, der nicht in diese eingeweiht war, ihnen Aufmerksamkeit entgegengebracht hätte. Wie auch sonst galt es hier, sich in einem Wust von Bezügen zu verbergen, seine wissenschaftliche Tiefenschärfe unter Beweis zu stellen und Nebelbänke auszuleuchten. Ab und zu konnte man durch ein paar Schlaglichter des Vortragenden so etwas wie eine Position eingrenzen, auch wenn es dem Redner schamlos vorgekommen wäre, dies mit einem klaren Bekenntnis zu verbinden und damit fortan als naiver Einfaltspinsel zu gelten. Selbst von Staden, der am Ende seiner Laufbahn nichts mehr zu verlieren gehabt hätte, von dem vielleicht sogar eine altersweise Klarheit und Durchsichtigkeit zu erhoffen gewesen wäre, verzettelte sich in seinem Vortrag in irgendwelchen Spezialdebatten über Luthers Nähe zu Augustinus, und Eingeweihte, die den verschwiegenen Kontext natürlich sofort mitdachten, verstanden das Ganze als warnende Drohung vor dem Ende der Willensfreiheit und dem finsteren Mittelalter, wenngleich sich der damit beabsichtigte Schauder am Ende nicht mehr recht einstellen wollte.
Von Stadens Vortrag war der letzte am Abend des zweiten Veranstaltungstages. Nach einer kurzen Diskussionsrunde gingen alle nach draußen und freuten sich noch kurz über die laue Luft. Ich stand eine Weile lächelnd und händeschüttelnd neben ihm, und er machte mich mit dem einen oder anderen Kollegen bekannt, darunter auch einem seiner ehemaligen Studenten, Johannes Hinrichs, der nur ein paar Jahre älter war als ich, immerhin aber schon eine Pfarrstelle in Wittenberg hatte. Neben diesem, zunächst etwas unscheinbar, eine junge Frau, die mir von Staden, wohl anspielend auf mein Fachgebiet, als profunde Kennerin weiblicher Ikonographie vorstellte, deren Namen ich zunächst aber nicht verstand oder gleich wieder vergaß. Während die beiden Herren sich nun in ein offenbar nur halböffentliches Zwiegespräch vertieften und froh waren, uns miteinander beschäftigt zu wissen, standen wir uns etwas abgeschoben gegenüber und versuchten, irgendeinen Faden aufzunehmen. Ich fragte, was sie herführe, und siezte sie dabei, was ich ohne Anzug und Anlass nicht getan hätte, fügte aber noch ein saloppes, uns mäßig erheiterndes «Forschen Sie noch oder predigen Sie schon?» hinzu. Sie tat weder das eine noch das andere, erzählte von einer Ausstellung über Katharina von Bora, die sie gerade vorbereite, momentan sei da viel in Bewegung während des Reformationsjubiläums. Sie sei eigentlich freischaffende Künstlerin und habe Altertumswissenschaften studiert, beides aus reiner Lust, die aber die laufenden Rechnungen nicht begleiche, weshalb sie nun alle möglichen Kultur- und Begleitveranstaltungen organisiere, Projektmanagerin sei da wohl der passende neudeutsche Terminus.
In jenen Momenten des sich in alle Richtungen ausbreitenden Smalltalks nahm man weniger vom anderen als die eigenen ungeordneten Befindlichkeiten wahr. Wahrscheinlich hofften wir beide, hier nicht länger aufgehalten zu werden, und waren innerlich schon auf dem Weg nach Hause. Das Einzige, was ich in den hin- und hergeworfenen Versatzstücken eines holprigen gesprächsweisen Abtastens von ihr wahrnahm, waren zwei große, schöne Augen und ein einzelnes Mohnkorn, das sich in ihrer unteren Zahnreihe verfangen hatte, deren makelloses Weiß es damit aber noch zu unterstreichen schien. Offenbar hatten es ihr die Frauen in der Kirchengeschichte besonders angetan, denn schon führte sie eine weitere Ausstellung und künstlerische Installation über Mechthild von Magdeburg an, die sie gerade im Zisterzienserinnenkloster Sankt Marien zu Helfta auf den Weg gebracht habe. Mechthild, sei das nicht die, die einmal geschrieben habe: «O Herr, minne mich gewaltig, und minne mich oft und lang …»? Weiß Gott, nicht mein hellster Moment, noch dazu in unseren aufgeregten Zeiten. Immerhin muss ich dabei aber so trocken und seriös gewirkt haben, dass sie den Ball amüsiert aufnahm und sich nunmehr ein feinsinniges Gespräch über die deutsche mystische Tradition entspann, die mir gerade über Eckhart und Tauler immer eine Herzensangelegenheit gewesen war. So etwas ergab sich eigentlich nur zwischen etwas schrägen Intellektuellen; man war erheitert und erleichtert zugleich, dass es noch andere Menschen gab, die eine so krause Entwicklung genommen hatten, und kam sofort vom Hundertsten ins Tausendste.
Aus dem Wunsch, hier nicht länger festgehalten zu werden, erwuchs langsam das Gefühl, dass dieses Festhängen so unangenehm dann doch wieder nicht war. Alle anderen hatten sich während des Gesprächs schon längst wieder verabschiedet und rückten geschlossen bei einem Italiener ein, während wir, nachdem wir noch eine Weile vor der Tür weitergeredet hatten und von einem aufs andere Bein getreten waren, langsam auf den Gedanken kamen, dass es vielleicht unhöflich sei, den anderen jetzt einfach allein zu lassen. Also gingen wir noch zusammen auf einen Wein ins Brauhaus und saßen dort, bis der Wirt uns hinauswarf. Davor disputierten wir Stunden über die alte katholische Messe, Luthers Gnadenlehre, feministische Auslegungen der Maria-Magdalena-Gestalt, das im Protestantismus verloren gegangene Sakrament der Beichte, die ebenso verloren gegangenen Heiligen, das Urchristentum, das Ausgesetztsein in der ostdeutschen Diaspora. Daran war an sich nichts Merkwürdiges; so lief es wahrscheinlich ab, wenn sich zwei verkopfte Akademiker mit religiösen Restbedürfnissen kennenlernten. Ich wusste danach so gut wie nichts über sie und sie recht wenig über mich, aber vielleicht wussten oder ahnten wir auf einer anderen Ebene mehr, als uns klar war.
Nebenher entfaltete sich vor meinen Augen und in Halbdunkel und Kerzenschein eine ungewöhnliche, um nicht zu sagen wahnsinnige und furchterregende Schönheit (und eigentümliche Reinheit, die noch schwerer zu ergründen war). Eine dunkle, ungeheuer gut gepflegte, leicht gelockte, etwas ausscherende, aber mit Bedacht inszenierte Haarwelle zog sich hinter ihren Ohren entlang, als sei sie nie berührt worden. Perfekte Ordnungen, die für den Maler, weniger für den Menschen gemacht schienen. Nase und Lippen in Proportionen, die idealistische Renaissance-Geometriker nicht glänzender hätten entwerfen können. Man hielt es nicht für möglich, dass solche Menschen existierten, vielleicht aber fielen sie mir in dem rasenden Nebeneinander des Alltags auch nicht weiter auf, und es brauchte dann solche Gelegenheiten, um mal wieder genauer hinzusehen. Ich bildete mir ein, dass es nichts Erotisches hatte, eher so eine Art heiliges Erschrecken über dieses unerwartete Maß an Formvollendung.
Ebenso ebenmäßig verliefen die Dialoge, die etwas seltsam Unpersönliches behielten und in denen weder private Details noch charakteristische Eigenheiten dieser Frau an die Oberfläche traten. So blieb es eine freundliche, engagierte, immer aber auch distanzierte Unterhaltung, in der keiner aus der Deckung kam oder wenigstens den Anschein erweckte, daran etwas ändern zu wollen. Dann bot ich ihr wenigstens das Du an, und wir verabschiedeten uns am Markt, tauschten Telefonnummern aus, Katharina Weißenbach, schön. Sie wohnte eigentlich in Berlin und kam nur über verlängerte Wochenenden nach Wittenberg zurück, wo sie Kindheit und Jugend verbracht hatte. Nebenher lud sie mich noch zum Abschlusskonzert ihrer Ausstellung im Kloster Helfta ein, für den Fall, dass mich die restlichen Veranstaltungen des Luthersymposions langweilen würden. Ich könne gerne mit ihr hinunter nach Eisleben fahren, ein paar Freunde kämen auch dazu. Ich melde mich, sagte ich, und dankte für den netten Abend.
Dann blieb ich drei Tage in Wittenberg, hörte mir die restlichen Vorträge an, darunter einen sehr eindrucksvollen von Hinrichs über Müntzers Schrift Wider das geistlose sanftlebige Fleisch zu Wittenberg, vertrieb mir die Zeit mit Spaziergängen und freute mich auf ein langes faules Wochenende mit Tee und Büchern. Ich meldete mich nicht, erhielt am vorletzten Abend jedoch eine so knappe wie knifflige SMS: «Nun sag, wie hast du’s mit der Religion? Luther oder die Beginen?» Na los, dachte ich, träge, aber freundlich, wie es meine Art war, schauen wir uns Mechthild mal genauer an. Ein sonniger Samstagmittag, sie holte mich vom Bahnhof in Eisleben ab. Wir fuhren nicht ins Kloster, sondern Richtung Wormsleben, parkten dann an einem Weingarten im Grünen, stiegen aus und gingen eine Weile an jenem Steilhang entlang, der hier als «Riss» bekannt war und sich zwanzig Kilometer an der Eislebener Niederung entlangzog. Auf oder über diesen Riss hatte sie, ich weiß nicht wie, auf einer weiten, abfallenden Feldfläche, eine unüberschaubare Zahl an großen, hellen Tüchern gehängt, befestigt an etwa fünf Meter hohen Holzstreben und darüber gespannten Leinen, sodass man den Eindruck hatte, irgendein Riese wolle hier seine Wäsche trocknen. Sie klärte mich darüber auf, dass es sich dabei um aufgehellte Reproduktionen des Brandenburger Hungertuchs handelte, aufwendige Textildrucke, auf denen in altdeutschem Schriftsatz je ein längeres Zitat Mechthilds von Magdeburg zu lesen war, reichlich überspannte Sentenzen wie:
O du gießender Gott in deiner Gabe,
o du fließender Gott in deiner Minne,
o du brennender Gott in deiner Sehnsucht,
o du schmelzender Gott in der Einung mit deinem Lieb,
o du ruhender Gott an meinen Brüsten,
ohne dich kann ich nicht mehr sein.
Oder:
Wenn ich scheine, musst du gluten,
wenn ich fließe, musst du fluten.
Wenn du seufzt, ziehst du mein göttliches Herz in dich hinein,
wenn du weinst nach mir, schließe ich dich in meine Arme.
Wenn du aber minnest, werden wir beide eins …
Oder schließlich:
Vide mea sponsa: Sieh, wie schön meine Augen sind, wie hold mein Mund ist, wie brennend mein Herz ist, wie fein meine Hände und wie schnell meine Füße sind, komm und folge mir!
Sie hatte den Passus nur bis hierhin aufgeführt. Lange Zeit später habe ich das vollständige Zitat gesucht und ergänze es hier: «Du sollst gemartert werden mit mir … die Augen werden dir verbunden, da man dir die Wahrheit nicht eröffnet. … Entkleidet durch Verlassenheit, gegeißelt durch Armut, gekrönt mit Versuchung, angespien durch Schmach. … Verwundet durch die Liebe, den Kreuzestod sterben in heiliger Standhaftigkeit, dein Herz wird durchbohrt durch stete Vereinigung. … Begraben wirst du in der Nichtbeachtung, auferstehen vom Tode in einem heiligen Ende, zum Himmel auffahren in einem Atemzug Gottes.» (Das war mal eine Ansage. Wer wollte da schon Nein sagen?)