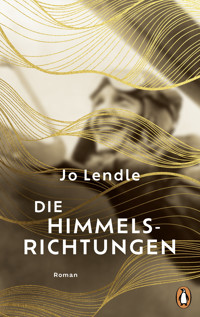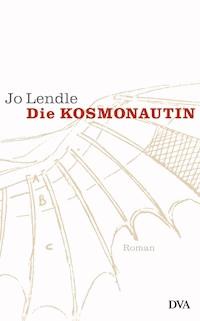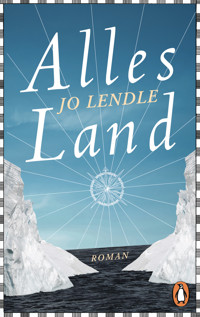
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DVA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein fesselnder Abenteuerroman über den letzten großen Helden der Polarforschung
Alfred Wegener ist ein Getriebener. 1930 bricht er auf, um der Menschheit zu zeigen, dass es möglich ist, am einsamsten Punkt der Erde, im grönländischen Inlandeis, zu überwintern. Aber es gibt Schwierigkeiten – er schafft es nicht mehr zurück zur Küste. Von Wegeners eisigem Grab aus blickt Jo Lendle zurück auf das Leben dieses letzten großen Helden der Polarforschung und verharrt überall dort, wo sich Geschichten darin finden.
Alfred Wegener verschrieb sein Leben der Forschung, war voll der Faszination für Abwegiges, aber auch ein Zweifler mit einer großen Sehnsucht nach Einsamkeit. Ein Leben wie ein Abenteuerroman – den Jo Lendle jetzt erzählt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 430
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Doubt not, go forward; if thou doubt, the beasts will tear thee piecemeal.
Alfred Tennyson
Kein Horizont. Der Wind treibt Schnee über den Boden wie einen Schwarm kleiner Tiere, von denen eines dem anderen folgt. Am Ende gehen sie über ins stumpfe, leere Weiß des Himmels.
Uns stört der Schnee nicht, die Skistöcke ragen aus dem Treiben heraus. Aber für die Hunde ist es eine Quälerei. Ihr Fell längst weiß gefroren, manchmal schnappen sie im Laufen nacheinander und nach den Schlittenleinen, dann sind ihre Schnauzen zu sehen und die von Schnee verklebten Augen. Starker Südwest, zum Glück haben wir ihn im Rücken, der Wind treibt uns vor sich her. Die Flocken wirbeln herum, umzingeln Schlitten und Hunde, um sich vor uns wieder zu vereinen. Wir sind kein Hindernis.
Die Flocken haben es so eilig, als hätten auch sie ein Ziel. Sie werden vor uns dort sein.
Unter dem Schneefegen ist kein fester Boden zu erkennen, vielleicht gibt es keinen mehr. Es hilft nichts, an die Spalten zu denken. Vor achtundzwanzig Stunden sind wir aufgebrochen, und noch immer ist es hell. Seither fahren wir auf dem Inlandeis, in der Wohnung der bösen Geister, wie die Grönländer es nennen.
Was werden wir finden? Beim Warten auf dem Schiff erzählte Wegener von Scott, wie man ihn und seine Leute entdeckte, eine Tagesreise vor dem rettenden Depot. Bis zum Ende trugen die Männer ihre Gesteinsproben mit sich, die Steinkohle mit den Pflanzenabdrücken. Man fand sie unter ihnen, im Schutz ihrer Körper.
Wer sich nicht mit jeder Faser daran klammert, heil zurückzukehren, könnte hier wohl vom Verstand kommen. Wir fahren ohne Pause, nach Schlaf ist keinem zumute. Die letzten Felsen sind verschwunden. Unter uns kilometerdickes Eis, Wegener hat es selbst gemessen.
Dies ist wahrhaftig der einsamste Ort der Welt.
Dann der dunkle Fleck in der Ferne. Ein Schatten, wie sich im Näherkommen zeigt, der auf dem Schneefegen liegt wie auf festem Land. Wir fahren jetzt dicht beieinander.
Lange gelingt es uns nicht auszumachen, was den Schatten wirft. Keiner sagt ein Wort. Erst als wir langsamer werden, gibt es sich zu erkennen: Zwei Skier stecken gekreuzt im Firn, dazwischen ein zersplitterter Skistock. Sobald wir stehen, stürzen sich die Hunde auf das Leder ihrer Geschirre und fressen es auf.
Die Alfonsinischen Tafeln
Alfred Wegener hatte mehr Geschwister, als einem Menschen zu wünschen ist. Sie standen um ihn herum und schauten ihn an, sie stießen sich in die Seite und zeigten auf ihn, einige griffen schon über den aus Weiden geflochtenen Rand der Wiege und wollten ihn kneifen, aus Liebe.
Nur mit Mühe gelang es seiner Mutter, die Kinder zurückzuhalten. Vierundzwanzig Stunden hatte die Geburt gedauert, einen ganzen Tag. Anna Wegener war eine kaum zu erschütternde Frau, aber der Versuch, diese Horde zu bändigen, brachte sie an den Rand ihrer Kräfte.
Die Hebamme hatte Mutter und Kind für einen Moment allein gelassen, um den Bottich hinunter in die Waschküche zu bringen, auch sie erschöpft von der langen Arbeit. Beim Aufstehen war ihr auf einmal schwindelig geworden, und sie fror vor Müdigkeit. Es war zu kalt hier drin, zu kalt für ein Geburtszimmer. Sie hatte all das weiße Leinen zusammengerafft, die Laken und Tücher, und dann von außen die Zimmertür nicht wieder verschlossen.
Die Kinder hatten keinen Augenblick gezögert. Kaum dass die Hebamme auf der Kellerstiege verschwunden war, schlüpften sie schon hinein, eins nach dem anderen. Sie brachten mit, was draußen war und was in den letzten vierundzwanzig Stunden hier drinnen keine Rolle gespielt hatte, ebenso wenig wie der Wechsel von Tag und Nacht.
Vor der Tür war große Pause, dort war Montag, es war der erste November des Jahres 1880. Draußen war Allerheiligen, ein Feiertag, der in Berlin, Hauptstadt des Königreichs Preußen, nicht begangen wurde. Kein Grund, die Schule ausfallen zu lassen. Die Kinder waren wie jeden Morgen zum Unterricht gegangen. Die Mutter hatte sie rufen gehört, am Morgen nach dieser endlos langen Nacht, dann war es die ersten Schulstunden lang still geblieben, und nun hatte drüben der Gong geschlagen. Die Kinder verbrachten ihre große Pause hier, bei ihrem neuen Bruder.
Es waren erheblich zu viele. Zu den vier leiblichen waren die anderen Geschwister zu zählen, zwei Dutzend sicherlich, vom Oberprimaner bis hinunter zu denen, die erst seit Kurzem bei ihnen waren. Lange, blasse Träumer ebenso wie dicke Landkinder mit vor Fröhlichkeit glänzenden Augen. Alles Knaben, alle hatten sie kurz rasiertes Haar und liefen immerzu durcheinander. Es waren die Söhne verstorbener Beamten, Lehrer und Pastoren aus der Mark Brandenburg, die bei ihnen im Waisenhaus wohnten. Alfred Wegener wurde hineingeboren in ein wildes, lärmendes Rudel, das niemanden je in Ruhe ließ.
So verschieden die Jungen waren, jeder trug seine Schulkleidung, schwarze Hosen, helles Hemd mit dem eingestickten Wappen, eine Strickjacke gegen die Kälte – die Uniform des Gymnasiums zum Grauen Kloster. Alfreds Vater war Lehrer dort, er unterrichtete alte Sprachen. Er ließ seine Schüler Plato lesen und Ovid und die Psalmen, so gut es eben ging. Er ließ sie aufschreiben, was sie verstanden, bis auch der letzte begriffen hatte, was er las.
Mittags, nach der letzten Schulstunde, kamen die Geschwister herüber ins Waisenhaus. Alfreds Vater begleitete sie, er stand der Anstalt vor. Seine Familie lebte mit den Zöglingen unter einem Dach. An den Sonntagen zogen alle in die benachbarte Klosterkirche, wo der Vater die Predigten hielt.
Schon am siebten Morgen seines Lebens besuchte Alfred zum ersten Mal einen dieser Gottesdienste, in der Woche darauf den nächsten und immer so fort, gemeinsam mit allen anderen, immer gemeinsam, und niemals blieb einer von ihnen allein.
Alfred Wegeners Vorfahren hatten seit Jahrhunderten als Pfarrer in Schlesien und der Mark gelebt, in Dörfern, deren Namen es längst nicht mehr gab. Sonntags hatten sie den Menschen mit leiser Stimme aus den Evangelien vorgelesen, sie hatten die Kinder Beten gelehrt und Lesen und Singen und Hoffen. Von jedem hatten sie Namen und Geburtstag im Kopf und hielten daneben schon etwas Platz für den Sterbetag. Sie kannten das Leben jedes Einzelnen, sie tauften, trauten und begruben sie. Im Gegenzug versorgten die Bauern sie mit allem, was man zum Leben brauchte, und oft waren ihre Häuser die schönsten des Ortes, weil alle zusammen sie errichtet hatten.
Diese Vorfahren waren eigensinnige Menschen gewesen, selbstbewusst gegenüber den Kirchenoberen und unempfänglich für ihre Vorgaben. Lieber studierten sie selbst die Heilige Schrift und legten sie aus, wie es ihnen für ihre Schützlinge am besten erschien. Sie erfanden eigene Rituale und neue, vielstimmige Gesänge.
Nur allmählich wuchsen ihre Interessen über das Seelsorgamt hinaus.
Alfreds Vater war der erste in der Reihe seiner Ahnen, der schrieb. Begonnen hatte er mit theologischen Aufsätzen, die von Mal zu Mal freimütiger ausfielen und sich mit jedem Anlauf weiter von Gott entfernten. Richard Wegener schrieb nachts, wenn alles schlief, vielleicht sogar Gott. Er hätte nicht erklären können, was falsch daran war. Er fühlte nur, dass sein Schreiben ihn von der Welt entfernte, aus der er kam, von ihren Regeln und Gesetzen.
Tagsüber nahm er sich vor, damit aufzuhören, nachts aber lockte ihn die Grenzenlosigkeit der leeren Seite. Am Ende stand eine kleine Sammlung von Gedichten, der er den Titel Poetischer Fruchtgarten gab. Er zeigte sie nicht einmal seiner Frau.
Ein Verleger in Cöthen erklärte sich zur Publikation bereit, bald darauf bekam Richard Wegener sein Handexemplar geschickt, in rotes Leinen gebunden. Er verbrannte es im Kamin.
Als das Feuer erlosch, war das Buch zu Asche geworden, ohne zerfallen zu sein. Deutlich war noch der Titel zu erkennen und das eingesetzte Schildchen mit der Zeichnung eines Bauerngartens, in der Mitte ein schreiender Hahn. Darüber sein Name. Er nahm den Schürhaken und stocherte so lange in der Asche, bis nichts als helle Flocken übrig waren.
Richard Wegener schrieb nie wieder ein einziges Gedicht. Beim Einschlafen betete er, seine Kinder würden niemals von den Abschweifungen ihres Vaters erfahren. Sie sollten auf Gottes Wegen bleiben.
Seine Frau hatte er in Wittstock getroffen. Da war er vierundzwanzig gewesen und noch immer Student der Theologie. Er wollte der Welt etwas schenken. Anna Schwarz hatte früh ihre Eltern verloren. Richard hatte seit jeher eine Schwäche für Waisenkinder gehabt. Er sah sie auf einem Empfang des Superintendenten, bei dem sie aushalf, Anna lief mit einem Krug voll Eiswasser durch die Reihen der Gäste, es war ein brütend heißer Nachmittag. Neben dem Gemeindehaus gab es ein kleines Dörr-, Brau- und Waschhaus. Später behauptete er, Anna habe ihm schöne Augen gemacht. Sie entgegnete, sie habe sich nur gewundert, warum er die ganze Zeit zu ihr herüberstarrte.
Sie hatte damals schon dieses Gesicht, mit den großen blauen Augen. Er fror an diesem Nachmittag im Hof des Superintendenten von all dem Eiswasser, das er sich hatte bringen lassen. Ihm gefiel ihr Familienname, er stellte sich vor, dass bei der Hochzeit alle in Schwarz kämen. Erst auf dem Heimweg wurde ihm bewusst, dass er nicht in der Lage war, eine Familie zu unterhalten. Von diesem Tag an tat er alles, um in diesen Stand zu geraten.
Ein knappes Jahr später hielt er sein Abschlusszeugnis in der Hand und fand eine Stelle als Hilfsprediger in der Provinz Posen. Sie brachte ihm dreihundert Taler Jahresgehalt und die Kollekte der Weihnachtsfeiertage. An Johannis 1868 beim ersten Gurren der Tauben hatte er Anna zum Traualtar geführt, bei ihrem Eintreten in den Kirchenraum erhoben sich alle von den Bänken, ein einziges schwarzes Rascheln von Bratenröcken und Taft.
Wenn die Mutter am Vormittag die Wäsche besorgte, legte sie ihren Jüngsten auf den Boden des Elternschlafzimmers im ersten Stock des Hauses an der Friedrichsgracht. Alfred war jetzt ein Dreivierteljahr alt. Es war Sommer, alles kam in Bewegung, nur Alfred nicht. Er verbrachte seine Vormittage auf der Schurwolldecke, ohne sich zu regen. Manchmal sorgten sich seine Eltern, er könne für immer so liegen bleiben, und stritten leise, ob man ihm helfen müsse, die Gliedmaßen zu bewegen, oder ob die Bewegung von selber komme, aus Gott.
Alfred lag bäuchlings auf seiner Decke, den Kopf weit im Nacken. Zwischen den Vorhängen fiel ein Streifen Licht herein, in dem der Staub tanzte. Über dem dunklen Bett hingen die Gesichter seiner Großeltern und schauten auf ihn herab. Im offenen Uhrkasten hielt das Pendel die Zeit in Gang. Es gab ein Übermaß an Geruch in diesem Zimmer. Nach Lavendel roch es, nach Staub, nach den Schurwollschlaufen unter seinem Kinn. Es roch nach dem Geschmack in seinem Mund und nach den Körpern seiner Eltern, wenn sie ihn an sich drückten. Zwischen den Bettpfosten stand ihr Nachtgeschirr, von einem grauen Tuch bedeckt.
Da bewegte sich auf einmal etwas, direkt vor Alfreds Augen, eine schwarze Flocke. Er kniff die Lider zusammen. Es war eine Ameise. Alfred ließ ein gurgelndes Lachen hören, er freute sich. Auch die Ameise hob ihren Kopf und streckte die Vorderbeine aus. Endlich gelang es auch ihm, die Arme zu heben. Er wünschte sich, das Tier zu berühren, immer wieder ballte er die Faust, stieß gegen seine Schläfe und in die Luft. Nach einer Weile erst traf er endlich das Tier und zerdrückte es mit einem Schrei der Wonne.
Dahinter lief eine zweite Ameise und hinter dieser noch weitere. Es war eine kleine Kolonne, eine emsig krauchende Linie zappelnder Pünktchen. Sie zog sich unter dem Bett entlang, um den Nachttopf herum und an der Fußleiste vor bis zur Tür.
Alfred lief ein dünner Faden Speichel auf den Handrücken. Er stemmte die Arme auf die Decke und drückte seinen Leib in die Höhe. Der kleine, in ein Nest weißer Windeln gebundene Körper bäumte sich auf und fiel zur Seite. Alfred rollte von der Decke, der ganze Raum wickelte sich um ihn, bis er gegen die Kante des Bettes schlug und auf dem Rücken liegen blieb. Er hörte sich atmen. Aus ihren hölzernen Rahmen sahen die Großeltern seinem Treiben zu.
Alfred streckte die Hand aus und fasste nach dem Fuß des Bettes. Seine Finger krallten sich ums dunkelbraune Holz, dann spannte er den Arm an und drehte sich langsam zurück auf den Bauch. So kannte er alles wieder. Vorsichtig zog er am Bett und rutschte stattdessen selber vorwärts. Wie leicht es ging. Mit den Händen schob er sich weiter. Schon berührte er mit der Stirn den Rahmen und beugte den Kopf, bis er unter dem Bett verschwand. Er tauchte ein in den Strom der Ameisen.
Die Unterseite der Matratze war rissig. Das Netz aus Stahlfedern hing in der Mitte durch, sie kratzten ihm über die Haut, hakten sich im Stoff der Windeln fest und zerrissen sie. Unaufhörlich schob er sich voran. Es war finster hier unten, der Nachttopf gab, als Alfred mit der Stirn dagegenstieß, einen dunklen Ton von sich. Längst tappte er mit den Händen auf Ameisen, krabbelten Ameisen über seinen Körper, sein Gesicht, sie verloren sich in den Falten seiner Windeln und bissen in seine Haut. Alfred weinte, aber er zog sich weiter. Vor ihm leuchtete der Spalt, wo es hinausführte ins Zimmer.
Als er sich unter dem Bettrahmen zurück ins Freie geschoben hatte, legte Alfred für einen Moment die Wange auf das Holz des Parketts und versuchte zu Atem zu kommen. Er wischte sich mit der Faust übers Gesicht und hob den Kopf.
Die Tür vor ihm stand offen. Die Mutter ließ sie geöffnet, um zu hören, wenn er schrie. Alfred sah, wie der Zug der Ameisen im Schatten des Türrahmens weiterlief und sich erst in der Ferne verlor, eine krabbelige Linie. Aus den Augenwinkeln sah er, dass die Blicke seiner Großeltern ihm folgten. Es würde ihnen nicht gelingen, ihn aufzuhalten.
Hinaus auf den Flur ging es wie von selbst. Die Streben des Treppengeländers waren schmal, Alfred robbte sich an den oberen Absatz heran.
Die ersten Stufen überwand er kopfüber, seinen Fall abwechselnd mit Stirn, Nase und Kinn bremsend. Er überschlug sich, die Windel dämpfte seinen Aufprall. So blieb er für einen Moment liegen. Dann ließ er sich Stufe für Stufe hinab.
Er wusste nicht, was ihn am Ende seiner Reise erwartete. Niemals war er auch nur annähernd so wach gewesen wie jetzt. Auf den Rändern der Stufen lag eine Schicht aus Staub, die verschwand, wenn man darüberstrich.
Am Fuß der Treppe fand er die Ameisen wieder. Ihre Spur zog sich über den Steinfußboden, er hatte nun keine Mühe mehr, ihnen zu folgen. Erst am Ende der Diele stieß Alfred auf eine Tür, die weiß war. Er drückte sich dagegen, aber sie ließ sich nicht öffnen. Nur die Ameisen zwängten sich durch eine Ritze unter der Fußleiste.
Alfed sah sie verschwinden, und auf einmal überwältigte ihn ein Sturm aus Unglück, Kälte und Hunger. Er drängte sich an die Ritze, als könnte er sich daran wärmen.
Tony fand ihn, seine größere Schwester, als sie vor den anderen von der Schule heimkam. Niemand konnte sich erklären, wie es ihm gelungen war, dorthin zu gelangen. Von nun an blieb, wenn die Mutter ihn zur Ruhe legte, die Tür verschlossen.
Einen ganzen Sommernachmittag über saß Alfred neben Käte im Garten, jeder mit einem Halbschuh im Schoß, und seine Schwester zeigte ihm, wie man eine Schleife band. Es war ganz still im Garten. Sie hatten Zeitungspapier unter die Sohlen gelegt, um sich die Kleidung nicht schmutzig zu machen. Alfred sah auf seine Hände hinab, zwischen denen sich die dünnen Schnürsenkel wanden. Seine Finger nahmen das eine Ende und legten es zu einer Schlaufe, umwickelten sie mit dem anderen Band, doch bevor es ihnen gelang, eine weitere Schlaufe zu legen, entglitt ihnen die erste schon. Alfred sah seinen kurzen, groben Fingern zu. Er wusste genau, was sie hätten tun müssen, aber sie taten es einfach nicht. Immer wieder begann er von vorne, mit zusammengepressten Lippen, bis ihm am Ende die Finger zu zittern begannen. Am liebsten hätte er sie sich abgeschnitten.
Die Schwester lachte, als er seinen Schuh auf den Rasen warf. Sie zeigte es ihm noch einmal in aller Ruhe, und Alfred machte einen neuen Versuch. Er merkte nicht einmal, dass Käte weiter lachte, über ihn, weil ihm vor Anstrengung die Zunge aus dem Mund heraushing. Bei jeder Bewegung seiner Finger sprang sie hin und her, er konnte sich nicht dagegen wehren. »Eher wirst du dir einen Knoten in die Zunge machen als in dein Bändel«, sagte Käte. Am frühen Abend endlich gelang ihm die erste Schleife, da war seine Schwester längst ins Haus gegangen. Alfred wiederholte das neue Spiel, bis seine Mutter kam und ihn zum Essen holte.
Anna Wegeners Sorge galt vor allem ihren drei jüngsten Kindern. Im Jahresabstand geboren, waren sie weniger kräftig als die älteren, und die Mutter fürchtete um ihre Gesundheit. Im Garten wuchs Holunder, aus den Beeren kochte sie einen schwarzen Sirup, der bitter war, aber gegen die Erkältungen helfen sollte, an denen Käte, Kurt und Alfred während der Hälfte des Jahres litten. Sie kochte süße Grießknödel und übergoss sie mit dem Sirup, damit sie ihn aßen. Sie kaufte Lebertran und erzählte ihnen Geschichten über den Wal, von dem der Tran stammte. Wenn sie zu der Stelle kam, an der die Fänger ihre Harpunen nach ihm schleuderten, steckte sie jedem ihrer Kinder nacheinander einen vollen Löffel in den Mund. Dazu schilderte sie, wie der Wal ein letztes Mal zu tauchen versuchte. Fast wäre das Schiff unter Wasser geraten. Die Kinder schluckten die Medizin ohne Gegenwehr.
Abends, wenn Alfred und seine Geschwister schliefen, lag Anna Wegener auf dem Kanapee und aß von dem Quittenbrot, das sie in großer Menge selber zubereitete. Die anderen Familienmitglieder verzogen den Mund, wenn sie die Schale auf den Tisch stellte, weil es ihr immer ein wenig bitter geriet, dabei brauchte es nichts als eine Prise Puderzucker. Dazu las sie die Schriften des Pfarrers Sebastian Anton Kneipp. Obwohl katholisch, hatte er bedenkenswerte Ansichten. Ihr imponierte, dass ihn ein Bad in der eiskalten Donau von seiner Tuberkulose geheilt hatte. Einen seiner Sätze behielt sie im Gedächtnis: Wenn du merkst, du hast gegessen, dann hast du schon zu viel gegessen. Morgens bei Sonnenaufgang lief sie von nun an mit ihren drei Jüngsten an den Gartenteich, zog ihnen Schuhe und Strümpfe aus, und Käte, Kurt und Alfred sprangen mit Geschrei in das kleine Becken. Sie mussten sich aneinander festhalten, um nicht umzufallen vor Überschwang. Manchmal begleiteten die Größeren sie, aber sie durften nicht mit hinein zum Wassertreten. Stumm standen sie am Rand des Teiches und ärgerten sich, so gut bei Gesundheit zu sein.
Alfreds Kindheit erstreckte sich zwischen dem Esstisch, der Schulbank, dem Garten, der Kirche und ihrem großen Schlafsaal. Auch die Kinder der Familie schliefen nachts zusammen mit den Waisen in der allgemeinen Bettenstube, das empfindliche Gerechtigkeitsgefühl ihres Vaters ließ es anders nicht zu.
Alfred gehörte das Bett am Fenster. Auf seinem Nachttischchen stand eine Schneekugel, die er abends in die Hand nahm, um ihre glatte, kühle Form zu spüren. Wenn der Mond aufging, brach sich sein Licht darin. Dann schüttelte er die Kugel und sah den Schnee unhörbar niedergehen wie in einer Sanduhr. Unter der gläsernen Kuppel steckte der Kölner Dom, klein und stolz wie Alfred selbst. Das Spielzeug war ein Geschenk seines Onkels gewesen, zu Alfreds Geburt, als der Dom gerade fertig gebaut worden war. »Sechshundert Jahre nach dem ersten Spatenstich«, hatte der Onkel zu Anna gesagt. Gut, dass der Junge schneller fertig geworden sei.
Geschwindigkeit war jetzt in aller Munde. Überall gab es neue Pläne. Beim Frühstück schaute der Vater von seiner Zeitung auf und sagte, nun wollten sie in Berlin eine neue Eisenbahn bauen, unter der Erde. Er las die geplanten Fahrzeiten vor, und Alfred lernte sie auswendig. Von der Warschauer Straße bis zum Stralauer Tor würde die Bahn nur eine Minute brauchen. Er selbst hätte sich in dieser Zeit nicht einmal die Schuhe geschnürt.
Für den Küchenherd gab es eine Waffelpfanne aus Eisen. Am Totensonntag hob die Mutter mit der Ofenzange das runde Mittelstück aus der Herdplatte und danach einen Ring nach dem anderen, von den kleineren im Zentrum bis zu den äußeren, immer höher schlugen die Flammen hervor, und Alfred, der danebenstand, fürchtete schon, sie könnten ihn erreichen, aber da kam die Mutter und setzte die Pfanne genau in das Loch hinein. Während sich das Eisen erwärmte, bereitete sie den Teig, dann wurde gebacken. Die Mutter riss die heißen Waffeln mit bloßen Händen auseinander und verteilte sie. Die Kinder verglichen die Größe ihrer Stücke und prüften, wo sie aneinanderpassten. Immer beschwerte sich Willi, Alfreds ältester Bruder, er sei zu kurz gekommen, aber niemand achtete darauf. Jedes Kind durfte sich selbst Puderzucker auf seine Waffeln streuen.
Als die Mutter einmal den Raum verließ, beugte sich Willi zu Alfred hinüber und fragte, ob er schon einmal im ewigen Eis gewesen sei. Vorsichtig schüttelte Alfred den Kopf. »Hier drin«, sagte Willi, »ist das ewige Eis«, und hielt ihm die Puderzuckerdose hin. Neugierig näherte sich Alfred den Löchern im Deckel, da klopfte Willi von unten ans Blech der Dose, und Alfred hatte das Gesicht voll von dem weißen Staub.
Das Lachen der anderen, das Ringen um die Puderzuckerdose und wie im Versuch, sie Willi aus der Hand zu reißen, immer weitere Wolken in die Luft stiegen, die langsam durch den Raum zogen. Alfreds Sorge, ob das erlaubt war, und seine entsetzliche Wut, die alles überdeckte. Endlich bekam er die Dose mit beiden Händen zu packen und riss daran, aber es war nur der Deckel, den er in der Hand hielt. Lachend machte Willi einen Schritt auf ihn zu und schüttete die ganze Ladung über ihm aus. Als die Mutter zurückkam, war das Zimmer eine weiße Wüste. Darin nur die vor Schreck erstarrten Kinder und der schwarze, vor Hitze puckernde Ofen.
Zu Weihnachten bekam jedes der Kinder einen Satz Kreidestifte in allen Farben. Nebeneinander saßen sie an dem langen Tisch und füllten Blatt um Blatt. Am beliebtesten waren die Rötel mit den Hautfarben, immerzu mussten sie gespitzt werden. Am Ende verschenkte Alfred seine an Kurt, um ihm eine Freude zu bereiten. Er malte ohnehin keine Menschen.
Das Trommeln überall, das Knallen und die Schüsse, der Lärm von allen Seiten. Alfred war noch niemals nachts auf der Straße gewesen, ohne die Eltern. Beim Aufbruch hatte er mit einem Mal nicht mehr mitgewollt, aber die Geschwister gaben sich den Anschein, sie würden so etwas jeden Abend erleben. Also war er mit den anderen, in die steifen Mäntel, Shawls und Fellhandschuhe gepackt, vor die Tür getreten, und Alfred hatte Sterne am Himmel gesehen, die unbeweglich zwischen den eilig ziehenden Wolken standen. Das Wasser im Schleusengraben war gefroren, das Eis von Schnee bedeckt. Der Vater sagte, es werde ein schönes Neujahr geben, und Alfred wunderte sich einmal mehr, was sein Vater alles wusste. Der Vater würde am Morgen in der Aula die Predigt halten, über Matthäus 7, Vers 7, das hatte ihm die Mutter geflüstert, weil es Alfreds Taufspruch war. Bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch aufgetan. Alle Kinder aus dem Waisenhaus würden da sein und zuhören, und am Ende blieben sicherlich wieder einige einfach in den Bänken sitzen, weil sie gar nicht zurückwollten auf ihre Stube, fort von den schönen Worten.
Von der Mutter hatten sie sich Bratpfannen und Deckel geben lassen, die sie nun gegeneinanderschlugen, um den Radau zu machen, der zum letzten Tag des Jahres gehörte. Alfred versuchte sich die Ohren zuzuhalten, was ihm nicht gelang. Kaum dass sie über der Brücke waren, hatte Willi ihm eine gusseiserne Kasserolle über den Kopf gezogen, die er nun mit regelmäßigen Schlägen eines Kochlöffels bearbeitete. Alfred bemühte sich, darunter hervorzulächeln, es war das erste Mal, dass er dabei sein durfte. Seine Aufgabe war es, in der Nähe des hellen Tons zu bleiben, bei den leeren Sodaflaschen, die Käte gegeneinanderschlug, sie lief ganz vorn. In der Hand hielt Alfred die große Milchkanne aus Blech, und wenn Willi eine Pause machte, hieb Alfred mit einem Rührstab gegen das Metall, ein dumpfer Klang, und für einen Moment war nichts anderes zu hören als seine Schläge und ihr leiseres Echo von den Häusern der anderen Straßenseite.
In der Dunkelheit unter seinem Topf versuchte Alfred sich vorzustellen, wo sie entlanggingen. Anfangs fiel es ihm leicht, ihren Weg zu verfolgen, aus dem Haus und am Ufer entlang, beim Bäcker vorbei, bei dem es selbst in der Nacht nach Teig roch. Dann wurde ihm schwindelig von all dem Lärm, und er hatte genug damit zu tun, achtzugeben, aus welcher Richtung das Klingeln der Sodaflaschen kam. Einmal meinte er, die Geräusche vom Wirtshaus zu erkennen, aber hätten sie dahinter nicht die Gertraudtenstraße kreuzen müssen? Tatsächlich, schon fühlte er unter den Sohlen die Bürgersteigkante, und da waren die Geleise der Pferdebahn. Kein Wagen war unterwegs. Nun müssten sie beim Molkereiladen sein, zu dem ihn die Mutter morgens mit der Kanne schickte, Alfred stellte sich vor, wie finster die Scheiben jetzt waren, die morgens so milchweiß glänzten.
Ihm wurden die Finger kalt, er nahm Kanne und Schlegel in die eine Hand und steckte die andere in die Tasche des Mantels. Zu seinen Füßen war der Schnee zu erkennen, über den sie liefen. Wenn sie unter einer der Gaslaternen vorbeikamen, strahlte es heller und sah noch kälter aus. Die Schneekristalle glitzerten wie lauter winzige Sterne. Es kam ihm vor, als würde Willi immer kräftiger schlagen, in den Pausen zwischen den Schlägen wurde es kaum leiser in seinem Kopf. Auf einmal sah Alfred Flecken vor der schwarzen Wand der Kasserolle, als liefe er durch einen nächtlichen Schneesturm, ganz allein. Er hörte nichts mehr vor lauter Lärm, ihm liefen Tränen über die Wangen, aber er konnte sie ja nicht abwischen. Am Ende setzte er sich einfach auf den Boden, die anderen zogen ihm den Topf vom Kopf und rieben ihm so lange das Gesicht mit Schnee ein, bis alles wieder gut war.
Vor dem Haus lag der Schleusengraben, an dem spielten sie, wann immer das Wetter es erlaubte. Am Ufer schauten die Pfosten aus dem Wasser heraus wie verlorene Seelen. Die Pfähle trugen Haarschöpfe aus Gras, an denen man sie unterscheiden konnte, den Stutzer, das Fräulein, den Veteranen, die Elfe. Mittags hängten die Angler ihre Kescher zum Trocknen darüber, dann bekam das Fräulein einen Schleier, und die Elfe sah aus wie ein gefangenes Tier.
Meist blieben sie am Unterwasser vor dem Haus, zwischen Jungfernbrücke und Grüner Straße. Nur wenn sie nicht gesehen werden wollten, zogen die Kinder hinauf zum Oberwasser oder balancierten über die eisernen Ausleger der Gertraudtenbrücke zum Spittelmarkt, wo sie an den Kandelabern Abschlagen spielten und den Wagen der Pferdebahn nachsahen. Sie liefen hinüber ans Cöllnische Ufer und träumten vor den Schaufenstern der Technischen Anstalt, vor den Rokokokerzen der Wachshandlung Hildebrand, vor den optischen Instrumenten der Lorgnettenfabrik, sie sahen die riesigen Buchstaben der Kompass-Werke im Himmel stehen und flanierten über den Mühlendamm wie feine Leute, immer zu zweit nebeneinander, Hand in Hand, damit im Gedränge niemand verloren ging. Wenn sie von ihren Ausflügen zurückkamen, rannten sie das letzte Stück um die Wette und setzten sich verschwitzt auf die Jungfernbrücke vorm Haus, wo sie bis zum Abendessen Steine ins Wasser warfen. Sie sahen den flachen Kähnen zu, die langsam durch die enge Durchfahrt unter ihren Füßen glitten.
Manchmal trat eine einzelne, weiß verschleierte Gestalt zu ihnen auf die Brücke. Ein alter Hochzeitsbrauch verlangte, dass jede Braut der Gegend auf dem Weg zur Trauung hinüberlief zu ihrem Bräutigam, der am anderen Ufer mit den Gästen auf sie wartete. Blieb alles still, stand dem Jawort nichts im Wege. Knarrten dagegen die Bohlen, so gab es Grund, an ihrer Jungfräulichkeit zu zweifeln. Die Bohlen allerdings knarrten immer, die Hochzeitsgesellschaft brüllte vor Lachen, die Braut errötete unter ihrem Schleier, was sie noch zauberhafter aussehen ließ, der Bräutigam machte gute Miene, und alle zogen froher Dinge weiter zur Kirche.
Die Geschwister blieben bis zur letzten Schleusung. Wenn eine Jolle herankam oder ein Boot mit höherem Aufbau, sprangen sie zu den riesigen Kurbelrädern der Brücke, über die die Zugketten liefen. Auf ein Kommando hin begannen vier von ihnen zu kurbeln wie Steuermänner im Sturm, während die anderen sie anfeuerten. Die Ketten spannten sich rasselnd, langsam hob sich der Brückengrund, als täte die Erde sich auf, und teilte sich in zwei Hälften, die ruhig in die Höhe glitten. Wenn die Brücke offen stand, gaben die Kinder dem Schiffer die Durchfahrt frei und stellten sich nebeneinander an die niedrige Brüstung wie Matrosen an der Reling, die Hände am Mützenspiegel zum Gruß. Nur die Brüder an den Kurbeln hielten die Hände ruhig auf ihren Steuerrädern und blickten in die Ferne, als wären sie auf großer Fahrt.
Der Auftritt verfehlte nie seine Wirkung. Der Letzte in der Reihe kletterte rasch über das Geländer hinunter zum Schiff und nahm das Brückengeld entgegen.
Mit den Jahren wurden die Geschwister weniger. Am Tag nach Alfreds sechstem Geburtstag begruben sie Käte, die sich von einer Lungenentzündung nicht erholt hatte. Willi starb im darauffolgenden Frühjahr, als er beim Schlittschuhlaufen auf dem Kanal vor dem Haus einbrach und nicht wieder auftauchte. Er musste unter dem Eis abgetrieben sein. Als man abends die Suche längst eingestellt hatte, saß Alfred noch immer am Ufer und wartete darauf, dass alles nur ein Streich gewesen war. Er glaubte, Willis Trommelschläge vom Jahreswechsel wieder zu hören. Nachts bekam er den Anblick des schwarzen Wasserlochs nicht mehr aus dem Kopf. Sein Vater setzte sich an sein Bett und riet ihm, das Bild zu vergessen. Willi sei jetzt im Herrn. Dabei wusste Alfred ja, dass er im Kanal war.
Er fragte: »Wohin führt der Graben?«
»In die Spree.«
»Und weiter?«
»In die Havel.«
»Und die Havel?«
»Fließt in die Elbe.«
»Wo endet die?«
»In der Nordsee«, sagte der Vater.
Von einer Nordsee hatte Alfred noch nie gehört.
Am offenen Sarg las der Vater aus der Genesis vor: »Steht dir nicht alles Land offen? Scheide dich doch von mir.« Alfred war froh, nicht über den Rand in den leeren Sarg schauen zu können.
Bei der Beerdigung ging er an der Hand seiner Mutter. In einem großen Kreis standen sie am frisch ausgehobenen Grab, die ganze Familie mit allen Kindern des Waisenhauses, und keiner sagte ein Wort. Anfang April, ihre guten Schuhe vom Schlamm bespritzt. Dann trat Alfred vor, griff in die Tasche seines Anzugs, kniete am Rand der Grube nieder und legte dem Bruder seine Schneekugel auf den Sarg.
Zurück bei der Mutter, vergrub er seinen Kopf in ihrem Schoß. Sie strich ihm über den Scheitel, aber er konnte nicht aufhören zu weinen. Sie erinnerte ihn daran, wie fröhlich Willi gewesen sei, es ließ ihn nur lauter heulen. Am Ende sagte sie: »Das Leben ist ein Kunstwerk Gottes. Niemand kann voraussagen, ob es glücken wird oder misslingt. Es bleibt uns nichts anderes, als seine Werke zu betrachten und uns zu freuen, wenn sie ihm gut geraten.«
Alfred hörte auf zu weinen. Dort, das Gesicht im schwarzen Kleid seiner Mutter verborgen, fasste er den Plan, sein Leben gelingen zu lassen. Er wollte Gott keine weitere Enttäuschung zufügen.
So festlich es sonntags bei ihnen war, so streng ging es an den Sonnabenden zu. Das seien, sagte Kurt einmal, keine Tage, das seien nichts als Vorbereitungen auf den Sonntag. Gleich morgens nach dem Aufstehen mussten die Kinder ihre Betten neu beziehen. Und auch wenn sie wussten, wie kühl und fest sich ihre Kissen am Abend anfühlen würden, schimpften sie morgens beim Versuch, die kratzigen Decken in die Leinenbezüge zu bekommen. Anschließend fegten und schrubbten sie die Bettenstube, manchmal täuschte Alfred Husten vor und durfte währenddessen die heruntergebrannten Kerzen erneuern.
Am Vormittag wusch jeder seine Wäsche und anschließend sich selbst. Sie stiegen zu zweit in die heiße Wanne und schrubbten einander den Rücken mit einer Bürste, bis die Haut rot glänzte vor Sauberkeit. Wenn alle gebadet waren, stellten die Kinder sich, in ihre Handtücher gewickelt, in einer langen Reihe vor der Mutter auf. Noch immer hing die Waschstube voller Dampf, eine feuchte Wolke, die sie satt und schwer umgab wie der Heilige Geist. Ein Kind nach dem anderen hob Anna Wegener auf ihren Schoß, um ihm die Nägel zu schneiden. Mit der Linken umfasste sie Finger oder Zehen, mit der Rechten führte sie ihre silberne Schere. Sie ließ sich Zeit damit.
Während des Schneidens erzählte die Mutter Geschichten. Meist waren es Bilder aus den Testamenten, die sie für ihre Kinder veränderte, ausschmückte und neu verband. In ihrem Evangelium gab es zur Speisung der fünftausend nicht nur Brot und Fisch, sondern auch Huhn, Kartoffeln und Kekse. Immer neue Gerichte wünschten die Kinder sich von Jesus, und ihre Mutter sorgte dafür, dass jedes einzelne davon auf den Tisch kam. Ihre Vertreibung der Wechsler aus dem Tempel führte zu einer gewaltigen Prügelei, und das Gleichnis vom Senfkorn endete mit einer Bratwurst.
An einem dieser Sonnabende, als die Reihe des Nägelschneidens gerade an Alfred kam, erzählte Anna Wegener von der Schöpfung. Alfred kletterte auf den Schoß seiner Mutter und lehnte sich in ihre Armbeuge. Sie nahm seine linke Hand, fuhr mit der Schere unter den Rand des Daumennagels und zog sie langsam hinüber zur anderen Seite. Die Klinge verwandelte die Schwärze und ließ nichts als einen hellen Nagelstreifen zurück. Ein Finger nach dem anderen kam an die Reihe, während die Mutter von Licht und Finsternis erzählte und wie der Herr sie voneinander schied. Wie er den Himmel von der Erde trennte und das feste Land vom Wasser. Die Schöpfung schien eine einzige Geschichte von Trennungen zu sein. Jetzt stach die Mutter mit der Spitze der Schere ins Nagelbett und pickte nach den dunklen Stücken, die sie noch nicht erwischt hatte. Alfred presste die Lippen aufeinander. Kurt, der als Nächster in der Reihe wartete, fragte: »Woher sind Gott all die Einfälle gekommen für seine Schöpfung? Er hat doch nur sieben Tage Zeit gehabt. Auf Sonne und Mond wäre ich wohl auch gekommen, aber es gibt ja noch die Gräser und Kräuter, die Vögel, all die wilden Tiere und die Walfische.« Und die Menschen, ergänzte Alfred im Stillen.
Seine Mutter war jetzt mit seinen Füßen zugange, wo die Nägel dicker waren. »Ich verrate euch«, sagte sie, »ein Geheimnis. Gott hatte einen Plan. Da hat alles schon gestanden, in jeder Einzelheit. Deshalb ist er so schnell gewesen mit seiner Arbeit.« Sie nahm Alfreds letzten Zeh und schnitt ganz langsam einen halbmondförmigen Streifen des Nagels herunter. Als sie damit fertig war, griff sie sich das Stück und schnippte es in die Waschschüssel zu ihren Füßen.
»Und wo ist dieser Plan jetzt?«, fragte Alfred leise. Die Mutter überlegte einen Moment. »Er hat ihn zerrissen, als er ihn nicht mehr brauchte. Am Sonntagnachmittag, nachdem er fertig war, hat er ihn zerrissen und weggeworfen.«
»Und wo sind die Stücke?«, fragte Kurt.
»Das wissen wir nicht«, sagte die Mutter. »Über die Welt verstreut.«
Man müsste sie einsammeln, dachte Alfred. Man müsste sie aneinanderhalten und schauen, ob sie zusammenpassen. Und wenn sie passten, könnte man sehen, ob ihm der Plan gelungen war.
Von hinten fragte einer der Waisenknaben, ob das eine wahre Geschichte sei. Die Mutter ließ Alfred von ihren Knien herunter. »Nein«, antwortete sie, »es ist eine Sage.« Dann half sie Kurt, auf ihren Schoß zu klettern.
Verschwisterte und vergesellschaftete Halos
Im Spätsommer 1887 wurde Alfred eingeschult. In seinem Ranzen fand er eine Bibel, ein neues Oktavheft, eine Brezel, eine Zuckertüte und einen Kompass. Die Geschwister begleiteten ihn zur ersten Stunde. Als er in das Klassenzimmer ging, standen sie draußen im Flur und winkten. Obwohl sich Alfred seit Langem darauf gefreut hatte, ein Schüler zu werden, beschlich ihn eine seltsame Leere.
Die Geschwister hatten ihm düstere Andeutungen gemacht, die, bevor sie zu einem Ende fanden, im allgemeinen Kichern untergingen. Alfred hatte nichts dagegen, etwas zu lernen, aber er fürchtete das dicht gedrängte Sitzen neben den anderen.
Das Klassenzimmer war bereits voll besetzt, auf dem Herweg hatte es noch so viel zu besprechen gegeben. Am Rand der ersten Bank fand sich ein Platz für ihn. Als Alfred seinen Ranzen ans Pult hängte, stieß er gegen einen Kartenständer. Der große Plan kam ins Schaukeln, fiel aber nicht herunter. Alfred entzifferte die Beschriftung: DIE ERDE. Hier war er richtig.
Von jedem seiner Geschwister hatte er sich im Verlauf der letzten Monate einen Buchstaben zeigen lassen, das reichte fürs Alphabet. Der Raum war groß, aber nicht groß genug für all die Kinder. Vorne die Tafel, daneben waren Haken in der Wand befestigt, an denen Zirkel, Lineal und eine Geige hingen. Davor stand das Lehrerpult mit dem Globus. Die Luft im Klassenzimmer war schon am Morgen schlecht.
Uneingeschränkt freute sich Alfred vor allem auf den Kaiserwecken, den jedes Schulkind an Kaisers Geburtstag ausgeteilt bekommen würde. Seit Jahren hatte er zusehen müssen, wie seine Geschwister an einem Tag im März mit ihrem Hefestück nach Hause kamen, von dem höchstens am Rand etwas abgebissen war. Den Rest des Tages hatten sie ein Theater darum gemacht, als hätte man ihnen Nektar und Ambrosia geschenkt. Sobald Alfred in ihre Nähe kam, rochen sie daran und seufzten, um dann in winzigen Portionen davon zu naschen. Keiner war auch nur auf die Idee gekommen, mit ihm zu teilen.
Sie hatten nun schon den dritten Kaiser in diesem Jahr. Anfang März war Wilhelm Friedrich gestorben, wenige Tage bevor sie seinen Geburtstag feiern konnten. Sein Sohn Friedrich Wilhelm war bei der Krönung schon krank und starb nach neunundneunzig Tagen, ohne je einen kaiserlichen Geburtstag zu begehen. Noch am Todestag hatte man seinen ältesten Sohn Friedrich Wilhelm zum Nachfolger ernannt, ein Januarkind. So bekam Alfred den drei Kaisern zum Trotz in seinem ganzen ersten Schuljahr keinen einzigen Kaiserwecken.
Alles in allem erwies sich die Schule als enttäuschend. Er konnte das Geräusch der Griffel auf den Schiefertafeln schlecht ertragen. Neben ihm saß ein kleiner, schielender Junge, der hin und wieder Karamell mitbrachte und schlecht roch. Er hieß Gregor und zwickte Alfred unter dem Pult in den Schenkel. Im Rechnen schrieb er ab, so dass Alfred sich ganz an die Wand drücken musste. Wenn der Lehrer Gregor etwas fragte, begann der manchmal zu weinen.
Die Pausen waren Alfred unheimlich, weil er die anderen Kinder nicht kannte. Es gelang ihm kaum, sie voneinander zu unterscheiden. Erst wenn alle zurück ins Klassenzimmer strömten, rannte er noch einmal über den leeren Hof und wünschte, es bliebe noch Zeit.
Der Lehrer hatte nur ein Auge, ein Bein und ein Stöckchen. Je ein Auge und Bein waren im Krieg geblieben, das Stöckchen klemmte unter dem Arm, wenn der Lehrer auf seinen Krücken ins Klassenzimmer humpelte.
Was es zu beherzigen galt: gute Haltung. Mit geradem Rücken und geschlossenen Beinen blickten die Schüler nach vorn. Zweitens: Keiner sprach ungefragt. Das nannte man Gehorsam. Wer gefragt wurde, antwortete im ganzen Satz. Das war ein Gebot der Demut. Am meisten Mühe bereitete Alfred die vierte Regel: gute Form. Nach einigen Monaten wechselten sie zur Stahlfeder, was ihm noch schwerer fiel als das Führen des Griffels. In den Heften waren Linien vorgedruckt, zwischen die ihre Buchstaben gehörten.
Der Lehrer sagte: »Wer die Linien übertritt, übertritt auch das Gesetz.«
Er hielt Unterricht in Religion, Deutsch, Rechnen, Zeichnen, Singen und Turnen, außerdem in den Realien, Alfreds Lieblingsfach. Hier durfte er sein Oktavheft mit allem füllen, was ihn ohnehin beschäftigte: Er klebte Herbstblätter ein, malte das verblüffende Muster eines Vogeleis ab und führte täglich Buch über die Entwicklung des Wetters. Die schwarze Tinte, mit der er das Vogelei gezeichnet hatte, drückte sich auf der Rückseite des Bogens durch. Beim Umblättern lief Alfred ein Schauer den Nacken hinauf, als er begriff, dass so das Muster von innen aussah, dies war das Erste, was der Vogel in seinem Leben zu Gesicht bekam. Ob ein Vogel schon blinzelte, solange er im Ei steckte? Alfred stellte es sich einsam darin vor.
Nach Ablauf des Jahres kamen neue Kinder in die Klasse und setzten sich in die erste Reihe, wo eben noch Alfred gesessen hatte. Er durfte eine Bank nach hinten ziehen, während Gregor sitzen blieb. Mit dem neuen Nachbarn verstand Alfred sich besser, gemeinsam zogen sie im nächsten Sommer weiter, und so ging es langsam nach hinten, fort vom Lehrer, Bank für Bank.
Auch wenn Alfred keine leichte Beute für die Vergnügungssucht seiner Geschwister war, lernten sie bald, wie er sich ködern ließ. Sobald sie ihm anboten, Verstecken zu spielen, war er mit von der Partie. In den Sommerferien erfanden sie eine eigene Variante, die sie Hasenjagd nannten, und spielten, sobald sie mit dem Frühstück fertig waren. Dabei suchte nicht einer die anderen, dafür waren sie zu viele, sondern einer versteckte sich, und alle anderen machten sich auf die Suche. Gemeinsam stellten sie sich in den Kreis, schlossen die Augen und zählten zusammen bis hundert, murmelnd, es klang wie ein Vaterunser. Dann rieben sie sich die Augen und zogen aus nach dem Hasen. Einzeln strichen sie über den Hof und durch die Räume, die zum Spielen freigegeben waren: das ganze Haus mit Ausnahme von Bibliothek, Küche und dem Schlafzimmer der Eltern.
Anfangs riefen sie einander noch Hinweise zu, wenn sie sich trafen, wo man bereits geschaut habe und wo man nun suchen wolle. Bald aber konzentrierte sich jeder einfach auf seine Suche und ging den anderen aus dem Weg.
Die Regeln des Spiels sahen vor, dass derjenige, der als Erstes auf den Hasen stieß, nicht jubelnd triumphierte, sondern stillschweigend mit ins Versteck schlüpfte. So leerten sich Haus und Hof allmählich, während es beim Hasen zusehends enger wurde. Kind um Kind drückte sich zu den anderen unters Bett, hinter die Tür, in den großen Kleiderschrank, wo man es flüsternd begrüßte, um ihm, sobald es zu Erklärungen ansetzte, warum es ausgerechnet hier niemanden vermutet hätte, die Hand auf den Mund zu legen.
Alfred liebte die schleichende Vereinsamung, wenn das Spiel unmerklich leiser wurde und ihn allmählich nur noch Stille umgab, der leere Hof, verlassene Räume, manchmal ein eingebildetes Kichern. Nie wusste er, wann der Moment erreicht war, da er als Letzter noch suchte. Während er durch die Räume lief und mit halber Aufmerksamkeit Ausschau hielt, fühlte sich sein Übrigbleiben an wie ein Gewinn.
Manchmal lief er weiter, obwohl er längst ahnte, wo die anderen steckten, zu einer Extrarunde durchs Haus. Er kam sich vor wie der einzige Überlebende einer Schlacht. Niemand konnte wissen, was er wusste, er gab vor, den herausstehenden Fuß eines Bruders nicht gesehen, ein Flüstern nicht gehört, die Ausbeulungen im Vorhangstoff im Durchgang zur Veranda nicht bemerkt zu haben. Auf einmal sah er Dinge, die ihm vorher nicht aufgefallen waren. Offenbar musste man das Bekannte außer Acht lassen, um Neues zu finden. Er stand im Hof, als er das dachte, im Schatten der Mauern, aber oben auf dem Dachfirst der Scheune lagen schon die Strahlen der frühen Sonne. Es würde ein schöner Tag werden. So lief er weiter, den Blick hinauf zum Himmel gerichtet, auf die vom Nordwind sauber gekämmten Zirruswolken, die im Morgenlicht aussahen, als hätten sie kein Gewicht.
Es war ein Topf mit roten Geranien, über den er stolperte, seine Mutter hatte ihn gerade erst hinausgestellt, weil die Blattläuse überhandnahmen. Alfred stürzte hin und landete mit dem Gesicht in den Brennnesseln am Fuß der Gartenmauer. Obwohl er sich wehgetan hatte, blieb er einen Moment lang so liegen, das blutig geschlagene Knie mit den Händen umklammert, ihm war nicht nach Weinen zumute. Als er die Augen öffnete, saß vor ihm in den Brennnesseln eine Raupe.
Sie war dick, leuchtend rot und stachelig, er hockte sich vor das Blatt, an dem sie fraß, es kitzelte, als er sie in die Hand nahm. Nachdem er sie lange genug betrachtet hatte, die schwarzen Füßchen, den hellen Schleier am Bauch, die Einschnürungen hinter jedem Segment, schloss er die Finger darum, stand auf und ging zum Versteck. Längst hatte es hinter dem Stapel Bohlen unruhig zu rumoren begonnen. Seine Geschwister waren dankbar, erlöst zu werden, einer nach dem anderen kroch hervor und freute sich mit ihm über seinen Schatz. Heinrich, ein älteres Waisenkind, fand eine große Kienspanschachtel aus Holz, da hinein legte Alfred die Raupe sowie einige Brennnesselblätter und steckte die Schachtel dann in seine Hosentasche.
Mit den Ameisen wurde es nicht besser. Von allen Seiten drangen sie in diesem Sommer in die Küche ein, selbst aus der Waschstube krochen sie das Heizungsrohr herauf. Beim Frühstück enterten sie den Brotkorb und die Schale mit den eingelegten Zwiebeln. Alfreds Schwester Tony hatte anfangs ein paar von ihnen auf ihren Finger gelockt und sie hinaus in den Hof getragen, aber wenn sie stolz zurückkam, waren es nicht weniger geworden. Der Vater schlug mit der flachen Hand nach ihnen, die Mutter wischte sie mit einem Lappen fort, die Kinder schnipsten sie über die glatte Fläche des Tisches einander zu. Einmal, als Alfred seiner Mutter beim Abräumen des Frühstücks half, zerschnitt er eine von ihnen heimlich mit dem Obstmesser an der dünnsten Stelle. Er hatte gehört, dass manchen Tieren neue Gliedmaßen wuchsen, so dass sie weiterleben konnten, aber Ameisen gehörten wohl nicht dazu.
Die Mutter stopfte Tücher in die Ritzen, durch die sie eindrangen, und tränkte die Lappen mit Petroleum. Es änderte nichts. Heinrich suchte sich im Hof einen Stock und schlug lange und beharrlich auf die Ameisenstraße ein, bis er am Ende ganz verschwitzt und verängstigt zurück ins Haus kam, weil es immer mehr zu werden schienen. Tony nahm das Nudelholz von der Wand und rollte ruhig und gleichmäßig die Strecke vom Küchenschrank bis zur Hoftür ab, was wirkungsvoll war, aber entsetzlich aussah, so dass die anderen ihr das verklebte Nudelholz aus der Hand nahmen. Im Stillen nahm Alfred sich vor, in diesem Advent auf die ausgerollten Plätzchen zu verzichten. Die Mutter kam mit einem Kessel kochendem Wasser und goss es vorsichtig über die Steine im Hof, den ganzen Weg bis hinüber zu den Beeten. Alfred beugte sich über das Pflaster und sah, wie die kleinen Körper der Ameisen durch die Ritzen der Steine geschwemmt wurden, sie zappelten nicht einmal mehr. Zweifellos ein wirkungsvolles Verfahren, aber man konnte ja nicht den ganzen Tag mit kochendem Wasser herumlaufen.
Es war Alfred, dem die Idee mit der Falle kam. Erst hatte er an etwas Brennbares gedacht, aber das war nicht einmal nötig. Aus der Remise holte er den Topf, den Willi ihm an jenem Silvesterabend über den Kopf gezogen hatte. Er stellte das Gefäß in den Hof, ließ sich von der Mutter eine halbe Flasche Bier hineinschütten und streute so lange Puderzucker darauf, bis sich eine feste Insel bildete. Dann rief er die anderen, und gemeinsam standen sie um die Anordnung herum, es war das erste Experiment seines Lebens.
Es dauerte nicht lange, bis eine Ameise die steile Wand der Kasserolle erklomm. Oben angekommen, sah sie sich um und lief einen Moment auf dem Rand hin und her, als hätte sie eben die Grenze zum Schlaraffenland erreicht. Dann hielt sie inne und kletterte wieder die Außenwand hinab, sie kreuzte ein wenig auf den Steinplatten, bevor sie zurückkehrte auf den Rand des Gefäßes, vielleicht hatte sie einfach die Vorfreude noch ein wenig verlängern wollen. Die Puderzuckerinsel war unterdessen auseinandergebrochen, gemächlich trieben die Stücke auf dem Bier. Wenn sie mit anderen zusammenstießen, vereinigten sie sich zu größeren Gebilden, rissen an anderer Stelle wieder auseinander und immer so fort, in einem langsamen Tanz. Eine der Inseln trieb an den Rand und blieb dort haften, darauf landete die Ameise, als sie nun hinunterstürzte in ihr Glück. Die Innenseite des Gefäßes war emailliert, es gab keinen Weg zurück. Für diese nicht und auch nicht für all die anderen, die ihr bald folgten, manche stürzten sich gleich in die Fluten, manchen gelang es noch, auf ihre Gefährten zu klettern, mit denen zusammen sie kleine Flöße bildeten, die bald versanken. Andere konnten sich auf eine der Puderzuckerinseln retten und trieben mit ihnen herum, am Ende müssen es Hunderte gewesen sein, die kleinen Inseln waren schwarz von ihnen. Aufgeregt liefen sie von einer Küste zur anderen, aber Rettung war nicht in Sicht.
Am letzten Tag der Sommerferien waren sie im Hof und spielten Kutsche, auf einmal warf Alfred die Reitgerte zur Seite und rannte ins Haus. Schon auf der Treppe rief er mit überschlagender Stimme: »Wo ist meine Hose?« Von oben sah ihn seine Mutter verblüfft an, und es dauerte schrecklich lange, bis er alles erklärt hatte, der Sturz, sein Knie, die Kienspanschachtel. Seine Mutter lachte, die Hose liege noch beim Schneider. Alfred fragte, wo er die Werkstatt finde. »Im Krosigkschen Haus«, antwortete sie, »der Flicken sollte längst fertig sein.«
Sie gab ihm einen Groschen mit, und er rannte aus dem Haus, er sah den Zeitungsjungen nicht, der an der Ecke stand, fast wäre er in einen Pferdewagen gelaufen, er rannte die Friedrichsgracht hinunter und über die Grünstraßenbrücke, vor der Destillation rief ihm ein Mann hinterher und hob die Hand, aber Alfred konnte sich nicht damit aufhalten zu entscheiden, ob es ein Gruß war oder ein Fluch – erst als er keuchend die drei Stufen zur Werkstatt hinaufsprang, hatte er die Gewissheit, einen Teil der verlorenen Zeit wieder gut gemacht zu haben.
Der Schneider war ein älterer Herr. Er war glatt rasiert, aber man hätte sich gewünscht, dass ein gnädiger Bart sein pockennarbiges Gesicht bedeckte. Auf Alfreds hervorgestoßene Frage strich er sich mit einer Hand über die verschorften Wangen, stach dann die Nadel in den schwarzen Anzugstoff, über dem er saß, erhob sich ächzend und verschwand hinter einem Vorhang zum Nebenraum. Alfred lehnte sich an eine Rolle Leinwand und versuchte zu Atem zu kommen. Überall in der Werkstatt lagen Stoffreste herum, zerknitterte Schnittmusterbögen, Maßbänder und Garn in allen Farben. Auf einmal musste Alfred husten, immer heftiger, und konnte nicht mehr aufhören damit, er hob die Arme, um zu Luft zu kommen, und erst als der Schneider mit der sorgsam gefalteten Hose hinter seinem Tuch hervortrat, wurde es besser, auch wenn ihm die Augen noch tränten. Der alte Mann wollte ihm die Stelle zeigen, die er ausgebessert hatte, aber Alfred hielt ihm nur den Groschen hin, bekam die Hose eingeschlagen und verschwand ohne ein Wort des Grußes aus dem Geschäft.
Auf dem Rückweg trödelte er, ging langsam die Wallstraße zurück, sah auf der Kreuzung einem Kind zu, das seinen Kreisel vor sich hertrieb, und hielt erst auf der Böschung zum Spreekanal an. Dort legte er sein Bündel auf den Boden, löste die Kordel und schlug das Packpapier auf. Behutsam öffnete er den Knopf der Hosentasche, griff
1. Auflage
Copyright © 2011 by Deutsche Verlags-Anstalt, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Typographie und Satz: DVA/Brigitte Müller
Gesetzt aus der Aldus
eISBN 978-3-641-06217-0
www.dva.de
www.randomhouse.de
Leseprobe