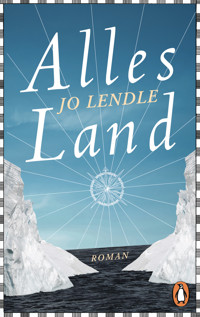16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
„Solange ich rede, bin ich am Leben. Solange ich fliege. Die letzte Gewissheit, die mir bleibt: Wenn ich niemals lande, werde ich nicht gestorben sein.“
Es ist der 2. Juli 1937, in ihrer Lockheed Electra fliegt Amelia Earhart hoch über dem Ozean. Die Schatten der Wolken sehen aus wie Inseln. Sie steht kurz davor, als erster Mensch die Welt zu umrunden. Dies ist die schwerste Etappe.
Jo Lendle erzählt die Geschichte einer Heldin, die keine Heldin sein will. Amelia fliegt, sie schreibt, sie setzt sich für Frauen ein – ein Vorbild. Doch sie hadert mit all den Zuschreibungen, weil sie sich selbst darin nicht findet, nicht zuletzt in den Kategorien von Frau und Mann. Also hebt sie ab und lässt alles hinter sich, ohne Kompromisse.
»Die Himmelsrichtungen« ist das Porträt eines ungeheuer mutigen, charismatischen, eigensinnigen Menschen. Es ist eine Liebesgeschichte mit wechselnden Beteiligten – manche erstaunlich, andere flüchtig wie Wolken. Und es ist ein Roman über die Erinnerung und wie sie sich allmählich entblättert. Jede Schicht zeigt die Vergangenheit in einem neuen Licht. Wie soll man diese Geschichte anders erzählen als rückwärts? Amelia weiß noch nicht, dass es der letzte Tag ihres Lebens ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 249
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Es ist der 2. Juli 1937, in ihrer Lockheed Electra fliegt Amelia Earhart hoch über dem Ozean. Die Schatten der Wolken sehen aus wie Inseln. Sie steht kurz davor, als erster Mensch die Welt zu umrunden. Dies ist die schwerste Etappe.
Jo Lendle erzählt die Geschichte einer Heldin, die keine Heldin sein will. Amelia fliegt, sie schreibt, sie setzt sich für Frauen ein – ein Vorbild. Doch sie hadert mit all den Zuschreibungen, weil sie sich selbst darin nicht findet, nicht zuletzt in den Kategorien von Frau und Mann. Also hebt sie ab und lässt alles hinter sich, ohne Kompromisse.
»Die Himmelsrichtungen« ist das Porträt eines ungeheuer mutigen, charismatischen, eigensinnigen Menschen. Es ist eine Liebesgeschichte mit wechselnden Beteiligten – manche erstaunlich, andere flüchtig wie Wolken. Und es ist ein Roman über die Erinnerung und wie sie sich allmählich entblättert. Jede Schicht zeigt die Vergangenheit in einem neuen Licht. Wie soll man diese Geschichte anders erzählen als rückwärts? Amelia weiß noch nicht, dass es der letzte Tag ihres Lebens ist.
Jo Lendle wurde 1968 geboren und studierte Literatur, Kulturwissenschaften und Philosophie. Bei der DVA veröffentlichte er seine Romane »Was wir Liebe nennen« (2013), »Alles Land« (2011), »Mein letzter Versuch, die Welt zu retten« (2009) und »Die Kosmonautin« (2008). 2021 erschien sein Roman »Eine Art Familie« bei Penguin.
www.penguin-verlag.de
Jo Lendle
DIEHIMMELS-RICHTUNGEN
Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2024 Penguin Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Sabine Kwauka
Umschlagabbildung: ullstein bild – brandstaetter images / Austrian Archives (S) und shutterstock / Net Vector
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-32571-8V001
www.penguin-verlag.de
für Emil Harte und alle anderen
Bis morgen sind die welken Blüten frisch und schließen sich zu Knospen.
Ilse Aichinger
Ouverture
1937
Ich – denn darum geht es, um mein Dasein als Frau oder als Mensch, um die Fragen, die es aufwirft, und um die Furcht, meine eigene und mehr noch die der anderen – ich also war damit zugange, einen Kanister Flugbenzin in den Tank zu füllen, vorsichtig, um keinen Tropfen zu verschütten. Ich hatte die Handschuhe ausgezogen, es war heiß und das steifgetrocknete Leder machte die Sache nicht leichter, außerdem riechen deine Hände am Ende des Tages ohnehin nach Benzin, da kannst du dich anstellen, wie du willst.
Es war früh am Morgen und die Luft stand über dem Asphalt des Flugfelds wie Fieber. Die Männer schliefen noch. Seit Jahrhunderten schliefen sie. Ich wollte los.
Beim Start in Oakland hatte es eine Reihe von Fehlzündungen gegeben. Flammen waren aus dem Backbordmotor geschossen. Nichts Wildes. Jedenfalls nichts, was sich mit einem Feuerlöscher nicht beheben ließ. Der Flug selbst verlief bislang ruhig. Bis Miami blieben wir über Land und setzten dann über die karibische See nach Puerto Rico und Venezuela. Am Abend bezogen wir unsere Quartiere, morgens ging es weiter. Zum ersten Mal in meinem Leben sah ich einen Dschungel. Eindrucksvoll, aber als Landeplatz wenig verlockend. Wir folgten dem Verlauf der Küste bis an die östlichste Spitze Brasiliens. So verging die erste Woche.
War ich nervös? Ich hätte die Frage von mir gewiesen. Was ich war: gefasst. Entschieden. In Erwartung von allem, was kommen würde. In Natal lösten wir uns vom Kontinent und flogen hinaus auf den Ozean. Dem Flugzeug ist es gleich, ob du festen Boden unter dir hast oder nichts als Wasser. Einen Unterschied macht es nur für uns.
Aber das Navigieren wird schwerer. Über Land ist es leicht, die Geschwindigkeit zu bestimmen. Du wählst einen Punkt am Boden und schaust, wie schnell er zurückbleibt. Auf dem Ozean gibt es keine Punkte. Von Zeit zu Zeit stieß Fred die Flugzeugtür auf und warf ein Fläschchen Aluminiumpulver hinaus. Es zerbrach auf dem Meer und bildete einen kreisrunden, metallisch glitzernden Fleck. Nachts warfen wir Kanister mit Acetylen ab, das sich im Kontakt mit Wasser entzündet.
Wir flogen nach Osten, das machte die Tage kürzer. Zwei Stunden weniger Licht. Nicht schlimm, wenn alles nach Plan läuft, aber unweigerlich fliegst du der Dunkelheit entgegen. Nach dreizehneinhalb Stunden erreichten wir Land. Senegal, südlicher als von Fred erwartet, was mir nicht gefiel. Aus Saint Louis schickte ich eine Depesche nach Hause, bislang verlaufe der Flug ereignislos. An den Abenden erzählte mir Fred seine Geschichten und ich hörte ihm zu.
In Französisch-Äquatorialafrika war es so heiß, dass wir nachts tanken mussten. So viele Menschen, und alle waren bemüht, uns zu helfen. Ich schickte George die Namen, damit er jedem etwas zum Dank auf den Weg brachte. Dicht am Boden überflogen wir den Schari, im Fluss eine Herde Nilpferde. Später der Umriss eines Sees wie ein Embryo, der Wind ließ die Wellen glänzen. Hinter al-Faschir überflogen wir ein Gebiet, das auf unserer Karte vollkommen leer geblieben war. Ich legte meine gespreizte Hand aufs Papier und sie bedeckte nichts, keine Höhenlinie, keinen Wasserlauf, keinen einzigen mit einem Namen verzeichneten Ort. Aus der Luft gab es an diesem Befund nichts zu korrigieren. Da war kein einziger Gegenstand, an dem sich das Auge hätte festhalten können. Ein Niemandsland aus Entbehrung.
Khartum. Massaua. Wir wechselten Länder, ohne es zu bemerken. Die Idee der Grenzen ist ans Land gebunden, dort sind sie offensichtlich: Es gibt Straßen und Wege, Schlagbäume, Zäune, Zollstellen, Mautpunkte, es gibt Flüsse und Gebirge, und alle miteinander gewähren zumindest ein gewisses Maß an Kontrolle. In der Luft gibt es das nicht. Der Himmel hat keine Grenzen.
Über dem Hochland von Abessinien stieg heißer Wind auf und stieß uns kräftig herum. Hinaus aufs Rote Meer. Erst bei der Landung in Karatschi erfuhren wir, dass noch nie jemand hinübergeflogen war. Es gelang mir, eine Verbindung herzustellen. George war kaum zu hören. Ich brüllte ins Telefon, wir hätten eine gute Zeit. Irgendwann würden wir das alles einmal zusammen machen. Ich hoffte, er konnte mich verstehen. Am Abend ritt ich auf einem Kamel.
Über Indien lag Dunst, aber die Eisenbahnstrecken halfen bei der Orientierung. Nach Kalkutta flogen wir in einem Schwarm schwarzer Adler. Von dort schrieb ich George, es gebe personelle Probleme. Er kabelte umgehend zurück: Ich solle bleiben, bis alles geklärt sei. Weil die Startbahn schlammig war, ließen wir beim Weiterflug die Tanks halbleer.
Wir hatten unseren gesamten Flugplan gedreht, um dem Monsun auszuweichen. Und gerieten nun mitten hinein. In Burma wurde der Regen so stark, dass uns der Lack von den Flügeln platzte. Zwei Stunden im Blindflug, zum Glück hatte ich es geübt. Singapur, Java und hinüber an die australische Küste. Weit unten die Wolken. Schaum, Schaum. Unbeweglich und fest, ein hochaufgetürmter Schnee, der einfach nicht schmilzt.
Am nächsten Tag erreichten wir Lae. Wir querten Neuguinea auf ganzer Länge, stiegen auf ins Gebirge, glitten wie ein Raubvogel über den schroffen Gipfel des Mount Wilhelm und stürzten dann steil hinab zur Bismarcksee. In weiter Kehre flogen wir in die Bucht, dicht über dem Meer. In den Bergen hingen noch die Wolkenfetzen, die wir von oben gesehen hatten, darunter das Grün des Regenwalds. Im Näherkommen einzelne Palmen, verstreute Bungalows und dann öffnete sich direkt am Wasser die Linie der Rollbahn, als würde sie uns erwarten.
Wir blieben vorerst in Lae. Schlechter Wind, außerdem hatte Fred Probleme mit der Funkverbindung, so dass es ihm nicht gelang, seine Uhren richtig zu stellen. Wir brauchten die genaue Zeit, um mit Sonne und Sternen zu navigieren. Howland war winzig. Der kleinste Fehler und wir würden die Insel verfehlen. An George schrieb ich: FUNKSCHWIERIG. PERSONELLEUNZULÄNGLICHKEITENHALTENVORAUSSICHTLICHEINENTAGAN.
Es wurden zwei Tage. Man kümmerte sich gut um mich. Ich fand dennoch keine Ruhe. Noch einmal sortierte ich alles aus, was für die letzte Strecke nicht mehr nötig war. Ansonsten unternahm ich kleinere Ausflüge ins Umland. Saß in heißen Quellen. Probierte fremde Früchte. Was man beim Warten so tut. Am liebsten hätte ich den ganzen Tag geschlafen. Im Ort schienen vor allem Goldsucher und Paradiesvogeljäger zu leben. Sie waren äußerst herzlich.
Noch immer war es möglich, zum vierten Juli zurück zu sein. Es war nicht klug, mir auszumalen, wie es wäre, am Nationalfeiertag zu landen. Ich tat es trotzdem. Immerhin bekamen wir einen ganzen Tag geschenkt. Hier war Freitag, während zu Hause noch Donnerstag war. Beim Überqueren der Datumsgrenze würde ich denselben Tag noch einmal erleben. Als fiele man in einen Spalt.
Ich stellte den Kanister neben die Startbahn. Meine Handschuhe legte ich darauf. Dann stieg ich ein. Prüfte die Anzeigen, eine nach der anderen. Startete die Motoren. Langsam begannen die Propeller zu kreisen. Es war alles Routine, ich dachte nicht darüber nach, was ich tat. Um keinen Teil der Prozedur zu vergessen, flüsterte ich jeden Schritt einzeln vor mich hin wie ein Gebet. Wenn ich ehrlich war, hörte ich mir längst nicht mehr dabei zu.
Das Abheben ging leicht wie nie. Kein Wunder, ich war allein. Ich hätte mich viel früher dazu durchringen sollen.
Ich flog auf zehntausend Fuß, aber der Himmel zog sich zu. In den Wolken zu sein, schaltet nicht einfach die Sicht aus wie die Dunkelheit. Es ist eine vollkommene Beendigung der Sinne, als gäbe es nichts mehr zu empfinden. Alles wird dumpf und blass, du hörst sogar auf zu riechen. Ich weiß, wie es sich anfühlt: sofortiger Schwindel, Tränen, Übelkeit. Es heißt immer, das Fliegen enthebe einen aller Schwere. Festigkeit gebe es nur am Boden. Dabei ist es anders – bei freiem Himmel behältst du das alles, es gibt ja ein Oben und Unten. Erst in den Wolken verlierst du den Halt. Erst dort verlierst du dich aus den Augen.
Ich lasse mich auf siebentausend Fuß fallen. Hier ist freie Sicht bis in die Unendlichkeit, wo sich Himmel und Wasser berühren. Wenn es so bleibt, wird die Itasca von weitem zu sehen sein, sie haben versprochen, schwarzen Rauch auszustoßen. Bald überfliege ich die Datumsgrenze. Ich zwicke mich, um beim Navigieren daran zu denken, sonst weicht jede Berechnung ein Grad von der Wirklichkeit ab. Aber in welche Richtung? Ich bin noch nie über Datumsgrenzen geflogen, schon gar nicht allein. Unter mir die leere See. Falls sie die Antwort kennt, behält sie sie für sich.
Es ist die letzte große Etappe. Die einzige, auf die es ankommt. Ich weiß, das sollte ich nicht denken. Wie Großmutter immer sagte: Jede unserer Taten zählt.
Ich werfe niemandem etwas vor. Ich hätte es besser wissen müssen. Nicht alles wird leichter, wenn man sich auf andere verlässt.
Das Meer sieht aus wie der Rücken eines Elefanten, von Falten übersät.
Ansonsten mache ich, was ich immer gemacht habe: Ich fliege. Dies ist, was ich tue. Eine Insel suchen – ich kann mich nicht erinnern, jemals etwas anderes getan zu haben. Als wäre ich schon immer hier gewesen.
Ich rede so vor mich hin. Am Ende macht es keinen Unterschied. Sie hören mich oder Sie hören mich nicht. Solange ich rede, bin ich am Leben. Solange ich fliege. Die letzte, einzige Gewissheit, die mir bleibt: Wenn ich niemals lande, werde ich nicht gestorben sein.
Menuett
Ein Jahr zuvor
»Amelia. Wie schön, dass Sie Zeit für ein Gespräch gefunden haben. Schauen Sie sich an! Sie sehen bezaubernd aus.«
»Danke. Sie auch.«
»Das hat mir noch niemand gesagt.«
»Dann wurde es ja Zeit.«
Für einen Moment herrschte Schweigen. Der Mann strich sich über die Nasenspitze. Dabei lächelte er noch immer, genau genommen lächelte er, seit ich das Studio betreten hatte, wo er mit langen Schritten auf mich zugestürmt war, in weißen Hosen und weißem Hemd. Strandbräune, das Haar in Schwüngen nach hinten geföhnt, dass seine blanken Schläfen glänzten. Er sah aus, als spielte er den Helden in einem Western, und in gewisser Weise tat er das ja auch. Der Mann im Licht, einsam und frei, tun zu können, was er will. Und ohne jedes Bewusstsein, wie erstaunlich diese Freiheit war.
»Wir legen gleich los«, sagte er. »Unsere Zuschauer sind schon ganz aus dem Häuschen, und ich bin es ebenfalls. Wir haben so viel zu bereden.«
»Wenn Sie das sagen.«
Der Moderator bat mich, auf dem Sesselchen in der Mitte des Lichtkegels Platz zu nehmen. Er selbst werde stehen, das mache das Bild dynamischer. Ich setzte mich und strich meine Hose glatt.
Der Mann ging ein paar Schritte zurück wie ein Maler, der sein Werk betrachtet. Dann nickte er, für meinen Geschmack ein wenig zu oft. Er bat um Entschuldigung und trat aus dem Licht, zur Kamera, zu den Beleuchtern und Tonleuten. Ich konnte nicht alles sehen, aber ich hörte, wie sie im Flüsterton miteinander sprachen. Dann Schweigen. Erneutes Flüstern. Nacheinander traten sie an die Kamera und schauten lange durch den Sucher. Nach einer Weile kam der Moderator zurück, jetzt begleitet von einem kleineren Herrn in weitem Anzug.
»Darf ich vorstellen? Lionel von der Bildregie. Wir haben uns kurz abgestimmt. Üblicher Vorgang, um die Wirkung einzuordnen. Wenn man die Perspektive der Zuschauer einnimmt, wirkt es alles womöglich etwas, nun ja, robust. Wenn Sie wissen, was ich meine.«
Ich lächelte.
»Unser Fehler, wir hätten das Bühnenbild heimeliger denken können. Es fehlt an Wärme. Im Moment sieht es aus, als würde ich mit einem«, er suchte nach Worten, »mit einem Politiker reden.«
Er ließ seinen Blick schweifen. An einer jungen Frau mit Scriptblock blieb er hängen. Er winkte sie heran.
»Vielleicht haben wir hier die Lösung. Wertes Fräulein, würden Sie so gut sein, unserem Gast kurz Ihre Jacke zu leihen? Amelia, dürften wir das einmal probieren? Ich stelle mir vor, das sieht gleich viel freundlicher aus.«
Er nahm der Frau ihr rotes Samtjackett ab und stellte sich hinter mich, um mir behilflich zu sein. Auch wenn mir jetzt manchmal in den Mantel geholfen wurde, wusste ich nie, mit welcher Seite man das Spiel beginnt. Wie immer verfing sich meine Hand im Ärmel, und sein Ruckeln machte es nicht besser. Es mochte daran liegen, dass die Jacke für kleinere Personen gedacht war. George wäre sicherlich eingeschritten, aber was sollte ich hier einen Aufstand machen? Der Mann zupfte den Pelzbesatz am Kragen der Jacke zurecht und strich mir eine Haarsträhne hinter das Ohr.
»Ein Traum. So wirkt es gleich viel lieblicher. Fühlen Sie sich wohl? Nichts gegen eine strenge Garderobe, aber die Kamera ist einfach unerbittlich. Die braucht nichts als Anmut.«
Ein Techniker wurde geschickt, um aus der Bodenvase am Haupteingang etwas Blumenschmuck zu holen. Bis zu seiner Rückkehr blieb es still. Einmal nur bat der Herr von der Bildregie leise darum, das Licht eine Spur milder zu regeln. Einmal schlich die Maskenbildnerin mit ihrem Puderdöschen heran. Der Kameramann drehte an seiner Linse. Auf seiner Jacke stand NBC. Ich murmelte die Buchstaben vor mich hin wie eine Beschwörung. Ich mochte es, wie meine Lippen sich beim B berührten. Als gäbe ich mir einen Kuss. Was für ein Trost, dass es möglich war, sich selbst zu küssen. Flüsternd sagte ich mir das Alphabet auf und war erstaunt, nur auf vier Küsse zu kommen.
Der Techniker kehrte mit einer weißen Amaryllis zurück, schüttelte einige Wassertropfen ab und überreichte sie mir. Der Moderator klatschte in die Hände. Das Studiolicht erlosch. Ich saß allein im Glanz des Strahlers.
»Willkommen, willkommen, willkommen! Amelia. Sie sind – es lässt sich anders nicht sagen – eine Legende. Jedes Kind möchte sein wie Sie. Wir alle erträumen uns Ihr Leben. Und doch bleiben Sie geheimnisvoll. Ich denke, ich spreche für viele in diesem Land, wenn ich sage: Sie sind uns ein Rätsel. Die Sphinx der Lüfte, wenn Sie das Bild erlauben. Nun heißt es, Sie stünden vor dem womöglich letzten Abenteuer des Planeten. Sie müssten aufgeregt sein. Stattdessen sind wir es. Sie dagegen wirken heiter, als ginge es zum Tanz. Sie lassen sich nichts anmerken. Niemals. Ich habe viele Stunden Aufnahmen mit Ihren Interviews angehört. Eine Frage wurde dabei nie gestellt. Darf ich es wagen? Ich bin mir sicher, Millionen von Zuschauern fiebern nach Ihrer Antwort. Kann ich die Frage stellen?«
»Nur zu.«
»Warum fliegen Sie?«
Es war ein altes Gefühl. Ich hätte nicht sagen können, wann es zum ersten Mal aufgetreten war, es gehörte einfach schon immer zu mir. Eine leichte Erwärmung des Rachens, wie der plötzliche Anflug einer Mandelentzündung, man will schlucken, aber der Hals ist zu eng dafür. Tatsächlich hatte ich mir die Frage nie gestellt.
»Warum ich fliege?« Die Gegenfrage brachte mir kaum eine Sekunde. Der Moderator nickte und begann Vorschläge zu machen: Freiheit und Freude, Mut, Pioniergeist, das Überschreiten von Grenzen. Stolz drehte er sein Gesicht in die Kamera, für Momente sah es aus, als würde er das Gespräch lieber mit sich selbst führen. Als ich nicht reagierte, wandte er sich wieder zu mir: »Sie weichen sonst nie aus.«
Noch immer die Hitze im Hals. Ich schaute hinauf ins Licht des Scheinwerfers, als läge dort oben die Antwort.
»Wahrscheinlich fliege ich, weil ich mich nie nach dem Grund gefragt habe. Ich bin schon immer geflogen. Auf die eine oder andere Art. Ich mache es einfach gern. Mein Vater nannte mich Vagabund des Himmels.« Kurz dachte ich nach und fuhr dann fort: »Ihre Vorschläge gehen davon aus, dass man dort oben etwas sucht. Und wenn das gar nicht das Ziel ist? Wenn es darum geht, von hier unten wegzukommen?«
Ich versuchte die Mundwinkel ein wenig anzuheben zu dem, was George mein unbesiegbares Lächeln nannte. Der Moderator sah mich einen Moment zu lange an. Dann schaute er auf seinen Block und las ab: »Beim letzten Mal sind Sie allein über den Atlantik geflogen. Haben Sie einen Gefährten vermisst?«
Und ich, mit unvermindertem Lächeln: »Im Gegenteil. Ich hätte mich immerzu verantwortlich gefühlt. Es war eine große Erleichterung, allein zu sein.«
»Amelia«, sagte er, »Sie kennen die Welt von oben. Spaßvögel könnten auf die Idee kommen, Sie abgehoben zu nennen. Jedenfalls haben Sie mehr Landstriche gesehen als jeder von uns. Hand aufs Herz: Was bedeutet Ihnen Heimat?«
Wieder musste ich länger überlegen, als mir lieb war. Ich fuhr mir über die Nase, wie ich es manchmal tat, und sagte: »Ach, wissen Sie, ich bin in Heimat nicht gut. Mein Vater war ja bei der Eisenbahn, da sind wir ziemlich rumgekommen. Immer hin und her. Wir sind nie lange an einem Ort geblieben. Immerhin habe ich dabei ein Talent entwickelt, mich rasch anzupassen. Nicht die schlechteste Voraussetzung für ein Leben als Mensch.«
Der Moderator lachte. Ich sah ihm dabei zu. Er räusperte sich. Dann fragte er: »Und jetzt? Berichten Sie uns, wie es weitergeht. Man hört, Sie hätten Pläne?«
»Ich habe immer Pläne, das ist ja das Problem. Aber es stimmt, ich will es noch einmal versuchen.«
»Um die Welt?«, fragte er.
»Wie kommen Sie darauf?«
»Es gibt Vermutungen.«
»Da wissen Sie mehr als ich.«
»Es heißt, Sie seien im Begriff, einmal um den Erdball zu fliegen, am Äquator, auf ganzer Länge. Als erster Mensch. Was könnte Sie daran reizen?«
Diesmal musste ich nicht überlegen. Ich sah ihn an und sagte: »Manchmal müssen Frauen zeigen, dass sie können, was Männer können. Und manchmal müssen sie zeigen, dass ihnen etwas gelingt, was noch kein Mann gewagt hat.«
Ich nahm einen Schluck aus dem Wasserglas, den ersten während unseres Gesprächs. Ich mag es nicht gern, wenn jemand zusieht. So ein Schluck Wasser bekommt eine riesige Bedeutung, wenn dir das ganze Land beim Trinken zuschaut. Nicht zuletzt dauert es auf einmal viel länger. Ich wischte mir über die Lippen und sagte:
»Es fühlt sich an, als hätte ich nur noch einen guten Flug übrig, und ich hoffe, dies ist er. Er ist mein Schwanengesang. Mein Zuckerguss auf dem Kuchen.«
Als die Wochenschau gezeigt wurde, fragte ich George nicht, ob er sie gesehen habe. Es war auch nicht nötig. Er war außer sich und lief unablässig im Wohnzimmer auf und ab.
»Man kann dich wirklich nirgendwo alleine hinlassen. Das war eine Chance. Du hast sie verschenkt. Allmählich musst du das doch wissen. Du hast gleichzeitig viel zu viel und viel zu wenig gesagt. Es ist wie immer: Chancen pflückt man, sonst pflücken sie dich. Wie kann man so etwas verhauen?« Er blieb stehen und sah mich an. »Und dann diese idiotische Blume. Eine einzelne, mickrige Blume. Sie lag auf deinem Schoß wie ein totes Baby.«
Am Morgen vor der Aufzeichnung hatte George mich kaum aus dem Haus gelassen. Er wollte unbedingt, dass ich zu diesem Auftritt ein Kleid trage. »Ausnahmsweise!«, hatte er immer wieder gerufen. »Sieh es als Geschenk! Für mich. So ein Publikum bekommen wir so schnell nicht wieder. Du brauchst sie. Wir brauchen sie. Sie sollen dich lieben. Glaub mir, von Wirkung verstehe ich mehr als du. Wenn ich dir überhaupt irgendetwas bedeute, wirst du mir den Gefallen tun.« Ich hatte ihn noch gehört, als ich schon in der Haustür stand. Mit einem Lächeln zog ich sie hinter mir zu.
Kurz darauf schrieb Eleanor mir einen Brief. Über den Auftritt verlor sie kein Wort, jedenfalls kein direktes. Womöglich hatte es einfach nur ihre Erinnerung aufgewühlt. Sie schrieb: »Für den Fall, dass wir uns vor deinem Aufbruch nicht mehr sehen, will und muss ich dir ein Wort zum Abschied schreiben. Und weil du – wieder einmal – zu einer so wagemutigen Reise aufbrichst, will und muss ich etwas grundsätzlicher werden. Ich bin dankbar für unsere Begegnung. Für alles daran. Manchmal denke ich nach über die Tatsache, dass wir unterschiedlichen Jahrgängen angehören. Ich kann so viel lernen von deiner Art, die Welt zu betrachten, die sich um manches nicht schert, was mir unumstößlich scheint. Und womöglich kann ich dir von Erfahrungen berichten, damit du sie nicht neu machen musst. Erst recht dankbar bin ich, dass du eine Frau bist. Immer.«
Es dauerte einige Wochen, bis ich zu einer Antwort fand: »Verzeih mein langes Schweigen. Ich bin jetzt dauernd zu Vorträgen unterwegs, die Reisen rauben mir den Verstand. Jeden Abend, wenn ich in einem neuen Hotelzimmer meinen Koffer aufschlug, lag dein Brief obenauf, zugleich tröstend und mahnend. Und weil ich mir die Gedanken an dich nicht beschweren wollte, beschloss ich, ihn nur als Trost anzusehen und nicht als Mahnung. Ich hoffe, das war in deinem Sinn. Allerdings hat die Antwort deshalb länger gebraucht. Bitte sieh es mir nach. Auch ich bin dankbar, dass wir uns getroffen haben. Ob wir uns in besonderer Weise guttun, weil wir unterschiedlich lange auf der Welt sind, kann ich nicht beurteilen. Offen gestanden habe ich über den Unterschied nie nachgedacht. Mir ist er vollkommen gleich. Ich will noch nicht einmal aus deinen Erfahrungen lernen. Am Ende muss ich doch meine eigenen machen. Und überschätze bitte nicht meine Jugend. Zum einen ist sie schon bald vorbei. Zum anderen bin ich in mir selbst ganz ohne Alter. Ich kann es nicht erklären, aber ich bin blind für diese Dinge. Wenn ich in mich hineinschaue, sehe ich nichts als ein Ich, ohne Alter und ohne Gestalt. Ich bin nicht jung, ich bin Amelia. Ich jedenfalls sehe in dir nichts als eine Frau, die ich schätze. Und wenn ich ganz ehrlich bin, sehe ich nicht mal die Frau. Auch in dieser Sache gibt es eine Art Blindheit.«
In ihrem nächsten Brief fragte Eleanor, ob ich ihr Flugstunden geben könne. Es sei ein alter Traum, sie habe sich noch nicht getraut, mich darum zu bitten. Am Ende des getippten Briefes stand eine handschriftliche Ergänzung: »Ich habe mit ihm gesprochen & er wird es mir jetzt nicht erlauben. Aber vielleicht kann ich ihn später einmal überzeugen!«
Uns war bewusst, dass unsere Briefe auch von anderen gelesen wurden.
George war eitel. Wann immer ich fotografiert wurde, versuchte er, mit auf dem Bild zu sein. Wenn ich auf Fotos lachte, lag es meist daran, dass er gerade versuchte, sich mit hineinzudrängen. Er schätzte Prominente, vor allem für ihre Prominenz. Anderen gegenüber konnte er auftrumpfend sein. Ich hatte keine Ahnung, was er sich davon versprach, und nahm es ihm im Stillen übel.
Während ich so über ihn nachdachte, schaute George auf einmal von seinem Fortune Magazine auf. Er war nicht in der Lage, etwas zu lesen, ohne sofort zu erzählen, was er gelesen hatte.
»Sie haben eine Untersuchung zur Sprache im Alltag gemacht«, rief er. »Eine Frau redet täglich zwanzigtausend Wörter. Was sagst du dazu? Zwanzigtausend, an jedem gottverdammten Tag.«
»Hm«, sagte ich.
»Was heißt hier ›Hm‹? Soll das alles sein, was du dazu denkst? Ist doch sagenhaft. Zwanzigtausend. Stell es dir einfach mal vor. Zwanzigtausend Wörter. Ein ganzer Raum aus Geschwätz, eine Kathedrale aus heißer Luft. Ich fasse es nicht. Wer hat denn dermaßen viel zu erzählen? Ich erlebe gar nicht genug, um so viel zu reden. Und wer hört sich das alles an?«
»Eben.«
George blätterte weiter. Eine ganzseitige Annonce zeigte eine junge Dame im Negligé, die den Betrachter aus den Laken eines Bettes heraus anlächelte. Die Bildzeile lautete Serving you from dawn to dusk. Es ging um Bakelit. Bevor George auch diese Seite kommentieren konnte, fragte ich:
»Und ein Mann?«
»Wie bitte?«
»Wie viele Wörter sagt ein Mann?«
»Dreizehntausend«, murmelte George.
Ich sagte: »Wir hätten dich zur Hochzeit in ein Brautkleid stecken sollen.« Aber George war schon wieder in den nächsten Artikel vertieft.
Was es über mein Leben mit George zu sagen gab:
1. Er denkt sich immerzu etwas aus, um mich zu überraschen. Umgekehrt mache ich das fast nie. Offen gestanden achte ich nicht immer auf ihn. Er dagegen nimmt alle Menschen in seiner Umgebung wahr und ahnt, was jeder sich wünscht. Ich habe noch nie ein Kompliment von ihm bekommen, das ich ihm nicht geglaubt habe. Und er macht viele Komplimente. Völlig verzückt ist er von meinen Händen. Wie oft er sie ansieht. Er sagt dann irgendetwas über ihre sich zuspitzende Anmut und ich lache. Aber es freut mich doch, dass er bemerkt, wie schön sie sind. In seinen Briefen kommentiert er alles an mir, besonders oft meine Kopfbedeckungen. »Deine Hüte!!« (Für einen Verleger ist er recht großzügig mit Ausrufezeichen.) Ich kenne niemanden, dem es solch eine Freude bereitet, anderen eine Freude zu bereiten. Er ist ein König des Schenkens. Manchmal möchte er etwas dafür, aber nicht immer.
2. Ich glaube, dass George im Kopf immerzu Geschäftsideen durchspielt. Zum Glück verwirft er die meisten davon. Manchmal habe ich den Eindruck, es ist seine Art, dem Moment zu entfliehen. Wie andere beginnen, Wörter rückwärts zu buchstabieren, wenn sie sich in einer Situation unwohl fühlen, konzentriert er sich auf das Spiel von Angebot und Nachfrage. Es ist einfach sein Wesen.
3. George ist müde, sobald keiner mehr hinschaut. Er setzt sich einfach irgendwohin und stützt sein erschöpftes Kinn auf die Hände. So bleibt er. Sobald jemand auftaucht, wird er sogleich wieder der, der er ist.
4. Ich aber mag seine Müdigkeit. Wie ich überhaupt vor allem die Seiten an ihm schätze, die er am liebsten verbirgt und von denen er wünschte, es gäbe sie nicht. Aber es gibt sie und in mir haben sie eine Freundin. Egal, was er selbst darüber denkt.
5. Es ist erstaunlich, neben ihm im Bett zu liegen. George schläft auf dem Bauch und spreizt im Schlaf ein Bein ab, als würde er einen riesigen Schritt machen, hinüber in eine andere Welt. Ich dagegen halte beim Einschlafen die Beine geschlossen und beim Aufwachen finde ich sie unverändert vor. Als stünde ich die ganze Zeit auf der Stelle. Dabei weiß ich natürlich nicht, was zwischendurch geschieht.
6. Wir lieben uns, wenn ich es will. Manchmal auch, wenn er es will, aber er will es nicht oft.
7. Als wir zusammenzogen, war er ganz beflügelt. Das ist einige Jahre her. Er zitterte vor Plänen und Ideen, die meisten drehten sich um mich. Eins war so eilig wie das andere. Er plante ein Label für Damenmode mit meinem Namen, er plante eine Serie von Reisegepäck, für die ich Werbung machen sollte, er führte Gespräche mit in- und ausländischen Postbehörden, um Sonderbriefmarken mit meinem Gesicht herauszubringen. Die Erregung hat sich mittlerweile ein wenig gelegt.
8. George hat eine heimliche Schwäche für süße Liköre, der er allerdings kaum je nachgibt.
9. Wenn man acht darauf gibt, erkennt man in George die Spuren seiner Vorfahren. Den über Generationen gewachsenen Einfluss in der Welt. Das offensichtliche Übermaß ihrer Möglichkeiten. Sie haben sich daran gewöhnt, Gehör zu finden. In ihnen wohnt die unumstößliche Gewissheit, immer schon dazuzugehören. Wie ein Menschenrecht, das allerdings nicht für jeden gilt. Sie nehmen die eigene Position als von der Natur gegeben. Wie schafft man es nur, nicht erstaunt darüber zu sein? Als wäre es alles eine Selbstverständlichkeit. Wahrscheinlich lauert dahinter wie eine verflogene Erinnerung die Einsicht, dass es einmal anders gewesen sein muss, und nun geht es darum, auf keinen Fall daran zu denken. Aber ein Rest dieses Wissens ist da, wie in einer Speise die Spur eines Gewürzes, auf dessen Namen man nicht kommt. Sobald man glaubt, es zu schmecken, verfliegt es schon, und erst recht fällt einem nicht ein, wie es heißt. Man bekommt die Sache nicht zu fassen und vielleicht ist es das, was einem Angst macht.
10. Ich stelle es mir ungeheuer mühsam vor, George zu sein.
George war eifersüchtig. Er selbst hatte damit gar kein Problem, mit Vorliebe zitierte er das fünfte Buch Mose: »Ich bin ein eifersüchtiger Gott.« So sah er sich. Wobei er aufs Göttliche noch stolzer war als auf die Eifersucht. Er sah darin eine Eigenschaft seines Berufes, eine Art Déformation professionnelle: Seine Interessen seien einfach plural. Einmal erklärte er mir: »Das Schreiben ist eine monotheistische Religion. Wer schreibt, hat einen Verlag. Ein Verleger dagegen hat viele Autoren, er huldigt der Vielgötterei.« Ich widersprach ihm nicht.
Einmal kamen wir von einem Empfang zurück. Im Taxi hatte George geschwiegen. Als er die Haustür aufschloss, sagte er: »Ich habe Sorge, dass du mich verlässt. Du bist nur noch mit Gene unterwegs.«