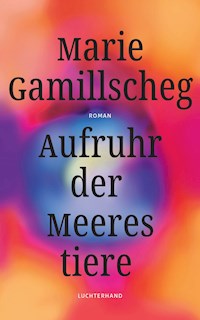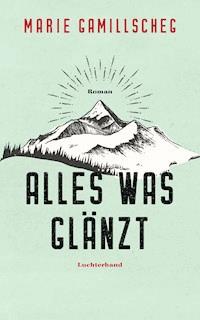
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand Literaturverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Marie Gamillscheg nimmt den Leser mit in eine allmählich verschwindende Welt. Vielstimmig und untergründig erzählt ihr Debüt von einer kleinen Schicksalsgemeinschaft im Schatten eines großen Bergs und vom Glanz des Untergangs wie des Neubeginns.
Tief in den Stollen des alten Bergwerks tut sich was – und alle im Dorf können es spüren. Die Wirtin Susa zum Beispiel, wenn sie im „Espresso“ nachts die Pumpen von den Ketchup-Eimern schraubt. Oder der alte Wenisch, ihr letzter Stammgast. Sogar der Bürgermeister, wenn er nicht gerade auf Kur ist. Zuallererst aber hat es der schweigsame Martin gespürt, bis er dann eines Morgens die Kontrolle über sein Auto verlor. Es ist, als würde der Berg zittern, als könne er jeden Augenblick in sich zusammenbrechen. Für die junge Teresa und den Neuankömmling Merih ist die Sache klar: Sie will sich endlich absetzen aus dem maroden Ort, er hingegen sucht einen Neuanfang - ausgerechnet hier.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 235
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Zum Buch
Tief in den Stollen des alten Bergwerks tut sich was – und alle im Dorf können es spüren. Die Wirtin Susa zum Beispiel, wenn sie im »Espresso« nachts die Pumpen von den Ketchup-Kübeln schraubt. Oder der alte Wenisch, ihr letzter Stammgast. Oder Teresa, wenn sie oben am Waldrand steht, wo sie die Wiese schon aufreißen sieht. Zuallererst aber hat es der schweigsame Martin gespürt, bis er dann eines Morgens die Kontrolle über sein Auto verlor. Es ist, als würde der Berg zittern, als könne er jeden Augenblick in sich zusammenbrechen. Nur der gerade erst im Ort angekommene Merih merkt noch nichts. Er sucht einen Neuanfang – ausgerechnet hier.
Zur Autorin
MARIE GAMILLSCHEG, geboren 1992 in Graz. Lebt in Berlin, arbeitet als freie Journalistin. Studium der Osteuropastudien an der FU Berlin. 2015 u. a. Literaturförderungspreis der Stadt Graz und New German Fiction Preis. 2016 Klagenfurter Literaturkurs und Arbeitsstipendium des Berliner Senats, 2017 Aufenthaltsstipendium in Schöppingen. »Alles was glänzt« ist ihr Romandebüt.
Roman
Luchterhand
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2018 Luchterhand Literaturverlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Covergestaltung: buxdesign/München
Covermotive: © grop/Shutterstock
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-21559-0V002
www.luchterhand-literaturverlag.de
facebook.com/luchterhandverlag
Fressen und gefressen werden, das war schon immer so. Am Anfang war ein Meer.
(0,0)
Alles schläft. Nicht die Nacht, der Tag höhlt die Häuser aus. Tagsüber schwarze, leere Löcher. Manche sind ausgebrannt. Da hat wer randaliert. Da hat wer die alten Matratzen verbrannt, und jetzt liegen nur mehr Drahtgestelle herum. Nachts kann man glauben, dass hier Menschen schlafen, dass hier am nächsten Morgen Menschen aufstehen, in Autos steigen und zur Arbeit fahren. Aber seit der Journalist hier war, sind viele in die Stadt gezogen, und Susa vermietet ihre Zimmer dauerhaft zum Nebensaisonpreis. Man klopft noch immer auf die Plakette am Boden vor der Kirche: ZURSTADTERHOBEN 1857, wie um zu überprüfen, ob sie noch immer da ist, eingelassen in den Boden. Die Plakette bleibt. Man darf sich offiziell Stadt nennen. Nur die Katzen bleiben über, wenn es Abend wird. Sie haben sich das alte Tourismusbüro ausgesucht; das ist ihr Revier. Sie legen sich in die Regale, rollen sich eng ein, erbrechen Gras zwischen den Altpapierstapeln. Sie zerren tote Maulwürfe durch den offenen Türspalt.
Der rote Knopf im Schaubergwerk funktioniert nicht mehr, und niemand repariert ihn. Wenn man ihn jetzt drückt, gehen die blauen und violetten und weißen Lichter nicht an, die den Fels bestrahlen, geht die Stimme nicht an, die die Sage vom Blintelmann erzählt, und in der Höhle ist es immer nur dunkel. Der Bürgermeister sagt: Wer weiß, ob sich das lohnt. Damit der rote Knopf wieder funktioniert, damit der Blintelmann wieder spricht und die Lichter leuchten, müssen alle elektrischen Leitungen getauscht werden und wer weiß, ob sich das lohnt. Man muss sich vorstellen, sagt der Bürgermeister: Man tauscht die Leitungen und dann auf einmal, genau dann, natürlich genau dann, wird eine tragende Stollenwand gesprengt, oder sie löst sich durch die Erschütterung und ein Stollen klappt in sich zusammen, in einen anderen Stollen, und der in einen weiteren Stollen, und das Geröll aller Stollenwände bricht auf den Ort, die Häuser brechen ineinander, Staub in Staub, wie der Journalist geschrieben hat, dass es passieren wird.
Man denkt an die Zeitung damals. Auf dem Titelblatt war der Umriss des Berges abgebildet, in eine Holzscheibe geritzt, zersetzt von Nagekäfern. Wie ihn die Kinder in der Schule früher in die Kartoffeln geschnitzt und auf Tischdecken gedruckt haben: Auf der einen Seite ein steiler glatter Hang, auf der anderen führt die Flanke etwas länger ins Tal, am Fuße des Berges drängen sich Bäume und Häuser.
Überall Gänge, Löcher. Höhlen.
Stollen und Schächte.
Schon jetzt brechen bei den Sprengungen kleinere Schächte zusammen, stand in der Zeitung. Schon jetzt brechen die Böden ein, die Steine rieseln die Etagen hinunter, und wenn es so weitergeht, ist der Berg irgendwann einfach hohl. Jahrhundertelang grub man von unterschiedlichen Etagen und Seiten Stollen in den Berg, man grub einfach drauflos, den Erzspuren hinterher. Erst im Nachhinein hat man versucht Pläne anzufertigen, aber zu groß, zu verworren das Netz an Stollen. Immer wieder neue Abzweigungen, neue Höhlen und Luftlöcher in der Erde, von denen niemand weiß, zu welchem Schacht sie gehören.
Ob man von dem Grubenunglück in Lengede gehört hat?
Von der Gasexplosion in dem Bergwerk in Donezk?
Warum sind Chinas Kohlegruben so gefährlich?
Manchmal läuft was im Fernsehen.
Man stellt sich einen großen Knall vor. Oder es passiert ganz leise. Ein Rauschen, wie eine Welle, die ins Tal schlägt. Das man zuerst hört, dann sieht.
Ein Rauschen, das man sehen kann!
So denkt man es sich zurecht. Wenn man in der Kirche am Weihwasserbecken steht. Wenn man im ESPRESSOan der Bar sitzt und Susa beim Gläserputzen zusieht, oder wenn man die Hand ins Brunnenwasser streckt, wenn man sich eigentlich gerade die Zierleiste der Häuser auf dem Hauptplatz näher anschauen will.
Der Journalist hat unrecht, da sind sich alle im Ort einig. Der Bürgermeister weiß das auch. Aber trotzdem, sagt er. Man denkt natürlich daran. Susas Katze hat einmal ein neues Hüftgelenk bekommen, und in der Woche darauf fand Susa die Katze mit dem steifen Bein angelehnt an der Hauswand. Jemand hat sie überfahren, und der Tierarzt hat das Hüftgelenk noch bei einer anderen Katze einbauen können, Susa hat ein bisschen Geld zurückbekommen, aber nicht viel. Susa denkt daran.
Früher ist man abends oft bei Susa im ESPRESSOzusammengesessen, die Alten und manchmal auch die Jungen. Damals ist man um die kleinen Tische gesessen und nicht alle an der Bar. Auch der Journalist hat sich dazugesetzt, als er im Ort war, damals, vor zehn, fünfzehn Jahren. In Pantoffeln ist er hinunter in den Gastraum. Die Alten haben sich nichts dabei gedacht. Er hat nach dem Leben im Ort gefragt, nach Plänen von den Schächten, nach den Archiven, er hat Schnaps getrunken und Bier und wieder Schnaps, er hat immer mitgetrunken und verstanden, wie das funktioniert: wann der Zeitpunkt ist, aufzustehen und an der Bar noch eine Runde für alle zu holen. Er hat auch erzählt, von sich, dass er eine Tochter hat und dass er gern wandern geht, aber die Tochter nicht und deshalb sei alles schwierig, mit dem Sommerurlaub, weil die Mutter wolle auch lieber in den Süden oder nach New York, das sei schwierig.
Ihr wäre er immer unsympathisch gewesen, sagt Susa. Er habe jeden Tag die Handtücher im Zimmer auf dem Boden liegen lassen, und er wäre nie wirklich betrunken gewesen, immer noch kontrolliert, und immer hätte er nach dem Essen den Teller von sich geschoben, als würde er sich davor ekeln. Sie hätte es gleich gewusst, sagt Susa. Das sagt Susa erst später.
Wer durch den Ort geht, der weiß: Hier passiert etwas. Oder eher: Hier ist etwas passiert. Man grüßt sich nicht auf der Straße. Der rote Knopf ist kaputt. Seit der Journalist hier war, kommen keine Touristen mehr, und der rote Knopf im Schaubergwerk wird nicht repariert. Man weiß nicht mehr, wie das war: ob der rote Knopf kaputtging, als der Journalist hier war, oder ob der rote Knopf schon vorher nicht mehr funktionierte und nicht mehr repariert wurde, weil der Journalist hier war. Auf jeden Fall hat der was damit zu tun. Jetzt ist es immer dunkel in der Höhle, und man sieht nicht, wie die Wände glänzen, wie alles, was glänzt, so viele Farben hat, und man kann sich nicht mehr fragen, ob zuerst das Glänzen oder die Farben waren.
***
Das Glänzen! Teresa sitzt vor der Zimmertür und hält ihre Hände ganz nah an die Augen. Beim Zeigefinger hat sie nicht ruhig gehalten und den silbernen Lack über den Nagel hinaus aufgetragen. Sie muss wieder an die eineiigen Zwillinge aus der Doku denken, die gleichzeitig sterben. Die auch zur gleichen Zeit Kinder bekommen oder große Entscheidungen treffen, obwohl sie auf unterschiedlichen Kontinenten leben. Teresa sagt: Es soll eineiige Zwillinge geben, denen es gleichzeitig gut oder schlecht geht, obwohl sie nicht wissen, was der andere macht oder wo er wohnt, das sagt sie zu ihrer Schwester Esther, das sagt sie zur Tür, sagt es in die Tür, hinter der Esther noch immer die weiße Decke anstarrt. Sie liegt rücklings auf dem Bett, noch immer die Hände zu Fäusten verkrampft.
Später wird sich kaum jemand dafür interessieren, wie es genau passiert ist. Ob Martin in der zweiten oder dritten Serpentine aus der Kurve geflogen ist. Ob es sich einen Moment für ihn so angefühlt hat, als ob er abhebt, ob es diesen Moment vor dem Aufprall überhaupt gibt. Ob sich das Auto mehrfach überschlagen hat, oder ob es nur einmal aufgeschlagen ist. Ob er sofort tot oder noch kurz bei Bewusstsein war. Ob er noch einmal gesehen hat, wie der Ort vor ihm auf dem Kopf steht. Ist hinter den Bergen schon die Sonne aufgegangen?
***
Der Lastwagenfahrer, der Martins Auto findet, hört vor allem: den Motor des Lastwagens, den er lenkt, wie er lauter wird, als er Gas gibt, dann leiser, als er schaltet. Das Gebläse der Lüftung, nachdem er den Motor ausgemacht hat, das Geräusch, als er die Handbremse zieht, wie dann etwas knackt im Auto; das warm gewordene Plastik der Armatur vielleicht. Er erkennt überhaupt erst spät, dass es ein Auto ist, das da vor ihm auf der Straße liegt.
Das Öffnen der Tür, wie der Innentürgriff wieder zurückschnappt, das Zuschlagen der Tür, dann nur die Vögel, der Wind, die Schritte am Schotter. Es ist noch früh am Morgen, so früh, dass alles noch in ein grelles graublaues Licht getaucht ist, die Konturen zu scharf, weil es so früh am Morgen noch keine Farben gibt, die sie weicher zeichnen. Es ist so früh, dass er einen Moment braucht, um zu verstehen, dass noch jemand im Auto sein könnte. Er probiert das Auto selbst umzudrehen, schafft es aber nur zu schaukeln. Dann ruft er die Polizei an.
Er stellt sich an den Straßenrand, wo es bis zur nächsten Serpentine, zur nächsten Etage des Berges, beinahe senkrecht hinuntergeht, schaut ins Tal und dreht sich nicht um, bis er die Polizei kommen hört.
Dem Polizisten erzählt er zuerst vom Hören: der Motor, das Knacksen, die Tür, das Schaukeln des Autos, die Stille danach. Die Feuerwehrmänner heben das Auto mithilfe eines ausfahrbaren Krans an und drehen es um. Die Windschutzscheibe ist zerborsten, und ein Feuerwehrmann schneidet die Fahrertür mit einer Bergeschere auf. Den Lastwagenfahrer überkommt eine Gänsehaut, das Metall, der Lack, das Plastik der Innenausstattung, alles nur ein Knacksen. Das Dach ist eingedellt, die Seite aufgeschnitten und der Lack zerkratzt, trotzdem sieht man, dass jemand gut auf das Auto aufgepasst haben muss.
Jemand hat das Nummernschild und die Felgen geputzt.
Jemand hat nichts auf der Rückbank liegen gelassen.
Er könne heute den restlichen Tag freimachen: Das sagt der Chef dem Lastwagenfahrer am Telefon. Er soll den Lastwagen zurückbringen, seine Arbeit wird ein Kollege übernehmen oder nicht, wer weiß, wie lange die Straße blockiert sein würde. Er solle sich keine Sorgen machen. Er sieht über die Serpentinen, die er gerade hinaufgefahren ist, hinunter ins Tal, er sieht, wie der Schulbus die Bundesstraße am rechten Rand des Tals entlangfährt, an der Haltestelle stehen bleibt, weiterfährt. Er sieht die Serpentinen unter sich, die wie Wellen ins Tal gehen, sie schneiden sich hellbraun in den orangeroten Berg wie die Altersringe eines aufgeschnittenen Baumstamms. Links von ihm, ein paar Serpentinen weiter unten, windet sich die Straße um einen türkisblauen Stausee herum, der in ein Becken zwischen den Etagen eingelassen ist. Vor ihm der Ort, von den grünen Hangseiten des Tals links und rechts eingeschlossen. Von hier oben sieht es so aus, als gäbe es nur die Farben Grün und Rot; die grünen Hügel, das Karminrot der spitzen Dächer der Häuser um den Hauptplatz, der orangerote Stein des Abbaubergs, auf dem er gerade steht, am Ende des Tals großflächiges Zinnoberrot: die alten Arbeitersiedlungen. Von hier oben sieht es so aus, als würde es im ganzen Tal nur die eine Straße geben, die Bundesstraße, die immer geradeaus in die Ferne führt. Von hier oben sieht der Ort so aus, wie er immer schon ausgesehen hat. Von hier oben kann man glauben, dass dort jeden Sonntag viele Menschen auf einen Markt gehen, dass es dort Feste gibt, wo Menschen Nägel in einen Baumstumpf einschlagen und danach Kinder das Konfetti vom Boden aufsammeln und ihre Zungen damit färben. Der Lastwagenfahrer sieht, wie im Kiosk Licht angeht, er hört die Kirchenglocke. Dort ist das, was hier oben auf der Straße liegt, noch nicht passiert. Er denkt an die Geschichten, die man über den Berg und den Ort erzählt. Er denkt daran, wie er nach Hause fährt und sich wieder ins Bett legt.
Himmel, sagt der Polizist. Der Martin.
Martin ist nur noch ein schlaffer Körper, als man ihn aus dem Auto holt, eingeklemmt zwischen Lenkrad, Sitz und Dach.
Bis gerade eben hat der Polizist die Arme verschränkt, jetzt steckt er sein Hemd fester in die Hose, zieht die Hose hoch. Er ist der Einzige aus dem Ort. Die anderen, der Lastwagenfahrer, die Feuerwehrmänner, die Sanitäter, sind aus Nachbarorten, für sie ist es nur irgendein junger Mann in einer dunkelblauen glänzenden Sportjacke, die er bis oben zugezogen trägt, irgendein junger Mann mit dünnem glatten Haar, der schlaff und schwer in den Armen der Feuerwehrmänner hängt. Aber auch sie halten kurz inne. Er ist jung und sieht aus wie jemand, über den man sich erzählt, dass er im Leben noch alles vor sich hat, und sie verstehen nicht, wie genau so jemandem so was passieren kann.
Einer der Feuerwehrmänner spricht als Erster wieder.
Er war angeschnallt, das ist wichtig, sagt er, das muss in den Bericht.
Man legt ihn auf die Liege des Rettungswagens, die Sanitäter beugen sich über ihn und auch der Feuerwehrmann und der Polizist, obwohl sie nicht müssen, aber ab dem Moment ist es, als gehörten sie irgendwie zusammen, als wäre es ihre gemeinsame Aufgabe, sich über Martin zu beugen und seinen Puls zu kontrollieren. Dann kommt der Arzt. Er zieht bald die Decke ganz über den Körper und setzt sich in sein Auto, um das Protokoll zu schreiben. Die Sanitäter bleiben stehen. Man nickt sich zu.
Im Tal beginnt etwas: ein Montag.
Der Polizist und der Lastwagenfahrer stehen am Straßenrand und schauen auf den Ort hinunter. Der Polizist erinnert sich, er hat am vergangenen Wochenende noch gesehen, wie Martin und Esther im Auto gesessen sind, in genau diesem schwarzen Auto, das jetzt keine Windschutzscheibe und keine Fahrertür mehr hat, sind sie an ihm vorbeigefahren, als er gerade an der Straße stand und auf den Bus wartete, um den Busfahrer persönlich zu fragen, warum er jeden Morgen später kam, die Leute beschwerten sich. Wahrscheinlich sind Esther und Martin in die Stadt gefahren oder in den Nachbarort, was die Jungen so machen, am Wochenende. Die Jungen, die ein Auto haben. Er weiß, dass Martin in der Pubertät ein Kind war, um das man sich Sorgen machte: immer allein, immer den Zippverschluss seiner Jacke im Mund. Oft lag er bäuchlings auf der Straße und trank aus Regenlaken, als er eigentlich schon viel zu alt für solche Dinge war, er kletterte in die Bäume und versteckte sich dort, bis die Eltern den Polizisten riefen, wenn sie ihn nicht fanden. Und immer dieser Zippverschluss im Mund, immer dieses Nicken, ohne was zu sagen, wie hängen geblieben, wie eingependelt, aber dann kam Esther, und er kletterte nicht mehr in die Bäume, er begann zu arbeiten und kaufte sich ein Auto, dieses große schwarze Auto, und fuhr am Wochenende mit Esther in die Stadt oder in den Nachbarort.
Und was machen Sie hier oben, so früh am Morgen, fragt der Polizist den Lastwagenfahrer. Schaut ihn von der Seite an.
Der Lastwagenfahrer zögert kurz, hält dem Polizisten eine zusammengedrückte Schachtel Zigaretten hin, Rückbau sagt er dann. Er zündet sich eine Zigarette an. Der Polizist nimmt keine.
Ich habe gedacht, die Jungen sind sowieso schon längst weg, sagt der Lastwagenfahrer.
Der Polizist schüttelt den Kopf. Dann schüttelt auch der Lastwagenfahrer den Kopf.
Schon verrückt, sagt er, da hat man immer Angst, dass der Berg einen umbringt, und dann ist es wirklich so, nur, er schüttelt den Kopf, macht seine Brusttasche auf, macht sie wieder zu, dann doch irgendwie anders.
Mittlerweile ist die Sicht klar. Die Sonne muss irgendwo hinter den Wolken aufgegangen sein. Die Steine, der Wald, die Dächer haben ihre echten Farben.
Ich muss dann, sagt der Lastwagenfahrer und bleibt stehen. Ich muss in die Firma, sagt er, schaut den Polizisten an, schaut hinunter in den Ort, auf das Auto.
Wenn das in Ordnung ist, dass ich gehe, sagt er.
Jaja, sagt der Polizist und der Lastwagenfahrer öffnet die Tür zur Fahrerkabine. Der Polizist hat sich umgedreht und zieht seine Hose hoch.
Die guten Familien, die bleiben, sagt er.
***
Ein paar Stunden später ist der Ort ein einziges Kopfschütteln. Man weiß zu wenig. Man denkt vor allem über früher nach. Der Polizist hat sein Bestes getan. Er hat Martins Mutter an die Schulter gefasst, kurz zugedrückt, aber sie hat gesagt, nein, das kann nicht sein, Martin ist bei der Arbeit, Martin hat sein Bett heute Morgen noch gemacht und ist dann in sein Auto gestiegen und zur Arbeit gefahren, Martin hat sich doch die Außenfarbe des Neubaus aussuchen dürfen, Martin installiert gerade irgendwo fremden Menschen ihre Internetanschlüsse, und abends wollte sie doch Lasagne machen, genau heute wollte sie Martin doch Lasagne machen und dann Martin zusehen, wie er ihre Lasagne isst. Der Polizist steht da, seine Hände in den Hosentaschen, seine Hände hinter dem Rücken, will sagen, dass es eigentlich wie früher ist, als sich Martin in den Kirschbäumen versteckt hat: dass man nur geduldig sein muss.
Martins Vater ist auf dem Sofa sitzen geblieben.
Auf dem Berg, sagt er, wo genau. Heutzutage weiß keiner mehr, dass die Etagen alle Namen haben, dass sie Namen berühmter Bergarbeiter oder Heiliger haben, und es wäre schon interessant, auf welcher Stufe.
Der Polizist bleibt vor dem Haus stehen. Das Haus ist gelb, der Neubau dunkler, fast orange. Pfirsichfarben, Esther hat gesagt, Pfirsich ist freundlich, er erinnert sich, Pfirsich ist immer irgendwie modern.
***
Irgendjemand hat es ihr sagen müssen. Teresa hält Esther am Arm und sagt: atmen. Du musst ruhig atmen. Aber Esther verkrampft nur ihre Finger und Zehen, jetzt auch die Beine, die Arme, sie spreizt sie von sich, als hätte sie auf einmal Gelenke an ungewöhnlichen Stellen, als wären sie mehrfach gebrochen, oder als würden sie einfach nicht mehr zu ihrem Körper gehören. Du musst atmen, ruhig einatmen, ausatmen, einatmen, sagt Teresa und bekommt auf einmal selbst keine Luft mehr, sie drückt Esther immer fester, und Esther schaut nur auf ihre eigenen steifen Finger, auf ihre Beine, die von ihrem Körper abstehen; ihre Augen, ihr Mund, sind weit geöffnet, kein Laut, kein Atemzug, ich rufe einen Arzt, sagt Teresa, ich rufe die Eltern, sagt sie und läuft aus dem Zimmer, läuft wieder hinein, und Esther schüttelt nur den Kopf, ich rufe jetzt wirklich einen Arzt, sagt Teresa, und als Esther tief Luft holt, danach alles ein großes Zittern, das Atmen, die Beine, die Finger, ist sie schon hinaus, die Straße hinunter, in das pfirsichfarbene Haus hinein, und Teresa kann sie nicht mehr am Arm zurückziehen und läuft hinterher. Esther macht die Tür hinter sich zu. Teresa traut sich nicht, sich vor der Tür auf den Boden zu setzen, wenn Martins Mutter kommt, was würde die denken, in dem fremden Haus, auf dem neuen Laminatboden. Sie versucht sich auf etwas zu konzentrieren. Auf den kleinen Spalt zwischen Boden und Tür zum Beispiel. Auf das silberfarbene Muster auf ihren Fingernägeln. Auf den Geruch von Leim, von frisch gestrichenen Wänden. Sie versucht etwas zu hören, aber sie hört nur ein Knirschen, ein Knirschen der Decke vielleicht, wie sie sich über ihr ausdehnt.
***
Es bleibt nur das Kopfschütteln. Das Bingo bei Susa fällt heute aus. Der Verein zur Erhaltung der alten Pressmühle hat sein wöchentliches Treffen abgesagt.
Susa probiert ein paar Sätze aus, die sie immer sagt, wenn jemand im Ort stirbt.
Sie sagt:
Er hat sein Leben gelebt.
Sie sagt:
Es war besser für ihn so, am Ende.
Sie sagt:
Er war ja wer bei uns, man wird ihn nicht vergessen.
Dann füllt sie Erdnüsse in ein Schälchen. Die Nüsse sind ganz klein in ihren Händen. Sie isst wie jemand, der will, dass ihm die Zähne wehtun oder dass er sich irgendwann auf die Zunge beißt. Dabei schaut sie auf den Fernseher in der Ecke.
Susa sagt: Wenigstens hat er nicht lang leiden müssen.
Sie dreht die Musik lauter.
Wenisch fragt Susa, ob das Wetter anhalte, ob jetzt der Sommer komme.
Susa holt den Waschlappen aus der Küche, hebt das Metallgitter der Bierausschenke und putzt es.
Man kann wiederholen, was der Bürgermeister zur Zeitung gesagt hat: In der Stadt wäre das nichts, aber hier, bei uns, das trifft uns direkt ins Herz.
Wie der immer auf die Tränendrüse drückt, der, sagt Susa.
Sie macht die Musik aus, schaltet den Fernseher lauter.
Sie fixiert einen Punkt in der Ferne, verhakt ihren Blick in dem weißen Spitzenvorhang vor den Milchfenstern. Wenn sie ganz ruhig steht, spürt sie ein Zittern in ihrem ganzen Körper, ein leichtes Schütteln der Arme, der Beine, der Haut am Hals.
Man muss sich die Sachen zurechtdenken. Man muss sich die Geschichte zusammendenken, sonst wird man verrückt.
Als meine Mitzi in die Stadt gezogen ist, habe ich das auch gemacht, sagt Wenisch. Er prostet Susa zu. Sonst wird man verrückt.
Wenisch schleckt seinen Zeigefinger ab und fährt damit über die Innenseite des leeren Schälchens, schleckt dann das Salz und die Erdnussbrösel von seinem Finger. Er sitzt noch ein bisschen an der Bar. Ein bisschen länger heute oder kürzer oder gleich lang wie immer. Durch das gelb-braune Milchglas sieht es so aus, als wäre bei Susa immer Licht, die ganze Nacht.
***
Später, Tage später, als man weiß, dass Martin aus der fünfundzwanzigsten Serpentine geflogen sein und das Auto sich mehrfach überschlagen haben muss, dass er an gleich mehreren seiner Verletzungen hätte sterben können, der Milzriss, die durchtrennte Halswirbelsäule, und wahrscheinlich gleich tot war, redet kaum wer darüber, was genau passiert ist. Von Hubertus hat es ihn aus der Kurve geworfen, auf Thekla ist das Auto auf dem Dach liegen geblieben.
Das macht keinen Sinn, sagt der Vater.
Wenn man vor die Tür tritt und der erste Blick auf den Berg fällt, dann bleibt man jetzt kurz stehen. Man redet davon, wann man Martin zuletzt gesehen hat. Der Bürgermeister hat ihn letzte Woche gesehen, als er den Router im Gemeindeamt repariert hat. Der Polizist hat gesehen, wie er und Esther am Wochenende im Auto an ihm vorbeigefahren sind. Wenisch muss daran denken, dass er noch letzte Woche mit Martin über Mitzi geredet hat, seine Mitzi, hier an der Bar im ESPRESSO, und Susa sagt, das Letzte, was ich ihm gesagt habe, ist, dass ich ihn nicht mehr anschreiben lasse, wenn er nicht am Monatsende pünktlich zahlt.
Wenisch sagt: Der Blintelmann hab ihn selig.
Teresa hat ihn das letzte Mal am Sonntag gesehen. Martin ist zum Essen zu ihnen nach Hause gekommen, und danach sind Esther und er in ihr Zimmer gegangen, und Teresa hat währenddessen im Fernsehen gesehen, dass es eineiige Zwillinge geben soll, die gleichzeitig sterben. Die auch zur gleichen Zeit Kinder bekommen und große Entscheidungen treffen, obwohl sie auf unterschiedlichen Kontinenten leben. Es soll eineiige Zwillinge geben, denen es gleichzeitig gut oder schlecht geht, obwohl sie nicht wissen, was der andere macht oder wo er lebt, das hat Teresa gesehen, als sie Martin zum letzten Mal gesehen hat, und das erzählt sie Esther durch die Tür, und wie ist das in der Liebe, hast du was gespürt?
Diesen Sommer wird es keine Kirschen geben. Martins Mutter hat alle Blüten vom Baum geschüttelt, und Martin sitzt nicht in der Baumkrone, aber Esther liegt noch immer im Bett und starrt die Decke an. Wer durch den Ort geht, der weiß: Hier ist was passiert. Noch immer kommt jeden Morgen der Schulbus, bleibt stehen, fährt weiter. Das Licht im Kiosk geht an, und die Glocke im Schichtturm schlägt.
Aber jetzt schläft alles. Alles ist dunkel. Nur bei Susas orangefarbenen Milchfenstern weiß man nie, ob drinnen Licht ist oder nicht. Irgendwo surren Insekten, jetzt schon wie im Sommer. Die Katzen schlecken ihre Jungen so fest, als wollten sie ihnen das Fell abziehen. Dann kotzen sie Haare aus. Am Ortseingang fehlt das Ortsschild. In wenigen Stunden wird Teresas Mutter den Laden aufmachen, wird den Ständer mit den Angeboten hinausstellen.
Merih hat noch nicht ausgepackt. Er stellt seinen Laptop auf den Schreibtisch, mit Blick auf die Dächer, die Berge, den Berg, und schreibt:
martin ist weg
Alles schläft, fast alles.
Fressen und gefressen werden, das war hier schon immer so. Am Anfang war ein Meer. Flechten und Algen bewuchsen die Steine. Schwämme und Würmer besiedelten das Wasser, später auch Seeigel, Seesterne und Armfüßer. Kellerasseln und schneckenähnliche Tiere grasten den Meeresboden nach Bakterien ab. Ein Hai mit stacheligem Kopf erbeutete Kleinfische. Als die Erde abkühlte, starben die Meere aus. Es bildeten sich Berge, und die Platten begannen zu schwingen, dann brachen die Vulkane aus. Ein saurer Regen kam über das Land, vom Himmel fielen Steine. Es gab keine Oberflächen mehr, nur eine sich selbst ausspeiende Lavaschicht, die sich lange nicht beruhigte. Als die Erde abkühlte, blieben aus den Meeresüberresten große Kalkhaufen zurück, sie reagierten mit Wasser zu Eisenkarbonat. 400 Millionen Jahre später kollidierten die Platten, und der Berg faltete sich zum zweiten Mal auf.
Am Anfang war ein Meer.
(700,0) MERIH
Wenn er zumindest ein Hobby hätte, hat sie am Abend zu ihm gesagt, oder eigene Freunde. Lara aschte ins Spülbecken in der Küche, während Merih am Fenster lehnte und mit den Fingern gegen seine geschlossenen Augen drückte. Sie finde es befremdlich und in dieser Befremdlichkeit auch wieder interessant, dass er einfach gar kein Profil habe.
»Du bist wohl ein uninteressierter und deshalb, das ist die Frage, wahrscheinlich auch ein uninteressanter Mensch«, sagte Lara.
Merihs Augen brannten, als er sie öffnete. Er wollte die ganze Nacht packen, aber dann war er nach einer Stunde fertig und konnte nicht einschlafen.
Als Merih heute Morgen die Wohnung verließ, saß Lara wieder in der Küche und kratzte und zupfte an den Rändern ihres Nagellacks, ließ ihn auf den Tisch bröseln. Von manchen Fingern zog sie ihn in einem Stück ab. Er blieb in der Tür stehen, sagte, er gehe jetzt, blieb dann noch weiter stehen, sah sie an, sie sah ihn nicht an, dann ging er.
Merih ist mit der Regionalbahn aus der Stadt bis zur Endhaltestelle gefahren. Dort hat er ein Taxi genommen und sieht seitdem durch das heruntergekurbelte Fenster nach draußen. Draußen: zur einen Seite grobmaschige Netze, die über die Felsen am Straßenrand gespannt sind, ein Schild ACHTUNGSTEINFALL. Zur anderen Seite grüne Hügel, wie von einem Eisportionierer in gleich große Halbkugeln geformt. Ein Plakat, das 100 EXOTISCHEGIRLSverspricht, ein Haus mit einer rot blinkenden Reklameschrift, OPEN open OPEN. Geradeaus: eine Straße, die den Felsen und Hügeln nach links und rechts, oben und unten ausweicht und sich so immer weiter ins Tal schraubt.
Irgendwo hier in den Bachbetten zwischen den Hügeln müssen die Nutrias leben. Merih hat gelesen, dass es im Tal eine Nutriafarm gibt, von der in den letzten Jahren so viele Nutrias ausgebrochen sind, dass sich von selbst ein natürlicher Bestand aufgebaut hat. Was ist der Unterschied zwischen einer Nutria und einer Bisamratte?
Merih schaut auf sein Handy. Dann wieder nach draußen. Keine Nutrias am Bach, an dem die Straße entlangführt.
Auf einem Hügel drängen sich mehrere Häuser sonderlich nah zusammen, als wäre die grüne Wiese ringsum nicht betretbares, nicht bebaubares Gebiet. Merih denkt an die vielen Schlangen in seinem Zimmer, als er ein Kind war, über die er jede Nacht springen musste, um ins Bett zu kommen; das lange Wachbleiben, wenn er doch eine berührte.