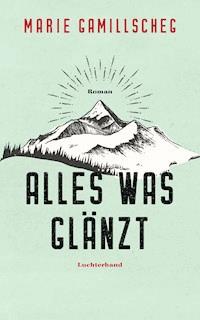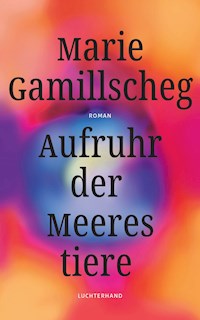
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand Literaturverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nominiert für den Deutschen Buchpreis 2022
Luise ist klug, Luise ist unabhängig, Luise ist eine Insel. Als Meeresbiologin hat Luise sich einen exzellenten Ruf erarbeitet, ihr Spezialgebiet: die Meerwalnuss, eine geisterhaft illuminierte Qualle im Dunkel der Ozeane. Als Luise für ein Projekt mit einem renommierten Tierpark nach Graz reisen soll, zögert sie nicht lang. Doch Graz, das ist auch ihre Heimatstadt, das ist die Wohnung ihres abwesenden und plötzlich erkrankten Vaters. Und das ist die Geschichte einer jahrelangen Sprachlosigkeit und Fremdheit zwischen ihnen.
Soghaft und strömend erzählt Marie Gamillscheg von der allmählichen Befreiung aus den Zwängen der eigenen Kindheit, des eigenen Körpers und aus den Gesetzen, die andere für einen gemacht haben. Es ist zugleich der Versuch, die Unmöglichkeit einer Beziehung zu erfassen: zwischen Mensch und Tier, Mann und Frau, Vater und Tochter.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 330
Veröffentlichungsjahr: 2022
Sammlungen
Ähnliche
Zum Buch
Luise ist klug, Luise ist unabhängig, Luise ist eine Insel. Als Meeresbiologin hat Luise sich einen exzellenten Ruf erarbeitet, ihr Spezialgebiet: die Meerwalnuss, eine geisterhaft illuminierte Qualle im Dunkel der Ozeane. Als Luise für ein Projekt mit einem renommierten Tierpark nach Graz reisen soll, zögert sie nicht lang. Doch Graz, das ist auch ihre Heimatstadt, das ist die Wohnung ihres abwesenden und plötzlich erkrankten Vaters. Und das ist die Geschichte einer jahrelangen Sprachlosigkeit und Fremdheit zwischen ihnen.
Soghaft und strömend erzählt Marie Gamillscheg von der allmählichen Befreiung aus den Zwängen der eigenen Kindheit, des eigenen Körpers und aus den Gesetzen, die andere für einen gemacht haben. Es ist zugleich der Versuch, die Unmöglichkeit einer Beziehung zu erfassen: zwischen Mensch und Tier, Mann und Frau, Vater und Tochter.
Zur Autorin
Marie Gamillscheg, geboren 1992 in Graz, lebt als freie Autorin in Berlin. Veröffentlichungen in zahlreichen literarischen Zeitschriften und Magazinen. Ihr Roman »Alles was glänzt« landete auf der ORF-Bestenliste, wurde für den aspekte-Literaturpreis nominiert und mit dem Österreichischen Buchpreis für das beste Debüt 2018 ausgezeichnet.
Marie Gamillscheg
Aufruhr der Meerestiere
Roman
Luchterhand
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die handelnden Figuren dieses Romans sind fiktiv. Etwaige Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind nicht beabsichtigt.
Copyright © 2022 Luchterhand Literaturverlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
Covergestaltung: buxdesign, München
unter Verwendung einer Illustration von © Ruth Botzenhardt
ISBN 978-3-641-21560-6V004
www.luchterhand-literaturverlag.de
Für A. und L.
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Danksagung
Zuerst überlegten wir, wie immer, was wir tun würden, wenn wir hier vergessen werden.
Die Bergstation war im abendlichen Nebel verschwunden, unter uns der gleiche dicke weiße Himmel wie vor uns. Der Sessellift stand still und schaukelte wild auf und ab. Ganz schwindelig wurde uns davon, aber wir sagten nichts. In unseren Fäustlingen führten die klammen Finger heimliche Tänze auf. Da war diese Geschichte von dem Kind, das den kalten Bügel abschleckte und dem die festgeklebte Zunge dann abgeschnitten werden musste. Und da war die Geschichte von Hermann Maier, der bei den Olympischen Winterspielen in Nagano 1998 drei Tage nach seinem schweren Sturz in der Abfahrt Gold im Super-G gewann. Aber lieber noch ließen wir in Gedanken erst die Ski, dann die Skischuhe fallen, knoteten unsere Anoraks und Hosen aneinander und hofften auf einen weichen Himmel.
Das Problem an Buckelpisten ist, dass man den Ski nicht unkontrolliert laufen lassen kann, wenn man nicht wahnsinnig ist. Wir verstanden nicht, warum eine Buckelpiste mehr Spaß machen sollte als ein frisch präparierter Hang, aber wir wussten, dass Buckelpisten für Hermann Maiers waren, nicht für Kinder. Oben klappte der Liftwart schon die Sitze hoch. Wir standen jetzt nebeneinander. Die Skispitzen über der Kuppe, in der Luft, die Stöcke schon im Hang. In unseren Ohren tickte die Zeituhr, wir trippelten mit den Ski auf und ab. Los. Bei jedem Schwung gingen wir in die Knie, versuchten, die Ski parallel und so nah wie nur möglich beieinanderzuhalten. Wir achteten auf den Stockeinsatz im richtigen Moment, wie wir es gelernt hatten, nicht zu früh, sodass der Ski schon drehte, aber vor allem nicht zu spät, damit der Stock nicht im letzten Buckel hängen blieb. Wir vertrauten dem Tal, dass es in diesem dicken Nebel auftauchen würde, und ließen uns von den Ski tragen, ohne die Kontrolle ganz abzugeben, doch als wir einen Buckel übersahen, hob es uns die Knie in die Brust. Jetzt übernahmen die Ski. Wir rutschten über eine Eisplatte und hielten erst wieder bei der ersten Hütte, knapp vor der Talstation. Wir schlugen mit dem Skistock in den Schnee, als hätten wir den Sieg um nur ein paar Hundertstel verpasst, aber doch verpasst. Dann schauten wir den Hang hoch, auf die vom Wind verwehten Wellen. Lange schauten wir dort hoch. Dein roter Anorak tauchte plötzlich aus dem Nebel auf. Dein Oberkörper ganz gerade ins Tal gerichtet, nur die Ski schwangen in regelmäßigen Abständen zu den Seiten, so eng, dass wir keine Lücke zwischen deinen Beinen sehen konnten. Nichts sagtest du, als du neben uns stehen bliebst. Aber als du einen Ski hochstelltest, machten wir das auch. Als du einen Ski abschnalltest und hoch in die Luft hobst, zur Siegespose, lachten wir dich aus. Wie gut du im Skiurlaub aussahst. Zehn Jahre jünger, sagten wir. Wenn wir noch länger Urlaub machen, sind wir älter als du.
Bald würden wir im Auto die schweren Skischuhe ausziehen und uns freuen, wie die Socken dampften. Wir würden uns zu Hause noch lange nicht duschen, sondern erst stundenlang in Skiunterwäsche vor dem Fernseher liegen und Vanillepudding essen. Aber lieber noch ließen wir in Gedanken erst die Ski, dann die Skischuhe vom Sessellift fallen, knoteten unsere Anoraks und Hosen aneinander und sprangen in die Wolken. Dass es in den Weihnachtsferien bald nur noch Schnee aus der Schneekanone geben würde, erklärtest du uns auf der Rückfahrt. Naturschnee hatte sechs Ecken und war deshalb sehr leicht, angenehm zu fahren, Kunstschnee war rund und kugelig und vereiste schneller. Aber am Ende, sagtest du, war ja alles nur Wasser.
1
Im Sprechen über ihre Arbeit hatte Luise sich in den letzten Jahren eine gebärmutterartige Höhle eingerichtet. Obwohl deren Inhalte, also die Ergebnisse ihrer Forschung höchst bedrohliche Zukunftsprognosen stellten, wirkten sie auf Luise beruhigend und heilsam. Auch jetzt, als sie im Hörsaal im Souterrain des Instituts vor den Studierenden auf und ab ging, halfen sie ihr zu fühlen, wo sie war, das Bewusstsein, die Schulterblätter zusammenzudrücken, vor einer Gruppe Menschen zu stehen und über ihre Untersuchungen zu referieren: Hier war sie zu Hause. Wie die meisten ihrer Kolleginnen hatte sie jegliche andere Verbindungen zu ihrem Geburtsort mit der Zeit wie ein totes Saisonfell abgestreift. Darunter eine Sprache, die sich manchmal noch ungewöhnlich lang auf den Vokalen ausruhte, aber ansonsten keinerlei Herkunft verriet. Man sprach nie über die Weihnachtsfeiertage anderswo oder über kleinstädtische Gewohnheiten und Liebeleien. Es war ein Inselleben, hier am Institut. Man sah sich keiner Stadt und keinem Landstrich verpflichtet, nur der Arbeit und dem, was man, genau in diesem Augenblick, darzustellen versuchte. Luise wollte jemand sein, an den man sich erinnerte. Luise war eine Insel. Ihre Arbeit war eine Höhle auf dieser Insel. Luise war eine Insel, eine Höhle auf der Insel auf der Welt war die Welt.
Hell und schmal klackten ihre Absätze über den glatten Hörsaalboden. Wie wenn man einer dünnen, zart gemusterten Porzellantasse den Henkel abbrach: Etwas löste sich, barst bei jedem Schritt und vergrößerte sich als Klang im Raum. Der Hörsaal abgedunkelt. Nur das Licht des Projektors. Nur das Weiß in den Augen der Erstsemester, das ihre Gesichter ausstrahlte, als würden sie von innen leuchten. Noch nichts wussten sie von den kurzfristigen Arbeitsverträgen und den äugelnden Kollegen, von den Papers, deren Veröffentlichungen sich immer weiter in die Zukunft verschoben. Sie stellten keine Nachfragen, wenn Luises Argumentation schwammig wurde, sie gingen noch von einer Wahrheit der Wissenschaft aus, die unabhängig von Geldern und Geldmenschen war. Alles, was sie wussten, war, dass Luise damals eine der Ersten gewesen ist.
Luise sah in die Gesichter. Was sie zuletzt Kluges gedacht hatten, fragte sie sich. Was sie zuvor gegessen hatten. Mit wem sie schliefen und ob sie dieses Etwas hatten, das mit der Art zu tun hatte, wie sorgfältig man seinen Schreibblock in den Rucksack räumte und ob man sich manchmal abends, nur für sich, eine Kerze anzündete. Da die Studentin, die ihre Jacke während der Vorlesung nie auszog. Letzte Woche war ihr Haar noch dunkel und lang gewesen, jetzt war es blond und rahmte kürzer und fransig ihr Gesicht. Hatte sie Kummer? Hatte jemand sie verlassen, wollte sie sich selbst verlassen, oder hatte sie im blonden Haar vielleicht wirklich etwas gefunden, das ihr mehr entsprach? Dieser Hang der Menschen zur Metamorphose, Luise verstand ihn nicht. War es nicht so schon genug Mühe, als dieselbe abends schlafen zu gehen, die morgens auch den Tag begonnen hatte?
Die Beziehung zwischen Mensch und Tier funktioniert einzig über Angst, sagte Luise.
Auch wenn Sie sich die Geschichte der Meerwalnuss anschauen, ist es zunächst einmal eine Geschichte der Angst, so wie der Mensch sie erzählt, sagte sie und klackte vor den Studierenden auf und ab, versuchte jetzt alles hinter sich zu lassen, das noch zu einem Außen gehörte, ein Wetter, ihren Vornamen, den bevorstehenden Termin mit dem Institutsleiter. Es stimmt schon, dass nicht das Artensterben, sondern jene Arten, die sich explosiv vermehren, die größte Gefahr für unsere Ozeane darstellen, sagte sie. Aber wenn wir die Ausbreitung der Meerwalnuss nur als Problem sehen, das es zu bekämpfen gilt, dann vergessen wir, dass es der Mensch selbst ist, der seit Beginn des internationalen Warenhandels die Meerwalnuss in den Ballastwassertanks seiner Schiffe in neue Gewässer bringt. Vor Ort hat die Meerwalnuss keine natürlichen Fressfeinde. Noch dazu sind die Ozeane warm, leer gefischt und sauer, sagte sie, und die Meerwalnuss kann sich ausgezeichnet ausbreiten.
Da eine Hand:
Aber warum sie nicht die Bezeichnung invasive Arten verwendete? Das verstehe er noch immer nicht ganz.
Luise blieb stehen und suchte im Dunklen den Kopf zur Hand. Er war ihr in den vorherigen Vorlesungseinheiten schon aufgefallen, hatte da ihren Vortrag fast zum Stolpern gebracht: ein Gesicht, in dem sich nichts erinnern ließ. Etwas so Farbloses und Gewöhnliches, etwas so der Norm Entsprechendes hatte sie noch nie zuvor gesehen.
Gute Frage, sagte sie. Was denken Sie denn?
Er zuckte mit den Schultern.
Man könnte sagen die Augen, dachte Luise sich. Die Augen hätten sich auf besondere Weise in ihre Höhlen zurückgezogen, oder die Symmetrie der Wangenknochen und der Augenbrauen wäre beachtlich, oder dass die Partie um sein Kinn besonders weich gelungen war, aber als sie ihn jetzt ansah, wusste sie, dass selbst diese Dinge nichts Abweichendes hatten. Sie würde ihn nach der Vorlesung hundertfach oder kein einziges Mal an sich vorübergehen sehen. Luise drehte sich um, ging zurück zum Rednerpult.
Dann denken Sie nach!
Luise legte ihre Hände auf die Plastikoberfläche neben der Computertastatur. Es war ihr sofort unangenehm. Dieses Gefühl, die Worte doch nur geliehen zu haben, als wären es gar nicht ihre, und erst in dem Moment, in dem sie sie aussprach, der Schreck, dass es doch sie war, die hier im Hörsaal stand und zu den Studierenden sprach, dass die also nicht anders konnten, als die Worte auch diesem Körper vor ihnen zuzuordnen.
Will jemand dem Kollegen helfen?
Luise stand zwischen Leinwand und Projektor, sie spürte die Farben auf ihrem Gesicht. Niemand hob die Hand oder versuchte es mit einem Wort, einem Wortanfang zumindest. Was für ein schlimmer Ort die Schule war, dachte sie sich. Es kamen wirklich die meisten mit verkümmerten Gehirnen an der Uni an.
Der Mensch greift doch vielmehr in den Lebensraum der Tiere ein und nicht umgekehrt, sagte Luise, probierte es noch einmal vorsichtig mit den geliehenen Worten: Wir wollen also Lebewesen nicht als invasiv bezeichnen, wenn sie nachweislich nicht freiwillig in neue Ökosysteme ziehen, sondern vom Menschen eingeschleppt werden. Und wissen Sie, wenn wir hinter die Angst schauen, sagte sie, wenn wir die Meerwalnuss nicht als invasiv, auch nicht als räuberisch oder kriegerisch bezeichnen, dann könnten wir von ihr lernen, wie man sich selbst den schlimmsten Lebensbedingungen anpassen, in ihnen sogar nicht nur überleben, sondern gut leben kann.
Sie klickte mit der kleinen Fernbedienung in ihrer Hand weiter. Dann drehte sie sich um, schaute mit den Studierenden auf die Leinwand hinter sich. Aus einer fernen Wirklichkeitsblase schlug ein gläserner, leuchtender Körper auf schwarzem Hintergrund durch die Mauer. Etwas in Luise wurde kühler. Da:
Eine schwebende Laterne mit weiten, zarten Flügeln.
Eine durchsichtige Plastiktüte, verloren auf See.
Eine feingliedrige Lichterkette in einer klaren Nacht, vom Wind angetippt.
Oder: ein bewegtes Röntgenbild. Eine birnenähnliche Form mit milchiger Oberfläche, darauf dünne Fadenzeichnungen. An den Außenseiten und in der Mitte dickere, rippenähnliche Linien, sie leuchteten hell. Sie pulsierten auch, sie blinkten, funkten, vermeldeten, schlugen Alarm, und in der Mitte, wo es immer heller, das Licht immer dicker wurde, dort rasten Spektralfarben wild auf und ab.
Mnemiopsis leidyi, sagte Luise. Die Meerwalnuss. Das gefährlichste Raubtier der Welt.
Eine Laterne, eine Lichterkette, ein funkender Roboter.
Am Automaten neben ihrem Büro kaufte Luise sich eine Tafel Nussschokolade und einen Schokoriegel, die Verpackungen warf sie gleich in den Mülleimer daneben, später wollte sie auf keinen Fall mehr daran erinnert werden. Die nackte Tafel Schokolade steckte sie in ihre Manteltasche, den Riegel aß sie in wenigen hastigen Bissen gleich auf dem Weg zurück in ihr Büro. Sie eilte die Treppen hoch. Vor ihrer Tür stand eine Studentin, deren Abschlussarbeit sie betreute, später, sagte Luise, keine Zeit jetzt. Während der Vorlesung war der Kirschbaum aus dem Innenhof des Instituts in ihr Büro eingezogen. Der Baumstamm lag jetzt fett und schwer auf dem Teppichboden, seine Schattenäste zitterten an den Wänden. Sie versuchte, sich noch einmal an dieses Normgesicht zu erinnern, aber schon war es weg. Wer nicht fortwährend an seiner Wirklichkeit arbeitete, verschwand sofort, sie kannte das ja von sich selbst. Luise schüttete Wasser in die kleine Plastikwanne unter ihrem Schreibtisch, gab die Salzlösung dazu, rührte mit dem Finger um, zog hastig Schuhe und Socken aus und stellte ihre Füße ins Wasser. Sie sah auf ihr Handy.
Eine SMS von Juri, zwei Stunden alt:
Magst du fenchel? Wegen heute abend
Und eine hinterher: Wie geht’s den quallen?
Sie brach sich ein Stück von der Nussschokolade ab, klickte ihre ungelesenen Mails durch, aß die ganze Tafel. Keine der Mails meinte sie als Person. Alle waren über unterschiedliche Verteiler von Unis und Zeitschriften gekommen, Ausschreibungen, Forschungsnews, neue Stellenbesetzungen. Eine Forschungsgruppe aus Kopenhagen hatte schon wieder Millionen aus einem EU-Topf für ein Projekt zur Weiterverarbeitung von Plastik in den Ozeanen bekommen, der Kollege aus Marseille hatte noch immer nicht auf ihre Anfrage nach einem Vorabblick in seine neue Studie zur Genveränderung der eingewanderten Meerwalnuss im Kaspischen Meer geantwortet. Sie nahm noch einmal ihr Handy in die Hand, schob die linke Ferse über den rechten Fußrücken.
ich esse kein wurzelgemüse
und rippenquallen nicht quallen
Im Büro des Institutsleiters waren die Jalousien halb heruntergelassen, das Licht von draußen kam in schmalen Streifen herein und malte sie dem Institutsleiter auf. Liniert saß er ihr gegenüber. Sie könne leider keine Fortschritte vermelden, sagte sie gleich. Leicht vornübergebeugt, mit auf dem Tisch gefalteten Händen, sprach Luise, sagte, sie sei mit dem Kollegen aus Frankreich in engem Kontakt, ihre eigenen Untersuchungen mit den Aalfängen seien noch nicht erfolgreich gewesen, sie sei jedoch weiter davon überzeugt, dass der Aal sich sogar hauptsächlich von der Meerwalnuss ernährte.
Ich bin mir sicher, sagte sie.
Hören Sie, sagte der Institutsleiter. Auch er lehnte sich jetzt vor, Luise wich zurück. Sie haben sich ja bereits als ausgezeichnete Wissenschaftlerin bewiesen, sagte er. Und sich ein für ihr Alter erstaunlich zielgerichtetes Forschungsprofil zugelegt, außerdem schätze er sie als eine der ehrgeizigsten und fleißigsten, ja wichtigsten Mitarbeiterinnen des Instituts. Trotzdem solle sie bitte bald, ja baldigst erste Ergebnisse vorweisen. Aber eigentlich, sagte er, wollte er noch einmal über das Projekt in Graz mit ihr sprechen, bevor sie dort hinfahre.
Luise strich sich mit der Handfläche über die Stirn, als gäbe es dort einen Schweißfilm, den sie erst jetzt bemerkte, oder als müsste sie sich kurz der physischen Existenz ihres Gesichts vergewissern.
Natürlich, sagte sie.
Sie wissen ja, Doktor Schilling und ich kennen uns schon lange, sagte der Institutsleiter, und eine so enge Kooperation zwischen einem Tierpark und einem Forschungsinstitut ist äußerst ungewöhnlich. Verstehen Sie?
Ich verstehe, sagte Luise.
Wenn sie in Graz das Institut vertrete, vertraue er ihr natürlich voll und ganz, sie sei die Expertin. Er wolle ihr nur ein paar Dinge noch mitgeben.
Sie solle bitte eine gewisse Offenheit gegenüber den Publikumsinteressen des Tierparks zeigen, auch wenn das nicht ihr Anliegen sei.
Sie solle dennoch die Anliegen des Forschungsinstituts nicht vergessen.
Sie solle den interdisziplinären Charakter des geplanten Forschungszentrums unterstreichen und fördern.
Sie solle bitte nicht zu sehr ihre eigenen Forschungsinteressen, die ja doch abseits der gängigen Meerwalnussforschung verliefen, betonen. Das könnte von der aktuellen Relevanz ablenken.
Sie solle auch nicht unbedingt erwähnen, dass es noch einige Schwierigkeiten mit der Laboraufzucht der Meerwalnuss über mehrere Generationen hinweg gab.
Und sie solle sich keine Sorgen machen, wenn ihr das Projekt zu groß würde, es sei ja erstmal nur die Vorbesprechung, und sie könne ihn bei Bedarf natürlich jederzeit anrufen.
Wir wollen unsere Frauen am Institut ja besonders fördern, sagte er.
Luise nahm sich vor, sich mit beiden Händen auf den Seitenlehnen des Bürostuhls aufzustützen, wenn sie ging, und keinen Blick zurückzuwerfen, wissend, dass er dort klein und unbewegt hinter seinem Schreibtisch saß.
Eine Insel: keinerlei Abhängigkeiten zur Küste, nur lose Blickbeziehungen zu den Stränden und zur Vegetation dahinter. Auch eine Insel: gegenüber Naturkatastrophen wie Vulkanausbrüchen oder Überschwemmungen robuster als das Festland, umso weniger bei anthropogenen Einflüssen. Jede kleinste Veränderung konnte das ganze Ökosystem kollabieren lassen.
Luise stützte sich mit beiden Händen an den Seitenlehnen ab und ging aus dem Raum. Sie sah nicht zurück.
Luise war, von einem wissenschaftlichen Standpunkt betrachtet, in eine gute Zeit hineingeboren. Als die Meerwalnuss am 17.10.2006 zum ersten Mal in der Ostsee gesichtet wurde, schrieb sie noch an ihrer Doktorarbeit. Auf einmal war das Interesse an ihren Untersuchungen groß, denn man wusste nichts über die Meerwalnuss, über Rippenquallen generell. Wie vermehrte sich die Mnemiopsis leidyi? Warum leuchtete sie? Wenn sich die Rippenquallen tatsächlich als Erste vom Stammbaum der Lebewesen abgespaltet hatten, wie entwickelten sie ihre Sinnes- und Gravitationswahrnehmung und ein eigenständiges Nervensystem? Wie sah dieses aus, das hieß: Wie könnte es anders aussehen als jenes, das wir kannten, aus dem heraus wir dachten, und ließ sich dieses aus jenem anderen heraus überhaupt denken? Stand die Meerwalnuss am Beginn der Evolution oder an deren Ende? Würde sie das Ökosystem grundlegend verändern? Wie kam sie in die Ostsee? Wie konnte sie in dem dreckigen Hafenwasser überleben? War sie tatsächlich unsterblich? Warum leuchtete sie?
Im Keller des Instituts, in den man nur über eine Seitentreppe neben dem Aufzug gelangte, saß Luise vor den Aquarien. Im Dunkeln, hinter einer schweren Tür, mit krausem Haar von der feuchten Wärme. Ein Dröhnen von den Wasseraufbereitungsanlagen, wie im Unterbauch eines Schiffs. Mit einer Pipette zog Luise das Plankton auf, spritzte es ins Wasser, legte die Pipette wieder auf das kleine Tablett auf ihrem Schoß. Sie sah dem Plankton zu, wie es im Wasser Fäden zog. Mittlerweile gelang es ihr, dass die Meerwalnuss in den Laboraquarien überlebte. Aber während sie sich im Meer bereits fortpflanzte, bevor sie überhaupt ausgewachsen war, wollte sie sich in den Aquarien einfach nicht vermehren. Luise fütterte sie, wechselte das Wasser, regulierte die Temperatur und den Salzgehalt, doch die Quallen starben und Luise sah ihnen dabei zu, oder sie kam am nächsten Tag in der Früh in den Keller und in den Aquarien war nur noch Wasser, als hätte es die Quallen darin nie gegeben. Als hätte Luise sie nie aus dem Meer gefischt, sie nie bereits auf dem Untersuchungsschiff mit Plankton gefüttert, nie in einem Eimer vom Hafen in diesen Keller getragen und vorsichtig in eines der Becken geschöpft und sie dann auch nicht wochenlang beobachtet, um zu verstehen, was sie brauchten und wenn ja wie viel davon, als hätte es auch Luise nie gegeben. Luise verschwand mit den Quallen, ohne auch nur eine Spur zu hinterlassen. Schon seit man sich darauf geeinigt hatte, dass sich die Meerwalnuss durchaus in der Nord- und Ostsee verbreiten konnte, und sich immer mehr Wissenschaftlerinnen mit ihr beschäftigten, hatte Luise nicht nur das Gefühl, dass ihr etwas weggenommen wurde und sie selbst nicht weiterkam, dass sie stehen blieb, während andere das Feld übernahmen, sondern auch, dass es dort draußen längst eine Gegenwart gab, ein Heute, auf das sich alle anderen in einem geheimen Abkommen geeinigt hatten, ein Heute, mit dem sie nichts mehr zu tun hatte.
Du bist zweiunddreißig und promoviert, hatte Simon gesagt.
Was willst du denn noch, hatte Ben gesagt.
Ich hätte gern deine feste Institutsstelle, hatte Ali gesagt.
Die Einzigen, mit denen du eine Beziehung führst, sind deine Quallen, sagte Juri.
Undankbar war sie, man hatte es ihr immer gesagt, sie hatte es nie bestritten.
Luise hob die Pipette wieder an, tröpfelte erneut Plankton ins Wasser. Sie lehnte sich zurück. Dass sie den Quallen immerhin keine Namen gäbe und sie auch noch nie süß oder schön genannt hätte wie ihre Kollegen, hatte sie Juri letztens auf seinem Balkon geantwortet. Weil dadurch eine Verschiebung der Perspektiven passiert, die gefährlich ist und die ja eigentlich schon mit der Sesshaftwerdung begonnen hat, als der Mensch nicht mehr mit der Natur, sondern von ihr lebte, hatte Juri gesagt. Ich weiß, ich weiß. Und später haben das die Philosophen festgeklopft und noch schlimmer die Christen natürlich, die den Menschen zu einem gottähnlichen Wesen erklärten, das sich die Tiere untertan machen sollte. Am Ende hat der Mensch aber nur Angst vor dem Tier und behauptet gerade deshalb, dass sein Haustier ihn verliebt anschaut, hatte Juri gesagt: Ist es nicht so? Er hatte sich über den Tisch gebeugt, ihr zu: Vor was fürchtest du dich dann, Luise? Ich will wissen, warum du noch nie bei mir übernachtet hast und warum etwas von dir immer woanders ist oder wannanders, ich weiß es nicht. Luise hatte auf die andere Straßenseite geschaut. Ein Park, Menschen in orangefarbenem Laternenlicht. Sie hatte sich gefragt, wer von ihnen nachts alleine schlafen ging und wer eine gute Zeit hatte und wer nur die Zeit der anderen wollte. Er habe den Witz an der Sache nicht verstanden, hatte sie Juri sagen wollen, nämlich dass der Mensch sich im Laufe der Zeit ganz und gar unnötig im Kreislauf der Natur gemacht hatte und dennoch glaubte, unersetzbar zu sein: Du bist ersetzbar, so wie ich ersetzbar bin, das hatte sie Juri sagen wollen, aber Juri verstand nichts vom Verschwinden.
Ein Sprudeln von der Strömungspumpe. Die Quallenpolypen waren im Wasser kaum zu erkennen. Es sah so aus, als ob es nur das Lampenlicht war, das dem Wasser Kanten schlug. Luise schaltete das Licht aus, verließ das Institut, auch draußen schon Nacht, vom Dunkel des Kellers ins Dunkel der Welt. Zu Hause richteten ihr die Geräusche der anderen Wohnungen den Schlaf ein. Die Frau mit dem Hund ein Stockwerk über ihr saugte spätnachts noch die Ecken ihres Schlafzimmers und verschob den Schrank. Jemand aus der Studenten-WG nebenan knipste sich die Nägel, der Nachbar von der anderen Seite legte sich neben sie und zog ihr die Decke weg.
Geisterhafte Formen drifteten in den schwarzen Raum. Leuchtende, milchige Wesen, so zart, kaum vom Schlaf zu unterscheiden. Sie trieben aufeinander zu. Sie trafen sich. Sie stülpten sich ineinander, übereinander, jahrtausendelang. Zu einem gigantischen Körper wuchsen sie heran. Immer dicker wurde das Licht. Immer weißer, bald blendend weiß, schmerzhaft weiß.
Es geht vorbei, hatte eine Freundin einmal zu ihr gesagt. Man kann nicht ewig von der Sehnsucht leben.
Es gab sie schon, diese Erleichterung, die ersten Hügel zu sehen. Luise hatte sie beinahe vergessen. Das letzte Mal war sie in den Süden gefahren, da war die Umgebung weiß und von dünnen grauen Linien durchschnitten. Jetzt lag ein Frühherbst darüber. Der Zug durchquerte die Talzungen, als wäre ihm die Landschaft nichts, zu den Seiten wölbte sich die Erde auf. So lange hatte Luise sich noch über das Gespräch mit dem Institutsleiter geärgert, dass ihr erst spät klar wurde, was das noch bedeutete: nach Graz zu fahren. Sie kam ja von dort. Hieß, sie war dort geboren, zur Schule gegangen, hatte die Stadt gleich danach verlassen. Als sie im Sekretariat des Instituts nach der Bezahlung der Unterkunft gefragt hatte, schwiegen die Blicke so lange, dass sie gleich sagte, sie übernachte sowieso lieber bei den Eltern, sie habe nur nachfragen wollen, damit nicht, um zu, dann ging sie schnell und sortierte zu Hause die Birnen und Äpfel in der Obstschale neu. Ihre Mutter meldete sich nicht zurück. Vielleicht war sie mit ihrem neuen Freund verreist, Luise wusste es nicht. Sie rief ihren Vater an. Sie erreichte ihn nicht. Er rief zurück, da saß sie gerade auf dem Fahrrad, sie rief zurück, er hob nicht ab. Er rief zurück. Sie hob nicht ab. Luise trank ein Glas Rotwein und aß einen halben Becher Naturjogurt, sah währenddessen auf die dunkle Straße vor ihrem Fenster. Eine stille Häuserfront. Ein Mann ging mit einer offenen Konservendose vorbei und fischte mit zwei Fingern eine Ravioli heraus. Dann schrieb sie ihrem Vater eine Mail von ihrem privaten Account, überlegte es sich anders, kopierte den Text und schickte ihn von ihrer Institutsmailadresse. Er antwortete erst am nächsten Tag. Er sei leider zu der Zeit auf einer Konferenz in Wien, sie könne aber gerne bei ihm übernachten. Er würde den Schlüssel bei der Nachbarin hinterlegen. Es sei bescheiden bei ihm, schrieb er.
Ich hoffe, das ist in Ordnung. LG
Die schnelle Landschaft vor dem Fenster ließ Luises Gedanken ganz flatterig werden. Dieses Dazwischen, wenn sie noch nicht wusste, wer sie am Zielort sein sollte, aber auch nicht mehr die war, die eben am Bahnhof noch Mäuse zwischen den Schienen gezählt hatte: Ihr fehlte das Gefälle des Hörsaals, die zuverlässigen Wände des Labors. Neben ihr saß eine Frau, die, während sie auf ihr Handy schaute, Cashewnüsse aus einem winzigen Glas mit Schraubverschluss aß, das und ihre auffallende Schönheit, diese symmetrisch zurechtgezupften und zurechtgekämmten Augenbrauen, der helle Haarflaum an den Wangen, beides erschütterte Luise. Sie sah aus dem Fenster. Stundenlang.
Sie schlief ein. Wachte in einem anderen Wetter auf. Sie war schon über die Grenze, als sie auf ihr Handy sah.
Eine SMS von Juri: Dann heute Abend?
Ihm war also nicht aufgefallen, dass sie doch längst, heute Morgen schon, die Stadt verlassen hatte. Er hatte nicht bemerkt, dass die Temperatur leicht abgesunken war und die Eiswürfel in seinem Getränk in tieferen Tonlagen klimperten als an gewöhnlichen Tagen: Nichts wusste er von ihr. Sonst hätte er auch längst verstanden, dass das Ganze ein Missverständnis war, was da zwischen ihnen passierte, so wie es ein Missverständnis war, dass Luise sich manchmal doch in gemeinsame Sätze dachte, haarscharf am Rande der Wirklichkeit. Ein Herz aus Stein hatte Luise. Wenn Juri sie liebte, was ging es sie an. Sie wollte weder die Geschichte hinter der verlorenen Wimper auf seiner Wange noch die von dieser kleinen Falte unter seinem linken Nasenflügel wissen, auch nicht, ob er in seiner Kindheit Ballspiele praktizierte. Sie hatte kein Interesse daran, ein gemeinsamer Körper zu werden, sie als Bizeps und Juri als Unterarmmuskel, der den Befehl zur Bewegung kommentarlos ausführte oder umgekehrt. Es war Arbeit genug, ihre eigenen Muskeln zu stärken und gefügig zu machen. Bahnhof nach Bahnhof sah Luise zu, wie sich Liebes- und Freundespaare voneinander verabschiedeten oder sich freudig, tonlos durch die Zugfenster, begrüßten. Sie beobachtete die Körper, die sich Bauch an Bauch dicht umarmten und Hüfte an Hüfte die Bahnsteige über die Rolltreppe abwärts verließen oder unvollständig mit der Hand zum Abschied erhoben ebendort zurückblieben und alsbald die Arme vor dem Bauch verschränkten, als gäbe es da jetzt eine offene Stelle, welcher der andere Körper mit Gewalt entrissen worden war. Mit Juri war es wie mit den anderen gewesen. Es war über sie gekommen, rauschhaft, und für den Moment einer ersten Berührung hatten sie sich auch im selben Heute gefunden, hatten gemeinsam in einen Spalt des Universums gelugt, der sich plötzlich und doch altbekannt aufgetan hatte. Dass sie sich vor ihren Gefühlen fürchtete, das wollte er von ihr hören und ihr dann mit der Zeigefingerspitze über den Ellbogen streichen. Dass sie sich also vor dem Leben fürchtete, aber auch das war nur ein Missverständnis, denn Luise hatte sich doch genau deshalb ihren Alltag in den letzten Jahren von Freundschaften und Beziehungen freigeräumt, all den lästigen Unsicherheiten, in denen sie nie besonders gut war, für ein Leben, das sie nur in den Quallen fand. Und jetzt lösen die Quallen sich auf, verstehst du, wie tragisch das ist, Juri? Wie erbärmlich auch? Schon beim ersten Biss in die Oberlippe hatte Luise gewusst, dass auch Juri niemals verlangen würde, dass sie sich für ihn von der Brücke stürzte und dass also von der Liebe nichts zu erwarten war, im Gegenteil, dass man sich in ihr nur weiter verlieren konnte. Sie traf Juri dennoch weiter. Aber sie übernachtete nie, sie lud ihn nie zu sich nach Hause ein. Sie ließ sich nicht bekochen. Sie aß auch keine Wurzeln.
In einem Provinzbahnhof stand ein Mann mit Storchenbeinen und grauen Stoppelhaaren mit einem Schild in der Hand und suchte die Zugfenster mit eiligen Augen ab. Dann drehte er sich um und lief Richtung Zugende. Luise wandte sich vom Fenster ab, sah in die andere Richtung. Da saß noch immer die schöne Frau neben ihr. Jetzt sahen sie sich beide an und Luise fragte:
Haben wir schon Verspätung?
Sie kamen ins Gespräch.
Luise erzählte von ihrem Auftrag in Graz, zwei Wochen sollte sie dort sein, das wäre sie schon sehr lange nicht mehr gewesen.
Sie klingen gar nicht danach, sagte die Frau.
Wonach?
Als ob Sie aus dem Süden kommen.
Ich bin harmoniebedürftig.
Wie?
Ich passe mich schnell an.
Die Frau erzählte ihr, dass sie gerade zu ihrer Freundin zog. Sie musste raus aus der Stadt. Ihr Vermieter hatte sich in sie verliebt und war erst wütend, dann aggressiv und schließlich krank geworden. Alt war er schon zuvor gewesen. Wenn er jetzt stirbt, sagte sie, ich weiß nicht.
Sie verrückte kurzerhand die Proportionen in ihrem Gesicht, zog die Nase hoch, die Augenbrauen zusammen: Ich weiß gar nicht, warum ich Ihnen das erzähle.
Später holte Luise ihre Unterlagen aus der Tasche und versuchte darin zu lesen. Aber das Aussehen der Sitznachbarin wurde ihr bald so zudringlich, dass sie sich in den Speisewagen verabschiedete. Sie setzte sich einige Waggons weiter wieder auf einen Fensterplatz. Sie dachte daran, was sie heute schon gegessen hatte. Ein hartgekochtes Ei, zwei Datteln noch kurz bevor sie die Wohnung verlassen hatte. Auf ihrem Handy sah sie sich ein Video an, in dem ein glatzköpfiger, muskelbepackter Mann weinte, als der Sohn seiner Freundin ihn fragte, ob er ihn adoptieren möchte. Auf einer anderen Internetseite scrollte sie durch die Fotos einer Regisseurin und eines Sängers, die bei einem Spaziergang in New York zusammen fotografiert worden waren, sie hielten sich nicht die Hände.
Noch zu Beginn ihres Doktorats, erst ein, zwei Jahre waren seit ihrem Umzug nach Kiel vergangen, war Luise zu einer Konferenz in Berlin eingeladen. Damals, also bevor die Meerwalnuss zum ersten Mal in der Ostsee gesichtet wurde, waren sich die Invasionsbiologinnen einig, dass sie sich niemals in den europäischen Gewässern verbreiten würde. Der Salzgehalt stimme nicht und die Temperaturen sänken im Winter so weit herab, dass sie unmöglich überleben könnte. Man hielt sie außerdem für eine unbedeutende ökologische Sackgasse, salzwassergefüllte Ballons ganz am unteren Ende der Nahrungskette. Luise trug eine weiße Bluse mit Stehkragen, wie ihre Doktormutter. Nicht zu feminin, trotzdem schick. Die Bluse machte Geräusche, wenn sie die Hände hob. Vor dem Vortrag über ihre Doktorarbeit im Rahmen der Reihe Impulse hatte sie im Hotelzimmer versucht, ihre Neurodermitisnarben an den Wangen und Händen mit Schminke zu übermalen, Schicht um Schicht. Impulse hieß: In einem kleinen Seminarraum durften Doktoranden aller Länder sprechen, sie trugen noch keine Titel, dafür Vornamen und meist einfarbige T-Shirts, keine Blusen, wie Luise später bemerkte. Weil Luise sich dringend an die Zeitangabe halten wollte (sie wollte professionell sein), ging sie über alle Regeln des akademischen Vortrags hinweg und verzichtete darauf, ihre genaue Methodik und Arbeitsweise vorzustellen. Gleich zu Beginn erklärte sie, dass die Bedingungen für eine massive Verbreitung der Meerwalnuss in der Nord- und Ostsee längst gegeben seien. Das Wasser sei warm und sauer genug, außerdem habe die Mnemiopsis hier keine Fressfeinde. Luise ging davon aus, dass alles, was sie sagte, so dringlich war, dass die unkonventionelle Herangehensweise ihr nachgesehen wurde, sogar erwünscht war. Außerdem glaubte sie damals noch, dass es an der Zeit war, den akademischen Betrieb ein wenig aufzurütteln, und dass es ihre Zeit war, sowieso. Sie sprach also von der Globalisierung der Märkte und vom internationalen Warenhandel, von den Containerschiffen und ihren Ballastwassertanks, in die der Mensch mit dem Wasser auch Kleintiere und Larven schöpfte und so über die Weltmeere schiffte, und weil sich in den Gesichtern der Menschen weiter nichts regte, nannte sie die Ozeane gleich eine Todeszone, die Meerwalnuss ihren großen Profiteur, sie sprach von einem Kollaps des Ökosystems der Meere, des Ökosystems generell. Am Ende prognostizierte Luise eine baldige Rückkehr ins Kambrium, in dessen warmen und nährstoffreichen Meeren die Zvanobakterien und Schwämme dominierten und die Quallen die größten Raubtiere waren. Nach ihrem Vortrag, im Foyer, kam ein Professor (einer von jenen, die selbst in hitzigen Kongressräumen einen leichten, schlammfarbenen Mantel über dem Anzug trugen) zu ihr. Was er genau sagte, erinnerte sie sich später nicht mehr, nur noch, dass er sie Mädchen nannte und an der Schulter tätschelte. Sie rannte zurück ins Hotel. Dort im Badezimmer traf sie ihr Spiegelbild, unvorbereitet. Etwas in ihrem Gesicht hatte sich verschoben. Die Augen auf unterschiedlicher Höhe, die Nase zur Seite gerückt, die Haut rot und aufgequollen. Luise konnte aus den Augenwinkeln auf ihre Wangen sehen. Ein Kind stand da im Spiegel, ein Kind, das die Mutter zur Firmung in ein neues Oberteil gesteckt hatte. Merkwürdig »angezogen« sah sie aus. Die Bluse wölbte sich ungeschickt über ihrem Busen. Dass ihre Doktormutter von Geburt an bevorzugt worden war, dachte Luise sich, die Kurve von der Taille bis zur Hüfte bei ihr ein wenig eleganter, die Symmetrie der Augenbrauen und die Stirnhöhe gelungener, das Gold in ihren Ohren wegen eines Muttermals am rechten Wangenknochen immer der Hinweis auf ein Weiter, in dem all diese Dinge keine Rolle spielten, ein Weiter, zu dem Luise nie hingelangen würde. Ihr Vater hatte recht gehabt. Sie hätte einfach Lehrerin werden sollen, wie er. Sie wäre Lehrerin geworden, wenn er nicht schon einer gewesen wäre, wenn nicht alles, was sie nicht sein wollte, Lehrerin gewesen wäre. Mit Zeigefinger und Daumen drückte sie ihre Augen in den Kopf hinein, bis sie platzten. Erst als sie sich so fest in den Unterarm biss, dass ihr schwindelig wurde, konnte sie wieder sehen. Sie reiste so schnell wie möglich ab. Danach verbrachte sie einen Sommer auf einer Alm. Als wäre ihr Hirn ein Stück weit abgestorben, brach jede Information ungefiltert über sie herein: Wenn sie Blut sah, dann weinte sie. Stand sie mit bloßen Füßen im Gras, war sie glücklich. Sie stand jeden Tag um fünf Uhr morgens auf und zählte 212 Kühe. Einmal ging sie den ganzen Berg auf und ab, weil sie eine nicht fand. Als sie die Kuh am nächsten Tag abseits ihrer Herde mit einem verletzten Knöchel entdeckte, holte der Bauer sie ab. Sie sah sie nie wieder.
Vor dem Fenster, zu beiden Seiten, stiegen nun wechselnd Felsen und Wälder steil an. Der Zug fuhr langsam, in langen Kurven den Berg hoch, querte auf einer schmalen Brücke ein Tal, da ging es hinein in eine Welt, in der es nur noch Berge gab. Eine Schneezunge, die schon bis zu den Häusern reichte. Karge Kalkberge, die sich klar an eine Rangordnung hielten, die einen türmten sich hinter den anderen, die eine Spitze ließ in der Senke Platz für den dahinter liegenden Gipfel. In die braunen Wiesen drückten sich Seilbahnstützen, an manchen hingen Sessellifte, vielleicht schaukelten sie ein wenig im Wind, aber das sah Luise im Vorüberfahren nicht. An einem Gipfel war die Bergstation in den Fels geschlagen, ein fensterloser Flachbau in der Schwebe, durch zwei in den Stein gehauene Stahlsäulen vor dem Fall geschützt. Weiter unten im Tal, im späten Nachmittagslicht, waren die Wiesen hellorange, die Seen dunkle Laken. Jetzt war es nicht mehr weit. Luise dachte an die Hochwasserkatastrophe vor zwanzig Jahren, als auch hier das Wasser über die Ufer getreten war. Damals hatte sie sich vorgestellt, wie das Wasser noch weiter die Berge hochkroch, wie nur die Gipfel als kleine, spitze Inseln zurückblieben, die letzten Rückzugsorte. Wie enttäuscht sie gewesen war, als all das nicht geschah. Die Berge blieben Berge, die Menschen wohnten in Häusern, gingen bald wieder zur Arbeit, heirateten, um sich dann zu betrügen. Von einer Katastrophe hatte Luise sich mehr versprochen.
Als der Zug in den letzten Bahnhof vor Graz einfuhr, öffnete sich der Blick auf eine Ebene, die Hügel wurden grün und weich. Entlang der Zugstrecke jetzt Einfamilienhäuser mit ausladenden Balkonen, ein Steinbruch, langgestreckte Fabrikhallen. Sie dachte an die Skiurlaube als Kind. Lange hatte sie nicht mehr daran gedacht. In der hohen Ankunftshalle des Hauptbahnhofs in Graz roch es nach vergorener Milch.
Sie kannte das Viertel hier draußen, in dem es gar nicht mehr nach Stadt aussah. Bevor die Eltern sich trennten, hatten sie als Familie in der Nähe gewohnt. Dicke Thujenhecken, Carports mit Wellblechdächern, Rutschen aus buntem Plastik neben knöchernen Obstbäumen. Ein Kind auf dem Radweg, das zu seinem Tretroller sprach. Als Luise näher kam, sah es auf und fuhr eilig weiter. Die Wohnung ihres Vaters war in einem weißen Mehrparteienhaus, dem auf Erdgeschosshöhe zwei grüne Querbalken aufgemalt waren. Luise läutete bei der Nachbarin, deren Name ihr Vater ihr geschrieben hatte. Sie öffnete sofort und stand schon in der Tür, als Luise die Treppe hochkam. Hinter ihr eine Wand voll mit Fotos in bunten Holzbilderrahmen, eine Großfamilie sah Luise von dort entgegen, ein strenger Geruch von Gewürzen. Das ist also die Tochter, sagte die Nachbarin. Sie betrachtete Luise von oben bis unten, lächelte an, was sie sah, dann gab sie Luise den Schlüssel. Das wird Ihren Vater aber freuen, dass Sie mal länger da sind. Gerade jetzt.
Die Wohnungstür ihres Vaters hatte etwas Neumodisches. Sie war dick und in einem matten Weißgrau, außerdem hatte sie eine behäbige Kunststoffklinke, die lautlos und langsam in die Ausgangsposition zurückglitt, selbst wenn man sie plötzlich losließ. Ein Piepsen. Licht an: ein langer, schmaler Flur, die Türen zu den Seiten geschlossen. Auch hier mattgraue Klinken. An der Decke eine Leiste mit kleinen Lichtern, die in verschiedenen Höhen die nackten Wände wie Kunstwerke anstrahlten. Ein goldenes Kreuz über dem Schuhschrank. Es musste Jahre her sein, dass Luise zum letzten Mal hier gewesen war. Jemand hatte aufgeräumt, aber nicht geputzt; um die Schüssel auf der Kommode ein schmaler Staubkreis, darin Kaugummi, Schlüssel, eine einzelne Zigarette, der Boden glänzte speckig. Links von der Tür einige Paare Schnürschuhe auf einer braunen Matte, schwarz und blau, glänzend bis matt, auch graue Laufschuhe, Pantoffel. Ein Piepsen über allem, ein fiepsender Ton, der immer lauter wurde. Zu beiden Seiten des Gangs standen Pflanzen in weißen und tonfarbenen Töpfen Spalier, auf einem Schemel oder direkt auf dem Boden, alle Größen bis hüfthoch, doch keine verneigte sich, als Luise ihren Rollkoffer abstellte, auch nicht, als sie die Tür hinter sich zufallen ließ und den Fliesenboden auf leichten Füßen betrat, als würde er glühen, oder als sie auf dem kleinen Nummernfeld neben dem Eingang den Zahlencode eingab und den Stern drückte. Das Piepsen hörte auf. Spots, dachte Luise sich, diese Lichter heißen Spots.