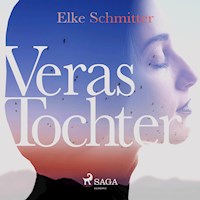19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sie treffen sich und stürzen ineinander: Helena und Levin, die beide ein erstes Leben hinter sich haben; fast erwachsene Kinder, Karrieren, die sie erfüllen. Es wird eine Episode, die Helena nicht vergessen kann. Was bedeutet es, dieses Gefühl, und wie kommt es, dass wir sogar wider Willen begehren? Dieser Roman ist eine Zumutung – wie die Liebe selbst. Nach Sigmund Freud, Simone de Beauvoir und Eva Illouz ist die romantische Passion durchschaut als Wahn und Skript. Und doch hört sie nicht auf, für Unruhe, Glück und Qual zu sorgen. Dieses Buch erzählt in einzigartiger Weise – mitreißend, reflektiert, abgründig und amüsant – von Sehnsucht und Kontrollverlust in Zeiten der Emanzipation. "Wir berühren einander gerade genug, um zu spüren: Hier erwartet uns was. Hier gibt es unter der Vertrautheit, die zutiefst beruhigend wirkt, unter den sanften Wellen, die da hin und her wogen und uns ein wenig enger liegen und dann wieder Abstand nehmen lassen: das Ozeanische, das über Jahre still war. Schlummernd, ohne Beachtung. Was in den letzten Tagen geschah, fühlt sich so sachte wie gewaltig an, und da es Januar ist: Noch kann man gehen, über den See, doch ist es zu hören, wie das reinweiße Eis, von einer Schicht aus knirschendem Reif bedeckt, die ersten Risse bekommt." Alles, was ich über Liebe weiß, steht in diesem Buch ist eine Geschichte über das Glück und die Qualen der Liebe, über die Sehnsucht, die Nähe und das Nichtweiterwissen. Ein Einbildungsroman. Zugleich ist es ein Bildungsroman - eine Erfahrung, mit Fußnoten bedacht. Was wissen wir inzwischen über die innere Chemiefabrik, über Narzissmus, Ghosting und das Rätsel der spontanen Anziehung? Und sind Liebende aus früheren Jahrhunderten uns darin nah? Ein vielstimmiges Buch über das emotionalste Thema, das es gibt - für alle, die diesen Zustand erlebt haben oder gerade erleben, aber auch für die, denen er fremd ist oder die ihn vergessen haben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Elke Schmitter
ALLES, WAS ICH ÜBER LIEBE WEISS, STEHT IN DIESEM BUCH
EINBILDUNGSROMAN
C.H.Beck
Übersicht
Cover
Inhalt
Textbeginn
Inhalt
Titel
Inhalt
Motto
EIN BILDUNGSROMAN
(GESCHICHTE DER M.)
(GESCHICHTE DER S.)
(GESCHICHTE DER H.)
EINBILDUNGSROMAN
Literatur
Zum Buch
Vita
Impressum
Wenn man lieben könnte, was man wollte, so könnte man sich ja immer glüklich machen!
Rahel Levin Varnhagen, Tagebücher, 4. April 1824
EIN BILDUNGSROMAN
Also, der Anfang. Den werde ich erzählen, und natürlich wird er anders sein als jeder andere, als deiner oder auch deiner. Jeder Anfang ist anders, das ist ja der Zauber, dass er jedes Mal anders ist. Und sich erzählen lässt. Mit allen Details. Mit dieser sagenhaften Begeisterung, die einen neidisch machen kann, an die man sich erinnert oder nach der man sich sehnt, und bei der man, je nach Seelenlage und Großzügigkeit, ganz stumm wird oder traurig oder von Herzen alles Gute wünscht. (Oder auch wach wird. Und alarmiert. Doch dazu später.) Bei der man Bedenklichkeiten empfindet oder auch leises Bangen (um die Glückliche), oder bei der man gleich anknüpfen und selbst weitererzählen könnte. Weil man schon weiß, wie es weitergeht, wie es hoffentlich oder hoffentlich nicht weitergeht. Aber habt ihr euch je gefragt, warum man das so gut erzählen kann, obwohl die Details so verschieden sind, und obwohl die Glückliche, die erzählt, einfach kein Detail auslassen kann; alles muss erzählt werden, ganz genau; und dann sagte er, und dann sagte ich, und dann er, und dann ich, wie auf einer Wippe, oder vielleicht, in der Wirkung, eher wie auf so einem Ding, wie sie auf manchen Kinderspielplätzen stehen, diese kreisrunden Bänke auf einem Podest, auf denen man sich drehen kann, so dass, nicht so brutal wie auf einem Rummelplatz, sondern sanfter, alles drum herum ein bisschen verschwimmt. Man dreht sich, gemeinsam, und die Konturen werden unscharf und machen ein Bild, das verwischt, aber sich unaufhörlich bewegt. So kann man sich fühlen, wenn einem so etwas erzählt wird; dass man die Konturen nicht mehr so genau sieht, oder dass man die Details, kaum sind sie erzählt, schon wieder vergisst. Denn ziemlich oft sind sie ziemlich banal; es ist ja auch nicht so wichtig, ob es dieser Park war oder ein anderer, ob früher Nachmittag oder schon später und ob dieser erste Kuss auf einer Bank oder unter einer Buche –.
Also, diese wahnsinnig vielen Details. Die ganz genau erzählt werden müssen. Die man eigentlich gar nicht sortieren kann, auch gar nicht sortieren wollte, wenn es um etwas anderes ginge. Wenn die Freundin, zum Beispiel, davon erzählte, wie sie ihre Mutter im Altenheim besucht. Und dann ging ich die Straße lang, auf dem Bürgersteig, weißt du, da, wo dieser Ginster wächst, der eigentlich ein bisschen komisch riecht, so als hätte ein Hund dahin gepisst, aber an diesem Tag war das ein ganz anderer Duft, das habe ich nie so wahrgenommen bisher, das war so ein … Und da wäre man schon ausgestiegen und hätte vielleicht gesagt: Ja, und wie war es dann bei deiner Mutter?
Aber so ist das hier eben nicht. Da will man jedes Detail, da fragt man vielleicht sogar nach. Weil man aus Erfahrung weiß: Alles, was jetzt gesagt wird, hat eine Bedeutung. Und alles, was jetzt nicht gesagt wird, das wird später gesagt, hervorgekramt, ins Licht gehalten: Ah, das hatte ich vergessen, es war ja gar nicht am Nachmittag, es war schon am frühen Abend … usw.
Und wenn ihr euch fragt, warum das so ist, nicht beim ersten Zuhören vielleicht, sondern später, wenn ihr wieder nach Hause geht oder das Telefon zur Seite gelegt habt, dann sage ich jetzt: Das ist der Trick. Diese Details sind wichtig, und sie sind es natürlich nicht. Sie sind das Futter, das wir brauchen, für unsere kleinen Wunschmaschinen, für unsere inneren Honigpumpen, die werden damit gefüttert, dann fangen sie an zu laufen, ganz von selbst. Sie brauchen die Details, das ist Material, und was daraus entsteht, das ist ganz unabhängig davon. Eigentlich müssten sie verwirren, diese Geschichten, zu viel, lauter Kleinigkeiten, die nicht relevant sind und die man, in jedem anderen Fall, wegräumen würde, im Kopf, oder bei deren endloser Erzählung man mit leiser Ungeduld, beginnendem Gelangweiltsein, fragen würde: Und dann?
Aber das fragt man eben nicht. Aus Respekt vor der Freundin, die sie erzählt, die sie so erzählen muss. Das wäre ein schöner Grund: Man ist höflich, man ist verbunden, man will eine gute Zuhörerin sein.
Aber darum geht es nicht.
Man hört auf diese Weise zu und man kann auf diese Weise sortieren, weil man das große Skript ja kennt. Weil man genau weiß, worum es geht. Weil man, während man zuhört, bereits die eigene Geschichte schreibt, neu schreibt, weil man sich erinnert oder etwas erhofft, weil man dabei ist, mittendrin, auch wenn man nur zuhört. Deshalb kriegt man das alles sofort klar.[1]
Ihr merkt natürlich, während ich spreche, dass ich in einem manischen Zustand bin. Ich bemerke das auch. Ein manischer Zustand, den man auf keinen Fall verlieren möchte. In dem die ganze Welt, mit all ihren Details, eine ungeheure Bedeutung hat. Manche werden witziger in diesem Zustand, sprühender, eine besonders heitere Gesellschaft; sie mögen sogar zugewandt sein. In einer unwahrscheinlichen Großmut können sie die Scheinwerfer auch zurück auf dich richten und fragen: Wie geht es eigentlich bei dir (mit x, mit y)? Und du wirst beschienen von dieser freundlichen Intensität und fühlst dich wie eine Celebrity; beschenkt und so aufmerksam betrachtet, wie es lange nicht mehr vorkam. Da ist etwas zu dir herübergeschwenkt, eine riesige Lampe, in deren Lichtkegel du stehst und sagen kannst, was du willst; alles ist interessant in dieser Aufmerksamkeit, sogar das, was bisher, bis eben, grau und belanglos war.
Andere sind auf eigentümliche Weise still. Sie simmern so vor sich hin, ein kleiner, brodelnder Topf voller Glück, aus dem winzige, manchmal auch kinderfaustgroße Blasen steigen, in unaufhörlicher Produktion. Die sich in der Luft verlieren wie Seifenblasen, die entstehen, indem die Seifenwassertropfen von diesem dünnen, daumengroßen Plastikring gepustet werden, oder eher geblasen, fast gehaucht, ganz vorsichtig, und dann steigen sie auf, sprudelnd, lautlos, zart, und man sieht die Blasen glänzen in der Luft, bis sie platzen ohne das leiseste Geräusch, aber da kommen die nächsten Blasen schon nach; so ein ganzes Röhrchen Seifenblasenlauge, das gibt eine Menge her. So sitzen sie da, die Manischen dieser Sorte, die frisch Verliebten, und ohne, dass sie es wissen, sieht man die schimmernden, bunten Blasen (Farben wie auf dem Rummelplatz, Hellblau und Violett, Rosa und ein helles, synthetisches Grün), die steigen wie Gedankenblasen in einem Comic. Manche reden in einem fort nur von sich selbst, aber man spürt, dass es eine notwendige Egozentrik ist und man verzeiht; es hat nichts mit dem Charakter dieser Person zu tun, sie ist warmherzig und interessiert und gar nicht so selbstbezogen, aber jetzt, gerade jetzt, geht es nicht anders. Und es ist ja auch, siehe oben, wahnsinnig interessant.
Mir fällt keine weitere Sorte ein. Es gibt, glaube ich, nur diese drei Varianten: die Scheinwerfer, die brodelnden kleinen Töpfe, die unentwegt Redenden. Bis auf eine seltene vierte Sorte. Eine Freundin erzählte gestern davon, dass sie zu dieser Rarität gehört, von der ich bisher nichts wusste. Sie sagte, dass sie eigentlich nicht weiß, wovon bei der ganzen Sache die Rede ist. Dass sie das alles nicht kennt, die stille Raserei, das sanfte Reißen, unaufhörlich, das manische Gefühl von Lebendigkeit, in dem die Welt aussieht wie frisch gewaschen und jeder Briefträger und jeder Trottel, der mit seinem zu dicken Wagen einzuparken versucht und dir die Straße versperrt, unbedingt angelächelt werden muss. Und in dem, was sonst das Gemüt verdüstert und das Leben schwer und trübe oder verzweifelt macht, auf einmal weit weggerückt ist; ein fernes, staubiges Herzogtum. Die Steuererklärung, die bösen Nachrichten über den Klimawandel, die Obdachlose gleich um die Ecke, die man sich immer noch nicht anzusprechen traut, obwohl sie so etwas wie eine Nachbarin geworden ist. Der Krieg. Denn irgendwo ist ja immer Krieg, und es sterben Väter, Mütter, Großväter und lassen traumatisierte Kinder zurück. Mit solchen Kinderaugen sind die vielen Briefsendungen bestückt, ja, regelrecht bestückt, die in der Vorweihnachtszeit im Kasten liegen, weil man weiß, dass sie alles durchdringen, bei den allermeisten Menschen. Aber die Verliebten, die können da eine Ausnahme sein.
Sie weiß also nicht, wovon die Rede ist. Ich schaue auch keine Liebesfilme, sagte sie, und ich lese keine Liebesromane; ich komme mir da vor wie eine Ethnologin, aber ohne jedes Interesse an diesem fremden Volk. Ich habe das nie erlebt.
Mich hat das überrascht. Es war, glaube ich, der erste Mensch dieser Spezies in meinem Leben, aber wer weiß, wahrscheinlich gibt es etliche davon, sie sagen es nur nicht laut und ungefragt, weil sie den Eindruck haben, dass ihnen etwas fehlt, so etwas wie ein Organ, mit dem die allermeisten Menschen leben und von dem sie sich leben lassen, hin und wieder jedenfalls, mit der allergrößten Bereitwilligkeit. Weil es das Skript ja gibt. Weil man sich damit auskennt, von Kindheit an, weil man, wenn man es zum ersten Mal erlebt, schon vorbereitet ist.
Als sie dieses Geständnis machte – denn für sie war es so etwas wie ein Geständnis, das eines Makels, eines unsichtbaren Defekts, mit dem sie sich bisher durchgeschmuggelt hat und von dem sie nie spricht, um nicht sonderlich zu erscheinen –, hätte mich das natürlich interessieren müssen.
Meine Freundin F., der unbekannte Mensch! Doch eigentlich will man sich damit nicht aufhalten, wenn man in diesem Zustand ist. Es ist, wie man so sagt, zu wenig Spiegelung da. Man kann auf den Paketboten oder die Frau im Gemüseladen, je nach erotischer Orientierung, alles Mögliche projizieren, aber bei einer Person, die sagt, dass sie dieses Gefühl nicht kennt: Da geht einfach nichts, in diesem Moment. Das kann man nur zur Kenntnis nehmen und sich ein bisschen wundern; das gibt es eben, sagt man sich, so wie es Albinos gibt.
Und ich weiß nicht, ob es die reine Höflichkeit war, dass sie mich nach diesem Zustand fragte. Bestimmte Antennen, nehme ich an, sind in meiner Verfassung außer Funktion; es ist gut möglich, dass sie es gar nicht wissen wollte, jedenfalls nicht so genau, aber möglicherweise mit einem Seufzen dachte, da müssen wir jetzt durch, es wird ja nicht ewig dauern. (Was natürlich nicht stimmt; es dauert ewig für die Angehörigen dieser ganz ahnungslosen Spezies.)
Es ist, natürlich, bei jedem anders, sagte ich, in den Details. Und es ist auch jedes Mal anders für einen selbst. So oft kommt das nicht vor, vielleicht zwei, drei Mal in einem Leben, oder auch vier, fünf Mal, wenn man ein Hefeherz hat, das schnell und ohne Zögern aufgeht, sich ganz bereitwillig im Volumen verdreifacht. Aber viel öfter sicher nicht, oder dann vielleicht eher in einer leichteren Variante.
Bei mir, sagte ich, ist es so: Ich liege vor allem rum. Wie ein kleiner Wal, der gestrandet ist, aber gerade noch genügend Luft hat, um nicht in Panik zu geraten. Nicht einmal in Sorge. Der sich schwer anfühlt, einerseits, und andererseits ganz leicht.
Wer nicht in diesem Zustand ist, das war mir schon klar, als ich es sagte, kann das natürlich nicht verstehen, erst recht, wenn man sich an nichts dergleichen erinnern kann. Aber es gehört eben dazu, dieses Detail. Manche Menschen sind auch so, wenn sie gar nicht verliebt sind, sie müssen alles nacheinander erzählen, sie dürfen nichts auslassen, sonst kommen sie durcheinander; in Konferenzen erlebt man das, wenn eine Kollegin aus dem Finanzbereich einen Überblick geben soll, oder wenn jemand ein Projekt erläutert, an dem er lange gearbeitet hat, aber so eine bin ich nicht.
Ich spüre auch, wie das Blut in mir kreist, sagte ich. Nicht im pathologischen Sinne, ich habe nicht das Gefühl, irgendwie krank zu sein. Es ist eher so, als wäre das innere Labor, das gerade auf Hochtouren läuft, direkt ans Bewusstsein geschaltet. Alles pulst, alles fließt und rauscht und simmert so vor sich hin, in unaufhörlicher Bewegung und zugleich selbstgenügsam, nicht im Geringsten bedrohlich; ein stilles, unhörbares Spektakel kurz unter dem Siedepunkt. Eine permanente Aufregung, die in Wellen kommt und geht, aber da reden wir nur von der Oberfläche, wie bei jedem tiefen Gewässer; die Wellen, das ist eine Beschäftigung, ein Rhythmus, doch das Darunter ist immer da, die seelische Tiefsee, die man im ganzen Körper spürt; ein Körper, der auf einmal Leib geworden ist. Und wieder Körper wird, sobald man eine Phantasie entwickelt, wie es weitergeht. Sich mit den Augen des anderen sieht, zu sehen glaubt. Was natürlich nicht stimmt. Man sieht sich mit dem eigenen mehr oder weniger fiesen Blick. Man kann ja nicht wissen, was der andere sieht; es ist das eigene Auge, das auf die Beine schaut oder die Brüste oder den Bauch und sich fragt, ob sie schön genug sind für alles, was kommen soll.
Also, ich liege vor allem so da. Bin froh, wenn niemand etwas von mir will. Bin vollkommen ausgefüllt damit, das alles wahrzunehmen und zu sein. Verliebt zu sein, manisch zu sein, ganz still zu sein. Dieses Sieden, Kreisen, Simmern zu spüren, das in meinen Konturen vor sich geht und das unbegreiflicherweise niemand außer mir bemerkt. Was mir die Möglichkeit gibt, unauffällig durch den Tag zu gehen, soweit es sein muss. Kaffee zu kochen, ein Dokument zu öffnen, ein Telefongespräch zu führen. Nichts Anspruchsvolles geht. Der Teil des Gehirns, den man zum Funktionieren delegieren kann, ist klein. Und nicht besonders smart. Wie ein automatischer Staubsauger, der seine Runden dreht und vor die Wand tuckert und stur und immer wieder vor derselben Wand zum Stehen kommt, bis er umgesetzt wird. Dann geht es weiter, so lange, wie eben Strom da ist. Und dieser Strom, das ist der gute Wille.
Den man braucht und den man hat. Der alles am Laufen hält, was unbedingt sein muss. Auch wenn es egal geworden ist.
Ich liege also da. Es sortiert sich nichts. Im Kopf ist alles voller kleiner, schimmernder Elemente, wie dieser Glitter, den man in Bastelläden kaufen kann, der sich in alle Ritzen verteilt und der sich schwer wieder loswerden lässt. Und so ist es ja auch; es ist dieser Glitter, es sind diese funkelnden Teilchen, die sich ablagern im Gehirn und die viel später, noch nach Jahren, plötzlich auftauchen und blinken und enorme Schmerzen machen können. Weil sie auf ihrer winzigen, leuchtenden Oberfläche alles gespeichert haben, wie in einem mikroskopischen Spiegel, und jählings erscheint da etwas, das aussieht wie das ganze Bild, obwohl man weiß, dass es nur ein Splitter ist, eine abgelebte Verheißung, etwas Unwahres und Gefährliches, aber man hat es doch erlebt, und deshalb muss es wahr und wirklich gewesen sein, und warum ist eigentlich … und schon ist man wieder im loop. Doch dazu komme ich noch.
Es sortiert sich nichts, aber das ist ja auch toll. Toll, das ist so ein altes Wort, das sich gehalten hat. Wegen des t am Anfang, nehme ich an, wegen des Effektes, den es macht, im Gaumen und im Ohr, der kleine Knall, das runde, große o, das schöne Doppel-l am Schluss, bei dem die Zunge kurz an die Zähne schnellt und da stehen bleibt, und der Mund geöffnet wie für einen Kuss. Tollheit, etwas ist toll, man selber ist toll, im Zustand einer Besessenen.
Es ist toll, und es ist ohne Zeit. Wie auf einem Trip, LSD oder ein Pilz. Die reine Gegenwart. Wunschlos, autonom bei aller Sehnsucht, die auch da ist. Sehnsucht, berührt zu werden, den anderen zu berühren, Haut an Haut; in diesem Stadium schmerzt es nicht. Die Sensationen sind zu groß. Gleichzeitige Kräfte, rauschend wie ein erheblicher Wasserfall, der nicht nur strömt, sondern um den herum auch Gischt und Dampf aufsteigt, eine Wolke aus hoch energetischer Atmosphäre, in der man sich befindet und die einen schützt, vor den Blicken der anderen, zum Beispiel aus der Gruppe der Ahnungslosen. Die Sache mit Innen und Außen ist hier nicht ganz klar, das merke ich selbst, der innere Wasserfall, die Wolke drum rum, aber so ist es eben in diesem Zustand, die logischen Grenzen lösen sich auf, nicht restlos und nicht beängstigend, aber sie geben nach.
Und das genügt. Fürs Erste, und für lange Zeit. Daliegen und dieser Zustand sein. Vollkommen und ganz ausgefüllt vom inneren Spektakel.
Zwischendurch ein bisschen Alltag, klar. Weil’s sein muss. Man geht da durch und trägt alles mit und funktioniert; natürlich eingeschränkt, aber man funktioniert. Man braucht nur nichts. Von Luft und Liebe leben, so heißt doch diese Redewendung, und sie stimmt. Man ist versorgt. So high, dass alles andere ein bisschen fahl wird und egal, aber das ist nicht richtig ausgedrückt, denn es gibt ja keine Wertung in diesem Zustand, erst recht keine Abwertung. Es ist eher so, dass man auf eine Speisekarte guckt oder auf einen Teller mit einer Mahlzeit, und es regt sich einfach: nichts. Wie unter Schock, oder in Panik, oder auf der Flucht, da denkt man ja auch nicht an die Versorgung, da stellt das System sich um, auf Notaggregat, und dann kann man noch diese Extraminuten laufen, die es sonst einfach nicht gibt.
Ich kenne dieses Gefühl nur von einem Ereignis, und auch da war es schon gemischt, halb Liebe, halb Not. Ich laufe nicht, ich habe nur davon gelesen, dass sich beim Marathon irgendwann die Euphorie einstellt, dieser Sonderzustand, in dem Reservoirs angezapft werden, von denen man weiß, die man nicht willentlich nutzen kann; sie müssen aufgerufen werden, vom System in Not. Und dieses eine Mal, da war ich eben schwer verliebt. Und saß mit einem Mann im Boot, in einem Kanu in Kalifornien, und wir hatten zwei Anlegestellen verpasst. Der Fluss, der einmal ein Bach gewesen war, oben in den Bergen, als wir ins Kanu gestiegen waren, hatte zu viel Kraft. Das Wasser war eiskalt, und zugleich war es zu wenig; immer wieder ragten Steine aus dem allzu flachen Flussbett, und da wir nicht kentern wollten, auf keinen Fall kentern wollten (denn alles wäre nass geworden und wir hätten uns nicht mehr aufwärmen können), stiegen wir aus und schoben das Kanu durch das flache, aber so reißende Wasser, in unseren dünnen Schuhen, die für eine Wanderung dieser Art gar nicht gemacht waren. Und natürlich kenterten wir doch, es war zu wenig Gewicht im Boot, um es stabil zu halten, und wir waren müde und unsicher auf den Beinen; zweimal kippte das Kanu und wir sammelten die Plastiksäcke wieder ein, in denen unsere Sachen verstaut waren; die eine hielt das Boot, der andere sammelte ein, und dabei fielen wir beide ins eiskalte Wasser direkt aus den Bergen hinter uns, Frühlingswasser aus den Bergen Nordkaliforniens; ein reines, klares, wahrscheinlich sogar wohlschmeckendes Wasser, aber in diesem Moment –.
Die Sonne war nicht mehr zu sehen, wir waren ja in einem Flussbett, in einer Schlucht, und die Ufer waren dicht bewachsen, keine Chance, da irgendwo anzulegen, selbst wenn wir die Kraft gehabt hätten, uns und das Boot dahin zu hieven. Es kommt noch eine Stelle, sagte der Mann, der diesen Fluss schon mal hinabgerudert war, ich weiß, es kommt noch eine Stelle! Und ich hörte diesen Satz und hielt mich daran fest; mit dem bisschen Restverstand, der noch da war, dachte ich: Das sagt er, weil er es glauben will, er hat selbst keine Ahnung mehr, wo wir sind, nach diesen Stunden des Watens und Kenterns und wieder Ruderns, ohne Orientierung. Denn dort, in den Bergen Nordkaliforniens, da gab es nichts, kein Trafohäuschen und kein Försterhaus und keinen Aussichtsturm, da gab es nur die sagenhaften Wälder, von denen alle Reiseführer schwärmen, und diesen wild gewordenen, zu flachen Fluss, der zum Pazifik will, mit aller Macht. Aber ich hielt mich daran fest: Es kommt noch eine Stelle, wo es breiter wird, und ruhiger, und wo es eine kleine Lichtung gibt, auf der rechten Seite (da gucken wir hin, da gucken wir von nun an hin), wo man anlegen und sogar ein Zelt aufschlagen kann. Doch ich ahnte, dass er auch nicht mehr wissen konnte, ob wir vielleicht an dieser Stelle schon vorbeigestolpert und -gefahren sind oder wie weit sie weg sein mag.
Aber das Wasser wurde ruhiger, und der Fluss verbreiterte sich. Ich kann mir nicht erklären, warum er wieder mehr Wasser führte, doch so war’s; bestimmt hatte es Zuflüsse gegeben, auf die wir nicht geachtet hatten oder die wir, stockdunkel, wie es inzwischen war, gar nicht mehr bemerkten. – Gab es einen Mond? Ja, es gab ein bisschen Mond, vielleicht einen Viertelmond, und das Wasser glänzte auf einer schmalen Linie genau vor uns, und ich dachte an einen alten Film, mit Katharine Hepburn oder Marilyn Monroe, die Frau auf einem Floß, mit einem Mann, und der Mond lässt alles glitzern. Katharine Hepburn war mir da lieber, gab mir mehr Halt und Festigkeit, dieses Sehnige, Entschlossene, der Witz und die Kühnheit, die sie hat, ich hielt mich also an Hepburn. Und der große Vorteil von diesem Mehr an Wasser war: Wir konnten wieder ins Boot, ich vorne, er hinten, das war die Aufteilung, die hatte er bestimmt, der geübte Wildwassermann, der Wildernessexperte und Bodysurfer; er hatte gesagt: Auf das Heck kommt es an (aber nicht herablassend, sondern caring, wie er überhaupt sehr caring war und blieb, auch in der Panik), da steuert man und hält das Gleichgewicht. Ich saß also vorne, und wir konnten wieder paddeln. Ich trug eine Jeans, weil wir in Amerika waren; ich bin der Mimesis-Typ, und obwohl ich mir aus Jeans und Sweatshirts eigentlich nichts mache, waren sie da eben richtig, so wie die songs von Maria Muldaur und Joan Baez und die Erinnerung an Katharine Hepburn. Aber der Nachteil von so einer classic american jeans ist, dass sie das Wasser aufsaugt und sich dann ganz eng um die Beine spannt; ich saß da in diesen eisigen Röhren, in denen ich meine Beine nicht mehr fühlen konnte, was für das, worauf es beim Paddeln ankommt – subtile Beweglichkeit, ständiger Ausgleich aller Schwankungen, gute Durchblutung auch bei stundenlangem Sitzen –, natürlich gar nicht half. Füße, Beine, Rumpf und Hände: alles taub. Haare nass. Aber die reine Gegenwart. Denn, das war eben das Aggregatwunder: All das wurde egal. Der Fluss breiter, breiter und ruhiger, schon fast ein kleiner Strom. Wir im Dunkeln im Kanu, vor uns ein schmaler Streifen Silber, in dem wir immer schneller vorwärtsglitten; wir mussten nur noch rudern, um den Kurs zu halten, oder vielleicht auch nur, um nicht einzufrieren. Um uns die Nacht. Und mir kam ein Lied in den Sinn, ich glaube, es war Moon River, und das summte und sang ich vor mich hin, und mit jeder Minute hatte ich mehr Kraft und noch mehr Kraft, ich hätte die ganze Nacht so weiterpaddeln können, so nach meinem Gefühl. Durchnässt, versteift, verfroren, ohne Licht und ohne Aussicht, in keiner Hinsicht Aussicht, aber all das war: egal. Eine große, unspezifische Liebe durchströmte mich, Liebe zur Welt, zu dem Mann und zu mir, Liebe zu den Elementen und der Nacht, zu allem, was da war in dieser absoluten Gegenwart.
Und dann fanden wir die Stelle wirklich, diese kleine Lichtung, von der Stunden zuvor die Rede gewesen war; vielleicht war’s auch eine andere, aber egal: Wir sahen sie rechtzeitig und manövrierten uns dahin. Wir zogen das Kanu ans Ufer und machten es fest – dafür hatte der Mann noch die Kraft, vor allem aber den Kopf, denn am nächsten Morgen erklärte er mir, dass wir vermutlich wirklich verloren gewesen wären ohne Boot, da wir es zu Fuß kaum hätten schaffen können zur nächsten Straße, wo immer die war; ohne Kompass, in einem Wald, der eigentlich unbegehbar, wo jeder Schritt ein Klettern war und man sofort die Orientierung verlor. Und die Leuchtraketen, die er dabeihatte, waren nass und zündeten nicht mehr. Er machte es also fest, das Boot, mit steifen Fingern, irgendwie, und dann holten wir einen Schlafsack aus dem Gepäck; wir hatten eigentlich zwei, doch er wusste genau, was jetzt zu tun war, und er sagte: Wir haben nur eine Chance, uns auf eine Temperatur zu bringen, die uns überleben lässt, wenn wir uns zu zweit in einen Einerschlafsack legen, eng wie Sardinen in einer Büchse, und wenn wir alles ausziehen, was wir jetzt am Körper haben, so schrecklich das gerade klingt, uns in der Kälte der Nacht alles vom klammen Leib zu schälen, aber das muss jetzt sein –. Inzwischen war ich nicht mehr euphorisch, die Sonderration war aufgebraucht, und ich wollte nur noch liegen, und wenn ich nicht mehr aufgewacht wäre, dann wäre es ein schöner Tod gewesen; so war mir zumute, apathisch und aufgelöst und schon mit einem Eisfuß im Nirwana, oder im Styx. Doch er bestand darauf, half mir und zog mich aus, nicht zum ersten Mal, aber zum ersten Mal aus medizinischen Gründen, und wir legten uns in diesen Schlafsack, steif gefroren, wie wir waren, und es dauerte nicht lang, da spürte ich, wie das Blut wieder zu kreisen begann und wie ich müde wurde. Und am nächsten Morgen, als wir erwachten, und am folgenden Tag und in der folgenden Woche hatten wir nicht einmal einen Schnupfen.
So viel zur inneren Chemiefabrik.[2] Die eben läuft. Und indem sie läuft, uns mitteilt: Hier passiert was Wichtiges. Hier kommen das Begehren, das Wünschen, das Hoffen auf Touren. Sie verbrauchen den größten Teil der Energie, aber es gibt auch neue Energie. Wir, zum Beispiel (Geschichte der H., mehr dazu später), haben uns gespürt, indem wir aufeinander zugingen. Kann man nicht immer machen, schon klar, war ein glücklicher Zufall der Positionen: Er geht von seinem Zuhause aus los, ich gehe von meinem Zuhause aus los, wir treffen uns auf der Straße, unter freiem Himmel, und wir merken im Gehen, wie das Bei-sich-Sein von Erwartung immer stärker durchzogen wird; die ersten elf, zwölf Ecken ist man noch für sich, ab da könnte es sein, dass man sich sieht; die Begegnung bereitet sich vor. Und ich, die beim Gehen nicht nur gute Laune bekommt, sondern auch das Gefühl, es klärt sich was, löst sich was auf oder richtet sich ein: Ich bin im Takt, ich bin intakt. Und einzigartig. Ich bin eine Hauptfigur in diesem Stück, in dem es zwei Hauptfiguren gibt, nur zwei; es gibt kein Publikum, oder: Das ist die ganze Welt, die es nicht weiß; die nicht zuschaut, aber den Rahmen gibt. Sie werden davon erfahren! Noch ist es eine Liebe im Kokon.
Ein zarter, aber unermesslicher Kokon. Etwas, das sich bildet, indem man redet, schweigt, Nachrichten schreibt und Fotos schickt, indem man etwas erschafft, das es zuvor nicht gab; nicht mit Mühe, sondern wie nebenbei. Mit Glück. Unbewusst und mit Aufmerksamkeit, mal so, mal so. In der miteinander verbrachten Zeit, aber erst recht, wenn man getrennt ist und immer weiter produziert – Gedanken, Zeichen, Empfindungen, Fragen & Antworten. Und Witze. Die heiterste, die allerschönste Verschmelzung, das schwerelose Zeichen von Vertrauen: die Pointe als Versicherungspolice. Denn nichts zeigt so unabweisbar, so stabil und zugleich ätherisch, wie hier ein Großes Paar entsteht.
Das ist so ein neues Land, in das man geht. Und das man, wie alles andere, erst gemeinsam erschafft. So, wie die Niederlande entstanden sind, dem Meer abgetrotzt. Nur, dass hier nichts abgetrotzt werden muss. Und dass nicht ein Element das andere ersetzt; wo vorher Wasser war, da ist nun Land, sondern: Wo vorher nichts war, ist nun das. Das neue Das. Es ist noch nicht Materie, sondern ein Dazwischen, etwas ganz Fluides, nur Gedachtes und Gefühltes, fast ohne Kristallisation. Vielleicht ein paar sms, auf die man zeigen könnte, oder ein mitgebrachtes Buch, ein Zettel mit einer Handschrift oder ein U-Bahn-Ticket. Aber das hat nur Bedeutung für diese beiden Menschen, und ebendiese Bedeutung ist ja das, worum es geht, eine andere Sphäre des Wirklichen; ein Etwas, das noch keine Konturen hat, sondern sich unaufhörlich ausbreitet, neu formt, ausstülpt und zu seinem Wachstum keinen Bauplan braucht. Ein ontologisches Wunder.[3]
Und das ist etwas, das man für sich behält. Wobei es egal ist, ob das ein paar Stunden sind oder ein paar Wochen. Das Seelenleben kennt keine Zeit, so sagt es Sigmund Freud. Der Seele ist es egal, ob das erste Mal, da man vom Vater geschlagen wurde und zugleich die Tagesschau-Musik erklang, schon dreißig Jahre her ist; sie zuckt noch immer bei der Melodie; diese Stelle ist wund, und sie wird es bleiben. Es sei denn, natürlich, es gab eine gütige Therapeutin, mit der man das hat besprechen können, und nicht nur besprechen, sondern geradezu durcharbeiten, so heißt das Fachwort, und das trifft es ganz gut: Es genügt nicht, die Szene aus dem Gedächtniskeller zu holen. All das, was sie schrecklich macht, muss mitbetrachtet werden, die Liebe zum Vater, und wie man sich wünscht, ihm vertrauen zu können, und wie zu diesem Wunsch-Kind ein anderes sich gesellt, wie es dann Zwillinge gibt, einmal den Wunsch, einmal die Angst, und sie können einander zwar vergessen, akut ebenso wie für längere Phasen, doch sind sie von da an verbunden, mit einer Nabelschnur, die all das vom einen Organismus in den anderen pumpt, das Vertrauen wie die Angst, das Glück wie die Pein, die kindliche Hoffnung wie die Verzweiflung. Aber das Ereignis selbst muss erst einmal vergessen werden.[4]
‹Trauma› nennt das die Fachwelt, ein Erlebnis, das zu groß ist für die Seele, das also abgespalten wird, aus dem Gedächtnis gerät, aber verkapselt und detailscharf im Unbewussten schlummert. So dass der Erwachsene gar nicht weiß, warum diese Tagesschau-Melodie, die doch eigentlich ganz schön ist, bei ihm merkwürdige Gefühle auslöst oder ihn dazu bringt, nebenher aufzuräumen, in die Küche zu gehen, eine Zigarette zu rauchen – eine Unruhe, ein ganz unspezifisches Weh. Und die Erkenntnis selbst, wenn sie schlagartig kommt, die hat noch keinen Effekt, außer dem tollen Aha, das es dann gibt, ein geradezu sanfter Blitz der Erkenntnis, der vieles heller macht; wenn nicht den ganzen inneren Keller, so doch ein Stück davon. Der auch die Gegenwart erleuchtet. Das Durcharbeiten, worauf es hier ankommt, geht eben nicht darin auf, einen Trigger zu identifizieren. (Und zu verstehen, dass alles als Trigger taugt; es kann ein Hut sein oder eine Geste oder ein Geruch, eine Sirene oder ein Lied, eine triviale Gleichzeitigkeit von einem roten Auto und einem gerufenen Wort; es kann alles sein, und der einzige Mensch, der es erkennen kann, ist der, der es nicht erkennen will.) Denn es ist ja gar nicht der Trigger, der es so schwierig macht, es ist der Zusammenhang. Das ganze feine Gewebe, in das er eingebettet war als ein Detail, als ein beliebiges Zeichen, das sich emanzipiert hat und ragt aus dem, was verschattet ist; etwas Hochsensorisches wie ein Mast, der Signale aus dem All empfängt, oder wie eine Stimmgabel, die erzittert bei einer spezifischen Stimmung, ein Instrument, das stur und ohne Rast seinen Job macht, der lautet: Ich bewahre dich vor Schaden. Ich sorge dafür, dass du zusammenzuckst und die Szene verlässt, wenn jemand in einer Jacke aufkreuzt, die genauso gelb ist wie die desjenigen, der dich damals so übel bedroht hat; so übel, dass du es vergessen hast, aber ich weiß es noch, denn dafür bin ich da, bin ich bei dir, und ich weiche nicht, bis du mich aus guten Gründen entlässt. Wir kommen darauf zurück.
Wir kommen darauf zurück, weil das sehr wichtig ist, an sich, aber es gewinnt seine Wichtigkeit erst im Verlauf. Noch sind wir im Kokon. Noch sind wir in dieser Blase aus Gefühlen, Gedanken und Atmosphären, deren Ränder, mangels Materie, gar nicht bestimmbar sind. Wenn morgen der eine, Gott behüte, unter die Straßenbahn geriete; niemand würde etwas wissen von dieser Geschichte.[5] Es fänden sich, im Nachlass, vielleicht kleine Fetische (eine zerdrückte Blume, ein hellgrauer Herrenpullover, ein verwackeltes Foto) oder Notizen größter Intimität, doch könnten diese Objekte eben nicht ‹gelesen› werden, weil von dieser Intimität noch niemand weiß außer dem Großen Paar, das gerade in the making war.[6] Der einzig nicht nur kompetente, sondern mögliche Leser wäre der jeweils andere.
Also, noch gibt es keine Zeit. Vielleicht aber entstehen jetzt schon Bilder, die eigenen Bilder, die zu Stationen werden können, eine Art Kreuzweg der nichtreligiösen seligen Qual. Noch zuvor, vielleicht: Der erste Besuch bei Freunden, bei dem man nicht von ihm erzählt, wird irgendwann zu einem Besuch, bei dem man von ihm erzählt. Aber wie?
Zum ersten Mal beobachtet die Liebende, die Liebeskranke, die Glücksbefallene, wie sie darüber spricht. Wie sie die Elemente teilt; hier das Ozeanische, das sich in ihr ausbreitet und in dem sie schwimmt (wie gesagt, das mit den Grenzen funktioniert in dieser Phase nicht besonders gut), und dort ihr sozialer Kosmos. Natürlich macht es einen Unterschied, wem man es zum ersten Mal erzählt oder wem gegenüber man überhaupt eine Erwähnung macht, aber zunächst: Das Wort ist in der Welt und kann nicht mehr zurückgenommen werden. Der erste ontologische Sprung, vom Intimen ins Private.
Von nun an ist es nicht nur Erleben, sondern auch eine Erzählung. Eine fortlaufend zu ergänzende, vielleicht irgendwann sich korrigierende Erzählung; eine Erfahrung, in Worte gefasst, die über das Selbstgespräch hinausgeht. Und die natürlich Wiederworte – hoffentlich noch keine Widerworte – ergibt. So dass es nicht trivial ist, wer hier das erste Bekenntnis hört, wer dem bisher Beschwiegenen durch seine Reaktion (erst recht die unwillkürliche: die Blicke, die Mimik, die Gesten, die sorgende Unruhe oder freundschaftliche Mitfreude) eine soziale Kontur gibt. Eine erste Definition. Trifft die Geschichte, die hier gehört wird, auf ein empathisches Entgegenkommen? Auf eine Bereitschaft, das Glück für Glück zu nehmen?
Das erste Bekenntnis, das versteht sich von selbst, ist schon ein Beziehungsgeschehen. Hat man sich einen Freund gesucht, der eine frische Narbe pflegt oder dessen Liebeserfahrung zu einer Enttäuschung geronnen ist, trifft man also auf ein skeptisches, vielleicht auch warnend lächelndes Gegenüber, das in der manischen Lebendigkeit der Liebenden vor allem Hysterisches sieht, welches nach Abklärung verlangt oder notwendig ent-täuscht (hier muss er sein, der besserwisserische Bindestrich)? Trifft man auf eine Freundin, die ihrerseits so etwas gerade hinter sich hat, frisch betaut in zärtlicher Erinnerung?
Oder ist ein Paar mit der jungfräulichen Zeugenschaft betraut, das seinerseits natürlich darauf achtet, wie der jeweils andere reagiert – denn alles, was nun gesagt wird, wirft ja auch ein Licht auf das Paar, auf dessen Liebeserfahrung und die Geschichte, die es sich selber erzählt?[7] Die erste Spiegelung, die hier stattfindet, formt das Gedächtnis der Liebenden, lässt sich weder ignorieren noch vergessen. Die soziale Skulptur, die hier entsteht, ist noch frisches, weiches Material, in das sich alles abdrückt, das nun die ersten Dellen oder Verzierungen oder auch einen Sockel erhält.[8]
Damit verbunden: die Bilderfrage. Sehr prekär! Vermutlich hat man, bereits nach den ersten Tagen, ein Selfie oder Porträt zur permanenten Verfügung. Zunächst einmal der heikle Abgleich mit dem inneren Bild: Ist das der Mensch, bei dem man gerade einen Auslieferungsantrag stellt? Ist das Lächeln, der Blick, die Haartracht, der Ausdruck, you name it, das Passende zu dem, was man selber wünscht und fühlt, zeigt es die innere Gegenwart? Oder muss sofort kommentiert und korrigiert werden: Das ist ein altes Foto, hier schaut er anders als sonst, du musst dir dieses und jenes weg- oder dazu denken? Konfrontiert das Bild mit einer inneren Bangigkeit, à la: Ja, ein bisschen gerader könnte er sich halten, oder diese Brille, kann ich ihr die ausreden, oder: klar, wir sind beide nicht mehr die Jüngsten? Und wie viel von alldem fließt in das erste Zeigen ein, das als Wunsch sofort und selbstverständlich auf der Schwelle der ersten Erzählung steht: Wie sieht er denn aus? Und dann wird ja nicht nur er kommentiert (und sei es durch einen Blick), sondern auch die eigene Wahl. Eine erste Entfremdung, paradoxerweise in der ersten sozialen Einbettung, diese Konfrontation mit ‹der Realität› – obwohl man weiß, dass ein Foto nur einen Moment einfängt, und den eben als eine Ordnung unbelebter Pixel, so zufällig und notwendig verzerrend wie ein aus dem Fluss der Gegenwart und des Geschehens Herausgefischtes; immer im elementaren Sinne falsch.
Man sieht: Hier, mit der ersten Erwähnung, wird es komplex. Und kompliziert.[9] Die Geschichte breitet sich aus wie ein Fächer, und schon ist man nicht mehr die Einzige, die damit wedelt, die Aufregung und Zeichen in die Atmosphäre fächelt. Es ist in der Welt.
Weshalb die ersten Geständnisse, wie bei schweren Erkrankungen, oft an physisch Fernstehende gehen. Bei denen man den Rhythmus der Nachfragen selbst bestimmen kann; man muss ja nicht ans Telefon gehen oder eine sms sofort beantworten. Man ist dem sorgenden, suchenden Blick der Menschen, die man täglich sieht, nicht ausgesetzt; niemand misst ungebeten die Temperatur dieser Liebe. Es ist ein erster Schritt in die kommunikative Unübersichtlichkeit, aber in einem Reservat, dessen Grenzen man selbst bestimmt. In dem die wilden und die niedlichen Tiere noch weitgehend unbeobachtet schweifen.
Doch ich wollte vom Anfang erzählen. Diese Anfänge. Zum Beispiel wie ein Pfeil.
(GESCHICHTE DER M.)
Ein Blick, ein Blick zurück, und jählings das Gefühl: Hier geschieht gerade etwas, etwas von Bedeutung. Unvorbereitet. Bei Tageslicht, in einem Schwarm von Menschen, in diesem Feld von Blicken, Gesprächen, Gehen und Vorübergehen. Viele – es war Buchmesse in Frankfurt, kaum ein nüchternerer Ort ist denkbar als diese riesige Anordnung von offenen Schachteln, Stände genannt, mit aneinandergetackerten Regalen, leichten weißen Möbeln, grauem Bodenbelag, Büchern als Auslegware, viele noch eingeschweißt, glänzend im künstlichen Licht wie im Drogeriemarkt – mit nach innen gekehrten Gesichtern, auf dem Weg zu einer ‹Besprechung›, einem ‹Termin›, eine schwere Tasche über der Schulter oder eine Mappe unter dem Arm. Lauter Einzelne, die ambulante Inseln bilden an den Ständen, wo wiederum jene sitzen, die dort berufsmäßig diese kurze Woche verbringen, ihrerseits wie angetackert und schon am Ende des ersten Tages mit dem Pantherblick von Rilke, «und hinter tausend Stäben keine Welt». Ein Ort ohne Rituale außer dem Moment, da morgens das zentrale Licht an- (aber da ist kaum jemand da) und dann, am frühen Abend (es sind noch zu viele da), es wieder ausgeschaltet wird: Für heute ist es vorbei, nehmt Euren Weg zum Ausgang, lasst alles stehen und liegen, gleich kommen die Putzkolonnen, Ihr habt nicht mehr viel Zeit. Packt Euch und Eure Gesellschaft, findet einen Platz, wo Ihr weitertrinken, weiterreden könnt, oder hebt Euch in eine S-Bahn in den Taunus, wenn Ihr ein Hotel in Frankfurt nicht bezahlen wollt. Kommt morgen wieder, verkatert oder nicht, mit fahlen oder erwartungsfrohen Gesichtern, mit übersäuerten Mägen von zu viel Kaffee und Alkohol, mit Euren Auftragsbüchern in der Hand und Euren Zetteln, wo die Termine des Tages notiert sind, 10.15, Halle 5.1, Stand 43 usw., aber nun: Geht!
Es war aber an einem Nachmittag, in dieser unbestimmten Ausdehnung, diesem breiten Becken aus Zeit, in dem man sich auch vertrödeln kann und in dem jene, die das Privileg oder die Not haben, ohne Funktion zu sein, wie Guppys durch die Gänge schwärmen, in losen, wechselnden Konstellationen. Und sich hin und wieder für ein paar Minuten, aus denen Viertelstunden werden können, an eines der Regale stellen, ein Buch herausnehmen und so tun, als würden sie lesen; angelegentlich, aber dann doch auf der Suche nach einem Satz, der ein Lot versenkt und sie kurz innehalten lässt, mit einem bestimmten Gefühl oder einem halben Gedanken. So war das; ich stand da im Gespräch, und er guckte in ein Buch, vielleicht war es auch umgekehrt, und zwischen uns einer, der uns beide kannte und am dritten, vierten Messetag noch frisch genug war, beiderlei Namen parat zu haben. Ein paar Worte, die das Feld eröffneten, zum Spiel, ein paar Zeichen, die uns drei – aber eigentlich nur uns zwei – eine soziale Orientierung gaben (mit wem man es zu tun habe). Die nicht nötig war. Denn dieser Wimpernschlag des Schicksals, mitten im Hellgrau mit Neonlicht, war ja schon da, die rätselhafte Gleichzeitigkeit, und dieser kleine Chock in der Körpermitte; etwas von Gewicht, das sich da einsenkt und bleibt. Die soziale Unwahrscheinlichkeit, das anmutige, unlösbare Rätsel: warum jetzt, warum hier?[10]
(Freundin F., aus der Spezies der Ahnungslosen, wird inzwischen eingeschlafen sein –)
Ein gewissermaßen idealer Anfang der romantischen Liebe. Oder, sagen wir: ein Auftakt. Etwas, das vor dem ersten Taktstrich angesiedelt ist, vor der objektiven Rhythmisierung, den ersten strukturierenden Elementen: Sätzen, die man austauscht und auf die man irgendwann zurückkommt, Eindrücken, die alles weitere färben oder daran gemessen werden (Humor, Schüchternheit, eine melodische Stimme …); zwischenmenschliche Erfahrungen, die etwas anderes sind als reine Projektion.[11]
Etwas, das sich ereignet, plötzlich, und von dem sich nie mehr wird sagen lassen, wer hier, bei diesem Epiphanischen, den Anfang machte. Ein Satz ohne Autor. Ein Geschehen ohne Handelnde. Ein Beginn ohne Verantwortung. Ein Zufall, der Notwendigkeit war. Eine Existentialübung im Paradox.
Und zwei Systeme des Unbewussten, die kooperieren.[12] In ihrer aktuellen, äußeren Gestalt, so oder so gekleidet (er in Jeans und Sneakers, ich: weiß nicht mehr). In diesem Fall in einem sozialen Rahmen, der Vertrauen stärker ermöglicht als, beispielsweise, öffentlicher Nahverkehr: Hier ist einer, der liest. Vermutlich Abitur hat. Vielleicht auch schreibt. Was man so zur Kalmierung braucht, in der modernen Welt erst recht.[13]
Beziehungsweise, in diesem Stadium: zwei Unbewusste, die erst mal kolludieren, damit überhaupt etwas passieren kann.[14] Denn bei einem solchen Anfang gibt es keine bewusste Entscheidung. Der bleibende Zauber in jeder möglichen Erzählung einer solchen Geschichte (auch wenn sie unglücklich verläuft): Was hier geschah, war Wille & Vorstellung entzogen, kann nicht kritisch betrachtet werden, sondern nur als eine romantische Offenbarung. Allenfalls die Bedingungen der Möglichkeit lassen sich erhellen, aber das ist für die spezifische Geschichte fast ohne Gewinn, fügt dem Auftakt nichts von persönlicher Bedeutung hinzu.[15]
Und natürlich hat so ein romantisches Wunder eine bindende Kraft, gerade weil es der Verantwortung – und so auch der Moral und der Verhältnismäßigkeit – zunächst einmal entzogen ist.[16] Wie ein Scheinwerfer ohne Aus-Taste – oder wie eine Milchstraße der Möglichkeiten, die auch die Tage erhellt – lässt es alles, was kommt, in schicksalhaftem Licht erstrahlen. Macht die kommenden Akteure zu Kindern, die eine unerwartete Bescherung erhielten, und zwar gemeinsam; zur selben Zeit, am selben Ort. Das Märchenhafte hat erlösenden wie lösenden Charakter und hebt die entstehende Geschichte von allen anderen ab. Es ist, in der Literatur wie im Leben, ein Genre für sich.
So ein Anfang war das.
In diesem Fall.
Und hat lange geleuchtet. Das Epiphanische! Das, einmal geschehen, auch immer wieder aufgerufen werden kann. Als eine Erinnerung, an das Erleben einer Evidenz des psychischen und physischen Apparats (um hier mal einen Registerwechsel zu vollziehen, für F., die vielleicht wieder wach geworden ist), während der Verstand registriert: Hier ist gerade etwas Unerklärliches geschehen.
Und so könnte der Verstand an dieser Stelle nicht nur konstatierend, sondern auch analytisch tätig werden: Treten die beiden jetzt ein in eine symbolische Ordnung, in ein Skript, das sie nicht selber schreiben? Und das ist natürlich so. Sie sind, auch wenn ihr Bewusstsein sich damit gar nicht beschäftigen will (um den naiven Zauber nicht durch kulturgeschichtliche Betrachtungen zu stören), Figuren einer Aufführung. Nach diesem schicksalhaften Vorspiel sind die nächsten Schwellen, die nächsten Stufen und Akte einigermaßen klar. Nimmt man den Irrtum heraus, der logisch nicht auszuschließen ist (eine schnell wirksame Entzauberung durch eine triviale Unerträglichkeit wie den falschen Dialekt, ein serielles Schniefen – noch ist ja nichts ‹passiert›), bleiben dabei im objektiven Verlauf zwei Varianten: kompliziert oder nicht. Nicht kompliziert: Beide sind frei, beide sind nicht nur willig, sondern auch fähig, jene Nähe, die da als Verheißung so unerwartet aufgeschienen ist, auch zu erkunden und zu erfahren. Die andere Variante: häufig. Immer häufiger mit zunehmendem Lebensalter, da Kinder, Eltern, Ex herumstehen und innere wie äußere Plätze besetzen.
Aber auch in der vielversprechend offenen Phase des zweiten Lebensviertels gibt es widerstrebende Kräfte, die eine Abwägung von Äpfeln und Birnen erzwingen, gerade weil so viel in Bewegung ist. (Die Frage, z.B., ob man die Wahl des Studienorts der beginnenden Beziehung anpassen soll.) Doch das ist fernere Zukunft. Zunächst: der Taumel in der Gegenwart. Und die kulturelle Begleitmusik. Das brisante Gefühl, zugleich Akteur und passiv zu sein, Hauptfigur und Komparsin. Und von nun an verbinden sich nicht nur die beiden Verliebten, sondern auch deren Skripte der romantischen Liebe.
Und das sind zwar Schablonen, doch davon gibt es etliche. Die sich zudem schneller verändern, kombinieren und fusionieren als im vergangenen Jahrhundert, durch den Zugewinn an biographischer Freiheit vor allem für all jene, die nicht cis, hetero und männlich sind – und durch die Massenmedien, in denen kulturelles Material sich überkreuzt und überlagert, das ohne Weiteres nicht gut zusammenpasst. Wie Wrackteile im Ozean des kollektiven Unbewussten treiben Wünsche und Erfüllungsszenen in den Gemütern durcheinander, aus etlichen Jahrhunderten und immer mehr Kulturen. Der one night stand einer gläubigen Muslimin, das date im Steakhouse mit einem Hindu, der erste Kaffee mit einem Schwaben am Prenzlauer Berg: schon schwierig genug. Doch zu jeder Geste und Handlung, zu beinahe jeder Pause gibt es, jenseits der Unmittelbarkeit, die unpersönliche wie die persönliche Bedeutung. Ist es – der triviale Klassiker – selbstverständlich, höflich oder patriarchal, wenn er diesen ersten Kaffee bezahlt? Tut (oder lässt) er es nur, weil er sich in deinen Kopf versetzt? (Den er ja nicht kennt –.) Ist die Verständigung darüber etwas, das beiden mehr Sicherheit und vielleicht sogar den ersten gemeinsamen Witz verschafft? Oder sollte man die Frage lieber unerwähnt lassen, um nicht aus jedem Detail ein Kaleidoskop zu machen?
Was hier eine elementare Rolle spielt: ob die Begegnung eine zufällige ist. In ihrem Essay Die singuläre Frau beschreibt Katja Kullmann einen solchen Beginn von Balkon zu Balkon; beide in ihrer Privatheit, lässig und en passant; Seele im Bademantel. Ein fast schon historisch zu nennender Augenblick des Ungelenkten. Die Datenmengen, die da hin und her gehen, sind zunächst vollkommen ungesteuert. Und finden doch, in Blitzesschnelle und unwillkürlich, ein passendes Skript.[17]
Häufig, inzwischen: das geplante Gegenteil. Formatierte Fragebögen, die für Partnerbörsen ausgefüllt werden müssen, damit man zugelassen wird (ein high tea vor allem für sprachbegabte Akademiker:innen), oder eine Auswahl von Bildern, die für die Seele, den Körper und die Wünsche sprechen, die entscheidende Information bereits vorausgesetzt: Hier ist eine:r auch auf der Suche.
Das Dilemma liegt auf der Hand: Statt der unwillkürlichen Selbstpräsentation sind in diesem Verfahren bewusst gesetzte bzw. hergestellte Daten (z.B. alte wie verbesserte Fotos) die Basis, deren Natürlichkeit bzw. Angemessenheit sich erst bei der Begegnung, in der Praxis zeigen wird. Die damit schon verdoppelt ist, eigentlich sogar vervielfacht: Denn mit der realen Erscheinung wird sofort abgeglichen, was das imaginäre Bild des anderen versprach – und was die Selbstbeschreibung ihrerseits in Aussicht stellte. Wer sich z.B. als humorvoll beschrieben hat, wird sich bemühen, diesem Ideal zu entsprechen, und da Humor sich besonders schlecht dirigieren lässt, der eigene wie der des anderen, kann ein solches Versprechen zu einer Bürde werden. Auch gab das Halbprofil im blauen Oberhemd möglicherweise eine Ahnung von Männlichkeit, die durch ein gestreiftes muscle shirt ungut ergänzt oder gar torpediert wird, und während das erst mal verkraftet werden muss, hat sich das Karussell bereits entscheidende Runden weitergedreht … Man tauscht also bei diesem Verfahren für 1 Information, die in ihrer Verlässlichkeit kaum über Stunden bzw. die erste Begegnung hinausgeht – dass hier jemand in Beziehung gehen will –, unendlich viele weitere Rätsel ein. Es sitzen am Kaffeetisch: zwei reale und bemüht spontan agierende Personen; zwei Entwürfe, die sie von sich geliefert haben; zwei Gehirne, die sowohl den eigenen wie den Entwurf des anderen mit dem Realen vergleichen und fortlaufend korrigieren. Sechs Fremdheiten statt zwei, die sich im Fortgang auch noch permanent vermehren, weil das reale Geschehen mit allem, was der virtuelle Kontakt bereits als Material in die Begegnung stellte, verglichen und verrechnet werden muss. (Hatte er nicht von zwei Kindern geschrieben oder war das der andere? Und wenn sie wirklich so sportlich ist, wie sie von sich behauptet hat, wieso sieht man ihr das nicht an? Das nennt er elegant? usw.) Und damit ist eine weitere Komplexität noch gar nicht berücksichtigt, nämlich die Differenz zwischen dem, was wir von uns mitteilen, und dem, wie wir es meinen; all die Streiche, die unser Unbewusstes uns spielt und die in einer Seele-im-Bademantel-Szene erst mal gnädig im spontanen Tumult untergehen. Dass jenes aufregend erotische Foto, das man von sich gegeben hat, womöglich nicht einmal den eigenen Träumen entspricht, sondern die – unterstellten – Träume des unbekannten Gegenübers beantworten soll oder das Bild des Mannes als Gipfelstürmer eher von konstitutivem Ehrgeiz erzählt als von der Liebe zur Natur. Lauter kleine und größere Stolperfallen für bereits den ersten gemeinsamen Tanz um das goldene Kälbchen Intimität.
Immerhin: Bei beiden Sorten Begegnungen geht es, selbst wenn die Akteure es nicht so erleben, immer auch um Standards. Im Skript der spontanen Begegnung vielleicht diffuserer Natur, im anderen, durch die sondierten Vorab-Informationen, womöglich klarer festgeschrieben?
Aber dazu kann ich, mangels Erfahrung, kaum etwas sagen.
Zwei Episoden, die gibt es immerhin.
I: Nach einer traurigen Trennung, die mich kaum wieder auf die Seelenfüße kommen ließ, schenkten mir Freunde (ein liebend Paar, das sich allerdings im Realen kennengelernt hatte) ein Kontaktinserat in der Zeit, das sie formulierten (und das ich nie las). Darauf drei Zuschriften – es wird also eine recht spezifische Anzeige gewesen sein. Die eine ließ sich, da seriell, gleich aussortieren. Die zweite kam von einem Mann, den ich bereits freundschaftlich kannte (der aber nicht infrage kam) – was mich mit hohem Vertrauen in die Passung der unbekannten Anzeige erfüllte. Die dritte: überwältigend. Nicht nur durch das sympathisch unprätentiöse Foto eines großen, auf leicht verhauene, bayerische Weise gut aussehenden Mannes in den Bergen (ohne Statussymbole, nicht mal die Natur war spektakulär). Sondern erst recht durch den handgeschriebenen Brief, der davon erzählte, wie er die Anzeige gelesen, überlegt, die Zeitung dann doch entsorgt und schließlich, Tage später und am sehr späten Abend, im Dunkeln aus dem Papiercontainer des Hauses gefischt hatte. Ich gebe zu, man kann das auch anders sehen, doch mich hat diese Ambivalenz nicht nur beruhigt, sondern auch stimuliert. Sie schuf faire Verhältnisse: Angst auf beiden Seiten, Widerstand und Anziehung zu beinahe gleichen Teilen.[18]
Wir trafen uns in einem Restaurant, das wir beide nicht kannten; auch das eine, allerdings eher verunsichernde Symmetrie. Und ich war, leider, vom ersten Augenblick an (denn der Augenschein entsprach der Vorstellung) im Prüfungskäfig. Und kam nicht wieder raus. Es passte fatalerweise alles, bis hin zu seinem Beruf, der sich wie eine sardonische Pointe zu meinen tiefsten Wünschen ausnahm, der Mann war: Bindungsforscher.
Wir waren höflich und interessiert genug, vier Stunden miteinander zu verbringen, inkl. Ortswechsel (als mögliche Rettung aus der Lähmung am Restauranttisch) in eine Straßenbar, aber: nichts half. Wie er sich fühlte, weiß ich nicht, doch für mich war es ein Desaster; ständig wollte ich rufen: So, wie ich jetzt wirke, bin ich eigentlich nicht! Und diese verklemmt-passive, depressive Frau, die dir gegenübersitzt, die will ich auch nicht kennen.
(Am nächsten Morgen ein freundlicher Anruf von seiner Seite, der die nicht entstandene Bindung rücksichtsvoll beendete.)
II: Meine Antwort auf eine Anzeige. Ein Treffen im Münchner Hofgarten; für mich: das (allerdings vermutlich statistisch allerhäufigste) Unglück eines plötzlichen Absturzes in die Realität. Vieles stimmte, nichts von seinen Angaben war falsch, jedoch der erste Augenblick genügte, um zu wissen: Hier wird sich gar nichts ergeben. – Die folgende Stunde war eine Qual der Wohlerzogenheit, und auch hier werde ich nie erfahren, wie es für den anderen war.
Zwei Begegnungen, zwei Versuche, die mir bewiesen: Dieses Verfahren ist nichts für dich.
Es gibt allerdings eine Vielzahl guter Literatur.[19]
Der zweite Anfang, nach dem Epiphanischen: Die eigene Wahl.
(GESCHICHTE DER S.)
Es war im Ausland und in den Ferien; beides kann die Seele lockern. Ich war mit meiner Mutter unterwegs, die, glücklich vermählt, gesund und reizend anzusehen, mit sich und dem Leben zufrieden war. In den Ferien waren meine Eltern eigentlich dem Ungeplanten zugeneigt; in diesem einen Fall hatten sie einen Aufenthalt fest gebucht, in einem Hotel mit Halbpension auf der Insel Madeira, bekannt für ihr mildes Klima, ihren botanischen Reichtum, ihre (durch die Abwesenheit von Badestränden garantierte) Noblesse. Doch mein Vater brach sich zwei Tage vor Abflug den Arm auf komplizierte Weise, blieb ohne Harm zu Hause und ich sprang ein. Die Magisterprüfung war gerade absolviert und das Leben, wie Peter Fox es besingt: «Die Sonne blendet, alles fliegt vorbei/und die Welt hinter mir wird langsam klein/doch die Welt vor mir ist für mich gemacht/ich weiß, sie wartet und ich hol sie ab –» Dagegen kam auch das Hotel für Pensionäre nicht an, wie das Gefühl, am dritten Tag bereits alle infrage kommenden Speisen wie alle Mitgäste gut, sogar zu gut zu kennen; beides waren lange, bunte Leinen, an denen sich passende Zitate (vor allem aus den Buddenbrooks und dem Zauberberg, aber auch aus der Tante Jolesch) aufhängen ließen. Und so verging die Zeit, und sie ging schön. Bis ich am vorletzten Abend meine konservative Mutter davon überzeugte, im mondänen Nachbarhotel auf einen Aperitif in die Bar zu gehen. Wo, ein paar leere Hocker weiter, ein Mann in den späten Dreißigern höflich und auf Englisch ein Gespräch begann. Dass er aus Alaska kam, machte ihn interessant, dass er den small talk aufs Dezenteste beherrschte, machte die Sache beruhigend, und dass sie in einer Fremdsprache bestand, machte meine Mutter wiederum stolz genug, um im plätschernden Fahrwasser zu bleiben. – Der vorletzte Abend schon, und noch nie in Funchal gewesen, zur Nacht, wo es doch diese tollen Fado-Konzerte gab? – Dass es der letzte Abend sein würde, machte den Eskapismus für die treue Ehefrau (denn hier ging es um sie) zu einer Harmlosigkeit, und dass der Mann namens Mike einen Freund namens John mitbringen würde (in einem Fall von Abgründigkeit, erörtern wir später im Doppelbett, hätten die beiden weniger serielle Namen gewählt), gab der Unternehmung ein ebensolches Gepräge.
Im folgenden Sonnenuntergang stieg neben dem hochgewachsenen Mike ein drahtiger, kleiner Mann aus dem Auto, dynamischer und witziger als sein Freund, der seinem Beruf (Jurist) auch verhaltensmäßig folgte, unauffällig bis zur Wasserstofflichkeit. Wir, also John und ich, saßen hinten im Auto, wie die Kinder, und gerieten in verschwörerisch-geschwisterliche Stimmung, angesiedelt in der frühen Pubertät. Der Fado ergriff, das Essen war gut, die Drinks hoben die Stimmung, und auf der Rückfahrt war die klandestine Paarbildung allgemein, wenn auch nur in der Phantasie, jedenfalls in der meinen. Und der Abschied so unbeschwert, wie er nur sein konnte, wenn man sich in vordigitalen Zeiten voneinander kontinentalübergreifend verabschiedete: Das wäre schön und würde nichts werden.
Ich fuhr zurück nach München, an meine Alma Mater, und erlebte ein meinen Narzissmus schwer kränkendes Desaster. Der gutmütige, immer lobende Professor erwies sich als ein monströs seinen Ruf überschätzender Egomane: «Es ist doch allgemein bekannt, dass ich keine summa vergebe.» (Wäre das allgemein bekannt gewesen, knirschte ich hinter den Zähnen, dann hätte ich mich dir nicht überantwortet: Das Stipendium, das ich zur Promotion gebraucht hätte, war damit perdu.) Zugleich löste meine WG sich in trüber Windeseile auf; im Kleiderschrank der Mitbewohnerin fand sich, befleckt und beschädigt, mein schönstes Teil zum Ausgehen, und getragen hatte sie es zu einem date mit meinem Freund. «In ihm», so schrieb es Thomas Mann über Hans Castorf im Zauberberg, der mir aus Madeira noch geläufig war, «ereignete sich ein umfangreicher Zusammenbruch»; so fühlte sich das also an.
In diese schwere Woche flog ein Telegramm: «Stuck in Tirol with sister and brother-in-law. Any time to come and brighten the mood?»
In mittelschwerer Verstimmung kann das Angebot, andere zu erheitern, sehr verführerisch sein; so packte ich mein Bündel und floh nach Tirol. Auf einen Platz für Camper in einer durchweg schattigen Schlucht, an einem eiskalten Rinnsal, umgeben von unbegehbaren, so steinigen wie steilen Bergen, inmitten holländischer Urlauber (Johns Schwester hatte einen Niederländer geheiratet), die sich Tomaten, Bier und Käse aus der Heimat mitgebracht hatten und die Tage Canasta spielend auf gestreiften Campingstühlen verbrachten, die Abende vor dem Transistorradio mit Schlagern aus der Heimat: Es war ein Elend, das uns zunächst nicht anfocht, weil nichts von uns sich darin spiegelte. Wir fuhren mit dem kleinen, abgerockten Auto, das den niederländischen Wohnwagen brav in den Beinahe-Süden gezogen hatte, zu den Burgen und Klöstern in der Umgebung, auf der Flucht zu Steinen, die von anderen Zeiten erzählten, und zu Touristen mit einem Baedeker in der Hand; jeder Gymnasiallehrer für Latein, selbst mit Backenbart, gab mir den Glauben an die Menschheit zurück. Und John war ein Kamerad. Ein zauberhafter, aufs Selbstverständlichste ritterlicher Kamerad. Mit dem ich, weil die Logistik es gebot, in einem Doppelbett, vom ewig plätschernden Rinnsal nur durch eine dünne, nach Holzöl stinkende Fichtenwand getrennt, die schlagschwarzen Nächte verbrachte, gegen die Gefängnisschwermut anredend, die uns bereits am zweiten Tag erfasste: Dies alles hatte nichts mit uns zu tun, schon klar, aber wir waren nun mal drin, wie Mäuse auf dem blanken Grund eines tiefen, verschmutzten Eimers. Erzählten uns uns, was umso interessanter war, als es keinerlei Überlappungen gab außer dem allgemein westlichen Lebensgefühl, das seit den fünfziger Jahren für etwa weitere fünfzig Jahre in der Suggestion bestand, für alle würde das Leben immer leichter, süßer und fettiger werden. Zwei Fehlfarben-Exemplare allerdings, die sich hier trafen: ich, trotz frischer Madeira-Brise im Rücken, eine orientierungsarme Magistra der Philosophie mit Anfälligkeit für Melancholie und Krise. Und er: aus einer kinderreichen Familie, in welcher er, als einziges Exemplar, in der Vietnam-Lotterie verloren hatte. Zum Auswandern war er, obschon Student der Soziologie, nicht politisch genug gewesen; so wurde er ausgeflogen, erst ins Ausbildungscamp und dann in die Hölle und nach achtzehn Monaten wieder zurück nach Chicago; am Weihnachtsabend kam er zu Hause an, ein Zuhause, das kein Zuhause mehr war. Es war nicht zu erklären, was er erlebt hatte, und es war nicht zu vermitteln, wessen er bedürftig war; die Heimat wollte den Schrecken, den sie woanders anrichtete, säuberlich fern von sich halten. Auf der Party, die man zu seiner körperlich heilen Ankunft veranstaltete, teilte sich das Meer der Freunde in jene, die gegen den Krieg waren und also gegen ihn, und jene, die ihn als Patrioten hochleben ließen, das eine so falsch wie das andere, und für seine Qual, die psychische wie die moralische, gab es von keiner Seite Interesse. Er nahm das Studium wieder auf, das ihm evident sinnlos erschien, und er beobachtete, dass es zwei Sorten Veteranen gab: Die einen redeten nie mehr darüber, die anderen über nichts anderes mehr. ‹Ich entschied mich für Variante eins.› Er fühlte sich ganz unbrauchbar geworden für den american way of life und bewarb sich für ein Forschungsjahr bei den Inuit im Polarkreis, weit weg von Softeis und Studentenpartys und Heroin, und bei diesen freundlichen, introvertierten, nach Fischöl riechenden Menschen genas er, soweit es möglich war. Einmal im Monat ein Flugzeug mit Medikamenten und Post, ansonsten wurden faule Zähne, Depressionen und Bauchweh kuriert wie seit Hunderten Jahren üblich. Er brachte den Kindern Englisch bei und lernte von ihnen, was sie ihm beibringen konnten; Jahre später schlug er sich als Bärenführer in Alaska durch, weil er Spuren zu lesen und sich ohne Hilfsmittel zu orientieren verstand; er wusste, wie man in der Wildnis überlebt, nur das in der Gesellschaft, das ging nicht mehr gut.
Hin und wieder erwachte er von seinem eigenen Schreien und ich begriff, dass da nur Berührung half, Reden eben nicht; das war die erste Erfahrung als Paar, bevor wir eines wurden; der Körper macht alles kaputt, wenn er einen Körper kaputt macht, und er macht wieder heil, was noch zu heilen ist, und sei es nur für Sekunden.
So war das mit uns, als ich nach Hause fuhr. Er brachte mich zum Zug in die übernächste Stadt und hielt, auch ohne Vietnam, meine Hand in der seinen, fest und muskulös; die Hand inzwischen eines carpenters, der die Holzhäuser in Anchorage mit frischer Farbe und Sommerveranden ausstattete, zufrieden mit dem pragmatisch-freundlichen Kontakt, der sich aus solcherart vorübergehenden Verhältnissen ergab; ein freier, beinahe schwereloser Mann.
Zu Hause, das kein Zuhause mehr war, stülpte sich mir der Eimer um, über den Kopf und das ganze Leben, das lichtlos geworden war, ohne einen Sehschlitz in die erdachte Zukunft, den über Jahre selbstverständlichen Horizont: Promotion, na klar, und irgendwie weiter mit Freundschaft, Liebe, Denken & Schreiben, weit weg von der öden Jugend. Stattdessen: ging scheinbar jeder seiner Wege mit Ziel. Aus den Freundesphilosophen wurden Malerin und Medizinstudent, Volontäre und Musiker; alle schwirrten aus unter die Zirkuskuppel, ich blieb ratlos unterm Eimer. Nur eine Gewissheit: nicht zurück; wohin denn auch?
Ich löste die Wohnung auf; ich war die Letzte. Nahm jede Tontasse in die Hand, schrubbte die riesige Badewanne im Flur, die grundsätzlich nur zu zweit zu bespielen und in deren Mitte ein Brett installiert war, für Tee und Aschenbecher, das ich nicht abbauen konnte. Trug blaue Säcke hin und her, riesig und ohne Befüllung nach Erdöl stinkend, sammelte auf, was nach vielen Jahren WG