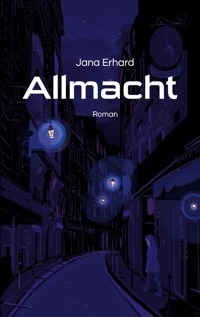
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Der Mensch herrschte über die Erde - bis die Nalise kamen. Sie sind intelligenter als wir. Ihre Technik ist fortschrittlicher. Mitleid kennen sie nicht. Seit der Invasion ist alles, was noch zählt, nicht als "Nutzloser" eingestuft und abtransportiert zu werden. Als Rebellen in der Kneipe von Louannes Familie gefasst werden, muss sie eine folgenschwere Entscheidung treffen, um ihre Familie zu beschützen: Sie meldet sich freiwillig als Soldatin der Nalise. Doch als sie endlich glaubt, in dem neuen Regime ihren Platz gefunden zu haben, verändert eine Begegnung alles.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 443
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Epilog
Prolog
Ungeduldig starrte der Junge zum Zooeingang, während aufgeregtes Stimmengewirr die Luft erfüllte. Er war auf eine Mauer geklettert, um besser über die Wartenden hinwegsehen zu können. Obwohl man die neue Tierart schon lange bestaunen konnte, wurde die Zahl der Besucher nicht weniger. Ganz im Gegenteil: Die Leute schienen sich gar nicht daran sattsehen zu können.
In seiner Schule wurde über nichts anderes mehr geredet als über die Bestie. Immer neue wilde Erzählungen und Spekulationen machten die Runde und man wusste nie ganz, wem man glauben konnte und wer einfach zu viel Fantasie besaß. Nach jedem Bericht seiner Freunde sehnte er sich mehr danach, sich selbst davon überzeugen zu können. Und jetzt war es endlich so weit, er würde der Kreatur gegenüberstehen – wenn der Zoo denn mal öffnen würde. Nervös ging er auf der Mauer auf und ab, ohne das noch fest verschlossene, gusseiserne Tor aus den Augen zu lassen.
»Wer ist eigentlich auf die bescheuerte Idee gekommen, sich hier den ganzen Tag die Beine in den Bauch zu stehen?«, hörte er seinen großen Bruder genervt dessen Freundin fragen.
Darauf erwiderte sie leise, aber nicht leise genug, dass der Junge es nicht trotzdem hören konnte: »Du hast versprochen, zusammen mit ihm herzukommen und ich kann mir dieses Gequengel wirklich keinen Tag länger anhören. Also bringen wir es einfach hinter uns.«
Haha. Sehr witzig. Als ob sie selbst nicht auch neugierig war. Er rollte mit den Augen.
Nach einer gefühlten Ewigkeit wurde das Eingangstor geöffnet und es kam Bewegung in die Menge. Aufgeregt sprang er von seinem Aussichtspunkt herunter und lief zu seinem Bruder. Dieser war gerade im Begriff seine Freundin zu küssen, doch er hielt ihn mit einem leichten Boxen gegen seinen Arm davon ab.
»Kommt ihr endlich?«, fragte er genervt, da die beiden mal wieder nichts mitbekommen hatten.
»Klar«, antwortete die Frau mit einem aufgesetzten Lächeln und löste sich aus der Umarmung. »Gehen wir.«
Gerade als er loslaufen wollte, spürte er einen Ruck an seinem Kragen. »Zivilisierte Leute rennen nicht durch die Gegend, also benimm dich!«, herrschte ihn sein Bruder plötzlich an, der bis eben noch gegrinst hatte. Er hielt ihn noch einen Moment lang fest, bis der Junge widerwillig nickte.
In quälend langsamem Tempo schlenderten sie durch den Zoo. Wenigstens ließen sie die anderen Käfige links liegen und gingen auf direktem Weg zu dem neuen Gehege. Nun würde er endlich der Bestie in die Augen sehen können.
Automatisch wurden seine Schritte schneller. Er konnte schon die Metallstäbe sehen, vor denen sich eine Traube gebildet hatte. Er hörte Lachen und begeisterte Rufe; bestimmt die halbe Stadt war hier.
Er warf einen kurzen Seitenblick zu seinem Bruder, der gerade im Gespräch mit seiner Freundin vertieft zu sein schien. Perfekt. Er nutzte die Gelegenheit und rannte los, drängelte sich an den Familien und Paaren vorbei. Die genervten Rufe, mit denen sein Verhalten quittiert wurde, nahm er dabei kaum wahr. Er hatte nur ein Ziel. Schließlich blieb er vor den dicken Gitterstäben stehen. Mit leuchtenden Augen betrachtete er das Wesen, das von einer Ecke des Käfigs zur anderen tigerte. Es lief auf zwei Beinen und hatte nur an manchen Stellen des Körpers helles Fell; besonders sein Kopf war voll davon. Der Junge kicherte, als er sah, dass dem Wesen sogar aus der Nase kurze Haare wuchsen. Auch an den Beinen stand ein heller Flaum unordentlich ab. Am Bauch hingegen war die schmutzige bleiche Haut völlig kahl.
Mit einem gruseligen Quietschen ließ das Tier seine Krallen über die Wand fahren und dem Jungen fuhr ein Schauer über den Rücken. Begierig folgten seine Augen dem Wesen, das an der Wand entlangging, begleitet von dem fürchterlichen Geräusch. Dann blieb es plötzlich stehen, drehte den Besuchern den Rücken zu und schlug unvermittelt den Kopf gegen die Wand. Wieder und wieder tat es das und der Junge ärgerte sich, dass es nicht etwas Spannenderes machte.
Da drehte sich das Tier um und er konnte Blut sehen, das über sein Gesicht strömte. Es war dunkelrot und lief in einer faszinierenden Geschwindigkeit über Hals und Körper. Als er die leeren Augen sah, mit denen die Kreatur in die Menge starrte, machte sich ein Grinsen auf dem Gesicht des Jungen breit und er fing an, schallend zu lachen.
Menschen gefielen ihm.
»Guten Abend. Hier spricht ein Vertreter Ihrer neuen Regierung. Wir möchten Sie darüber in Kenntnis setzen, dass sich Ihr Leben auf diesem Planeten von diesem Augenblick an von Grund auf ändern wird. Doch vergessen Sie eines nicht: Widerstand ist zwecklos. Über kooperationsbereite Erdlinge freuen wir uns. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.«
Kapitel 1
Nach dieser Meldung rief die brasilianische Regierung als einzige offen zum Widerstand auf. Doch bevor irgendwer zur Waffe greifen konnte, hatten die Nalise bereits ganz Südamerika dem Erdboden gleichgemacht. Die grausamen Bilder von einstürzenden Häusern und verkohlten Leichen schienen dem Rest der Welt keine andere Möglichkeit zu lassen, als sich zu unterwerfen. Binnen fünf Stunden hatten die Außerirdischen die Herrschaft über die Erde restlos übernommen.
Ich wurde von dem Bimmeln und Klirren des Windspiels aus meinen Gedanken gerissen, als ein voluminöser Pelzmantel mit Frau unsere Kneipe betrat. Hinter ihr kämpfte ein untersetzter Mann mit seinem Regenschirm. Erst versuchte er ihn zuzumachen und als das nicht funktionierte, wand er ihn umständlich durch die Tür, um ihn dann aufgespannt neben der Garderobe zu drapieren. »Kann ich Ihnen die Jacken abnehmen?«, fragte meine Mutter, die eilig zu den beiden gelaufen war.
»Gucci-Brillen – hätte nie gedacht, dass sich unsere Gäste mal so verändern würden«, murmelte mein Vater. Er stand hinter der Theke und zapfte dem wohl einzigen unserer Stammgäste, der uns noch geblieben war, ein Bier. Obwohl das mittlerweile kaum noch bestellt wurde, sondern stattdessen Rotwein und Häppchen am besten weggingen, war er nicht hinter der Theke wegzubekommen. Die paar Male, die wir es schafften, ihn dazu zu überreden, »diesen hochtrabenden Blödsinn« – wie er es nannte – zu servieren, hatte er dabei eine derart finstere Miene verzogen, dass wir ihn lieber weiter dort stehen und ab und zu ein Bier zapfen ließen und ihn ansonsten von den Gästen fernhielten.
Vor Jahren hatte meine Mutter einen schöpferischen Anfall gehabt, in dem sie unbedingt die Kneipe »ganz neu und ganz modern« gestalten wollte. Daraufhin hatte sie meinen Vater dazu gezwungen, im gesamten Bereich hinter der Theke bunte Fliesen zu verlegen. Wir anderen hatten die Idee scheußlich gefunden, aber sie war so begeistert davon gewesen, dass wir sie nicht aufhalten wollten. Jetzt stand mein Vater also grummelig vor pastellrosa, türkisen und weißen Fliesen und gab vor dem Kalender mit »lebensbejahenden Sprüchen« (wie meine Mutter es nannte) ein ziemlich komisches Bild ab.
Der Stammgast saß neben mir auf einem Barhocker und seufzte schwer: »Auf nichts kann man sich in diesen Tagen noch verlassen.« Er warf einen traurigen Blick zu der Dartscheibe, wie er es an dieser Stelle immer tat, und nahm einen großen Schluck des Biers, das mein Vater ihm wehmütig nickend hinstellte.
»Weißt du, was mit den anderen aus dem Dartclub passiert ist?«, fragte ich, bereute es jedoch sofort.
»Na was wohl«, brummte mein Vater, und die beiden Herren verfielen wieder in Schweigen.
Ich beschloss, dass sich dringend jemand um die Gäste kümmern sollte und rutschte von meinem Hocker. Ich ging an den Tischen vorbei, an denen überwiegend Menschen mit schicken Anzügen und kleinen Handtaschen saßen, zu den zwei Neuankömmlingen. Früher hätte niemand wie sie freiwillig unsere muffige Kneipe betreten, doch mittlerweile waren wir die Einzigen weit und breit, die noch geöffnet hatten. Und die Stammgäste kamen nicht mehr, weil sie Angst hatten. Niemand konnte noch wissen, ob er seinen Job am nächsten Tag verlieren würde, oder sogar sein Zuhause, sein Leben. Ausgehen war zum Statussymbol geworden. Nur wer in irgendeiner Weise mit den Nalise zusammenarbeitete, konnte sich sicher genug dafür fühlen.
»Was kann ich Ihnen zu trinken bringen?«
Die Frau, die ihren Pelz mittlerweile abgelegt hatte und ohne ihn irritierend dünn war, versicherte sich mit einem kurzen Blick bei ihrem Mann und sagte dann: »Weißweinschorle, für uns beide.«
»Gerne«, erwiderte ich und trat den Rückzug in die Küche an, während die beiden ihr angeregtes Gespräch über die Aktienkurse fortführten.
»Wir sollten dringend in Waffenfirmen investieren – das ist der Markt der Zukunft«, machte ich die näselnde Stimme des Mannes nach und brachte meinen Bruder damit zum Lachen.
»Dass ich daran nicht früher gedacht habe«, antwortete Emanuel und wendete schmunzelnd ein Steak in der Pfanne.
Er war ein Jahr älter als ich und schmiss mit einem unglaublichen Talent die Küche. Unterstützt wurde er dabei von unserer Mutter, die gerade mit liebevoller Präzision Salat auf einem Teller drapierte. Gleich würde sie damit zu den Gästen rauschen, mit ihnen schäkern und weitere Bestellungen aufnehmen. Sie hatte für das was sie tat eine Energie wie kaum ein anderer, war überall gleichzeitig und trotzdem nie erschöpft.
Ich goss zwei Weißweinschorlen ein, stellte sie auf ein Tablett und brachte sie zu dem skurrilen Paar, darauf konzentriert nichts zu verschütten. Mittlerweile sprachen die beiden über die Aerodynamik von Langstreckenraketen oder sowas. Was auch immer genau Aerodynamik sein sollte.
Ich ließ meinen Blick über die Gäste schweifen, um zu sehen, ob jemand noch etwas bestellen wollte oder ich irgendwo abräumen konnte. Dabei fielen mir zwei Männer auf, die etwas abseits von den anderen über einen Tisch gebeugt saßen. Sie waren bei weitem nicht so teuer gekleidet, gehörten jedoch auch nicht zu unseren Stammkunden. Der eine sah mit seiner schmuddeligen Jeansjacke und dem Dreitagebart so aus, als wäre er in seinem früheren Leben mal ein Frauenheld gewesen, hätte nach der Invasion aber beschlossen, dass Körperpflege eigentlich überbewertet wurde. Er schien auf den Glatzkopf einzureden, der immer wieder wachsame Blicke über seine Schulter warf. Das gefiel mir ganz und gar nicht.
Ich wollte gerade zu ihnen gehen, da räusperte sich jemand neben mir. Ich drehte mich zu dem kahlköpfigen älteren Herrn um, der schon seit Stunden mit seiner jungen Begleitung hier saß und einen Gang nach dem anderen bestellte.
»Ich habe gehört, Sie seien eine außergewöhnlich talentierte Klavierspielerin«, sagte er und sein von tiefen Falten durchzogenes Gesicht verzog sich zu einem Lächeln.
»Bis vor einem halben Jahr habe ich in Paris Musik studiert«, erwiderte ich und lächelte verkrampft, weil ich nicht ganz mit dem Kompliment umzugehen wusste. Ich wollte das Gespräch auf eine höfliche Art schnell beenden, denn ein weiterer kurzer Blick zu dem anderen Tisch verstärkte meine Befürchtungen. Die beiden hatten doch irgendetwas vor.
»Oh wie schön«, sagte er mit leuchtenden Augen. »Wissen Sie, ich war früher Dirigent, bis ich dann pensioniert wurde. Das war eine verrückte Zeit... Bei einer Aufführung in Prag, da waren die Journalisten ja völlig – einen kannte ich ja noch aus meiner Studienzeit...«
Ich sah ihn weiterhin an und nickte an Stellen, an denen ich glaubte, dass es passend war, doch es war mir schlichtweg nicht möglich, ihm zuzuhören. Zu viele Bilder rasten durch meinen Kopf, was passieren würde, wenn es sich bei den Männern wirklich um Rebellen handelte und sie in unserer Kneipe entdeckt wurden.
Ich wischte mir meine schwitzigen Hände an meiner Jeans ab. Seit ein paar Sekunden sahen mich der Mann und seine Begleitung nun schon erwartungsvoll an und mir fiel auf, dass sie mich wohl irgendetwas gefragt haben mussten. »Bitte was?«, fragte ich unschuldig lächelnd, überspielend, dass ich nichts mitbekommen hatte.
»Ob Sie uns mal etwas vortragen könnten«, wiederholte er freundlich. »Chopin zum Beispiel.«
Mit Blick auf all das Essen, das sie bereits bestellt hatten und in Gedanken daran, dass wir momentan jeden Cent gebrauchen konnten, blieb mir wohl nichts anderes übrig.
»Gerne«, sagte ich also, und ging zu dem Flügel, den wir in der Mitte des Raumes aufgestellt hatten.
Vor ein paar Monaten hatte ich das Musikstudium abgebrochen, denn seit der Übernahme der Erde war Kunst noch brotloser geworden als schon zuvor. Es zählte nur noch, irgendwie Essen nach Hause zu schaffen und von den Nalise nicht als »Nutzloser« eingestuft zu werden. Ich nickte dem Paar mit dem Musikwunsch zu, dann begann ich zu spielen.
Nach kurzer Zeit war es, als wäre ich völlig abgetrennt, eins mit der Musik, die einfach so aus meinen Fingern floss. Ich war völlig versunken in der Melodie, merkte noch nicht einmal, wie die Gäste neugierig ihre Köpfe zu mir wandten – bis ich fast unbewusst etwas hörte das so klang wie endlich zurückschlagen. Ich sah in die Richtung des Gesprächfetzens, zu den beiden Männern, die mir eben schon aufgefallen waren. Der eine schob dem anderen gerade etwas über den Tisch zu. War das eine Pistole? Ich verspielte mich kurz vor Schreck, fing mich dann aber wieder und konzentrierte mich, das Lied zu Ende zu spielen. Mein Herz raste. Die beiden Männer waren offensichtlich Rebellen, sonst wären sie nicht bewaffnet. Wie konnten sie es wagen, meine Familie in Gefahr zu bringen?!
Ich schaffte es, das Stück einigermaßen unfallfrei über die Bühne zu bringen. Unter dem Klatschen der Gäste eilte ich in die Küche. Emanuel und unsere Mutter waren zum Glück zu beschäftigt, um zu bemerken, wie beunruhigt ich war.
Ich schenkte Wein in zwei Gläser ein und stellte sie auf ein Tablett. Ich wollte nicht scheinbar grundlos zu dem Tisch gehen, das würde zu viel Aufmerksamkeit erregen.
Unter den lobenden Kommentaren der Gäste, die ich mit einem freundlichen Nicken abtat, ging ich zu den beiden Männern. Mit vor Aufregung leicht zitternden Händen stellte ich die Gläser vor ihnen ab. Leise und mit einem aufgesetzten Lächeln sagte ich: »Ich möchte, dass Sie jetzt gehen. Wir können keinen Arger gebrauchen.«
»Das ist ein Missverständnis«, erwiderte der Glatzköpfige und hob beschwichtigend die Hände. »Wir wollen hier nur in Ruhe etwas essen und uns unterhalten. Also kein Grund, überzureagieren.«
»Bitte gehen Sie jetzt«, wiederholte ich.
»Aber wir –«
Ein Knall ließ mich herumfahren. Jemand hatte die Eingangstür mit einer ungeheuren Wucht gegen die Wand geschlagen und dabei das Windspiel von der Decke gerissen. Nicht irgendjemand. Eine Nalice.
Sie betrat die Kneipe wie eine Jägerin, die sich ihre nächste Beute aussucht. Wie alle Nalise hatte sie zwar die Gestalt eines Menschen angenommen, war aber von einem leichten Flimmern umgeben. Es war, als wären die Konturen der Nalise nicht ganz scharf – als würde das flirrende, nebulöse Licht auf ihrer Haut sie verwischen.
Im ganzen Raum herrschte schlagartig Totenstille. Ich konnte den Angstschweiß von dutzenden Menschen riechen, die allesamt angestrengt versuchten, möglichst unauffällig zu sein. Die Nalise waren bekannt dafür, dass sie grundlos Leute töteten, einfach weil ihnen gerade danach war.
Ich warf einen kurzen Blick zu meinem Vater, der wie versteinert hinter dem Tresen stand. Er umklammerte ein Bierglas, als würde er sich nicht trauen, beim Abstellen ein Geräusch zu verursachen. Emanuel stand neben ihm, vor der Tür zur Küche. Er schien wegen des Lärms herbeigeeilt zu sein. Warum musst du nur immer so verdammt hilfsbereit sein? Warum bist du nicht einfach dortgeblieben und hast dich versteckt?, verfluchte ich ihn still. Da entdeckte ich meine Mutter, die hinter ihm stand und so aussah als könne sie nicht fassen, was sich da vor ihren Augen abspielte.
Die Nalice genoss sichtlich die Atmosphäre der Angst, die sie verbreitete. Ihr eiskalter Blick glitt bedächtig über die Menge, dabei strich sie mit der Hand über die Pistole, die an ihrem Gürtel hing. Als ihr Blick meinem begegnete, fing sie an zu grinsen. Mir rutschte das Herz in die Hose.
»Aaah, dich habe ich gesucht«, sagte sie, während sie langsam und mit funkelnden Augen auf mich zuschlich und ihre Waffe zückte.
Im Augenwinkel konnte ich sehen, wie meine Mutter einen Schritt auf uns zumachte, aber von Emanuel aufgehalten wurde. Ich war wie erstarrt vor Angst. Ich wollte mich erinnern, was ich aus ihrer Sicht verbrochen haben könnte, doch mein Gehirn weigerte sich, auch nur zu einem Gedanken anzusetzen.
Als sie näherkam, zog sich ihre Stirn in Falten. »Aus dem Weg, Mensch«, knurrte sie mich an.
Benommen wich ich zur Seite und konnte nun sehen, dass es in Wahrheit der Jeansjackentyp war, den sie gemeint hatte.
»Glaubst wohl, du könntest den Helden spielen und die Erde vor uns widerwärtigen Kreaturen retten – oder wie hast du uns noch gleich im Telefonat mit deiner hübschen kleinen Freundin genannt?« Lächelnd setzte sie ihm ihre Pistole auf die Brust.
»Was habt ihr mit ihr gemacht?«, fragte der Mann kreidebleich.
»Na ja, sagen wir mal so... Atria, du kannst jetzt reinkommen.«
Eine weitere Nalice trat in die Kneipe, triumphierend grinsend als wäre sie der Stargast des Abends. Sie schien draußen im Dunkeln auf ihren Einsatz gewartet zu haben. Und der schien zu sitzen. »Nein«, hörte ich den Mann neben mir verzweifelt flüstern.
Nalise nahmen die Gestalt der Person an, die sie zuletzt ermordet hatten.
»Töte mich«, sagte der Mann mit gefasster Stimme. »Bringen wir es hinter uns und lassen die Herrschaften weiter ihren Wein saufen und alles ignorieren, was um sie herum passiert.« Er warf einen vernichtenden Blick in die Runde.
»Neiiiin«, sagte die Nalice langgezogen und wirkte dabei wie ein kleines Kind, das überlegt, was es als nächstes spielen will. »Ich glaube, ...« Ein Schuss. Der Glatzkopf sank leblos in sich zusammen, »...das wäre zu einfach. Du hast uns verärgert, viel zu sehr als dass eine einzige Kugel da ausreichen würde. Ich nehme dich mit, für meine Sammlung.« Ein breites Grinsen zog sich wie eine Fratze über ihr Gesicht.
Sie zerrte ihn vom Stuhl, Richtung Tür. Doch dann hielt sie plötzlich inne. »Atria, was machen wir denn mit dem Wirt, der ein solches Dreckspack bedient?«
»Wem gehört der Laden?«, fragte diese und ließ ihren kalten Blick durch den Raum schweifen.
Die Stille war zum Schneiden dick. Ihr Blick blieb an meinem Vater hängen. Immer noch stand er hinter der Theke, mit einem über die Schulter geworfenen Handtuch. Immer noch hielt er das Glas in der Hand.
Ein Schuss. Klirren. Mein Vater sackte in sich zusammen, während Emanuel auf ihn zuschnellte, um ihn aufzufangen.
»Problem gelöst«, sagte Atria, die nun aussah wie eine abscheulich verzerrte Version meines Vaters, und verließ mit der anderen Nalice und dem Mann die Kneipe. Uns ließ sie in einem Scherbenhaufen zurück.
Kapitel 2
Wir kauerten weinend neben meinem Vater am Boden, während die Gäste schweigend und verstört die Kneipe verließen. Emanuel hatte einen Arm um unsere Mutter gelegt, die völlig aufgelöst in ihr Taschentuch schniefte und dabei immer wieder etwas Unverständliches vor sich hinmurmelte. Ich hielt die Hand meines Vaters und konnte nicht aufhören, auf seine Schusswunde zu starren.
Dann sprach Emanuel das Offensichtliche aus: »Wir sind im Arsch.«
Niemand bot ungestraft Rebellen seine Gastfreundschaft an. Dass sie unseren Vater getötet hatten, war erst der Anfang gewesen. Sie würden uns vernichten.
»Die Kneipe können wir nicht mehr öffnen«, murmelte ich.
Von nun an hatten wir eine Zielscheibe auf unsere Stirn gemalt. Wir durften in keinster Weise auffallen, wieder zu öffnen wäre eine Provokation. Es wurden schon ganze Siedlungen wegen so etwas abgebrannt. Abgesehen davon würde sich vermutlich sowieso keine einzige Menschenseele mehr hierher trauen.
»Er verdient eine angemessene Bestattung«, flüsterte meine Mutter unter Tränen.
»Mama, die Ausgangssperre fängt in einer halben Stunde an. Das schaffen wir nicht mehr«, sagte Emanuel.
»Aber wir können ihn doch nicht einfach hier liegenlassen!«
»Was, wenn sie zurückkommen?«
»Dann müssen wir ihn verbrennen. Ich will nicht, dass sie ihn hier finden und sonst was mit ihm machen.«
Ich starrte auf meinen Vater, auf eine graue Locke, die ihm ins Gesicht fiel; auf seine muskulösen Arme, mit denen er mich als Kind immer in die Luft geworfen hatte. Ich hatte nicht aufhören können zu lachen, wenn er das tat. Oder wenn er Emanuel und mich durch die Wohnung jagte. Wir waren immer kreischend vor ihm weggerannt, bis er uns von hinten packte und auskitzelte, bis wir vor Lachen keine Luft mehr bekamen.
Mamas Schluchzen riss mich aus meinen traurigen Gedanken. Ich sah zu ihr. Sie klammerte sich an Emanuel, den Kopf in seiner Brust vergraben und mit verzweifelt bebendem Körper.
Mit zittrigen Beinen stand ich auf. In einer Schublade kramte ich nach einer Schachtel Streichhölzern und hoffte inständig, dass Fliesen nicht brennen konnten.
»Lass uns gehen«, sagte Emanuel, der merkte was ich vorhatte, und schob unsere Mutter behutsam nach draußen.
Ich nahm eine Flasche hochprozentigen Alkohol aus dem Regal hinter der Theke und drehte mit zitternden Fingern den Verschluss auf. Ich goss den Inhalt über meinen Vater und hoffte, dass er mir verzeihen konnte. Dann trat ich einen Schritt zurück und entzündete ein Streichholz, ließ es auf den toten Körper fallen, während sich mein Magen zusammenzog. Als die Flammen begannen, sich in die Schürze zu fressen, wandte ich mich ab und folgte den beiden nach draußen. Ich warf einen letzten Blick auf das kaputte Windspiel, dann schaute ich nicht mehr zurück.
Wir gingen schweigend durch die von Laternen beleuchteten Straßen. Jeder hing seinen eigenen Gedanken und Erinnerungen nach. Ich ließ meinen Blick über die Häuserfronten schweifen. Nur in wenigen Fenstern brannte noch Licht, die meisten hatten ihre Vorhänge zugezogen. Wir kamen an einer eingeschmissenen Schaufensterscheibe vorbei. Was sollte nur aus uns werden?
Eine Patrouille der Nalise kam uns entgegen und wir wechselten schnell die Straßenseite. Angestrengt schauten wir auf den Boden, während sich unsere Schritte beschleunigten.
»In zehn Minuten beginnt die Ausgangssperre!«, brüllte einer der Soldaten zu uns herüber. Wenn sie uns jetzt anhalten, wird unsere Mutter zusammenbrechen, dachte ich. Erst als wir um die nächste Ecke gebogen waren, wagte ich es wieder zu atmen.
Als wir hastig eine Kreuzung überquerten, fiel mein Blick auf eine elektronische Werbetafel. Darauf war ein Mensch zu sehen, der neben einem heroisch in die Luft sehenden Nalice kniete. Das Flimmern, dass die Aliens sonst nur leicht umspielte, war hier übertrieben dargestellt. Es strahlte über das ganze Bild und ließ den Nalice damit fast gottgleich aussehen. Komm auf die Seite der Sieger. Melde dich freiwillig für die Armee, prangte in großen, goldenen Lettern über ihm. Das Bild sah wirklich lächerlich aus, trotzdem konnte ich meinen Blick nicht davon abwenden.
Wir erreichten unsere Wohnung fünf Minuten bevor die Ausgangssperre begann. Obwohl es harte Strafen gab, wenn man sich danach noch draußen aufhielt, waren wir alle zu betäubt gewesen, um uns zu beeilen. Wir streiften Schuhe und Jacke ab und da keiner von uns so recht wusste wohin mit sich, setzten wir uns nebeneinander auf die Couch.
Unsere Mutter weinte noch immer, das Gesicht in der Brust meines Bruders vergraben. Er drückte sie fest an sich und sprach beruhigend auf sie ein. Hilflos saß ich daneben und reichte ihr ab und zu ein Taschentuch.
Als sie sich irgendwann einigermaßen beruhigt hatte, löste sich Emanuel sanft aus der Umarmung. »Ich mach Tee für uns alle«, sagte er mehr zu sich selbst und sah dabei hundeelend aus. Er verschwand in der Küche und ich vermutete, dass er kurz Zeit für sich brauchte. Auch er wollte unserer Mutter nicht noch mehr Sorgen bereiten.
»Du musst jetzt stark sein«, sagte meine Mutter auf einmal absurderweise zu mir, und legte mir eine Hand auf das Bein, obwohl sie diejenige war, die pausenlos weinte. Ich nickte, um ihr einen Gefallen zu tun.
Wir schwiegen wieder. Ich sah aus dem Fenster in den aufkommenden Nachthimmel und fühlte eine unendliche Leere in mir. Irgendwann überwand ich mich und sprach den Entschluss aus, den ich schon auf unserem Heimweg gefasst hatte: »Ich werde mich für die Armee melden.« Ich starrte dabei auf meine Finger, um ihren Blick nicht sehen zu müssen.
»Nein!«, rief sie und die unerwartete Lautstärke ließ mich zusammenzucken.
»Es ist die einzige Möglichkeit«, schob ich nach.
Emanuel eilte mit der Teekanne ins Wohnzimmer. »Was ist los?«
»Deine Schwester will sich umbringen!«
Ich schaute in sein perplexes Gesicht und erklärte: »Ich melde mich freiwillig als Soldatin für die Nalise. In den Werbespots heißt es, dass die Familie dann unter Schutz steht und euch monatlich ein Einkommen überwiesen wird. Wenn wir nichts machen, werden wir in spätestens ein paar Tagen abgeholt, wie alle Nutzlosen.«
»Das lasse ich nicht zu«, sagte unsere Mutter und klammerte ihre Arme um mich. Ich spürte, wie ihre Tränen meinen Pullover durchtränkten. Unbeholfen tätschelte ich ihr den Rücken.
Emanuel stellte die Teekanne auf den Couchtisch und schaute unentschlossen zwischen der Kanne und uns hin und her. Er sah leichenblass aus.
»Es fehlen noch Tassen«, murmelte ich, weil ich nicht wusste, was ich sonst sagen sollte.
Er nickte und nahm welche aus dem Vitrinenschrank. Er schenkte uns allen ein und zum Glück löste sich unsere Mutter von mir, um ihre Tasse entgegenzunehmen.
Ich starrte in die rote Flüssigkeit, erleichtert, nicht reden zu müssen. Dafür musste ich mir Emanuels Bedenken anhören: »Es muss auch noch einen anderen Weg geben als diesen Wahnsinn.«
»Welchen denn?«, fragte ich trotzig.
»Na ja, wir suchen uns einfach einen anderen Job«, druckste er herum. »Zum Beispiel beim Supermarkt, da sind doch welche freigeworden.«
»Weil die letzten Angestellten verschwinden sind. Außerdem wird uns niemand einstellen; ab morgen weiß jeder, was passiert ist.«
»Louanne«, meldete sich unsere Mutter mit sanfter Stimme zu Wort. »Niemand weiß, ob die Nalise ihr Versprechen, die Familie zu schützen, wirklich einhalten.«
»Genau, es ist also vielleicht sogar völlig nutzlos, sich freiwillig zu melden«, schlussfolgerte Emanuel. Ich wusste, dass er es gut meinte, aber trotzdem ging er mir damit auf die Nerven.
»Was sollen wir denn sonst tun?«, fragte ich ihn provozierend.
Er wollte gerade zu einer Antwort ansetzen, da ertönten draußen Schüsse.
Emanuel war als erster am Fenster und zog die Vorhänge beiseite. Ich drängte mich hinter ihn und schob ihn ein Stück zur Seite, um auch etwas sehen zu können.
Ein Mann rannte die nebelige Straße entlang in unsere Richtung und versuchte dem tödlichen Geschoss mehrerer Aliens zu entkommen, die ihn verfolgten. Was hatte ihn so dumm sein lassen, nach der Ausgangssperre das Haus zu verlassen?
»Gnade! Gnade!«, schrie er verzweifelt. Durch die Fensterscheiben war es nur dumpf zu hören, trotzdem ließ es mir das Blut in den Adern gefrieren. So sehr ich es auch wollte, ich schaffte es nicht, meinen Blick von dem Mann zu lösen.
Ich konnte nicht genau sehen, wo die Kugel ihn traf. Er stürzte zu Boden und blieb reglos liegen, während sich eine dreckige, dunkle Blutlache um ihn herum bildete.
Einer der Aliens trat neben ihn und leuchtete ihm mit der Taschenlampe ins Gesicht. Dann drehte er sich zu den anderen um und sagte etwas zu ihnen, das ich hier oben aber nicht verstehen konnte. Sie drehten sich daraufhin um und liefen auf unser Mehrfamilienhaus zu.
Erst als sie die Haustür erreichten, löste sich meine Starre und ich fuhr panisch herum. In Emanuels Augen sah ich, dass er das Gleiche dachte wie ich: Wir mussten die Tür verriegeln. Daran, dass es vermutlich sinnlos war, weil sich die Nalise überall Zutritt verschaffen konnten, wenn sie es wollten, verschwendeten wir keinen Gedanken.
Wir stürmten in den Flur.
»Scheiße, wo ist der Schlüssel?«, schrie ich, und mit hektischen Bewegungen suchten wir den Raum nach ihm ab. Die Zeit lief uns davon.
»Ich hab ihn«, rief Emanuel und zog ihn aus einer Jackentasche.
Er stürmte zur Tür, doch seine Finger zitterten so sehr, dass er immer wieder neben das Schloss stach.
»Beeil dich!«, schrie ich ihn an.
»Ich versuch's ja!« Endlich traf er und drehte den Schlüssel so schnell er konnte um.
Währenddessen bemühte ich mich, unseren schweren Garderobenschrank in Richtung Tür zu schieben. Meine Mutter war herbeigeeilt und stemmte sich ebenfalls dagegen. Viel zu langsam bewegte er sich, Zentimeter für Zentimeter. Und Emanuel versperrte immer noch den Weg.
Man konnte schon die näherkommenden Schritte auf der Treppe hören.
Nach schier endlosen Sekunden war er endlich fertig und sprang zu uns, um uns zu helfen. Gemeinsam wuchteten wir den Schrank vor die Tür.
Im Treppenhaus ertönte ein Rufen: »Sie muss oben sein!«
Wir wichen zurück in den Flur und umklammerten uns unwillkürlich. Unsere Mutter in der Mitte, die mir fast die Hand zerquetschte.
Die Schritte kamen immer näher, mein Herz hämmerte gegen meinen Brustkorb. Jetzt waren sie auf unserer Etage. Vor unserer Tür.
Ich konnte es erst gar nicht glauben, als ich hörte, wie die Schritte wieder leiser wurden. Doch tatsächlich: Die Soldaten liefen an unserer Wohnung vorbei, weiter in den nächsten Stock.
Ein paar lange Augenblicke später hörte ich, wie ein Stockwerk über uns eine Tür eingetreten wurde. Mit schweren Schritten polterten die Nalise in die Wohnung über uns. Sie liefen direkt über unseren Köpfen.
Durch die Decke hörten wir eine Frau kreischen: »Ihr widerlichen Monster, lasst mich gefälligst los! Nehmt eure dreckigen Pfoten von mir!«
»Das ist Frau Dubois«, sagte Emanuel und schaute mich entsetzt an.
Seit ich mich erinnern konnte, wohnte sie schon in diesem Haus. Jeder in der Nachbarschaft kannte die uralte Frau. Früher hatte sie ab und zu auf uns zwei aufgepasst und uns immer Süßigkeiten geschenkt, wenn wir ihr beim Einkaufen halfen. Was hatte sie nur getan? Und noch wichtiger: Was würden die Aliens mit ihr machen?
Ich versuchte das Mitleid herunterzuschlucken, doch es war wie ein Frosch, der immer wieder nach oben kletterte und einem schlecht werden ließ. Gleichzeitig hatte ich ein furchtbar schlechtes Gewissen, denn ein bisschen erleichtert war ich doch, dass es jemand anderen erwischte als uns.
Auch als die Schritte im Treppenhaus und ihre Schreie schon lange wieder verklungen waren, standen wir noch da und starrten auf das verkratzte Holz des Schranks.
Dann brach mein Bruder das Schweigen. »Lou hat recht; nur wenn die Nalise einen Nutzen in uns sehen, werden sie uns am Leben lassen«, sagte er mit leiser, brüchiger Stimme und wandte sich mir zu. »Du warst schon immer die Mutigere von uns beiden. Aber ich werde mitkommen.«
Kapitel 3
Selbst nach einer schier endlos langen Diskussion wollte Emanuel einfach nicht einsehen, dass es besser für uns alle war, wenn er zuhause bei unserer Mutter blieb und sich um sie kümmerte.
»Ich lasse dich nicht alleine gehen«, sagte er mit verschränkten Armen.
»Du kannst das Mama nicht antun, sie braucht dich.«
»Und wer passt auf dich auf?«, erwiderte er trotzig.
Fast hätte ich verzweifelt aufgelacht. Emanuel würde als Soldat der Nalise keinen Tag überleben. Er verabscheute Gewalt schon immer und die wenigen Male, bei denen ich ihn als Kind doch in eine Rangelei verwickeln konnte, hatte er immer innerhalb kürzester Zeit verloren. Ganz abgesehen davon, dass es unserer Mutter das Herz brechen würde, wenn er ging, wäre er mir höchstens ein Klotz am Bein. Aber das konnte ich ihm natürlich nicht sagen. Also starrten wir uns nur stumm an, mit einer Mischung aus Wut und Sorge um den Anderen. Wer lauter die Tür knallte, konnte ich nicht sagen.
Nach einer Stunde hielt ich es nicht mehr aus und klopfte an seine Zimmertür. Sonst war er immer der Erste, aber heute war es anders.
»Frieden?«, fragte ich, und er nickte traurig lächelnd.
Er saß zusammengesunken an seinem Schreibtisch und ich konnte ihm ansehen, dass er geweint hatte. Ich ging zu ihm hin und er stand auf, damit wir uns umarmen konnten.
»Du kannst nicht gehen«, sagte er leise. »Uns muss etwas anderes einfallen.«
Ich nickte an seiner Schulter und antwortete mit einem Kloß im Hals: »Ja, morgen sehen wir weiter.«
Die ganze Nacht wälzte ich mich hin und her. Jedes Mal, wenn ich einschlief, kamen wieder die Bilder des letzten Tages hoch – mein Vater, der tot auf dem Boden lag.
Auch ohne Wecker wachte ich kurz nach Aufhebung der Ausgangssperre mit den ersten Sonnenstrahlen auf. Ich schlug die Decke zurück und schwang meine Beine aus dem Bett. Dann streifte ich mir schnell Kleidung über und nahm den Reiserucksack, den ich in der Nacht schon gepackt hatte. Auf Zehenspitzen schlich ich an den Zimmertüren meines Bruders und meiner Mutter vorbei und versuchte mein schlechtes Gewissen zu ignorieren.
In der Küche aß ich im Stehen ein Sandwich und trank ein paar Schlucke. Dann kramte ich alle möglichen Müsliriegel aus den Schränken, füllte mehrere Flaschen Wasser auf und verstaute alles im Rucksack.
Mein Blick fiel auf den bunten Notizblock, auf den wir normalerweise unsere Einkaufsliste schrieben. Sollte ich den beiden eine Nachricht hinterlassen? Ich dachte einen Moment nach, aber mir fiel wirklich nichts Besseres ein als Hey ihr, ich bin jetzt weg, obwohl ich versprochen habe zu warten, deshalb ließ ich es lieber bleiben. Ich redete mir ein, dass ich sie sowieso bald wiedersehen würde.
Ich streifte Regenjacke und Sportschuhe über und zog so leise wie ich konnte den Schrank zurück, nur so weit, dass ich die Wohnungstür öffnen konnte. Hoffentlich wurden die anderen davon nicht wach – was sollte ich Mama nur sagen, wenn sie plötzlich hinter mir stand?
Ich schob mich durch den Türspalt und zog behutsam die Tür hinter mir zu.
Als ich die Treppe hinunterlief, war der Nachbar unter uns gerade dabei aus seiner Wohnung zu treten. Er wollte offenbar zur Arbeit, wie jeden Morgen. Als er mich sah, weiteten sich seine Augen und schnell schloss er wieder die Tür.
Es hatte sich also bereits herumgesprochen, dass meine Familie auf der Abschussliste der Nalise stand. Gerüchte machten dieser Tage in einer rasenden Geschwindigkeit die Runde. Der Nachbar würde warten bis ich weg war, ganz egal, dass er ein alter Freund meiner Eltern war. Ich konnte es ihm nicht Übelnehmen, es war nicht gut mit Nutzlosen gesehen zu werden.
Als solche galten alle, die keinen Job hatten, den die Aliens als systemrelevant erachteten. Welche Berufe genau darunter fielen, wusste niemand so ganz genau. Doch ziemlich sicher war die Lebensmittelversorgung darunter, weshalb alle möglichen Menschen versuchten, einen Job auf einem Bauernhof, in einem Supermarkt oder Ähnlichem zu bekommen. Da es jedoch nicht genug Aufgaben für alle gab und niemand das Risiko eingehen wollte, weniger Stunden zu arbeiten, kam es zu Absurditäten wie Supermärkte, in denen Mitarbeiter Ware wieder aus den Regalen holten, damit andere sie wieder einräumen konnten. Manchmal wurde auch noch ein Dritter eingestellt, der zwischen den beiden Schritten die Flächen bemerkenswert penibel abwischte. Natürlich war es riskant, doch es gab immer wieder couragierte Menschen die es schafften, den Nalise bei Kontrollen glaubhaft zu versichern, dass dieses Vorgehen seinen Sinn hatte.
Auch in unserer Kneipe war ein halbes Dutzend Menschen angestellt gewesen, die putzten, Gemüse schnibbelten und andere kleinere Arbeiten verrichteten. Es war ihnen egal, dass wir ihnen nur einen Lohn zahlen konnten, der kaum zum Leben reichte. Das Wichtigste war, dass man einen Arbeitgeber hatte, der vor den Nalise bezeugen konnte, dass man bei ihm angestellt war.
Was wohl aus ihnen werden würde? Sie hatten bestimmt schon davon erfahren, dass sie sich eine neue Arbeit suchen, vielleicht sogar untertauchen mussten. Ob sie sich auch freiwillig für die Armee melden würden?
Die Straßen waren um diese Uhrzeit noch leer. Wenn möglich, verließ man nur zum Arbeiten und zum Einkäufen das Haus, denn jede Begegnung mit Nalise war ein Risiko. Nur die, die mit ihnen gute Geschäfte machten und die Gewinner der neuen Ordnung waren, konnten hocherhobenen Hauptes in teuren Autos durch die Stadt fahren. Alle anderen versuchten möglichst unsichtbar zu sein, selbst die Mode war zunehmend gräulicher und bräunlicher. Es war eine trostlose Welt geworden.
Nur vereinzelnd kamen mir Patrouillen entgegen. Erst jetzt wurde mir so richtig bewusst, dass diese zwar überwiegend aus Nalise bestanden, aber auch manche Menschen in Uniformen darunter waren. Ob ich sowas auch würde machen müssen? Leute abknallen, die nach 22 Uhr noch unterwegs waren? Mühsam schob ich den Gedanken beiseite.
Ich überquerte eine Allee und konnte zwischen den Bäumen schon das Polizeipräsidium erahnen, das Hauptquartier der Nalise in dieser Stadt. Das Rathaus oder die Stadthalle wären deutlich repräsentativer gewesen, aber das war ihnen anscheinend nicht wichtig. Sie mussten ihre Macht nicht zur Schau stellen. Sie hatten sie einfach.
Am Empfang saß eine zierliche Menschenfrau. Sie nestelte nervös an ihrer Halskette, als ich näherkam.
»Was kann ich für Sie tun?«, fragte sie mich und räusperte sich.
»Ich möchte mich freiwillig als Soldat melden.«
Mit einem bedauernden Blick sah sie mich an. Dann schaute sie sich zu beiden Seiten um und beugte sich vor.
»Sind Sie sich sicher?«, flüsterte sie, und ich musste mich ebenfalls zu ihr rüber beugen, um etwas zu verstehen.
Na, die machte einem ja Mut.
»Ja, ich möchte, dass meine Familie auf die Liste gesetzt wird, die sie unter Schutz stellt«, sagte ich und versuchte dabei möglichst bestimmt zu klingen, auch wenn ich nicht sicher war, ob ich das jetzt schon sagen musste. Aber besser einmal zu viel, als dass ich den richtigen Moment verpasste.
Sie ließ ihren Blick noch einen Augenblick lang auf mir ruhen, dann nickte sie und stand auf.
»Folgen Sie mir.«
Ich hatte ein ungutes Gefühl, aber keine andere Option. Also lief ich ihr die langen Flure hinterher, bis sie zaghaft an eine Tür klopfte.
»Ja«, hörte ich eine kalte Stimme, die mich frösteln ließ.
Die Dame vom Empfang öffnete die Tür und bedeutete mir hineinzugehen. Mein Brustkorb zog sich zusammen, als die Tür leise wieder hinter mir geschlossen wurde.
Die Nalise saßen um einen Tisch herum und schienen alles andere als erfreut darüber, von mir in ihrem Gespräch unterbrochen worden zu sein. Sechs eisige Augenpaare starrten mich an.
»Was willst du?«, fragte die vor Kopf sitzende Nalice mit einer Autorität, die den ganzen Raum füllte.
Wenn ich jetzt etwas Falsches sage, zerquetscht sie mich wie eine Fliege zwischen ihren pedikürten Fingern, schoss es mir durch den Kopf. Direkt gefolgt von dem Gedanken Aber wenn ich jetzt gar nichts sage, macht sie mich auch platt.
»Ich möchte mich für die Armee melden«, krächzte ich. Ich traute mich nicht, mich zu räuspern.
»Du?« Sie musterte mich von oben bis unten und ein hämisches Grinsen umspielte ihre Lippen.
»Ich boxe zweimal die Woche«, sagte ich kleinlaut. Ich hätte nicht gedacht, dass ich ein Bewerbungsgespräch durchlaufen musste, bevor sie mir erlaubten, mich für sie von irgendeinem außerirdischen Monster oder einem durchgeknallten Rebellen abmurksen zu lassen.
Wieder Schweigen. Gemustert werden.
»Planeten kann man ja nicht ganz allein erobern, ne?«, hörte ich mich plötzlich sagen und verfluchte mich im gleichen Moment dafür.
»Wir schon«, sagte einer der Nalise.
Stille.
»Mir wird langweilig, Ste bring sie endlich weg«, sagte die Vorsitzende und fuchtelte mit der Hand in Richtung eines Nalice, den ich bis jetzt gar nicht bemerkt hatte. Er stand an der Wand zu meiner Rechten und schien fast mit ihr zu verschmelzen.
»Natürlich«, sagte er und ging mit schnellen Schritten auf mich zu.
»Moment – Wo ist die Liste, auf die ich meine Familie setzen kann?«, fragte ich schnell.
»Sag uns die Namen«, stöhnte die Nalice genervt.
»Emanuel und Giselle Dupin. Woher kann ich mir sicher sein, dass keiner von eurer Spezies sie anrührt?«
Ich biss mir auf die Zunge, man sprach nicht einfach auf diese Weise mit den Nalise. Trotzdem war ich insgeheim auch ein kleines bisschen stolz auf meinen Mut.
»Wir können uns die Namen merken, glaub mir. Nun schaff sie endlich raus, Ste.«
Der tat wie ihm geheißen und schob mich unsanft aus dem Raum. Auch wenn ich gerne nachgefragt hätte, wie genau die Nalice sicherstellen würde, dass auch alle anderen ihrer Spezies die Namen wussten, biss ich mir auf die Zunge und ging stumm vor Ste her nach draußen. Ich hatte die Geduld der Aliens heute schon mehr als genug herausgefordert. »Hier entlang«, sagte er und deutete nach links. Dabei schaute er mich gar nicht wirklich an, als fände er mich dafür zu unbedeutend.
Er ging mir voraus durch die Flure, dann die Treppen immer weiter hinunter ins Untergeschoss. Dort öffnete er eine schwere Metalltür und wir gingen durch einen langen, durch Neonröhren beleuchteten Flur, der rechts und links von weiteren Türen gesäumt war. Das mussten früher die Zellen gewesen sein.
Fast am Ende des Ganges blieb er vor einer Tür stehen und wandte sich zu mir um. »Gib mir deinen Rucksack und den Inhalt deiner Jackentaschen. Du darfst nur einen Gegenstand behalten.«
Widerwillig tat ich wie mir geheißen. Seit der Invasion funktionierten Handys und dergleichen sowieso nicht mehr und etwas Persönliches hatte ich nicht mitgenommen. Also entschied ich mich pragmatisch für eine Wasserflasche.
»Du gehörst jetzt uns«, stellte er beiläufig klar, während er einen Schlüsselbund aus der Tasche seiner Uniform holte und aufschloss.
Ich betrat die Zelle, in der etwa zwanzig andere Menschen bereits dicht gedrängt auf dem Boden saßen oder an der Wand lehnten.
»Die Truppe fährt in zwei Stunden los«, sagte er, dann hörte ich, wie hinter mir die Tür zufiel und der Schlüssel umgedreht wurde. Seine sich entfernenden Schritte hallten dumpf im Korridor wider.
Ich setzte mich direkt neben der Tür auf den Boden – die einzige noch freie Stelle im Raum – und lehnte mich gegen die kühle Wand. Erst jetzt wurde mir die Tragweite meiner Entscheidung wirklich bewusst. Ich war nun ein Handlanger der Aliens, würde meine Familie vermutlich nie wiedersehen. Jetzt bereute ich, dass ich mich nicht richtig von meiner Mutter und meinem Bruder verabschiedet hatte. Ich vergrub mein Gesicht in den Händen, die Ellenbogen auf den angewinkelten Knien abgestützt, und dachte darüber nach, ob ich das Richtige getan hatte. Wenigstens würde Emanuel bei Mama bleiben; sie würde ihn mit Sicherheit aufhalten können, mir zu folgen. Er würde sie niemals alleine zurücklassen. Auch wenn er es gestern behauptet hatte, hatte er doch ein viel zu großes Herz dafür. Es war besser so: Er passte auf sie auf und ich versuchte so lange es ging durchzuhalten, um ihnen Geld zu schicken.
Die Zeit zog sich wie Kaugummi. Ein paar Mal wurde die Tür geöffnet und neue Menschen kamen herein, die sich ebenfalls freiwillig gemeldet hatten. Die meisten waren abgemagert und starrten vor sich hin. Unsicherheit hing im Raum. Niemand wusste, was in den nächsten Stunden passieren würde.
Plötzlich hörte ich direkt neben mir ein leises Schluchzen und wandte mich dem Geräusch zu. Als erstes fielen mir die roten Haare der Frau auf, die ihr in wilden Locken vom Kopf abstanden. Sie umrahmten ihr schmales Gesicht und passten perfekt zu dem schönen grünen Spitzenkleid, das sie trug. Dann entdeckte ich die blauen Flecken – an ihrem Auge, am Hals, an den Armen. An den wirklich außerordentlich dünnen Armen. Schnell schaute ich wieder weg, um nicht unhöflich zu sein. Doch ich wusste, dass es zu spät war und sie meinen Blick bereits bemerkt hatte.
Ich schätzte sie auf Anfang zwanzig. Wie ich. Es ging mich nichts an, aber trotzdem dachte ich unwillkürlich darüber nach, was ihr wohl widerfahren war.
»Ich habe geklaut«, durchbrach sie meine Gedanken in sachlichem Tonfall. Ich fühlte mich ertappt.
»Oh«, war das Originellste, was mir in dem Moment einfiel.
Sie musste wahnsinniges Glück gehabt haben, dass sie die Wahl bekommen und nicht direkt erschossen worden war. Aber das wollte ich ihr nicht sagen, das wäre ein sehr merkwürdiger Gesprächsanfang gewesen.
Wir verfielen wieder in Schweigen, bis meine düsteren Gedanken wiederkamen und ich doch versuchte, die Unterhaltung wieder in Gang zu bringen, um mich von ihnen abzulenken.
»Ich bin Lou«, sagte ich zu ihr.
»Ella«, erwiderte sie und streckte mir die Hand hin, während ein leichtes Schmunzeln ihre grünen Augen umspielte.
Ich schüttelte sie und hatte das Gefühl, sie könnte zerbrechen, wenn ich nicht aufpasste.
»Glaubst du, sie stellen wirklich die Leute unter Schutz, die wir auswählen?«, fragte sie.
»Sie haben dich am Leben gelassen und dir erlaubt, jemanden unter Schutz zu stellen?«, brach es ungläubig aus mir heraus.
»Ja?«, erwiderte sie mit einem unsicher fragenden Unterton.
»Du musst ja echt charmant gewesen sein.« Ich nickte beeindruckt.
»Äh, ja vielleicht...«, druckste sie herum. »Also was meinst du – stehen die Menschen wirklich unter Schutz?«
Sie schaute mich mit so großen, so besorgten Augen an, dass ich nicht anders konnte als »Natürlich« zu sagen.
»Trinkst du das noch?«, fragte sie und deutete auf meine Wasserflasche.
Ich zuckte mit den Schultern und murmelte etwas Unverständliches, was sie als Aufforderung sah, sich die Flasche zu nehmen.
»Bin schon seit Stunden hier«, sagte sie und trank das Wasser ohne Abzusetzen. Verdutzt sah ich ihr dabei zu.
Als sie es fast leer getrunken hatte, schien ihr etwas einzufallen. »Oh, willst du auch noch was?«, fragte sie und ich nickte perplex.
Nach einiger Zeit öffnete sich wieder die Metalltür; dieses Mal erschien Ste alleine.
»Folgt mir«, sagte er kalt und drehte sich auf dem Absatz um.
Die mittlerweile circa dreißig Menschen versuchten alle gleichzeitig, sich aufzurappeln, was in einem ziemlichen Chaos endete. Aber schließlich hatten wir es doch geschafft und hasteten hinter ihm her, durch die Flure, die Treppen hoch nach draußen.
Ich ließ meinen Blick durch den Innenhof gleiten und suchte ihn mehr aus Vorsicht als aus ernster Absicht nach einem Fluchtweg ab. Der Hof war jedoch komplett eingemauert. Der einzige Weg hinaus war die Tür, aus der wir gekommen waren.
In der Mitte des Hofs stand ein monströses, ovalförmiges Gefährt, dessen hellblaues Metall im Sonnenlicht glänzte. Es schwebte leicht über dem Boden, obwohl keine Rotorblätter oder ähnliches zu sehen waren. Durch die rundum verlaufenden, verdunkelten Scheiben hatte man keine Chance zu sehen, ob jemand drinsaß oder nicht. Ich hatte solche Teile schon oft über die Stadt fliegen sehen. Bei schönem Wetter konnte man sie jedoch kaum erkennen, da sie nahezu die Farbe des Himmels annahmen.
Plötzlich setzte ein leises Surren ein und eine schmale Rampe löste sich vor uns aus dem Metall. Sie schwang hinunter, wobei sie flach über dem Kies sanft stoppte.
»Steigt ein«, befahl Ste und positionierte sich neben der Rampe. Er starrte uns auffordernd an.
Man merkte den anderen an, dass niemand so wirklich begeistert davon war, irgendwo einzusteigen, ohne zu wissen, wohin es ging. Doch was hatten wir für eine andere Wahl? Transparenz und flache Hierarchien waren bei den Nalise wohl nicht zu erwarten.
Als ich hinter Ella die Rampe hochging, fühlte ich mich, als würde ich damit den Pakt mit den Aliens besiegeln.
Im Innenraum standen unzählige Plastiksitze in breiten Reihen angeordnet und Ella war bereits dabei, nach hinten durchzugehen, auf der Suche nach einem Sitzplatz. Unschlüssig blieb ich stehen und wusste nicht so recht, ob ich ihr hinterherlaufen oder mir woanders einen Platz suchen sollte. Doch zum Glück befreite sie mich aus diesem unangenehmen Moment, indem sie sich umdrehte und mir mit einem Handzeichen zu verstehen gab, dass ich mitkommen sollte. Also folgte ich ihr und ließ mich neben ihr auf einem Sitzplatz fallen. Ich streckte meine Beine aus und freute mich für einen Moment über den vielen Platz. Nach der Wartezeit, in der wir in der kleinen Zelle eingepfercht gewesen waren, war das eine echte Wohltat.
»Hier sieht's aus wie in einem Flugzeug«, sagte sie und schaute staunend über die Sitzreihen.
»Nur ohne Piloten«, ergänzte ich nachdenklich. Dort wo normalerweise die Tür zum Cockpit war, waren Fenster. Ich drehte mich auf dem Sitz um, doch auch hinten konnte ich nichts erkennen, das nur annähernd nach Steuergeräten aussah.
Mit einem mulmigen Gefühl beobachtete ich die Rampe, die sich langsam hinter dem letzten einsteigenden Passagier schloss. Mein Blick fiel auf Ste, der immer noch in kerzengerader Körperhaltung draußen neben dem Fluggefährt stand. Dann – Ich schüttelte den Kopf, weil ich es im ersten Moment nicht glauben konnte. Da wo er eben noch gestanden hatte, schwebte jetzt eine Lichtkugel. Sie war ungefähr so groß wie ein Handball und flimmerte leicht bläulich.
So etwas Faszinierendes hatte ich noch nie gesehen.
»Wow, wie schön«, hörte ich Ella neben mir flüstern. Mein Magen zog sich zusammen.
Als sie keine Reaktion von mir bekam, drehte sie sich zu mir um. »Nicht?«
»Doch, doch«, sagte ich schnell und setzte ein Lächeln auf. Aus irgendeinem Grund ärgerte es mich, dass so grausame Kreaturen wie die Nalise solch eine wunderschöne Gestalt annehmen konnten. Ich dachte wieder an meinen Vater. Aber wahrscheinlich war es besser, Ella nichts davon zu erzählen, sondern irgendwie alleine mit dem Schmerz klarzukommen.
Ich spürte ein kurzes Ruckeln, dann hob die Maschine ab. In rasender Geschwindigkeit gewannen wir an Höhe und binnen weniger Sekunden war die Landschaft unter uns winzig klein geworden. Knapp unter den Wolken flogen wir über die Dörfer und Städte hinweg, flankiert von der Lichtkugel, die neben uns herraste.
Kapitel 4
Nach etwa einer halben Stunde hatten wir unser Ziel erreicht. Das Gefährt wurde langsamer, blieb in der Luft stehen und verlor dann zunehmend an Höhe. Der Wald unter uns rückte immer näher und schließlich konnte ich erkennen, dass wir eine Lichtung ansteuerten, auf der mehrere Gebäude u-förmig angeordnet standen.
»Glaubst du, wir haben zwischendurch eine Ländergrenze überquert?«, fragte Ella.
Ich zuckte mit den Achseln. Bei der Geschwindigkeit die wir gehabt hatten, konnte ich nicht sagen ob wir noch in Frankreich waren, und wenn nicht, ob es nur eine Grenze gewesen war.
Das Flugzeug stoppte knapp über dem Boden und die Rampe öffnete sich wieder.
Zögerlich standen die Ersten auf. Sollten wir aussteigen? Oder noch warten? Gemurmel kam auf, niemand wollte etwas Falsches tun.
Ich sah aus dem Fenster, wie die Lichtkugel innerhalb eines Wimpernschlags wieder ihre menschenartige Gestalt annahm. Ste schaute zu einer Reihe von Nalise, die bereits auf uns warteten. Stocksteif und stumm standen sie da und beobachteten uns. Allesamt trugen sie hellblaue Uniformen, sodass ihre unterschiedlichen Silhouetten den Anschein von Karikaturen ein und derselben Person erweckten. Hinter ihnen konnte ich einen Berg voll dunkelblauem Stoff auf dem Kies ausmachen. Ich konnte nicht genau erkennen, was es war.
Ste nickte den Personen zu, dann wandte er sich um und lief im Eilschritt auf die Rampe zu. Er rief etwas zu uns herein, doch nur die vorderen Reihen konnten hören, was. Sie setzten sich in Bewegung und kletterten einer nach dem anderen nach draußen. Mit einem unguten Gefühl folgte ich ihnen.
Als ich aus dem Fluggefährt trat, kniff ich die Augen geblendet von der Sonne zusammen. Hinter Ella und mir drängten weitere die Rampe hinab und schoben die Traube beiseite.
Ste stellte sich ein paar Meter vor die Reihe der Soldaten und mir fiel auf, dass er fast die gleiche – nur etwas dunklere Uniform – wie sie trug. Ob es bei den Nalise unterschiedliche Ränge gab?
Als alle draußen waren und die Masse einigermaßen Stillstand, hob er zum Sprechen an: »Im Folgenden werden je zwei von euch einem von uns untergeordnet. Egal was wir euch befehlen, ihr werdet dem Folge leisten. Wer unseren Erwartungen nicht gerecht wird –« Er machte eine dramaturgische Pause. »Sagen wir mal so, es gibt einen Grund, warum jeder von uns über zwei von euch verfügen kann. Also stellt sicher, dass ihr nützlicher seid als der andere.«
Ella warf mir einen entsetzten Blick zu.
Als Ste begann, uns in Zweiergruppen einzuteilen, schickte ich ein Stoßgebet zum Himmel. Bilder blitzten vor meinem inneren Auge auf, in denen Ella und ich gegeneinander kämpfen mussten. Alles, nur das nicht!
Die gute Nachricht war, dass mein Flehen erhört wurde. Die schlechte, dass ich mit einem muskelbepackten Hünen in ein Team kam. Er war nicht von der Sorte klobiger Männer, denen man gerne ihre Anabolika wegnehmen will, sondern trotz seiner vielen Muskeln sah er auch noch außerordentlich athletisch aus. Ich schätzte ihn auf Mitte zwanzig. Er hatte kurzgeschorene, schwarze Haare, die sein auf eine faszinierende Art kantiges Gesicht betonten. Kurzum: Er war einer von den Menschen, bei deren Anblick meine Mutter jedes Mal den Fernseher ausschaltete und anfing, Emanuel und mir einen Vortrag über »völlig überzogene Schönheitsideale« und »Fitnesswahn« zu halten. Dieser wurde erst beendet, wenn wir ihr glaubhaft versichern konnten, dass wir uns nicht unter Druck gesetzt fühlten, dem dort gezeigten Bild zu entsprechen.
Nie im Leben würde ich mich gegen ihn durchsetzen können. Und das wusste er auch, wie sein verschlagenes Grinsen in meine Richtung unschwer erkennen ließ.
Wir wurden einer Nalice namens Lynn in der Gestalt einer älteren Dame zugeordnet, deren Dauerwelle von lila Strähnchen durchzogen war. Sie nickte uns mit starrer Miene zu. Wer die Frau wohl gewesen war, bevor sie getötet wurde? Schnell schob ich den Gedanken beiseite.
In gruseliger Synchronität gingen die Nalise auseinander, wobei die eine Hälfte nach links und die andere nach rechts wegtrat. Sie gaben den Blick auf den dunkelblauen Haufen frei, den ich schon aus dem Fluggefährt heraus gesehen hatte.
»Das hier ist eure Ausrüstung«, sagte Ste. »Jeder von euch wird sich gleich einen Rucksack nehmen und ihn in den Schlafsaal in Haus neun bringen. Dort werdet ihr den Anzug anziehen, den wir euch bereitstellen. Wir gehen ein einfaches Tauschgeschäft ein: Ihr bekommt von uns Nahrung, Kleidung und Unterkunft. Im Gegenzug verlangen wir von euch nur eines: unbedingten Gehorsam.« Er ließ seinen eisigen Blick über die Menge schweifen, wie um seine Worte noch zu unterstreichen. »Ihr werdet benachrichtigt, sobald das Training beginnt.«
Dann machten die Nalise auf dem Absatz kehrt und marschierten davon.
Nach einem Moment, in dem sich alle verunsicherte Blicke zuwarfen, begannen die Ersten, nach vorne zu preschen, um sich einen Rucksack zu sichern. Ich drängte mich durch die Traube nach vorne und ergatterte zwei für Ella und mich.





























