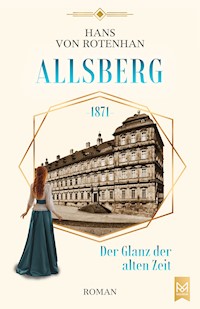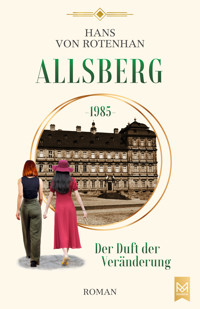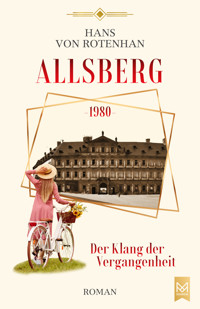
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Maximum Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Schloss Allsberg-Reihe
- Sprache: Deutsch
Wir alle tragen ein Erbe in uns "Sie saß in einem nur schwach beleuchteten Abteil und dachte, die Welt müsse nun endgültig einstürzen – zumindest ihre Welt. Sie hätte gern geweint, doch es kamen einfach keine Tränen." Ibiza, Herbst 1980: In einer kleinen, heruntergekommenen Finca trifft ein Telegramm ein, das das Leben von Karl Tröger durcheinanderwirbeln soll. Karl, der mit dem Leben auf Schloss Allsberg abgeschlossen hat, wird von seinem Vater Georg aufgefordert, unverzüglich ins Schloss in Unterfranken zurückzukehren. Das Wort, das Karl jedoch wirklich alarmiert, lautet "bitte". Karl reist übereilt gemeinsam mit seiner Freundin Giovanna nach Allsberg. Sein Vater, der schon früh die Erbnachfolge regeln wollte, hatte Karls Bruder Anton alles überschrieben, ehe Georg und Anton im Streit auseinandergingen. Aus Rache will Anton nun alles tun, um Schloss Allsberg zu zerstören und das Vermögen in alle Winde zu verstreuen. Die Familie muss ihn aufhalten. Als die Trögers von mehreren Schicksalsschlägen erschüttert werden, ist es die kluge Ziehtochter Katja, die sich um die zahlreichen Aufgaben auf Schloss Allsberg kümmern muss. Sie stellt sich den Schatten der Vergangenheit und bringt eine längst vergessene Schuld ans Licht. Findet sie hierbei auch ihr eigenes Glück? Ein Generationenroman um eine starke Frau, über die Rollen, die einem das Leben oft überraschend zuweist, Glück, dem man eine Chance geben muss und Kraft, die Wiedergutmachung in sich trägt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 462
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hans von Rotenhan
Allsberg 1980
Der Klang der Vergangenheit
Roman
Über das Buch
Wir alle tragen ein Erbe in uns
„Sie saß in einem nur schwach beleuchteten Abteil und dachte, die Welt müsse nun endgültig einstürzen – zumindest ihre Welt. Sie hätte gern geweint, doch es kamen einfach keine Tränen.“
Ibiza, Herbst 1980: In einer kleinen, heruntergekommenen Finca trifft ein Telegramm ein, das das Leben von Karl Tröger durcheinanderwirbeln soll. Karl, der mit dem Leben auf Schloss Allsberg abgeschlossen hat, wird von seinem Vater Georg aufgefordert, unverzüglich ins Schloss in Unterfranken zurückzukehren. Das Wort, das Karl jedoch wirklich alarmiert, lautet „bitte“. Karl reist übereilt gemeinsam mit seiner Freundin Giovanna nach Allsberg. Sein Vater, der schon früh die Erbnachfolge regeln wollte, hatte Karls Bruder Anton alles überschrieben, ehe Georg und Anton im Streit auseinandergingen. Aus Rache will Anton nun alles tun, um Schloss Allsberg zu zerstören und das Vermögen in alle Winde zu verstreuen. Die Familie muss ihn aufhalten. Als die Trögers von mehreren Schicksalsschlägen erschüttert werden, ist es die kluge Ziehtochter Katja, die sich um die zahlreichen Aufgaben auf Schloss Allsberg kümmern muss. Sie stellt sich den Schatten der Vergangenheit und bringt eine längst vergessene Schuld ans Licht. Findet sie hierbei auch ihr eigenes Glück?
Ein Generationenroman um eine starke Frau, über die Rollen, die einem das Leben oft überraschend zuweist, Glück, dem man eine Chance geben muss und Kraft, die Wiedergutmachung in sich trägt.
Impressum
Die Handlung dieses Romans ist frei erfunden, hätte sich aber genau so abspielen können. Auch die Personen sind der Fantasie des Autors entsprungen, Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Menschen sind daher Zufall und nicht beabsichtigt.
Nur die drei Typen im Café Pereyra auf Ibiza, die gab’s wirklich.
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der mechanischen, elektronischen oder fotografischen Vervielfältigung, der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, des Nachdrucks in Zeitschriften oder Zeitungen, des öffentlichen Vortrags, der Verfilmung oder Dramatisierung, der Übertragung durch Rundfunk, Fernsehen oder Video, auch einzelner Text- oder Bildteile.
Alle Akteure des Romans sind fiktiv, Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen wären rein zufällig und sind vom Autor nicht beabsichtigt.
Copyright © 2023 by Maximum Verlags GmbH
Hauptstraße 33
27299 Langwedel
www.maximum-verlag.de
1. Auflage 2023
Lektorat: Silvia Kuttny-Walser
Korrektorat: Angelika Wiedmaier
Satz/Layout: Alin Mattfeldt
Umschlaggestaltung: Alin Mattfeldt
Umschlagmotiv: © Max kegfire / Shutterstock, Khirman Vladimir / Shutterstock
E-Book: Mirjam Hecht
Druck: Booksfactory
Made in Germany
ISBN: 978-3-98679-002-8
Inhalt
Über das Buch
Impressum
Widmung
Dramatis personae
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
Epilog
Danksagung
Der Autor Hans von Rotenhan
Allsberg: Wie alles begann
Allsberg: Der dritte Teil
Widmung
Für Stephanie und David, meine Kinder, auf die ich sehr stolz bin.
Dramatis personae
Georg (Schorsch) Freiherr von Tröger
* 4.5.1923
† 29.12.1980
Ehefrau:
Agnes Freifrau von Tröger, geb. Gräfin von Alcaini
* 1.5.1925
Heirat: 1.3.1952
† 2.2.1970
Kinder:
Karl Freiherr von Tröger - genannt Carlos
* 27.1.1953
† 30.11.1980
Anton Freiherr von Tröger
* 14.3.1955
† 24.12.1980
***
Vater von Georg:
Carl-Wendt Freiherr von Tröger
* 1.9.1890
† 10.8.1948
Erste Ehefrau:
Bertha Freifrau von Tröger, geb. Gräfin von Renter
† 29.11.1915
Kind:
Uta Freiin von Tröger
* 29.11.1915
Heirat: 1941 mit Erich Brandl
† 14.10.1953
Kind:
Heinrich Brandl
* 1941
† 1941
***
Zweite Ehefrau:
Luise Freifrau von Tröger, geb. Freiin von Zott
(„Groma“ genannt)
* 5.5.1904
Heirat: 20.4.1922
Kinder (außer Georg von Tröger):
Magnus Freiherr von Tröger
* 23.10.1924
† 4.4.1972
Donata Princesse de Limmez, geb. Freiin von Tröger
* 12.11.1925
geschieden von: Gaston Prince de Limmez
Sohn: Yves
Tochter: Simone
Huberta Gräfin von Braunsfeld, geb. Freiin von Tröger
* 17.2.1927
geschieden von: Herbert Graf von Braunsfeld
Tochter: Asumpta
Sohn: Friedrich
Philippa Brunnmeister, geb. Freiin von Tröger
* 23.5.1928
geschieden von: Dr. Peer Brunnmeister
Sohn: Sven †
***
Giovanna Neri (Lebensgefährtin von Karl von Tröger)
* 1.6.1957
Tochter von:
Massimo Neri
* 25.3.1937
und
Beatrice Neri, geb. Conti
* 17.9.1937
***
Therese Riedmüller
* 1.10.1920
† 15.8.1972
Tochter (mit Magnus von Tröger):
Katja Riedmüller
* 17.4.1955
***
Agathe Gräfin von Altspaur, geb. Gräfin von Alcaini (Schwester von Agnes von Tröger)
* 17.12.1915
† 10.10.1979
Ehemann:
Anton Graf von Altspaur
* 13.2.1915
Sohn:
Enzio Graf von Altspaur
* 3.3.1953
1. Kapitel
Ibiza, Herbst 1980
„Komm nach Hause, bitte – STOP – Geld folgt per Post Ibiza – STOP – Vater“
Pep von der Bar an der Weggabelung hatte das Telegramm vorbeigebracht. Jeden Morgen schüttete elcartero, der Postbote, alle Sendungen, von denen er annahm, die Adressaten wohnten in der näheren Umgebung, auf dem Tresen der Bar Ca’n Pep aus. Pep ordnete die Post dann nach dem Alphabet und packte den Haufen auf das Regal an der Tür. Die Bar ging auch ohne das Postfach nicht schlecht. Mittags gab es für Bauarbeiter, Nachbarn und Zufallsgäste ein Tagesmenü, das Margarita, Peps Frau, in der winzigen Küche zubereitete. Im Sommer wechselten Schnitzel mit patatas fritas, Hühnchen mit patatas fritas und Fischfilet mit patatas fritas einander ab. Zu Höchstform lief die Köchin allerdings zwischen November und März auf. In der kalten Jahreszeit kochte sie ihre legendären potajes, dicke Suppen aus Linsen, Bohnen oder Kichererbsen. Letztere, potaje de garbanzos, gab es meistens am Montag und Donnerstag, da war es schwer, einen Platz in der kleinen Bar zu ergattern. Mindestens einmal pro Woche kamen am Abend alle Nachbarn wegen der Post. Die dabei konsumierten Getränke brachten einen schönen zusätzlichen Umsatz und damit Gewinn in die Kasse.
Telegramme kamen nie an in der Bar Ca’n Pep, oder fast nie. Das war etwas für die Spanier vom Festland oder eben für die Ausländer. Wenn ein Ibizenco einem anderen etwas Wichtiges zu sagen hatte, setzte er sich auf sein Moped und fuhr zu ihm hin.
Es war daher eine mittlere Sensation, als im Herbst 1980 doch einmal ein Telegramm in dem Packen lag, den elcartero auf den Tresen knallte. Adressat: Carlos Troeger, BarCa’n Pep, San Rafael, Ibiza.
Pep überlegte zusammen mit Pau, so hieß elcartero. Wer ist dieser Carlos Troeger?
Pau hatte wie immer einen café solo und einen Hierbas ibicencas bestellt.
Wer ist dieser Carlos Troeger?
Ibizencos und Festlandspanier kamen nicht in Frage, die hatten keine so komischen Nachnamen. Blieben Carlos el de la italiana und Carlos el francés. Der eine Carlos hatte eine italienische Freundin, deren Schönheit erheblich auffallender war als Carlos selbst. Und der Franzose war eigentlich Belgier. Wenn er spanisch sprach, betonte er die Worte auf der letzten Silbe, das taten hauptsächlich franchutes, Franzosen eben. „Soy belga“ – „Si, si, franchute.“
Der Postbote tippte also bei dem Namen Troeger auf Carlos el de la italiana, denn dieser langhaarige Hippie war doch angeblich Deutscher, und Troeger klang auch nicht richtig französisch.
Nachdem der Postbote das Glas Hierbas bezahlt hatte – der café ging aufs Haus, weil Pau irgendwie mit Margarita verwandt war –, schwang sich Pep auf seine Mobilette und fuhr die paar hundert Meter hinauf in den Pinienwald, wo das ausländische Paar eine halb verfallene Finca gemietet hatte, Ca’n Joan Petit. In Ca’n Joan Gros wohnte Toni, der Vermieter der beiden, ein geldgieriger Widerling, dem die Frau davongelaufen war. Statt seiner santa esposa schlug er jetzt seine Jagdhunde. „Die Italienerin ist alleine da oben“ rief er Pep hinterher. Pep war sich sofort im Klaren darüber, dass Toni aus der Ca’n Joan Gros heute Abend in der Bar todsicher verbreiten würde, Pep steige der Italienerin hinterher.
Tatsächlich fand er die junge Schönheit allein vor, sie strickte, wie gewöhnlich. „Heißt dein Carlos mit Nachnamen Tro-eger?“ Giovanna zögerte. Wie ihr Freund mit Nachnamen hieß, wusste Giovanna nicht so genau. Damals hatte man auf Ibiza nur Vornamen. Das war ja der Clou, dass man das vorherige Leben abstreifen konnte. Aber irgendwas mit T war es wohl, und so nahm sie das Telegramm entgegen. Ohne weitere Worte brauste Pep ins Tal. Keine Sekunde zu lange mit der guapa italiana! Margarita war schrecklich eifersüchtig.
Giovanna legte das Telegramm auf den Fenstersims, beschwerte es mit einem Stein und strickte weiter.
Ihre Produkte verkaufte sie mit großem Erfolg in den engen Gassen des Hafenviertels von Ibiza-Stadt, wenn im Sommer die Touristen dort den Abend begannen. Niemand wusste, wie man ihre Werkstücke nennen sollte. Manchmal strickte sie, wie sie es ausdrückte, für unterhalb des Nabels, dann waren es eigenartige Hosen oder Röcke, die aber nicht so aussahen wie Hosen oder Röcke. Die Farben überließ die Künstlerin, denn als solche empfand sich Giovanna, dem Zufall. Wenn sie für oberhalb des Nabels strickte, war es noch schwieriger, das Kleidungsstück irgendwie zu benennen. Spötter, die ihr den Erfolg neideten, tuschelten hinter vorgehaltener Hand, dass Giovanna „oben herum“ lediglich darauf achte, dass ihre Kreationen garantiert brustwarzendurchlässig seien.
Im Herbst verkaufte Giovanna natürlich nichts, und so strickte sie an diesem Tag einen dicken Pullover für sich selbst. Diesmal achtete sie genau darauf, jegliche Durchlässigkeit zu vermeiden. Ca’n Joan Petit hatte nur einen Kamin, und weder Türen noch Fenster schlossen dicht. Mailand kann sehr kalt sein, aber nirgendwo habe ich so gefroren wie auf Ibiza, ging ihr durch den Kopf.
Dann aber vertrieb das knatternde Geräusch eines 2CV den Gedanken – Carlos kam zurück. Kurz darauf entstieg ein langer Rotschopf seiner „Ente“. Groß und schlank war er wohl, aber eine blendende Erscheinung eher nicht. „Was will die nur von dem?“, fragten sich die einen. „Wenn der Carlos neben der Giovanna steht, scheint er neben ihr zu verschwinden, obwohl er größer ist als sie“, stellten andere nicht zu Unrecht fest. Giovanna lächelte nur und sagte nichts. Aber natürlich wurde ihr Lächeln kommentiert. Bald war man sich einig: Der Typ ist ein Sex-Titan! Auch dazu lächelte Giovanna, denn Carlos tat einfach ihrer Seele gut. Es gelang ihm immer, sie aus den wiederkehrenden Abgründen ihrer Selbstzweifel herauszuholen. Sie hatte Angst vor diesen Zuständen. Ihre Mutter musste immer wieder in der Nähe von Mailand in ein Sanatorium gebracht werden, und Giovanna fürchtete, die depressive Veranlagung ihrer Mutter könne erblich sein. Für die Hilfe und Unterstützung in diesen Phasen liebte sie Carlos. Und sie bewunderte ihn dafür, dass er keine Drogen nahm. „Rotwein ist auch eine Droge“, flüsterte ihr Carlos ins Ohr, wenn sie darauf zu sprechen kam.
Der rote Wein war sogar mehr als eine Droge, er war auch ein Indikator dafür, wie es um die Haushaltskasse bestellt war. Im Sommer, bei mittlerem Pegelstand, wenn das Geschäft florierte, gab es Rioja, „El Coto“, bei Hochwasser in der Kasse sogar manchmal „Marqués de Cáceres“. Heute aber hatte Carlos „Don Simon“ mitgebracht – Wein in der Pappschachtel.
„So schlecht geht es uns?“, fragte Giovanna besorgt.
„Es kommt halt nichts rein“, brummelte Carlos. „Die Konzerte im La Nada sind vorbei, und bei Juan el cojo läuft derzeit gar nichts.“
Carlos verdiente im Sommer Geld mit seiner Band, „Los Capullos“. Er spielte Saxophon und kam damit über die Runden, aber wenn die Touristen ausblieben, leerte sich auch das La Nada in der Calle de la Virgen. Nein, das war nicht ganz richtig: Leer war das legendäre Lokal auch außerhalb der Saison nie. Leer waren dann allerdings die Taschen seiner Gäste, und der Wirt konnte es sich nicht leisten, auch noch für die Musik zu zahlen.
Juan el cojo war wieder eine andere Geschichte. Er makelte unter der Hand und brauchte Carlos hin und wieder zum Übersetzen. Er hinkte, weshalb ihn seine Nachbarn und Freunde eben el cojo, den Lahmen, nannten. Die Gehbehinderung hatte ihm ein Arbeitsunfähigkeitsattest nebst Frührente eingebracht. Und nun fuhr el cojo tagein, tagaus mit seinem Moped über die Insel und pflegte seine Amouren auf einsamen Fincas. Er war stolz auf sein üppiges weißes, glattes Brusthaar und erzählte Carlos manchmal im Vertrauen, das mache ihn bei manchen Frauen unwiderstehlich. Den körperlichen Einsatz ließ sich Juan mit Informationen vergüten, und so wusste er stets genau, welcher Bauer Spielschulden hatte, wo gerade Geld notwendig war, um das Studium der Kinder zu bezahlen, oder wo, wie schon lange abzusehen, ein Hallodri endlich finanziell am Ende war.
Diese Informationen sammelte Juan, und so hatte er stets die interessantesten Fincas an der Hand.
Giovanna und Carlos tranken den Wein und aßen dazu Brot mit Olivenöl. Mehr war nicht im Haus. Dann nahm Giovanna Carlos’ Hand und zog ihn ins Haus. „Komm, ich hab noch was mit dir vor.“
Erst viel später fiel ihr das Telegramm ein. Carlos war wie elektrisiert. „Ein Telegramm bedeutet immer etwas Schlimmes, bestimmt ist jemand gestorben“. Mit fliegenden Händen öffnete er das Kuvert und las. Danach löschte er das Kerzenlicht und starrte in die Dunkelheit.
Als Giovanna später aufwachte, hörte sie, wie Carlos stöhnte. Sie nahm ihn in die Arme, streichelte ihm über den Kopf.
„Er hat bitte geschrieben.“ Seine Stimme klang fremd.
2. Kapitel
Allsberg, 15. Juni 1979
Der Baron saß auf dem Hochsitz und ärgerte sich. Obwohl er ein passionierter Jäger war, hatte er heute keinen Blick für das Wild, das zur Abendstunde aus dem Wald trat. Er ärgerte sich über seinen Sohn Anton, er ärgerte sich sogar maßlos über ihn. Mehr noch aber ärgerte er sich über sich selbst. Ja, er musste sich eingestehen, dass er es diesmal wirklich ganz allein verbockt hatte. Es war noch gar nicht so lange her, da hatte ihn der Notar Dr. Baumann aus Schweinfurt gewarnt: „Herr Tröger, tun Sie das nicht! Die Steuerersparnis wiegt den möglichen Ärger nicht auf.“ Jung war der Notar und nannte ihn Herr Tröger. Sicher ein Sozialist.
Er ließ dann die Urkunden beim Notar Dr. Nüsslein in Würzburg vorbereiten, dort widersprach man ihm nicht und nannte ihn „Herr Baron“. Und so übertrug er fast seinen gesamten Besitz auf seinen zweitgeborenen Sohn Anton. Die Nutzung, den Nießbrauch, behielt er sich bis zu seinem Lebensende vor, so vorsichtig war er denn doch. Und sollte Anton ohne Erben vor dem Vater sterben, würde das Eigentum wieder an ihn zurückfallen.
Georg Freiherr von Tröger war sechsundfünfzig Jahre alt. Seine roten Haare waren etwas schütter geworden, aber graue Strähnen gab es noch nicht. Darauf war der Baron stolz. Er legte äußersten Wert auf seine Erscheinung. Es war ihm sogar gelungen, die Wampe wieder loszuwerden, die er sich angefressen hatte, nachdem Agnes, seine Frau, gestorben war. Kummerspeck war das gewesen. Ebenso sehr wie auf seine Figur achtete er auf ländlich-schicke Kleidung. Seine Standesgenossen und Nachbarn gingen zu Waffen Frankonia in Würzburg oder zu Lodenfrey in München: Loden, Hirschhornknöpfe, Haferlschuhe – das kam dabei heraus. Er hasste das. Englischer Tweed war schon sehr viel mehr sein Stil.
Hätte Agnes, seine verstorbene Frau, ihm zugeraten, alles an Anton zu übergeben? Hätte sie tatenlos zugesehen, wie er Karl, den älteren Sohn, enterbte? Anton hatte damit begonnen, Landwirtschaft und Weinbau zu studieren, und zeigte reges Interesse an den Betrieben der Familie. Dabei ging es um mehrere tausend Hektar Wald in der Rhön und um landwirtschaftliche Flächen rund um den Ort Allsberg. Und nicht zu vergessen: die Weinberge rund um Volkach und Fahr – das Herzblut des Barons. Die Immobilien in Würzburg, die Ziegelei und den Weingroßhandel hatte er noch nicht übergeben, das war wieder ein ganz anderer Fall. Viel Geld kam da herein, dennoch behandelte er diesen Teil seines Eigentums mit einer gewissen Reserviertheit. Er fühlte sich da nicht wohl als Eigentümer. Das war nicht das echte Geschäft der Familie. Er kam sich vor wie ein Pfeffersack, wenn er sah, wie sein Direktor wegen der Mieten feilschte und Wein per Hektoliter in alle Welt verkaufte.
„Der Betrieb“ – das war das, was er an den Sohn übergeben hatte. Und der brachte unterdessen wieder Gewinn. Forst, Landwirtschaft und Weinbau hatte er von seinem Vater geerbt. Damals, nach dem Krieg, war das eine altmodische Angelegenheit gewesen, viel Vieh, viel Handarbeit, wenig Mechanisierung. Das war teuer, zumal es auch noch einige betriebliche Renten gab, die ausbezahlt wurden. Das war alles nicht mehr zeitgemäß gewesen.
Es hatte mehrerer Jahre bedurft, bis „der Betrieb“ durchrationalisiert war. Die Alten gingen in Rente, und die Jungen wanderten zu den besser bezahlten Stellen nach Schweinfurt ab. Niemand wurde entlassen, niemand wurde arbeitslos, darauf war der Baron stolz. Anton würde nur das gesetzliche Erbe, den Pflichtteil, an seinen Bruder Karl auszahlen müssen, sonst war alles unbelastet. Wenn man davon absah, dass der Unterhalt des riesigen Barockschlosses in Allsberg Unsummen verschlang.
Warum hatte Karl, der Ältere, ihn damals so enttäuscht? Weil er nach seinem Onkel Magnus kam? Er selbst, Georg, den alle Schorsch nannten, war als Kind ein Draufgänger gewesen und auf einem selbst gebauten Floß auf dem Karpfenteich herumgepaddelt. Das war natürlich streng verboten, und dafür hatte er auch die angedrohte Tracht Prügel eingesteckt. Aber was wog schon Senge gegen Abenteuer? Sein Bruder Magnus hatte dabei nie mitmachen wollen. „Schisser“, dachte der ältere Bruder und verachtete den Bücherwurm, der zu allem Überfluss auch noch malte und im Schulchor sang. Eine Generation später wiederholte sich das alles: Karl war wie Magnus, zumal er von seiner Mutter verhätschelt worden war. Zugegeben, auch Anton hatte sie zu weich erzogen, immer hielt sie ihre schützende Hand über die Buben, wenn er, der Vater, Mutproben oder sportliche Leistungen einforderte.
„Ihr müsst den inneren Schweinehund überwinden, sonst wird nie etwas aus euch.“
Leicht süffisant hatte Agnes dann gefragt: „Könnte es sein, dass du so was hast? Normale Menschen kommen auch ohne Schweinehund aus.“
Er gestand es sich nur ungern ein, aber wenn sie nicht gestorben wäre, hätte er sich irgendwann von ihr scheiden lassen. Daher kam es für ihn vollkommen unerwartet, dass er nach dem Tod seiner Frau in ein tiefes depressives Loch fiel. Hatte er sie doch mehr geliebt, als er sich eingestehen wollte? Jetzt, neun Jahre nach ihrem Tod, vermisste er sie sehr. Er versuchte nun, sich nur an harmonische Momente ihrer Ehe zu erinnern.
Mit der Zeit hatte er es sich angewöhnt, den Grund für all seine Probleme mit den beiden Söhnen darin zu sehen, dass Agnes sie eben viel zu lasch erzogen hatte. Das war zwar praktisch, änderte allerdings auch nichts an der ganzen Misere.
Vor den Abenden, den Sonntagen und den Zeiten, wenn er nicht auf die Jagd gehen konnte, war ihm bange. Allein zu sein, das waren trübe Aussichten. Es kam ihm oft so vor, als lebte er allein im Schloss. Sollte er zur Abwechslung wöchentlich einen anderen Salon nutzen? Zehn Gästezimmer! Was sollte er damit, wenn ihn nie jemand besuchte? Gut, es gab ja noch Katja. Manchmal dachte er, seine Nichte sei wie eine zugelaufene Katze, die sind ja besonders anhänglich. Katja Riedmüller war die nicht-eheliche Tochter seines Bruders Magnus mit der Schauspielerin Therese Riedmüller, einer vielbewunderten Schönheit. Katja war mit siebzehn Jahren nach Allsberg gekommen, nachdem ihre beiden Eltern kurz nacheinander gestorben waren. Das Mädchen hatte die familientypischen roten Haare und wusste ganz genau, was es wollte. Der Baron liebte sie sehr. Sie leistete ihm Gesellschaft, was er genoss, selbst wenn sie von langweiligen Kunstausstellungen in Zürich oder München schwatzte. Aber Katja hörte ihm auch zu, und das gefiel ihm über alle Maßen, wie er sich lächelnd eingestand, wenn sie ihn veräppelte und seine Ansichten nicht ernst nahm. Sobald sie abends neben ihm saß, fühlte er sich jung und geliebt. Das war schön. Daher sah er es ihr auch nach, dass die Freunde und Kommilitonen, die sie manchmal in Allsberg anschleppte, alles andere als standesgemäß waren.
„Reg dich nicht auf, schließlich bin ich ein Bankert“, hatte sie lachend gekontert, als er dieses Thema einmal angesprochen hatte.
„Sie ist halt ein rechter Handfeger“, urteilte die Soffi, die Schlossköchin, immer wieder.
Im Schloss wohnten außerdem noch seine drei Schwestern Donata, Huberta und Philippa.
Donata war mit einem französischen Prinzen verheiratet gewesen. Ein aufgeblähter Nichtsnutz, fand der Baron. Dass die Ehe nicht gehalten hatte, wunderte niemanden, Schorsch am allerwenigsten. Sie hatte einen Sohn und eine Tochter, die nach dem Vater geraten waren. Je mehr Abstand er zu diesen Leuten hielt, desto lieber war es ihm.
Huberta hatte Herbert Graf von Braunsfeld geheiratet. Ein Sesselfurzer in einem Ministerium in Hannover. Der Schwager war so langweilig, dass allein der Gedanke an ihn Schorsch schläfrig machte. Auch Huberta hatte zwei Kinder, die es nur selten nach Allsberg verschlug. Gut so.
Nur die jüngste seiner Schwestern mochte der Bruder gern. Philippa hatte als Einzige bürgerlich geheiratet, und zwar den Diplomaten Dr. Peer Brunnmeister. Schorsch bedauerte es zutiefst, dass auch diese Ehe gescheitert war. Er schätzte den Schwager sehr, aber er verstand, dass der Unfalltod des gemeinsamen Sohnes Sven die beiden Eheleute auseinandergetrieben hatte.
Sven war sein Patensohn gewesen. Bei einer Motorradtour durch Südamerika war er mit seinem Motorrad unter einen Autobus geraten und seinen Verletzungen erlegen. Philippa wusste, dass ihr Bruder Georg diese Reise gegen den Willen des Vaters ermöglicht hatte, indem er dem abenteuerlustigen Patensohn einen stattlichen Geldbetrag hatte zukommen lassen. Nun machte er sich schwere Vorwürfe und war seiner Schwester unendlich dankbar, dass sie es ihm nie nachgetragen hatte. Mit ihr verstand er sich am besten. Doch wenn es nicht unbedingt sein musste, vermied er den Kontakt zu seinen Schwestern generell, sie waren einfach zu neugierig.
Anders lag der Fall mit seiner Mutter, die von den Enkeln Groma genannt wurde. Seinen Vater, Wendt Tröger, eigentlich Carl-Wendt Tröger, hatte sie blutjung geheiratet. Da war sie gerade mal achtzehn und eine Schönheit gewesen. Heute, mit ihren fünfundsiebzig Jahren, sah man ihr die Schönheit ihrer Jugend immer noch an. Sie war eine beeindruckende Erscheinung, hager und aufrecht, eine Respektsperson. Die gebürtige Baroness von Zott aus Oberfranken hatte ihren Sohn stets darin unterstützt, wenn es um den Erhalt und die Mehrung des Besitzes gegangen war, selbst dann, wenn das, was er unternahm, gelegentlich ihren Moral- und Wertvorstellungen zuwiderlief. Der Glaubenssatz aller fränkischen Adelsfamilien war ihr in Fleisch und Blut übergegangen: „Das Zeug muss zusammengehalten werden.“ Schorsch vermied es vorerst, mit ihr über das Zerwürfnis mit seinen Söhnen zu sprechen. Er wusste, dass sie das ganz bestimmt nicht gutheißen würde. Denn noch höher in der Werteordnung, als den Besitz zusammenzuhalten, rangierte das Gebot, diesen von Generation zu Generation im Mannesstamm weiterzugeben. „Wenn der liebe Gott dir schon zwei Söhne geschenkt hat, dann versündige dich nicht an ihm, indem du beide verscheuchst!“ Es war ihm vollkommen klar, dass sie sich so äußern würde.
Aber was waren das schon für Söhne? Der eine, Karl, machte Musik. Es gab kein Instrument, mit dem er seinem Vater noch nicht lautstark auf die Nerven gegangen wäre. Interesse für den Betrieb? Fehlanzeige!
Zwei Jahre nach dem Tod seiner Mutter hatte Karl sich immer mehr vom Vater abgewandt. Nach dem Abitur ging er nach München, um Musik zu studieren. In den Schwabinger Kneipen wurde er bald zu einer bekannten Jazzgröße. Für den Vater war es ausgesprochen peinlich, wenn er im Winter auf den Treibjagden erfuhr, man habe seinen Sohn in der Occamstraße spielen gehört. „Ach was!“, wehrte er stets ab. „Ein Tröger an der Klarinette? Ich bitte dich!“
Wann genau war es eigentlich zum Bruch gekommen? Als Karl den Vater mit einer jungen Brünetten in Lech beim Après-Ski überraschte? „Dirty old man“ hatte er ihn genannt … Oder als er dem Sohn vorwarf, mit seinem Gedudel die Familie lächerlich zu machen?
Der guten Ordnung halber hatte er Karl an dessen einundzwanzigstem Geburtstag, am 4. April 1974, gefragt, ob er „den Betrieb“ übernehmen wolle.
Karl war explodiert: „Merkst du denn nicht, wie der Anton dir in den Arsch kriecht? Merkst du nicht, wie er dir schleimt, damit du denkst, der soll’s machen, und ich bin nur ein unzuverlässiger Künstler und Hippie? Leck mich am Arsch! Du bist so verdammt selbstgefällig und arrogant, dass du nicht einmal mehr das erkennst, was vor deinen Augen passiert! Mach in Zukunft deinen Dreck allein, vergiss, dass ich dein Sohn bin! Du liebst doch nur diesen gottverdammten Betrieb. Dass du womöglich deinen Sohn lieben könntest, davon habe ich nie etwas gespürt. Immer nur Leistung zeigen, besser sein als der andere, inneren Schweinehund besiegen! Ich verbiege mich nicht, und darum will ich das Zeug nicht.“
Wenige Tage später hatte er Karl testamentarisch auf den Pflichtteil gesetzt. Sein Stammhalter hatte ihn beleidigt und enttäuscht.
Und nun war ihm Ähnliches auch mit Anton passiert! Schlimmer noch, das war ein Umsturzversuch gewesen.
„Du wirst immer reichlich zum Leben haben, auch für deine Weibergeschichten. Aber du musst alles an mich übergeben. Schließlich bin ich Eigentümer, und ich habe keine Lust, auf deinen Tod zu warten, bis dein blöder Nießbrauch erlischt. Ich will einfach nicht mehr von dir kontrolliert und ferngesteuert werden. Ich will endlich selbst entscheiden, was Sache ist. Weißt du, warum ich das von dir verlange? Weil du dafür gesorgt hast, dass ich mich mein ganzes Leben lang für minderwertig halten musste. Wenn Karl und ich uns prügelten und ich als Jüngerer natürlich den Kürzeren zog, hast du nur gesagt: Dann musst du halt stärker zurückhauen. Wie denn, wenn ich doch jünger und schwächer war? Und wie ich damals im See fast ertrunken wäre, hast du am Ufer gestanden und die anderen angefeuert. Erinnerst du dich? Ich hatte einen Krampf und wäre fast abgesoffen, aber für dich war nur wichtig, zu sehen, wer das Wettschwimmen gewinnt. Sieht so väterliche Liebe aus? Als ich noch ein Kind war, hast du mich immer wissen lassen, dass Karl den Besitz übernehmen wird. Da habe ich mich eben angestrengt und Interesse für den Betrieb gezeigt, nur damit du vielleicht merkst, dass ich auch ein geeigneter Erbe sein könnte. Als du den Karl enterbt hast, war ich von einem Moment auf den anderen plötzlich dein Erbe, jetzt war ich auf einmal gut genug. Aber wenn das schon so ist, dann will ich auch nicht, dass du bis zu deinem Tod hier wirtschaftest. Du hast noch gute fünfundzwanzig Jahre, dann bin ich fast fünfzig. Soll ich mir bis dahin ein eigenes Leben, eine eigene Familie aufbauen, nur um dann alles wieder aufzugeben, wenn der hohe Herr in die ewigen Jagdgründe eingeht? Du hast mein Leben bisher versaut, und offenbar willst du das auch weiter so handhaben. Ich mache da nicht mit. Verzichte auf deinen Nießbrauch, oder du wirst dein blaues Wunder erleben! Ich erwarte deine Antwort bis morgen.“
Nun saß er hier auf seinem Hochsitz und wusste vor Ärger nicht ein noch aus. Blanke Wut packte ihn. Dieser Schnösel! Vierundzwanzig Jahre alt und den Vater wegbeißen wollen? Mit sechsundfünfzig in den Ruhestand geschickt werden, ja wo kommen wir denn da hin?
Keiner wusste besser als er selbst, wie „der Betrieb“ funktionierte. An Weinbau ohne seine fachliche Assistenz war gar nicht zu denken. Es war schon richtig so, dass sie ihn alle den „alten“ Baron nannten, nur war er eben nicht alt und grau, sondern alt und lebenserfahren. Sein ganzes Leben hatte er „dem Betrieb“ geweiht, er hatte für nichts anderes gelebt, na ja … Ein Lächeln umspielte seine Lippen.
Nie hatte er vorgehabt, den Stab vor seinem Tod an seinen Nachfolger abzugeben. In den Sielen wollte er sterben, das hatte er sich fest vorgenommen. Alles in die nächste Generation hinübertragen, dafür hatte er gekämpft und würde er bis zum letzten Atemzug weiterkämpfen. Aber er hatte überhaupt keine Lust, zu Lebzeiten mit ansehen zu müssen, wie Anton alles anders, sprich: falsch machen würde. Er selbst hatte mit siebenundzwanzig übernehmen müssen, der Vater war früh gestorben. Das war eine Zeitenwende gewesen, ein paar Jahre nach Kriegsende. Natürlich hatte er alles ganz anders machen müssen als sein Vater! Wohingegen Anton doch gar keinen Grund hätte, etwas zu ändern, es lief ja alles wunderbar.
Georg Freiherr von Tröger war ein geachteter, gestandener Mann, ein Herr alter Schule. Ihm begegnete man mit Hochachtung, manchmal auch mit Ehrfurcht. Wer ihm widersprach, wusste nicht, was er tat, oder musste schon ausnehmend gute Gründe dafür haben.
Mit leeren Augen sah der Baron auf die Landschaft vor sich. Die Abendsonne schien sie von Minute zu Minute lieblicher und anziehender zu machen. Wie so oft, wenn er allein war, meinte er, die Stimme seiner verstorbenen Frau Agnes zu hören. Er hatte sich daran gewöhnt, empfand es manchmal sogar als angenehm, wie sie dafür sorgte, dass er die Welt aus einem anderen Blickwinkel betrachtete.
„Aber Schorsch, der Anton hat doch gar nicht gesagt, dass er etwas anders machen will. Er will es nur selbst machen.“
Er dachte kurz darüber nach, dann brüllte er in die Abendstille hinaus: „C’est le ton qui fait la musique!“
Ein kapitaler Bock und zwei Ricken sprangen verschreckt auf den Wald zu. Der Baron sah es, aber es war ihm egal.
Als er vom Hochsitz hinabstieg, meldete sich Agnes noch einmal: „Ja, es ist der Ton, der die Musik macht. Aber sei mal ehrlich, wie hat eigentlich deine Musik über all die Jahre geklungen?“
Dem Baron war jetzt nicht nach Ehrlichkeit mit sich selbst zumute.
3. Kapitel
München, 1964
Katja durfte mit ihrer Mama nie kuscheln. Die große, die bewunderte, die umschwärmte Schauspielerin Therese Riedmüller war zu sehr mit sich selbst beschäftigt, als dass sie ihrer Tochter viel Aufmerksamkeit hätte schenken können. Sie war mit fünfunddreißig zum ersten und einzigen Mal Mutter geworden und liebte ihre rothaarige Tochter, war sich aber auch darüber im Klaren, dass das Kind ihrer Karriere nicht zuträglich war. Deshalb war die Riedmüller in der Wahrnehmung ihres Münchner Publikums nie Mutter, sondern stets nur strahlende Diva.
Katja merkte davon zunächst nichts. Sie sah ihre Mutter selten. Wenn sie zur Schule ging, schlief Mama noch. Mit dem benachbarten Metzger war ausgemacht, dass sie sich täglich ein Pausenbrot abholen konnte. Am Freitag war es immer mit Gelbwurst belegt, die mochte sie am liebsten.
Mit ihren Freundinnen redete Katja nur selten über ihre Familie. Sie hatte keinen Vater, wie man damals noch sagte. Das mussten aber nicht alle wissen, fand sie.
Nachmittags saß Mama meistens im Morgenmantel auf dem Sofa und hatte irgendeine Gesichtsmaske aufgetragen. Entweder las sie die Theaterkritiken in der Abendzeitung oder telefonierte mit den einschlägigen Kulturredakteuren der Stadt. Da passte Kuscheln einfach nicht dazu.
An ein Kindermädchen erinnerte Katja sich nicht. Sie hatte eine Ersatzoma, die Nachbarin Frau Gundermann, die sie abends zu Bett brachte. Die beiden Frauen und sie, das war Katjas Familie. Mamas Eltern waren bereits gestorben, und Geschwister gab es keine.
Wenn Ferien und spielfreie Zeit zusammenfielen, nahm Mama sie mit nach Wien. Dort wohnte Angelo, ihr Freund, der auch manchmal in München aufkreuzte. Eine Gelegenheit, mit ihrer Mutter zu reden, ergab sich da eigentlich nur auf der langen Bahnfahrt.
Mit zunehmendem Alter begann Katja allerdings, sich stärker dafür zu interessieren, wer ihr Vater war. Mama gab ausweichende Antworten, was nur dazu führte, dass die Frage drängender wurde.
Frau Gundermann hatte eine Idee, schon allein deshalb, weil es auch sie brennend interessierte, das wohlgehütete Geheimnis zu lüften.
Eines Abends erklärte sie, dass unverheiratete Väter Alimente bezahlen müssten. „Schau mer uns die Kontoauszüg amal näher an.“
Und bald schon stießen die beiden Neugierigen auf monatliche Einzahlungen von einem gewissen Prof. Dr. Magnus Freiherr von Tröger.
Einige Tage später hatte Frau Gundermann herausgefunden, wo dieser Professor mit dem langen Namen arbeitete: im kunsthistorischen Institut der Universität.
Wenige Tage später bat Katja ihre Mutter, mit Freundinnen ins Schwimmbad gehen zu dürfen. Aber statt zu schwimmen, fragte sie sich nach dem kunsthistorischen Institut durch. An der Pforte meinte der alte Mann in seinem Glaskasten: „Na, das junge Fräulein ist ja wohl noch zu jung zum Studieren, wo will es denn hin?“
„Ich will zum Professor von Tröger, das ist nämlich mein Papa.“
Dieser Satz ging wie ein Lauffeuer durchs Institut, aber zunächst einmal wirkte er als Türöffner. Der Pförtner begleitete Katja bis zum Vorzimmer des Professors und stellte sie „der guten Meyereck“, wie der Professor sie nannte, vor. Später sagte sie: „Die roten Haare und dieser Mund – ja, da war ich gleich ganz sicher.“ Sie öffnete die Tür zum Chefzimmer und schob Katja hinein.
„Grüß Gott, ich bin die Katja“, sagte das Mädchen zu dem über ein Buch gebeugten Rücken. Langsam drehte sich der Bürostuhl, und Katja blickte in das Gesicht eines hageren Mannes. Als er aufstand, war er auf einmal ganz groß, und dann plötzlich wieder ganz klein, als er vor Katja in die Knie ging, sie umarmte und flüsterte: „Endlich, Katja, endlich, endlich!“
Katja roch eine seltsame Mischung aus Zigarettenrauch, Rasierwasser und lange nicht gelüftetem Jackett. So riechen also Männer, dachte sie. Sie betrachtete ihren Vater. Er hatte volles rotes Haar mit einigen grauen Strähnen. Seine Hautfarbe erinnerte an eine einzige riesige Sommersprosse, die, von kleinen weißen Pünktchen unterbrochen, das ganze Gesicht überzog. Das Schönste an ihm, so dachte Katja, sind die Hände. Sie waren schmal und lang. Als der Vater Katjas Blick bemerkte, meinte er ganz nebenbei: „Ja ja, das sind meine El-Greco-Hände.“
Prof. Dr. Magnus Freiherr von Tröger ahnte, dass er für das kleine Mädchen wie ein alter Mann aussehen musste, aber das war ihm in diesem Moment unerwarteten Glücks vollkommen egal. Er nahm seine Tochter an der Hand und sagte beim Hinausgehen zur guten Meyereck: „Wir müssen jetzt erst mal ein Eis essen. Und Sie rufen bitte Katjas Mutter an, die Therese Riedmüller, und sagen ihr, wohin sich unsere Tochter verlaufen hat.“
„Die Riedmüller? Die schöne Riedmüller? Das hätt ich dem Chef gar ned zutraut.“ Aber das murmelte sie nur vor sich hin, als die beiden schon draußen waren.
Sie gingen in die Eisdiele, in der der Professor täglich seine Espressi trank. Luigi, der Besitzer, schaute verwundert die unbekannte Begleiterin des Stammgastes an. „La sua figlia?“ Der Professor strich Katja übers Haar und lächelte. „Bravo, bravo, Barone!“ Und schon war Luigi hinter dem Tresen verschwunden. Kurz darauf kam er mit einem Espresso und einer riesigen Portion Eis wieder. „Per la piccola baronessa, piacere.“
„Wie geht es denn deiner Mutter?“
„Ach, die ist doof, die verbietet mir immer alles, dabei bin ich doch schon neun!“ Der Professor erfuhr, dass sich seine Tochter ein Pferd, mindestens aber einen Hund wünschte, dass sie Skilehrerin werden wollte, sich in der Kirche immer langweilte und sich freute, wenn ihre Mutter wenigstens mal die Beatles auflegte, weil sie sonst immer nur noch älteres Zeug hörte. „Weißt du, sie schwärmt für klassische Musik. Manchmal ist es nicht zum Aushalten!“
Während sie so plapperte, studierte er ihr Gesicht. Die roten Haare, die stammten von ihm, auch der Mund kam ihm bekannt vor, aber der Rest war eindeutig Thesi. Gott sei Dank.
Luigis Stimme brachte ihn in die Wirklichkeit zurück. „Eh, professore, il dovere, die Pflicht ruft“, rief er und zeigte auf die Uhr hinter ihm.
„Danke, Luigi, wenn ich dich nicht hätte. – Ich muss ins Seminar, und weißt du was, ich nehm dich einfach mit.“
So kam es, dass Katja ihren Vater in den Seminarraum begleitete, wo schon etwa zwanzig Studentinnen und Studenten warteten.
„Das hier ist meine neunjährige Tochter Katja, und sie soll uns heute dabei helfen, festzustellen, ob das, was ich lehre und was Sie lernen sollen, verständlich ist. Mal sehen, ob es gelingt. Wenn sie es schafft, bis zum Schluss halbwegs stillzusitzen und zuzuhören, bin ich schon zufrieden. Dieses Seminar behandelt das Thema Frühromantik und ihre Maler. Wir sprechen also vom Beginn des 19. Jahrhunderts, und das Bild, über das ich jetzt sprechen werde, stammt aus dem Jahr 1810 und hängt in der Alten Nationalgalerie in Ost-Berlin. Der Maler war Caspar David Friedrich …“
Nach Ende des Seminars nahm der Professor ein Taxi, mit dem er seine Tochter nach Hause brachte. Der Empfang in der Mauerkircher Straße war erwartbar unterkühlt. Thesi schickte Katja in ihr Zimmer und hielt dem Kindsvater eine Standpauke. Sie hatten sich damals im Streit getrennt: Er hatte sie heiraten wollen, doch sie hatte es vehement abgelehnt, sich zu binden.
„Ich habe dir gleich nach der Geburt gesagt, dass das mein Kind ist. Ich will dich weder an meinem Leben noch an dem von Katja teilhaben lassen. Ja, ich habe gelernt, das Kind zu lieben. Aber du weißt ganz genau, dass das alles meiner Karriere nicht gedient hat. Ich musste und wollte allein bestimmen können. Deine antiquierten Vorstellungen von Familie, die konnte ich nun wirklich nicht gebrauchen.“
Erst als sie einmal Luft holen musste, gelang es ihm, klarzustellen, dass er das Kind beileibe nicht entführt hatte und dass die Tatsache, dass Katja vollkommen selbständig den Kontakt zu ihm gesucht hatte, als Beleg für ihre Reife zu sehen war – und für das Bedürfnis, ihren Vater zu sehen.
Das besänftigte Thesi zwar nicht, nahm ihr aber weitere Argumente. Später konnte sie sich auch nicht weiter dagegen wehren, dass Tochter und Vater sich regelmäßig sahen.
Der Professor war glücklich. Er zeigte Katja alles, was er in München liebte, und sie schleppte ihn überall dorthin, wo sie es schön fand. Er merkte dabei, wie blöd und borniert er mit den Jahren geworden war. Hellabrunn, das ist doch was für Kinder, und das Deutsche Museum, da gehen die Leute nur hin, weil sie Knöpfchen drücken wollen und sich dann freuen, wie sich im Schaukasten etwas bewegt. Und dann wetteiferte er mit Katja, wer zuerst das Knöpfchen drücken durfte, und beide begeisterten sich daran, wie daraufhin das Prinzip einer Schleuse anschaulich erklärt wurde. Im Tierpark dachte er an Rilke und teilte mit Katja eine kindliche Freude an den Elefanten, den kleinen Affen und dem Gorilla mit dem Silberrücken.
„Der sieht ein bisschen aus wie mein Bruder Schorsch.“
„Was, du hast einen Bruder?“
„Ja, er wohnt in Franken, geht dauernd auf die Jagd und brummt vor sich hin.“
In der Pinakothek musste Katja herzlich lachen, als ihr der Vater erzählte, seiner Mutter sei es noch als junger Frau verboten worden, die Gemäldesammlung zu besuchen. „Viel zu unanständig, manche Münchner nennen sie diePinackerthek.“
Wenig später, als Katja aufs Gymnasium wechselte, wurde die jeweils erste und die letzte Vorlesung des Semesters unter den Titel „Kunstgeschichte für Jugendliche“ gestellt. Katjas Klasse aus dem Max-Josef-Stift wurde eingeladen. Der Hörsaal war immer gesteckt voll.
Allerdings lief es nun nicht so ab, dass der Professor Tröger die Vorstellung eines Bildes, einer Statue oder einer Epoche aus dem Handgelenk schütteln konnte, wie sonst zumeist. Der Professor wusste, dass er unter Beobachtung seiner neidischen Kollegen stand und gab sich jedes Mal ganz besondere Mühe. Die Kunstgeschichte für Jugendliche entwickelte sich bald zu einem Renner an der Ludwig-Maximilians-Universität.
Katja wusste es natürlich nicht, aber es blieben ihr und ihrem Vater nur noch knappe sechs gemeinsame Jahre. Er war bereits vom Tod gezeichnet, als er mit seiner Tochter nach Berlin fuhr, um die Nationalgalerie im Osten der Stadt zu besuchen und sich den Mönch am Meer von Caspar David Friedrich im Original anzusehen. Im Interzonenzug auf der Rückfahrt waren sie allein im Abteil, und plötzlich sprach der Vater davon, dass ihm nur noch wenig Zeit zu leben blieb.
„Meine geliebte Katja, du weißt ja, dass deine Mutter auch krank ist. Wir haben uns vor einigen Wochen zusammengesetzt, um über deine Zukunft zu reden. Wir waren uns einig, dass du nach unserem Tod nicht in ein Internat kommen sollst.“
Die arme Katja war wie vor den Kopf gestoßen. Obwohl ihre Mutter ganz offensichtlich krank war, hatte sie nie auch nur ein Wort mit ihr darüber sprechen können, und nun erzählte ihr der Vater, dass sie in absehbarer Zeit beide Eltern verlieren würde. Sie hatte Tränen in den Augen, als sie ihn ansah. Sofort nahm er sie in die Arme und strich ihr übers Haar. Wieder roch sie die Mischung aus Zigarettenrauch, Rasierwasser und nicht gelüftetem Jackett. Aber da war noch etwas anderes, ein neuer Geruch, fremdartig und künstlich. War das der Geruch des nahenden Todes?
Katja hob ihr Gesicht dem Vater entgegen und stammelte:
„Aber wo soll ich denn wohnen, wenn ihr beide gestorben seid?“
Ihr Vater holte ein großes weißes Taschentuch aus der Hosentasche und trocknete ihr damit die Tränen ab, dann lächelte er seine geliebte Tochter an und erzählte: „Es war nicht leicht, deine Mutter davon zu überzeugen. Aber sie hat, wie du weißt, keine Verwandten, und schließlich musste sie einsehen, dass es immerhin noch das Beste wäre, wenn du bei meiner Familie wohnst.“
„Beim alten Silberrücken, der immer brummt?“
„Ja, bei meiner Familie, meinem Bruder Georg und seinen beiden Söhnen. Sie wohnen auf einem riesigen Schloss. Dort lebt auch meine Mutter, deine Großmutter, du wirst sie mögen. Und natürlich wirst du dort auch die Soffi kennenlernen. Das ist die Schlossköchin, sie hat ein so großes Herz, dass fast die ganze Welt hineinpasst, und du sowieso.“
„Aber ich kenne alle diese Menschen doch gar nicht.“
Damit hatte Katja zweifellos recht.
„Ja, ich weiß, mein Liebes. Die sind ganz anders als wir, sie leben anders als wir, und sie denken anders als wir. Aber ich bin felsenfest davon überzeugt, dass sie dich alle mit Liebe willkommen heißen werden. Und wenn du dich einmal allein und traurig fühlst, dann gehst du hinauf in die alte Bibliothek, dort riecht es vielleicht noch ein wenig nach mir. Ich war der Einzige, der dort oben in den Büchern gelesen hat. In der alten Bibliothek habe ich einen Großteil meiner Jugend verbracht …“
Als der Zug in den Münchner Hauptbahnhof einfuhr, hatte der Professor Magnus von Tröger seiner Tochter gerade die Allegorien in der Deckenmalerei der alten Bibliothek auf Schloss Allsberg erklärt.
Er starb im April 1972. Nur wenige Monate später starb auch ihre Mutter. Katja, das Stadtkind, landete als Vollwaise auf dem Land, in einem Schloss und umringt von Menschen, die ihr sagten, sie seien mit ihr verwandt.
4. Kapitel
Allsberg, Januar 1972
Lieber Schorsch, mein Bruder!
Deine von mir so verehrte Agnes ist nun seit fast zwei Jahren tot. Hast Du von ihrer Krankheit gewusst? Für uns Außenstehende kam alles so schnell! Kaum einen Monat nachdem wir erfuhren, dass sie krank war, trafen wir uns alle schon auf dem Allsberger Familienfriedhof. Dort liegen Ehepaare nebeneinander. Wo werde ich hinkommen?
Ich bitte Dich, einen würdigen Platz auf dem Friedhof zu finden. Anerkennung vonseiten der Familie ist mir egal, ich hätte es nur ganz gern, wenn man mich auf unserem Friedhof, in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, begraben würde. Für die Beerdigungskosten habe ich meinem Rechtsanwalt und Testamentsvollstrecker bereits eine angemessene Summe übergeben. Darf ich darauf hoffen, dass Du die Trauergemeinde ins Haus bitten wirst? Es werden viele Kollegen, Mitarbeiter und Freunde aus der Universität kommen. Gib ihnen Kaffee und Käsplootz, wie es gute fränkische Tradition ist.
Du merkst, ich schreibe Dir, weil ich weiß, dass ich bald sterben werde. Leberkrebs, damit ist nicht zu spaßen. Glücklicherweise geht es schnell.
Deine Trauer über den Verlust des jüngeren Bruders wird nicht allzu schlimm ausfallen. Ich nehme es Dir nicht übel, es wäre im umgekehrten Falle nicht anders. Es ist tragisch, dass wir nie ein brüderliches Verhältnis entwickeln konnten. Haben wir um die Gunst unserer Eltern gebuhlt? Verstanden wir uns deshalb in einem ständigen Wettkampf miteinander? Wolltest Du mich austricksen, weil Du befürchtetest, nicht der Erbe in den Augen unseres Vaters zu sein? Ich habe Dich immer als den Stärkeren empfunden und deshalb gar nicht erst zu kämpfen begonnen.
Was, wenn ich mich der Herausforderung gestellt und Vater an mich übergeben hätte? Eines ist sicher: Du, der Erstgeborene, wärst zutiefst gekränkt gewesen. Du wärst wahrscheinlich ausgewandert, weil für uns beide am selben Ort kein Platz gewesen wäre. Etwas anderes ist auch sicher: Ich hätte es nicht so gut gemacht wie Du. „Der Betrieb“, das war für Vater und ist für Dich eine Religion. Ihr geht zwar am Sonntag in die Kirche, aber der wahre Gott ist „der Betrieb“. Als Vater sich in den letzten Tagen des Krieges dem Wehrmachtsoffizier entgegenstellte und verhinderte, dass Allsberg gegen die vorrückenden Amerikaner verteidigt wurde, war das mutig, unerhört mutig sogar, weil er damit sein Leben aufs Spiel setzte. Ich habe mit ihm noch bei meinem letzten Besuch in Allsberg darüber gesprochen. Ich war und bin stolz darauf, einen Helden zum Vater zu haben, sagte ich zu ihm.
Er hat abgewunken und gelächelt. „Magnus, du kennst mich doch, natürlich habe ich an das Dorf und die dort lebenden Menschen gedacht. Aber wenn nicht auch der Betrieb und das Schloss in Gefahr gewesen wären, hätte ich das wahrscheinlich nicht gemacht.“
Er ist auf dieses Thema nicht wieder zurückgekommen, sondern hat darüber gesprochen, wie froh er sei, Dich auf Deine Aufgabe als sein Nachfolger gut vorbereitet zu wissen, wie glücklich demnach die Übergabe auf die nächste Generation gelungen sei. Wenn ich richtig gerechnet habe, dann bist Du, Schorsch, bereits der fünfundzwanzigste Tröger auf Allsberg, semperaugustus.
Ich habe ein schönes und in meinen Augen erfolgreiches Leben gehabt. Die Professur am kunsthistorischen Institut der Münchener Universität hat mich ausgefüllt und glücklich gemacht. Der Kontakt mit jungen Leuten hat mich davor bewahrt, im Vergangenen zu leben. Die Professur habe ich mir durch harte Arbeit verdient. Die Ehrungen kamen dann wie von selbst. Komisch, ich bin dennoch stolz auf sie. Der Verdienstorden der Italienischen Republik hat damals Agnes sehr gefreut. Du kennst ja ihre Vorliebe für alles Italienische.
Nun, ich komme ins Schwafeln, weil ich mich vor dem wirklichen Grund für diesen Brief zu drücken versuche:
Ich habe eine riesige Bitte, und ich appelliere damit an Deinen Familiengeist: Ich hinterlasse eine Tochter. Ihre Mutter ist Therese Riedmüller – vielleicht erinnerst Du Dich, sie spielte früher an den Kammerspielen. Du hast sie gesehen, als wir vor vielen Jahren gemeinsam das Stück Dr. med. Hiob Pretorius sahen. Sie spielte darin die Violetta Höllriegel. Du warst begeistert von ihr. Ich war es auch. Zur Heirat hat es nicht gelangt, aber zu einem Kind, einer Tochter, sie heißt Katja. Ja ja, ich weiß, ein unmöglicher Name, aber als natürlicher Vater hat man keinen Einfluss auf die Namensgebung. Therese, ich nannte sie Thesi, hat keine nahen Verwandten, und sie schrieb mir neulich, ihre Herzschwäche habe sich verschlimmert. Die Ärzte geben ihr nun auch nicht sehr viel mehr Zeit, als sie mir geben. Katja ist die Alleinerbin ihrer Mutter, und meine natürlich auch. Katja wird in Zukunft also nicht reich sein, aber sehr wohlhabend. Das Materielle muss nicht Deine Sorge sein. Aber sie braucht ein Zuhause. Ich möchte nicht, dass sie in eine Pflegefamilie kommt. Also haben Thesi und ich unsere jeweiligen Testamentsvollstrecker entsprechend instruiert, und wir haben Dich beide als Vormund vorgeschlagen. Bitte übernimm diese Aufgabe, und sei es nur als Sühne dafür, dass Du überall herumposaunt hast, ich würde aus gewissen Gründen nie Vater werden. Es amüsiert mich, dass ich Dich nun in Gestalt eines rothaarigen Mädchens Lügen strafe. Sie ist etwa so alt wie Deine Buben und wird gut ins Haus passen.
Lieber Schorsch, mein Bruder, ich wünsche Dir ein gutes Leben und einen gnädigen Tod. Vor allem aber wünsche ich Dir, dass es Dir gelingt, „den Betrieb“ sicher an die nächste Generation weiterzugeben. Dafür lebst Du. Ich kann das verstehen. Ich hoffe, Du wiederum verstehst, dass ich ein anderes Leben gewählt habe und dennoch glücklich geworden bin.
Grüße bitte Deine Buben von mir.
Dein Bruder Magnus
München, am 3. Januar 1972
Baron Tröger ließ den Brief sinken. „Jetzt tut der mir den Tort an und ist doch nicht schwul!“, brach es spontan aus ihm heraus.
Allenthalben hatte er keinen Zweifel daran gelassen, was er von Kunstprofessoren im Allgemeinen und von schwulen darunter im Speziellen hielt. Dass das Verhältnis zu seinem Bruder dadurch nicht besser wurde, war durchaus gewollt. Das fehlte gerade noch – der mit seiner Bagage im Haus auf Besuch, nie und nimmer!
Und jetzt das. Zu seiner Verwunderung machte ihn die Ankündigung des baldigen Todes von Magnus doch traurig. Enorm traurig sogar. Zu seinen Schwestern hatte er nie ein wirklich brüderliches Verhältnis gehabt. Er spürte, dass sie neidisch auf ihn waren, weil der Vater sie gezwungen hatte, auf ihren Pflichtteil zu verzichten, damit der Betrieb in eine Hand, nämlich die des ältesten Sohnes, überging. Magnus war nie neidisch gewesen, Philippa, die Jüngste, eigentlich auch nicht.
Jetzt musste er feststellen, dass er seinen Bruder nicht wirklich kannte.
Magnus starb im April und wurde auf dem Familienfriedhof begraben. Schorsch war froh, einen sehr würdigen Platz für ihn unter der Linde gefunden zu haben. Er hätte sich sonst schämen müssen, denn zur Beerdigung kam eine nicht enden wollende Schlange schwarzer Dienstlimousinen angefahren. Lauter Leute, die man aus der Zeitung kannte. Die Reihe der Grabredner wollte nicht enden, die Kränze häuften sich.
Beim Frühstück am nächsten Morgen fragte Karl seinen Vater:
„Warum hast du uns diesen Onkel eigentlich immer vorenthalten? Hätte ich gewusst, dass es auch musisch begabte Trögers gibt, hätte ich mich nicht zeitlebens als Außenseiter gefühlt.“
Ende August dann fuhr der Baron zur Beerdigung von Therese Riedmüller nach Rottach-Egern. Dr. Eibel, ihr Rechtsanwalt und Testamentsvollstrecker, meinte fast entschuldigend:
„Teuer ist’s halt scho, so ein Grab am Tegernsee, aber wertbeständig ist’s auch … Ja, das waren wir der Thesi praktisch schuldig, net wahr? Die Katja hat g’sagt, sie fahrt gleich mit Eana hoam. Die Thesi hat ja praktisch koa Verwandschaft ghabt, drum hat sie am End eing’willigt, dass des Madl praktisch zu Eana kimmt.“
„Verzeihen Sie, aber wenn ich Sie richtig verstehe, sprechen Sie von der Verstorbenen. Sie hieß Therese Riedmüller, dann wollen wir sie doch bitte auch so nennen.“
Zu dem rothaarigen Mädchen, das da etwas verloren am offenen Grab stand, sagte der Baron. „Dann können wir ja losfahren, praktisch losfahren, wie man hier sagt.“ Da war einfach nichts zu machen, er konnte die Bayern nicht ausstehen.
Er nahm das Mädchen an der Hand und führte sie zu seinem grünen Mercedes.
Sie setzte sich vorne neben ihn, und als sie sich angeschnallt hatte, meinte sie: „Du bist also mein Onkel, der Bruder von meinem Papa. Wie soll ich zu dir sagen?“
„Onkel Schorsch, bitte.“
„Aber du heißt doch Georg.“
„In Franken heißen alle Georgs Schorsch.“
Zuerst dachte der Baron, er müsse das junge Ding neben sich trösten, das Mädchen war ja immerhin Vollwaise.
„Weißt du, Onkel Schorsch, mein Vater ist im April gestorben, jetzt auch noch meine Mama. Ich wusste, dass beide schwer krank waren. Vielleicht habe ich zu viel im Voraus geweint. Ich weiß, es klingt altklug, aber jetzt sehne ich mich danach, nicht andauernd traurig sein zu müssen. Ich stehe ja auch vor einem ganz neuen Lebensabschnitt.“
„Gut, dann frag mich aus nach deinem neuen Zuhause.“
Und so erzählte der Onkel Schorsch, dass er in einem riesigen Kasten wohnt. Er heißt Schloss Allsberg und ist viel zu groß für das, was der Betrieb abwirft. Die Trögers haben nie das Geld gehabt, so etwas hinzustellen. Allerdings hat der Bruder von Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßvater Rudolf, der legendäre Onkel Max, sein Glück in Russland gemacht. Er hatte es dort bis zum General gebracht, und wie man in der Familie erzählt, ist er mit Gold, Weihrauch und Myrrhe beladen wieder nach Hause zurückgekehrt. Er erklärte damals seinem Bruder Rudolf, dass er nicht verheiratet sei und auch nicht vorhabe, diesen Zustand zu ändern. „Lass mich ein Stück Land aussuchen, ich bau mir ein Haus darauf, und wenn ich sterbe, geht es wieder an die Familie.“
„Weißt du, Katja, bei uns ist es extrem wichtig, dass ‚das Zeuch’, wie wir Franken sagen, zusammengehalten wird.
Onkel Max baute allerdings kein Haus, sondern ein riesiges Schloss, das der Familie noch so manches Kopfzerbrechen bereiten sollte. Es ist ein Angeberschloss und im Unterhalt einfach zu teuer. So groß ist unser Betrieb nun auch wieder nicht.“
„Wenn ihr kein Geld habt, warum hast du dann einen dicken Mercedes?“ Onkel Schorsch schaute angestrengt in den Außenspiegel, und es schien Katja, als ob er er ein Lachen verbergen wollte.
Schorsch erzählte später, dass dies der Moment gewesen sei, in dem seine unendliche Zuneigung zu Katja begonnen habe. Er war amüsiert und begriff sofort, dass seine Nichte mit dieser Frage ihren kleinen Finger in eine riesige Wunde gelegt hatte.
Er tat so, als habe er die kleine Frechheit nicht gehört, und erzählte weiter: „Onkel Max, so nennen wir ihn noch immer, beauftragte den italienischen Architekten Antonio Petrini, der damals viel für die Fürstbischöfe in Bamberg und Würzburg gebaut hat. Unzählige Kirchen und Klöster hat er entworfen, unter anderem das Juliusspital in Würzburg und Schloss Seehof bei Bamberg. Er war der Modearchitekt der Zeit, und es muss wohl sein Reichtum gewesen sein, mit dem Max den alten Petrini überzeugte, auch einmal den Auftrag eines lutherischen Ketzers anzunehmen. Ehe das Bauwerk fertig war, starb Petrini im Jahr 1701, und es wird berichtet, dass der damalige Fürstbischof von Würzburg, Johann Philipp von Greiffenclau, sagte, als er davon erfuhr: ‚Den hat der Satan geholt. Kein Wunder!‛ Trotz des Todes des Architekten wurde der Bau fertig, Geld spielte ja keine Rolle. Und so ist Schloss Allsberg eines der wenigen Schlösser in Franken, das wie aus einem Guss im späten Renaissancestil, fast schon Barockstil gebaut wurde. Nur die Deckenfreskos in der alten Bibliothek und im Gartensaal sind wirklich barock. Das Haus ist ein nach Süden hin offenes Viereck, bestehend aus drei Ebenen. An den offenen Enden erheben sich zwei Türme mit je einem Stockwerk mehr. Oben im Westturm haben übrigens Karl und Anton, deine beiden Vettern, eine Disco eingerichtet.“
Sie waren bereits von der Autobahn abgebogen, als Katja fragte: „Onkel Schorsch, warum lerne ich dich erst jetzt kennen?“
Der Gefragte wand sich etwas, aber bevor er in die Verlegenheit geriet, ehrlich antworten zu müssen, kicherte Katja und verriet dem Onkel prustend, dass ihr Vater in Hellabrunn einmal gesagt habe, der alte Gorilla sehe aus wie sein Bruder.
Als sie in Allsberg ankamen, war es bereits dunkel geworden. Onkel Schorsch stellte den Mercedes auf dem Schlosshof ab und führte Katja ins Haus, wo die Soffi bereits voller Ungeduld auf den Neuankömmling wartete.
5. Kapitel
Allsberg, am Abend desselben Tages
„Geh her, mei Mädla, ich bin die Soffi, die Schlossköcha.“
Und dann versank Katja in kräftigen Armen und wurde an einen großen und weichen Busen gepresst. Verstanden hatte sie eigentlich nicht, was man da zu ihr sagte, aber sie verstand wohl, was ihr da entgegenströmte: Es war Liebe, es war Zuneigung, es war ein Willkommen, begleitet vom wohligen Geruch nach Küche.
Die Soffi sagte von nun an immer nur „mei Mädla“ zu ihr. Und wie Katja schon bald herausfand, war die Soffi im ganzen Haus der einzige Mensch, der sein Herz offen mit sich herumtrug. Da gab es keine Vorbehalte, die der Konvention, dem Benimm geschuldet waren. Zuneigung, Lachen und Liebe äußerten sich bei ihr ebenso spontan wie Zorn, lautes Schimpfen und Ablehnung. Wehe dem, der bei der Soffi in Ungnade fiel.
Jetzt aber führte sie den Neuankömmling erst mal auf sein Zimmer. Es befand sich im mittleren Stockwerk und hatte ein eigenes Bad.
„Da“, sagte die Soffi und deutete auf das Wurstbrot und das Glas Apfelsaft neben dem Bett. Dann gab sie Katja einen Kuss auf die Backe und ließ sie allein.
Katja grinste in sich hinein: Wenn die Soffi kurze Sätze sprach, verstand sie sie sogar. Als sie ihren Koffer ausgepackt hatte und endlich ins Bett stieg, fand sie auf dem Kopfkissen noch eine Tafel Milka-Schokolade. Mit Tesafilm war ein Zettel daran befestigt, auf dem stand in einer sehr akkuraten und altmodischen Schrift: Willkommen daheim! Besuch mich bitte morgen am Vormittag. Deine Großmutter.
Das schien ja ein ziemlich belebtes Schloss zu sein – Onkel Schorsch hatte auf der Fahrt erzählt, er habe zwei Söhne, Karl mit neunzehn Jahren und Anton mit siebzehn, so alt wie sie selbst. Darüber hinaus gab es die Soffi und auch noch eine Großmutter. Und womöglich war das noch nicht einmal alles.
Dann schlief sie ein. Sie träumte, auf einem Pferd zu sitzen, das sie durch einen wunderschönen Garten trug. Dann aber erschreckte sie, dass hinter jedem Busch, hinter jedem Baum ein Gespenst saß.