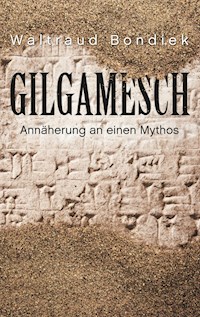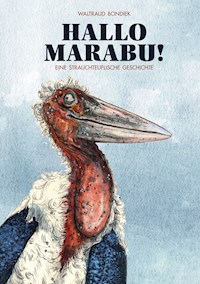Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mitte des 22. Jahrhunderts ist die Erde ein trostloser Ort: die letzten Menschen - vereinzelt, alt und unfruchtbar - leben in einer Welt, die sich selbst aufgegeben hat. Da die Lebenszeit der Einzelnen auf 100 Jahre begrenzt ist - eine Maßnahme aus der Zeit der Überbevölkerung, durch einen Ewigkeitscode gesichert und von niemandem außer Kraft zu setzen - ist das Aussterben der menschlichen Spezies absehbar. Staatliche Strukturen gibt es nicht mehr, die Gesellschaft existiert in einer Form des Anarcho-Kapitalismus, in dem Machtstreben und Besitz bedeutungslos geworden sind. In dieser Welt nähert sich die 98-jährige Alma dem Ende ihres Daseins und wirft einen vielschichtigen, nachdenklichen Blick auf ihr Leben und eine ungesühnte Schuld.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 272
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 0
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Kapitel XII
Kapitel XIII
Kapitel XIV
Kapitel XV
Kapitel XVI
0
Ich bin Alma. Meinen Zunamen müssen Sie nicht kennen. Wir werden einander ohnehin nicht begegnen, denn Sie werden vor mir gestorben sein. Kinderlos. Ich selbst werde an meinem 100. Geburtstag schmerz- und rückstandsfrei aus dieser Welt herausgeschnitten. Eliminiert. Eine Maßnahme aus den Zeiten der Überbevölkerung, gesichert durch einen Ewigkeitscode und durch nichts und niemanden außer Kraft zu setzen. Kein Grab, kein Hologramm, kein digitaler Zwilling wird an mich erinnern.
Im Jahre 2055, also vor achtundneunzig Jahren wurde ich gezeugt, durch einen Geschlechtsakt zwischen Mann und Frau, wie es damals üblich und zur Arterhaltung notwendig war. Ich selbst bin unfruchtbar. Die gesamte Menschheit ist es inzwischen. Es war Notwehr. Die Natur hatte keinen anderen Ausweg mehr gewusst: entweder sie oder der Mensch. In absehbarer Zeit wird homo sapiens von der Erde verschwunden sein.
Noch bin ich achtundneunzig, äußerlich eine Frau in mittleren Jahren, im Wesen eine etwas biestige Alte. Ich pflege eine überzuckerte Feindschaft zu meinen Schwägerinnen Laura und Tilla, die mit meinem geliebten Bruder Ludwig verheiratet waren. Er und ich, wir waren Kinder der Nacht, wir haben unserem Vater nicht das Leben gerettet, sondern ihn umgebracht. So war es. Und niemand hat Schuld.
I
»Atme, atme, du musst atmen.«
Ich schrecke aus dem Schlaf. Da sind Stimmen neben meinem Bett, Kinderstimmen, geisterhaft, dicht an meinem Ohr. Es klingt wie ein Sprechgesang. Liege ich im Sterben? Das wäre ja noch schöner, sage ich mir und ahne, dass ich nur träume, es zu denken, und nur träume, wach in meinem Bett zu liegen und diese Kinderstimmen zu hören.
»Atme, atme, du musst atmen.«
Nein, ich sterbe nicht, ganze zwei Jahre habe ich noch bis zu meinem hundertsten Geburtstag, und das System, das mich dann dem Nichts überantworten wird, hat sich noch nie im Datum geirrt.
Das Wort »sterben« ist im Grunde fehl am Platz, seit der Körper den Prozess des Sterbens überspringt und einfach aus der Wirklichkeit herausgeschnitten wird. Der Übertritt ins Nichts sei völlig schmerzfrei, heißt es, man verschwinde von einem Moment zum anderen, ohne der Nachwelt seinen Leichnam zu hinterlassen, man werde sozusagen in Luft aufgelöst, wobei Luft natürlich nur ein Ersatzbegriff ist, um der Vorstellung etwas an die Hand zu geben, denn ein Nichts und Nirgendwo ist letztlich unbegreiflich. Es widerspricht den Naturgesetzen und ist mit dem Verstand so wenig zu fassen wie die Ewigkeit oder eine Temperatur unterhalb des absoluten Nullpunkts. Und es heißt auch, dass es zu jedem beliebigen Zeitpunkt am hundertsten Geburtstag geschehen könne und es keine den Augenblick ankündigenden Vorzeichen geben werde. Laura, die zugegen war, als es ihren Bruder traf, will den Moment wie einen Riss durch Zeit und Wirklichkeit erlebt haben, wie ein Whiteout, das Gegenteil eines Blackouts. Einen Wimpernschlag lang soll sich ein weißer, völlig leerer, ins Unendliche gedehnter Raum ohne Unten und Oben aufgetan haben. Und Tillas Vater soll sogar versucht haben, sein eigenes Verschwinden zu dokumentieren, indem er sich an seinem hundertsten Geburtstag, punkt null Uhr, vor eine laufende Kamera setzte und dort ausharrte. Besagtes Whiteout soll sich wie eine Bildstörung gezeigt haben, die außer weißen und noch weißeren Pixeln nichts erkennen ließ. Was davon stimmt, was schmückendes Beiwerk ist oder in den Bereich der Fantasie gehört …
»Atme, atme, du musst atmen.«
Wieder diese Kinderstimmen. Es wird einer dieser Klarträume sein, die ich zuletzt als Kind hatte. Mit dem Heranwachsen haben sie sich verloren, scheinen aber jetzt, im hohen Alter, wiederzukehren.
»Atme, atme, du musst atmen.«
»Es reicht!«
Bin ich laut geworden? Ich schlage die Augen auf oder träume, dass ich sie aufschlage. Drei widderköpfige Mädchen in bizarren, altmodischen Kinderkleidchen, geliehen, geklaut oder mitgenommen aus dem Fundus eines Puppentheaters, haben sich am Fußende meines Bettes versammelt und grinsen mich mit geschwärzten Zähnen an. Ohaguro ist wieder in Mode gekommen. Angeblich zelebrieren die Widderköpfigen das Schwärzen der Zähne wie im Alten Japan, brauen sich nach Originalrezepten die schwarzen Tinkturen zusammen und verwenden zum Färben die gleichen Gerätschaften, wie sie früher von japanischen Frauen höherer Stände und von Prostituierten verwendet wurden.
Ich wedele die Widderköpfigen wie lästige Fliegen beiseite. Sie sind brav und verschwinden aus meinem Schlafzimmer.
Wie jeden Morgen setzte ich nun die Kopfhörer auf und greife in die Bonbonniere auf meinem Nachttisch. Fünf bunte Pillen. Die parke ich unter der Zunge und warte, dass sie brizzeln. Nur brizzelnd entfalten sie ihre konservierende Wirkung, zumindest bei mir, gegen Lauras Altern sind sie offenbar machtlos. Mit achtzig sah sie noch immer wie achtzig aus und jetzt, mit dreiundneunzig, keinen Tag besser. Dennoch finde ich sie ansehnlicher als Tilla, die genauso alt ist, aber ein Opfer schönheitschirurgischer Eingriffe wurde.
In den brizzelnden acht Minuten bleibe ich mit Kopfhörern im Bett liegen, rufe den Wetterkanal auf und höre mir Sendungen aus der Vergangenheit an. Einhundert Jahre Wettergeschehen ist dort versammelt, Nachrichten, Kommentare, Features, Berichte, beginnend mit dem 26. Mai 2023. Für mich ist es ein Vermächtnis an uns Nachgebliebene. Es ist interessant, unterhaltsam und manchmal zum Totlachen komisch, was die Klimaforschung einst prognostizierte. Sie stimmte uns auf die Apokalypse ein, sie kam über uns, die Apokalypse, und war in der Rückschau doch nur ein Präludium vor der Totenmesse.
Der letzte Beitrag wurde am 25. Mai 2123, also vor genau achtundzwanzig Jahren eingestellt. Damals schienen Himmel und Hölle den Weltuntergang beschlossen zu haben. Eine Stimme sprach live von gigantischen Faustschlägen, welche die Küsten aus der Höhe und aus der Tiefe trafen, von einem Aufbrechen des Meeresbodens war die Rede und von einem Brüllen, das aus den Ozeanen kam, Wasser, nichts als Wasser, schäumende, grollende Gebirge bewegten sich auf das Festland zu. Wer auch immer davon berichtete, ein schriller Ton drängte die Stimme mehr und mehr in den Hintergrund, bis da nur noch ein Pfeifen, Heulen und einstürzende Welten waren.
Neue Beiträge sind nicht mehr hinzugekommen. Es leben ja kaum noch Menschen, die etwas in den Podcast hätten einstellen können, keine Berichterstatter, keine Meteorologen, keine Klimaforscher. Und wer wie ich noch unter den Lebenden weilt, wird über kurz oder lang hundert sein und dann im Nichts verschwinden. Wem sollten wir warum etwas mitteilen? Ich wüsste es gar nicht.
Ja, wir sind zu einer aussterbenden Spezies geworden. Die Natur hat den Homo sapiens auf die Schwarze Liste gesetzt, aus Notwehr, denke ich, denn es geht ums Überleben: sie oder der Mensch. Das Mittel ihrer Wahl waren nicht die großen Naturkatastrophen, die waren eher Mahnung, Drohgebärde, bevor sie zum radikalsten Mittel griff und ein Virus, das später Xi genannt wurde, zum Vollstrecker machte. Xi hatte weltweit und unbemerkt ein winziges Detail in den menschlichen Keimzellen verändert. Betroffen waren ausschließlich Erwachsene. Die Infektionen wurden als solche entweder gar nicht wahrgenommen oder als Schlafstörung, Verdauungsproblem oder Fettleibigkeit missverstanden. Nach zwanzig Jahren war Xi so unbemerkt wieder verschwunden, wie es sich eingeschlichen hatte. Sein Auftrag war erfüllt: in achtzig Tagen einmal um die Welt, das zweite Mal in vierzig Tagen, danach in zwanzig, in zehn … Xi hatte alle erwischt, jeden Mann und jede Frau.
Wie tückisch die Strategie der Natur war, zeigte sich erst Jahrzehnte später, denn Xi hatte die Erwachsenen nur als Zwischenwirt benutzt, tatsächlich abgesehen hatte es das Virus auf die folgende Generation, nämlich meine. Und wir mussten erst ins reproduktionsfähige Alter kommen, bevor unsere Unfruchtbarkeit, Mitgift der Eltern, offenbar wurde. Seit fünfundsiebzig Jahren sind keine Kinder mehr zur Welt gekommen.
Nun hat es sich ausgebrizzelt. Mit einem Seufzer nehme ich die Kopfhörer ab und schlage die Nachtdecke zurück. Dann packe ich mein rechtes Bein, mein linkes Bein, bugsiere beide zum Rand der Matratze und schiebe sie über die Bettkante. Es dauert, bis ich es endlich in die Senkrechte geschafft habe. Dabei knackt und kracht es in allen meinen Knochen. Kein Wunder. Der gellende Heulton sämtlicher Sirenen aus den untergehenden Küstenregionen ist mir ins Mark gefahren. Selbst schuld, sage ich mir, nichts zwingt mich, mir diese früheren Beiträge wieder und wieder anzuhören. Dass ich auf diesen Beinen überhaupt noch stehen kann und meine knotigen Füße mich sogar vorwärtsbringen, ist ein Geschenk. Zum Glück schneidet sie der große Spiegel an der Wand gegenüber dem Gespenst im weißen Baumwollnachthemd, dem Gespenst, das ich mir selbst bin, kurzerhand ab. Dafür lässt er den Kopf dran und erinnert mich schmerzhaft an das, was bis in meine mittleren Jahre eine Lockenpracht war. Üppiges, schwarzes Haar hatte ich, kraus wie bei einer Südländerin. Jetzt sind sie weiß und durchscheinend wie Zuckerwatte. Ich mag gar nicht hingucken, wie sich dieses Gespenst damit abmüht, einen abgetragenen Morgenmantel aus Goldbrokat anzuziehen. Ein Arm ist bereits im Ärmel verschwunden, während der andere durch die Luft rudert, damit ich in das geliebte Stück reinkomme. Als es geschafft ist, hangele ich mich von Möbel zu Möbel bis ans Fenster. Die Vorhänge wandern auf Knopfdruck zur Seite. Gelb und wolkenlos hängt der Himmel hinter der Scheibe, gelb und wolkenlos wie jeden Tag, heute in einem stockfleckigen Sumpfdottergelb. Zum Abend hin wird es sich zu einem fauligen Oliv verdichten und schließlich ins Morastige fallen. Außer dem Mond und ein paar Sternen werden Satellitenschwärme über diesen Nachthimmel streichen, schrottreife Raumstationen werden ihre Bahnen ziehen oder abstürzen und im Verglühen meinen Blick fesseln.
Alt, sehr alt fühle ich mich, als ich nach unten ins Badezimmer tappe, eine Hand am hölzernen Treppengeländer.
Das Haus, ein Fachwerkhaus aus dem vorletzten Jahrhundert, ist vollgestopft mit den Jagdtrophäen der Vorbesitzerin, meiner großzügigen alten Freundin Safrane de Jong. Sie hat es mir mit allem Drum und Dran, allem Drunter und Drüber vermacht.
Als es noch gefährliche Tiere in freier Wildbahn gab, war sie auf allen Kontinenten unterwegs gewesen, um ihre Sammlung zu komplettieren, was in ihrem Fall bedeutete, dass sie die begehrte Trophäe zuvor erlegen musste. Die großkalibrige Jagdwaffe hatte sie von ihrem Vater bekommen, ein Geschenk zum fünfzehnten Geburtstag.
Im Laufe ihres hundertjährigen Lebens hat Safrane einiges zusammengeschossen, darunter die sogenannten Big Five of Africa, wie man das Ensemble aus Rhinozeros, Elefant, Büffel, Löwe und Leopard in einer heute nicht mehr gesprochenen Sprache nannte.
Die Innenausstattung ist ein tierisches Erlebnis. Doch der riesige Braunbär in der Diele empfängt inzwischen niemanden mehr, weder Geliebte noch ungeliebte Besucher. Zwei mannshohe Stoßzähne flankieren die Tür ins Esszimmer, und hinter der nächsten Tür schlummert vor dem Kamin ein Eisbärenkopf samt Fell, vergilbt und plattgelegen in all den Jahrzehnten; der aufgerissene Rachen präsentiert ein vollständiges, bestens erhaltenes Raubtiergebiss: zweiundvierzig Zähne, ich habe nachgezählt. Um das Zahnfleischproblem werde ich mich in diesem Leben nicht mehr kümmern. Soll sie doch weiter abblättern, die Farbe, die frisches Beuteblut simuliert und einst so kunstvoll verschmiert wurde. Gestört, wirklich gestört haben mich von Anfang an die vier Elefantenfüße in der Bibliothek. Inzwischen habe ich sie gegen zwei niedrige Holztrittleitern ausgetauscht. Elefantenfußgrau ist eine todtraurige Farbe, besonders dann, wenn es sich um das Grau indischer Arbeitselefanten handelt, das Safrane ausdrucksstärker fand als das der afrikanischen Verwandtschaft.
Treppauf, treppab bleiche Tierschädel an holzvertäfelten Wänden. Sie starren mich aus schwarzen Augenhöhlen an, starren mir nach und tragen schwer an ihren prunkenden Geweihen, Schaufeln und Hörnern in sämtlichen Ausführungen der Natur. Das ist alles nicht mein Geschmack, doch ich habe Safrane versprochen, ihre Trophäensammlung zu erhalten, und stehe zu meinem Wort.
Dieses Haus ist nie zu meinem Haus geworden, und schon gar nicht zu einem Zuhause. Ein Unterkommen bei einer Freundin war es, damals, als ich Ludwigs Frauen in unserem Elternhaus nicht mehr ertrug.
In der Totenstille höre ich die Geschöpfe zuweilen seufzen, als erinnerte sich sogar ihr präparierter Nachlass an eine Welt, die einmal ein Paradies war, bevor es wie jedes Paradies der Zerstörungslust des Teufels anheimfiel.
In den Zoos finden sich keine lebendigen Tiere mehr. Da alle Bemühungen zur Nachzucht fehlgeschlagen sind, präsentiert man die aus Urwäldern, Sümpfen und Steppen verschwundenen Arten in nahezu perfekter Illusion als Hologramme. Sie bewegen sich in lebensechten Farben durch eine lebensecht vorgetäuschte Natur. Mich traf es mitten ins Herz, wie diese digital animierten und wiederbelebten Orang-Utans, Paradiesvögel, Beutelwölfe und Ochsenfrösche sich durch stereotype Bewegungsmuster quälten und synthetisch erzeugte Laute ausstießen. Einen zweiten Zoobesuch habe ich meinem Herzen erspart.
Im Badezimmer dann mein Schaudern, dieses entsetzliche Schaudern jeden Morgen, wenn ich mich des keuschen, weißen Baumwollnachthemdes entledigt habe und meinen Körper bloßgestellt sehe. Sein müdes Fleisch hängt mir von den Knochen wie eine Verwünschung, als trete jede Nacht eine böse Fee an mein Bett und schüttele ihre Fäuste über mir. Dieses farb- und formlose Fleisch steckt in einer labberigen, stockfleckigen Haut, sie riecht ranzig und atmet Verfall. Ich sehe einen Leib, der fast hundert Jahre gelebt hat und verbraucht ist, während mein Zeitgefühl auf der Strecke geblieben ist und es nicht wahrhaben will. Schuld werden die fünf bunten Pillen sein, die ich nach dem Aufwachen brizzeln lasse. Sie sind ein Hexenwerk, täuschen und lügen. Der Spiegel hält mir zwar das Gesicht einer Fünfundsiebzigjährigen entgegen, aber ich spüre, dass mein inneres Gestänge, meine Knochen, dass der Prozess des Verrottens weit fortgeschritten ist.
Ich stelle diesen Körper unter die Dusche. Ich wasche ihn zärtlich wie den eines kleinen Kindes. Das ist mühsam, das ist heilsam, das warme Wasser lässt ihn schmelzen, meine duftende Seife nimmt ihm den Aasgeruch. Sie stammt aus der Vorzeit eines versunkenen Landes mit prunkvoller Geschichte. Aber das Meer hat auch dort seine Wasser in die großen Ströme gedrückt, hat sich der Küstenstädte bemächtigt und sich das Hinterland samt seiner Menschen einverleibt. Und bald schon wird es auch meine Erinnerung an dieses Atlantis, seinen Duft und seine Geschichte nicht mehr geben.
II
Mein Kleid ist schwarz, es bedeckt die Arme, sein Stoff ist leicht, ein Windhauch aus wehendem Chiffon. Schwarz und aus Chiffon ist auch das Tuch, das ich in einer Art Turban um Stirn und Schläfen drapiert habe. Tilla und Laura sollen sich nicht über das mokieren, was mir von meinem einst schönen Haar geblieben ist. Eine mit Haifischzähnen bestückte Kette ist mein Schmuck. Und meine rot geschminkten Lippen. Wie schön, die beiden werden sich erschrecken.
Ich drücke den Türöffner in der Friedhofsmauer, die eisernen Torflügel sperren auf, ich trete hindurch und pralle auf der anderen Seite mit der Sonne zusammen. Eine rötliche Schotterallee, Säulen zu beiden Seiten, läuft wie eine Prozessionsstraße der antiken Welt auf das Große Omega zu. Der mächtige Bau ist an die Stelle des früheren Krematoriums getreten. Wie ein düsteres Kraftwerk steht er vor dem gelbglühenden Himmel. Das Omega-Zeichen aus schwarzem Titan prangt auf der Zementfassade wie ein modernes Kunstwerk. Es umschließt die Eingangspforte wie ein Siegel und scheint dem Bauwerk nicht nur seinen Namen zu geben, sondern auf seine wahre Bedeutung hinzuweisen.
Fünfzehn Minuten werde ich wohl für die gut dreihundert Meter brauchen und vor der verabredeten Zeit am Treffpunkt sein. Lieber warte ich, als mich zu verspäten. Tilla wird pünktlich sein, Laura sicher nicht, weil sie einen lässigen bis nachlässigen Umgang mit der Zeit pflegt.
Das grelle Licht sticht mir in die Augen. Ich schiebe mir die Sonnenbrille ins Gesicht und gehe langsam, ganz langsam die Allee hinauf, ohne Stock, ohne Rollator, ohne Schmerzen, gerne würde ich zügigere Schritte machen, doch es fehlt mir an Kraft. Mit neunzig ist aus meinem Gehen allmählich ein Trippeln geworden und aus meinem Trippeln inzwischen ein Dahinschleichen. Nein, ich will nicht undankbar sein, noch komme ich ohne Hilfsmittel voran. Gut, dass sich alle zwanzig Trippelschritte eine Säule findet, an die ich mich lehnen kann. Fünfzehn habe ich noch vor mir, ich muss verschnaufen. Atme, Alma, atme, du musst atmen!
Die Säule gibt mir Halt und stützt meinen Rücken. Das Große Omega flimmert wie eine Fata Morgana. Ich atme, schwitze und denke an Schnee. Den gibt es nicht mehr, weil es keinen Winter mehr gibt, auch keinen Frühling und keinen Herbst. Seit fünfzig Jahren leben wir in einer einzigen heißen Jahreszeit. Ach, wie hieß doch gleich jener Tag im November, an dem wir uns auf den Weg zum Friedhof machten, Mutter und ich, um die Gräber der Großeltern mit Tannenzweigen und Mooskissen zuzudecken und ihnen ein Licht für die dunklen Tage anzuzünden? Warum fällt mir der Name nicht ein? Es beunruhigt mich, dass mir die Wörter jetzt so oft ausweichen. Es gibt sie, das weiß ich, aber sie verstecken sich. Manche besinnen sich, kehren wieder und springen mir unverhofft auf die Zunge. Dann spreche ich sie aus, mehrmals hintereinander, damit sie bleiben. Auch das Wort, das mir jetzt fehlt, wird mich wiederfinden, denn es wohnt ja in einem Bild, das ganz bei mir ist: Die Chrysanthemen sind erfroren, wunderschön sehen sie aus, die erschlafften, kupferbraunen Blütenköpfe unter der hauchzarten Reifschicht. Der Strauß steckt in einer Vase vor dem Grabstein. Mutter nimmt ihn heraus. Ich soll ihn auf den Komposthaufen an der Ecke bringen. Also gehe ich, die harten Stiele zwischen den gestrickten Fäustlingen. Es hat angefangen, leicht zu schneien. Weiße Flocken setzen sich auf meinen Kindermantel. Und schmelzen. Ich schaue nach oben, verwundert, weil die Schneeflocken plötzlich grau aussehen.
Mein Gesicht wird nass. In meiner Handtasche müsste ein Taschentuch sein. Ist es aber nicht. Ich wische mir den Schweiß mit der Hand von der Stirn. Mein Blick überfliegt dabei das staubtrockene, mit Steinen übersäte Gelände neben der Allee. Es grenzt an den ehemaligen Friedhof, eingestürzte Grabhäuser sind von hier zu erkennen und ein großer Gedenkstein für Soldaten, die in einem nur noch von Geschichtsbüchern erinnerten Krieg für nichts und wieder nichts gefallen sind. Das heutige Geröllfeld war einst als Reservefläche für neue Gräber vorgesehen, doch seit man mit dem Tod rückstandsfrei ins Nichts tritt, gibt es weder Seelen noch Asche oder Tote zu bestatten.
Ein halbes Jahrhundert musste vergehen, bevor ich mich überwand und den Friedhof noch einmal aufsuchte. Das Krematorium war verschwunden und an seine Stelle das Große Omega und sein System getreten. Ich hatte wenig Hoffnung, den weißen Marmorstein mit Mutters Lebensdaten wiederzufinden. Da war kein Weg, den ich erkannte, da standen nur noch kahle Sträucher, abgestorbene Bäume und die schwarzen, wie erloschene Fackeln in den Himmel ragenden Pappeln, da fand sich nichts, woran ich mich hätte orientieren können. Ich ging und ging, sah eingesunkene Gräber, gleichförmige Grabsteine in Reihe, umgestürzte Trauerengel, Inschriften und Namen auf verwitterten Steinplatten, verrostete Einzäunungen alter Familiengräber. Und viele Tafeln sah ich mit Namen und Sterbedaten aus jüngerer Zeit, zu denen kein Grab gehörte. Offenbar waren sie von jenen aufgestellt worden, die sich nicht damit abfinden wollten, dass von einem Menschen nach dem Tod nichts als das Nichts bleiben sollte. Irgendwann kehrte ich um, ermüdet vom Gehen und bekümmert, weil meine Suche ergebnislos geblieben war, bekümmert auch von der Trostlosigkeit des Ortes. In Erinnerung hatte ich einen Friedhof gehabt, der einer gepflegten Parkanlage glich mit stattlichen, dichtbelaubten Bäumen, blühenden Hecken, schattigen Wegen und Blumenrabatten. Ringsum Stille, Vogelstimmen und der besänftigende Geruch guter, feuchter Erde.
Ich zähle noch einmal und komme jetzt auf dreizehn Säulen. Die werde ich schaffen. Also los. Und atmen, atmen, tief atmen, Alma.
Ein Scherz, denke ich, als ich am Großen Omega angekommen bin und den Vorplatz vollgestellt mit neongrünen Relax-Sesseln sehe. Erschöpft lasse ich mich in den nächsten fallen. Die bisherigen Holzbänke, schlicht, hart und ohne Rückenlehne, stapeln sich an der Seite wie bereitgestellt zur Entsorgung. Gut so, finde ich, denn diesen Bänken ist anzusehen, dass sie nicht gerade der Bequemlichkeit dienten, aber aus ästhetischer Sicht gut ins architektonische Gesamtbild passten. Ich lehne mich zurück, dankbar für den Komfort. So lässt sich das Warten aushalten. Ich mache die Augen zu. Und sogleich wieder auf, um mich zu vergewissern, dass Tilla und Laura noch nicht im Anmarsch sind. Die Allee liegt einsam und verlassen da, kein Mensch, kein widderköpfiges Mädchen.
Laura und Tilla sind nicht meine Freundinnen, sie sind alles andere als das. In erster Linie sind sie meine Schwägerinnen, in zweiter Linie waren sie leider mit meinem Bruder verheiratet gewesen, jede neunundzwanzig Jahre lang. Laura war seine erste Frau, Tilla wurde seine Witwe. Allerdings hatte er die beiden nicht nacheinander geheiratet, also erst Laura und nach der Scheidung Tilla, sondern hatte sie gleichzeitig genommen. Sie waren ja mehr als Freundinnen, Blutsschwestern waren sie, unzertrennlich wie Siamesische Zwillinge, zusammengewachsen am Herzen. Ein Mann, zwei Frauen, das war kein Problem für sie, und schon gar keins für Ludwig. Aber für mich. Achtundfünfzig Jahre haben es die drei zusammen ausgehalten. Dann wurde Ludwig hundert und musste diese Welt verlassen. Das war vor genau einem Jahr. Heute, an seinem ersten Todestag, wollen wir ihn wiedersehen.
In der Armlehne habe ich einen Knopf ertastet. Ich drücke ihn und bin gespannt, was passieren wird. Etwas kommt in Gang, in den Eingeweiden des Sessels, dicht unter dem neon-grünen Kunstleder rollt es, walkt und kneten unsichtbare Hände meinen Rücken rauf und runter, zwischendurch ein Tritt, und weiter. Das tut gut. Ich liege da und gebe mich hin, bis ein Schatten mich stört. Er streicht über mich hin und summt. Augen auf. Das Geräusch kommt von einer Drohne im Spielzeugformat, die über dem Großen Omega kreist.
Früher, als in der Natur noch echte Bienen umherflogen und summten, nannte man die männlichen Bienen ebenfalls Drohnen. Und wenn es noch immer stimmt, was ich im Biologieunterricht gelernt habe, dann wurde eine Biene nur deshalb zur Drohne, weil die Königin dem Ei, das ihrem Körper entschlüpfte, ein Spermium aus ihrem Samentäschchen vorenthielt. Dass aus einem unbefruchteten Bienen-Ei dennoch ein Bienen-Mann entstehen konnte, fand ich so seltsam wie eine Jungfernzeugung. Noch seltsamer fand ich es, dass dieses Mängelwesen mit einem Penis ausgestattet war, den es bei der Begattung allerdings einbüßte …
Weg ist weg. Ich habe die Drohne aus den Augen verloren, nur das Implantat in meinem Innenohr lässt mich noch ein fernes Summen wahrnehmen.
Ich fahnde erneut nach dem Knopf in der Armlehne, um die Rückenmassage wieder in Gang zu setzen. Mit einem wohligen Seufzer lehne ich mich zurück, als ich ihn gefunden und gedrückt habe, denke an Bienen, denke an Ludwigs Penis und an das Virus Xi, das nicht nur mich und meinen Bruder, nicht nur Laura und Tilla, sondern unsere gesamte Generation weltweit und damit die Menschheit unfruchtbar gemacht hat. Wir, die derzeit Lebenden, gehören zu den Letzten, die auf dem von der Natur vorgesehenen Wege gezeugt und geboren wurden. Was hatten Wissenschaft und Medizin nicht alles unternommen, um das Aussterben der Spezies Mensch zu verhindern. Alles ohne Erfolg. Herausgekommen sind Chimären, Mischwesen weiblichen Geschlechts mit Widderköpfen. Wie viele es sind, weiß niemand.
Inzwischen habe ich genug vom Rollen, Walken und Treten, das der Massagesessel hinter meinem Rücken veranstaltet, und schalte es aus. Von Tilla und Laura ist noch immer nichts zu sehen, nur ein paar widderköpfige Mädchen in weißen, wippenden Tutus überqueren die rote Schotterallee von rechts nach links. Wo sind sie so plötzlich hergekommen? Wohin wollen sie? Leichtfüßig wie Ballerinen, spukhaft wie Hirngespinste, wehen und tänzeln sie nun über das trostlose Geröllfeld und verschwinden in der Ferne zwischen den eingestürzten Grabhäusern des Friedhofs.
Vermutlich sind sie vor den Stimmen geflüchtet, die jetzt die Allee heraufkommen. Laura hängt an Tillas Arm und humpelt. Dass sie nicht ohne Schmerzen würde gehen können, war vorauszusehen. Recht so, warum musste sie sich auch die Hammer- und Krallenzehen korrigieren lassen, nur weil sie wieder Pumps und offene Sandaletten anziehen will. In ihrem Alter! Ja, wer schön sein will, muss leiden, liebe Laura, das war schon immer so, und du bist keine Ausnahme. Was tut uns das Alter nicht alles an. In seiner großen Weisheit könnte es uns doch wenigstens vor einer Torheit wie Eitelkeit schützen.
Tilla war gerade sechzig geworden, als sie sich das Gesicht neu zuschneiden ließ. Hohe Wangen mussten her und weg, was Falte war oder nach Falte aussah. Eine römische Nase war für sie die Nase der Nasen, dazu ein Mund, so formvollendet wie die Lippen der Nofretete. Ihr Dr. Beau, ein Schönheitschirurg, der den Frauen alle Wünsche erfüllte, er selbst ein Homunkulus, baute ihr Allerweltsgesicht zu einem Kunstwerk um. Mit einem Antlitz, das nicht von dieser Welt ist, kam sie aus seiner Klinik. Nein, um ein solches Gesicht beneidete ich sie nicht, zumindest behauptete ich das, registrierte aber mit Genugtuung und frei von Mitleid, dass die vom Skalpell verliehene Schönheit ein Verfalldatum hat. Jahr für Jahr musste Tilla nachjustieren lassen. Ihr Dr. Beau schnippelte, spritzte, unterfütterte, raffte, vergrößerte, verkleinerte, zurrte, baute auf und bügelte aus. Doch irgendwann ging dem Alter das Aussehen verloren. Als Tilla mit fünfundsiebzig endlich wie vierzig aussah, glich ihre Erscheinung einem Haute-Couture-Modell, das vorne und hinten nicht passte. Da redete eine Vierzigjährige mit flacher Altfrauen-Stimme, da hatte der alt gewordene Körper mit seinen mühsamen Bewegungen und seinem gerundeten Rücken kein Mitleid, sondern stellte sie bloß. Zugegeben: Anfangs hatte sich Neid in mein Gemüt gebohrt, wenn Tilla nach jedem Schnitt ins Gesicht jünger und jünger aussah. Ja, ich spielte sogar mit dem Gedanken, mich ebenfalls einem Dr. Beau auszuliefern. Letztlich schreckte ich aber doch vor einem Gesicht zurück, das mir ein operierender Dr.-Beau-Roboter nach vorprogrammierten Idealmaßen verpassen würde. Nein, so ein Gesicht wollte ich nicht. Schöne Zähne sollten reichen. Leider waren die, die ich als Mädchen und junge Frau mein Eigen nannte, nichts für die Ewigkeit. Sie hatten es mir in jungen Jahren leichtgemacht zu strahlen, zu flirten oder sie zu zeigen. Bewunderte und beneidete Zähne hatte ich. Während ich ihnen noch immer nachtrauere, tastet meine Zunge ungewollt den makellosen Ersatz ab. Aus reiner Eitelkeit habe ich gegen den Rat meines Zahnarztes auf blendendem Weiß bestanden. Das Ergebnis erschreckt mich bis heute, wenn ich mich auf alten Fotos oder Videos lachen sehe, sogar in den Spiegel lächele ich nur noch mit geschlossenem Mund. Schrecklicher als zu weiße Zähne finde ich nur noch die geschwärzten Zähne der widderköpfigen Mädchen.
Tilla und Laura stehen nun auf dem Vorplatz und schauen sich suchend um. Ich bringe mich in die Senkrechte, winke, um auf mich aufmerksam zu machen, erhebe mich und gehe auf sie zu. Unsere Begrüßung fällt äußerst schlicht aus: ein leichter Händedruck, ein knapper Blick, gespielte Traurigkeit. Auf meine Frage, ob sie an den Code gedacht habe, reagiert Tilla pikiert. Natürlich hat sie.
Langsam und mit gesenkten Köpfen bewegen wir uns auf den Eingang ins Große Omega zu, die humpelnde Laura klebt wie festgebacken an Tillas Seite. Nach wenigen Schritten humpelt auch sie, wohl, um Laura nicht aus dem Rhythmus zu bringen. Blutsschwestern eben. Wir gehen schweigend. Würde über uns nicht eine Drohne summen, wäre es totenstill. Wir werden beobachtet, klar, warum und wieso, kann ich mir nicht vorstellen, noch weniger, an wen die Drohne das, was sie gerade sieht, weiterreicht. Was kann den verborgenen Empfänger an drei uralten, weißhaarigen Schachteln in schwarzen Sommerkleidern interessieren? Wir wollen einen Toten wiedersehen. Das ist alles.
Die massive Eingangstür öffnet sich. Wir treten ein in die schwarze Luft einer nächtlichen Halle. Ich spüre, dass wir uns in einem hohen, weiten Raum befinden, der von einer Kuppel überwölbt wird, doch wenn ich den Blick hebe, ist über mir nur Schwärze. Den Raum füllt eine seltsame Schwere, beinahe greifbar wie etwas Stoffliches, Dichtes, etwas, das mir wie das Kraftfeld einer unbekannten Materie vorkommt. Im unsteten Licht einiger weniger Kerzen in Wandnischen bewegt sich eine widderköpfige Gestalt. Sie entzündet eine letzte Kerze und entfernt sich danach lautlos und schattenhaft. Ihr Gewand erscheint mir wie von Silber durchwirkt.
Zwischen den Säulen im Zentrum der Halle eine kreisrunde Wasserfläche, so makellos glatt und glänzend, dass es auch ein großer schwarzer Spiegel im Boden sein könnte. Doch das Wasser verrät sich mit zitternder Oberfläche, als wir am Rand stehen und in sein tiefes Schwarz wie in einen Abgrund blicken. Kein Cello, kein Gesang, keine Sphärenmusik, nichts, was ein Gefühl heraufbeschwört oder eine Stimmung herbeizaubert, die sich von selbst nicht einstellen will. In der Stille unsere Schritte. Ich empfinde nichts. Ludwig ist tot, seit einem Jahr. Erst vor wenigen Tagen hat Tilla die Nachricht mit einem Code und einem Termin erhalten, dass nun ein Wiedersehen im Großen Omega mit ihm möglich sei.
Da!
Tilla schluckt hörbar, Lauras Finger krallen sich in ihren Arm, mich selbst fliegt Entsetzten an: Ludwig ist erschienen. Wie erstarrt, wie eingefroren wirkt er in seinem festlichen Abendanzug, den er auf altväterliche Art mit Weste, weißem Hemd und Fliege trägt. So schwebt er eine Handbreit über dem Wasser auf uns zu.
Mein erster Gedanke: Die Hologramme, die ich im Zoo gesehen habe, waren von besserer Qualität. Vom Großen Omega habe ich mehr erwartet, nicht diesen trostlosen 3D-Scan, den Ludwig kurz vor seinem Hundertsten von sich hat machen lassen. Das Ergebnis ist ein alter, totenstarrer Mann im dunklen Abendanzug, eine blutleere Figur mit vereisten Gesichtszügen. Schade um das berühmte Kunstwerk, das er investierte, um uns dieses Hologramm zu hinterlassen. Es war ein Magritte-Gemälde, selbstverständlich das Original »Der Zauberer – Selbstporträt mit vier Händen«. Nun existiert Ludwig also als digitale Mumie weiter, konserviert und eingeschlossen in einen Sarkophag aus Nullen und Einsen, der sich mittels Code öffnen und seine Gestalt wiedererstehen lässt. Was soll der Unsinn?
Tilla fängt an zu schluchzen. Laura lockert den Griff um Tillas Arm und streckt ihre Hand nach Ludwig aus, als wolle sie ihn liebkosen. Seine Lichtgestalt weicht ihr aus, sein holografisches Standbild kippt wie in Zeitlupe aus der Senkrechten in die Waagerechte. Einen Moment lang hängt es nach Art einer schwebenden Jungfrau in der Luft, bevor es weiter und weiter nach hinten kippt und schließlich kopfüber zur Ruhe kommt, den Scheitel eine Handbreit über dem Wasser. Nach dieser 180-Grad-Drehung, die Ludwig von den Füßen auf den Kopf gestellt hat, wendet er uns statt des Gesichts nun den Hinterkopf zu, wobei sein volles, schlohweißes Haar, als sei es mit Haarspray fixiert, nicht der Schwerkraft folgt. Einen Wimpernschlag später ein kurzer, heftiger Lichtzauber, in dem Ludwigs Gestalt zersplittert. Ich zittere und weiß nicht, warum.
»Lasst uns gehen«, sage ich.
»Ja, es ist schrecklich, einfach schrecklich das alles hier«, flüstert Laura.
»Grauenhaft«, meint auch Tilla und bietet Laura den Arm, damit sie sich einhängen kann.
Nie wieder. Wir drei denken wohl dasselbe auf dem Weg zum Ausgang. Über uns, in der Kuppel der Trauerhalle, ein Himmel voller Sterne, eine Lichtprojektion, die den Nachthimmel öffnet, tief und dunkelblau und sternenübersät wie in einem südlichen Land. Kein Mond.
Ach, Ludwig, sie war so deutlich zu sehen in jener Nacht, in jenem südlichen Land, die Milchstraße, unsere Galaxie. Das Lichtband erschien uns wie ein Gruß aus dem All. Wir waren nach dem Abendessen ein letztes Mal an den Strand gegangen. Wir mussten uns einen Weg durch die Dünen suchen, die offiziellen Strandzugänge waren gesperrt. Verendetes Meeresgetier wurde seit Tagen angespült, tonnenweise Fische und Muscheln, tote Robben, auch Wale, und immer wieder nicht zu identifizierende Kreaturen. Ursache: unbekannt. Das Meer kippte den Urlaubern ganze Schiffsladungen voll stinkender Kadaver vor die sandigen Füße, und das nicht nur an jenem Strand. Radlader schoben Tag und Nacht das stinkende Strandgut zusammen, die Berge wuchsen, die Berge wuchsen sich zu Abraumhalden aus. Zahllose Bagger waren im Einsatz, um sie abzutragen, LKWs transportierten rund um die Uhr verwesende Biomasse ab. Wo das alles landete, verbrannt oder atomisiert wurde, war nicht zu erfahren. Am kommenden Tag sollten die Arbeiten eingestellt werden. Kapitulation.
Wir hatten eine Düne erklommen, von der wir den mondlosen Strand in ganzer Länge überblicken konnten. Raupenfahrzeuge krochen an der Wasserlinie entlang, Scheinwerferaugen geisterten über den Sand, wiesen monströsen Maschinen und Mondgefährten den Weg und warfen scharfe Schatten. Der Motorenlärm drang nicht bis zu uns vor, Wind und Wellen übertönten ihn. Ludwig legte seinen Arm um meine Taille, unsere Hüften berührten einander, er war achtzehn, ich fünfzehn, es war Sommer und es war stinkend heiß. Unser Vater hockte mit schlechter Laune und in noch schlechterer Gesellschaft an der Hotelbar und soff. Am nächsten Tag würden auch wir abreisen und uns vor dem fauligen, blasigen, stechenden Gestank, den Millionen verwesende Körper in der Sonne ausschwitzten, in Sicherheit bringen. Eine ganze Ferienregion war im Aufbruch. Die Nachrichtenportale berichteten von einer Katastrophe unbekannten Ausmaßes, zeigten Bilder und Filme und hatten außer Mutmaßungen keine Erklärungen für das ganze Geschehen. Sie versuchten, den Pesthauch in Worte zu fassen. Aber es gabt kein Wort für den Tod, der in der Luft lag. Jene Nacht wollte Ludwig nicht im Doppelzimmer mit unserem betrunkenen Vater verbringen. Und ich wollte nicht allein sein in meinem Einzelzimmer mit dem schmalen Bett. Die Milchstraße, sie war eine Rauchspur, die der Satan im Himmel hinterlassen hatte.
Als wir, Laura, Tilla und ich, aus der Omega-Nacht hinaus auf den sonnenbeschienenen Vorplatz treten, ist mir, als stürzte ich aus der Jugend ins Alter. Tilla und Laura mokieren sich über die Farbe der Relax-Sessel. Ich schlage eine Sitzprobe vor. Kein Interesse. Also schlurfen und humpeln wir die Allee hinunter, wo vor dem Ausgang ein Level7 auf uns wartet.