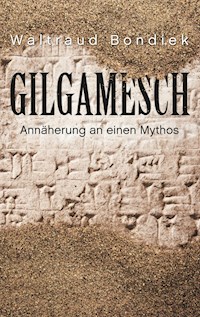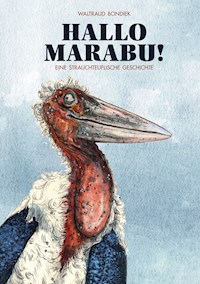Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Erotik
- Sprache: Deutsch
Zehn Paare, zehn erotische Begegnungen, die nicht immer Liebesgeschichten sind. Waltraud Bondiek erzählt sie in sinnlichen Bildern und sprachlicher Meisterschaft, stets poetisch, aber niemals obszön. Mal spiegeln sie das lustvolle Geschehen wie eine lackierte Fläche, mal bezaubern sie durch Leichtigkeit und subtilen Witz, dann wieder führen sie ins Halbdunkel, in den Schatten, die Irritation. Der Leser wird heimlicher Beobachter.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 73
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zu diesem Buch
Zehn Paare, zehn erotische Begegnungen, die nicht immer Liebesgeschichten sind. Waltraud Bondiek erzählt sie in sinnlichen Bildern, stets poetisch, niemals obszön. Mal spiegeln sie das lustvolle Geschehen wie eine lackierte Fläche, mal bezaubern sie durch Leichtigkeit und subtilen Witz, dann wieder führen sie ins Halbdunkel, in den Schatten, die Irritation. Der Leser wird zum heimlichen Beobachter.
Das Hörbuch von „Ohne ist auch schön“ ist als Lesung mit Brigitte Trübenbach und Wolfgang Gerber beim Audio Verlag Buchfunk in Leipzig erschienen und im Download-Shop erhältlich.
Inhalt
Nachtbild
Liebes Spiel
Weiße Stiere
Lob der Jadeflöte
Was uns verwandelt
Luxus, Stille und Wollust
Ruby
Auf Reisen
Cora.doc
Dark Orchid 5
Nachtbild
Ortega hatte Daphne nie nach ihrer Hautfarbe gefragt. Seine Vorstellung schwankte unentschieden zwischen hellen Erdtönen und dem violetten Schwarz seltener Tropenhölzer. Er hatte Daphne auch nie nach ihrem Alter gefragt. Ihr Körper war zart und biegsam, ihre Brüste schmiegten sich wie Tauben in seine Hände. Jung musste sie sein.
Daphne kam in den Abendstunden zu ihm, wenn die Hitze des Tages matt geworden war und die Gassen sich belebten. Sie kam, um ihm vorzulesen oder um ihn, den erblindeten Fotografen, der einst als Abenteurer und Weltreisender berühmt geworden war, zu lieben. Ihr Tag war der Mittwoch. Ausgestreckt auf dem Divan erwartete er sie in einem abgetragenen Hausmantel. Unter dem mürben Brokat trug er die Tätowierungen, die ihn vom Hals bis zu den Sohlen bedeckten. Ein Malaie hatte sie gestochen.
Ortega bewohnte das obere Geschoss eines alten, herrschaftlichen Gebäudes. Schwere Vorhänge und Teppiche, die er aus Täbris und Isfahan mitgebracht hatte, dämpften die Geräusche. Die Seidenbespannung der Wände war niemals erneuert worden. Daphne verglich ihre Farbe mit dem Ton der Abenddämmerung am Nil. Den Himmel, den sie vor Augen hatte, konnte sich Ortega nicht vorstellen, seine Erinnerungen hatten eine in den Staub sinkende Sonne festgehalten.
Vier Treppen musste Daphne zu ihm hinaufsteigen. Zur verabredeten Zeit war die Tür angelehnt. Ein wenig atemlos trat sie jedes Mal ein, löste im schwachen Licht, das von der Gasse heraufschien, die Riemen ihrer Sandalen, und nichts
verriet, ob sie danach ein Buch aus der Tasche nehmen oder ihre Kleider ablegen würde.
Die Bände, aus denen sie Ortega vorlas, atmeten vergilbtes Papier, Leder und Goldschnitt. Die Sprache verstand er nicht, ihr Klang und Rhythmus jedoch war von tiefdunkler Schönheit. Er lauschte ihr wie einem Epos, das in einer untergegangenen Sprache vom Ursprung der Welt und der Menschen erzählt. Daphnes Stimme zog ihn auf die andere Seite des wachen Bewusstseins.
Dass sie ihn heute Abend lieben würde, wusste er in dem Moment, da sie die Kerzen des mehrarmigen Leuchters entzündete, ihn vom Tisch hob und neben den Diwan stellte. Ohne zu sehen, sah Ortega dem Schattentanz eines jungen Mädchens zu, das sich entkleidete. Stoffe raschelten und fielen. Ein Duft von Nachthyazinthen füllte das flackernde Dunkel. Ortega rührte sich nicht. Ohne Ungeduld und ohne Gier erwartete er den Lufthauch, mit dem Daphne sich über ihn beugen würde. Alles war ihm erlaubt, nur ihr Schoß musste unberührt bleiben. Um sich zu schützen – vor ihm und wohl auch vor sich selbst –, trug sie ein Schrittband, ein handgroßes Dreieck aus Leder, das ihren Schoß versiegelte. Schnüre, raffiniert verknotet, verschränkt und verschlungen, hielten es am Platz. Wie man ein solches Kunstwerk an- oder ablegte, hatte er niemals gefragt.
Falke nannte sie ihn, als sie die Kordel seines Hausmantels löste, die Seitenteile zurückschlug und sich auf ihm ausstreckte. Er legte die Arme um sie, drückte sie an sich und genoss die Wärme ihres Körpers auf seiner kühlen Haut. Daphne küsste sein Gesicht, küsste die Lider, die Lippen, den Hals, die Mulde hinter den Schlüsselbeinen, die Narben über seinem Herzen. Doch als sich ihr Mund auf den Weg zu seinen Lenden machte, hielt er ihren Kopf fest.
„Lass mich warten, quäle mich“, flüsterte er, die Hände in ihrem Haar, das voll krauser Locken war.
Da legte Daphne ihre Wange auf seine Brust und zeichnete mit zärtlichen Bewegungen die kunstvollen Muster, verschlungenen Ornamente und phantastischen Figuren auf seinem Körper nach. Mit einem Finger fuhr sie die Konturen des Falken ab, der seine Schwingen über Ortegas Becken spannte. Der Nabel war das dritte Auge des Vogels. In seinen Fängen hielt er Ortegas Geschlecht. Daphne nahm dem Falken seine Beute ab, streichelte, quälte, küsste das durstige Fleisch.
„Dreh dich um“, bat Ortega.
Daphne legte sich auf die Seite, er presste seine straff gespannten Lenden gegen ihr Gesäß, während seine Lippen die Schultern erkundeten, die er auswendig kannte. Die Schwüle ihres Nackens war ihm mehr als vertraut. Er schmeckte ihr Haar, das roch nach Zimt und Rosen, er schmeckte ihre glatte Haut, die hellbraun oder schwarzviolett sein mochte. In allen Sprachen, die er kannte, flüsterte er Liebesworte. Seine Finger folgten den Rückenwirbeln abwärts, folgten den rätselhaften Verläufen der Schnüre um ihre Hüften, erspürten den Eingang ins Fleisch.
Haut. Häutungen. Öffnung. Tiefe. Sein Glied pochte.
Ortega nahm Daphne, wie der schöne, junge Nubier ihn einst genommen hatte, wie er ihn, wie sie einander genommen hatten, damals in der Oase, in der Wüstennacht, in einem Zelt, im Schweigen.
Liebes Spiel
Dieser Mann war verrückt. Eine andere Erklärung hatte ich nicht, denn er wollte mich, sofort, für ein Leben, ein ganzes, nach einer Stunde – nein, einer halben – und einem Cappuccino in der Fußgängerzone. Sogar ein Haus hatte er für uns entworfen, so groß, dass es nicht auf die Papierserviette passte.
Ich wollte ihn vielleicht, vielleicht für einen Nachmittag, und nur vielleicht. Vielleicht, dachte ich noch auf dem Weg zum Parkplatz, schaltete mein Handy aus und dachte: nein. Zwanzig Jahre war ich verheiratet, war es gut und war es gerne, denn es gab sie noch immer, die langen Nächte vom Anfang. Ich war … ja, ich war glücklich. Und doch. Dieser Tag war aus Leichtsinn gemacht, aus einem sonnigen Frühlingstag, guter Laune und einem neuen Kleid in der Einkaufstüte. Ich warf sie auf den Rücksitz und schaltete mein Hany wieder ein.
Nicht stören! steht auf dem Schild, das nun am Türknauf von Zimmer 314 im Hotel soundso hängt. Nicht stören. Nur das war klar, als wir an der Rezeption nach einem Zimmer fragten.
Wir tranken den mitgebrachten Rotwein, zuerst aus Gläsern, dann aus dem Mund des anderen. Wir küssten uns bis aufs Blut. „Ich liebe dich.“ Er schwor’s, ich schwieg und zog mich aus, er mir die Haut vom Leib und legte Hand an mein nacktes Herz. Er nahm es im Handstreich, ich fiel, hundert Küsse tief.
Wir vergaßen die Zeit und den Tag unserer Ankunft in jener Stadt, aus der wir irgendwann würden zurückkehren müssen. Wann war irgendwann? Für uns war immerzu jetzt. Zwei aus der Welt und uns in die Arme Gefallene waren wir. Gefallene.
„Engel“, nannte er mich.
„Woran denkst du?“
„Ich will nichts denken“, antwortete ich, den Kopf auf seiner Brust, in meinem Blickfeld der Nachttisch, darauf die Hornbrille des Architekten und seine Uhr.
Mit offenen Augen belauschte ich sein Herz, als verberge sich dort ein Geheimnis. Doch sein Herz verriet mir nicht mehr, als dass die Minute dieselbe Dauer hat wie die achtundfünfzig Schläge, die ich zählte. Das Geräusch durchdrang mich und grundierte das stumme Bild auf der anderen Seite der Straße. Das Bild, das war ein Himmel aus Milch und das Licht einer kranken Sonne auf einer Backsteinfassade mit dem Schriftzug „Tanz-Theater Caro“. Die bodentiefen Fenster der ehemaligen Fabrik zogen den Blick hinein zu einer Gruppe von Tänzern. Man probte. Eine Frau, vermutlich die Choreografin, gab eine Bewegung vor. Mit großer Langsamkeit beschrieb sie die Leere. Als sie sich umwandte, streifte die Sonne ihr Gesicht, und für einen Wimpernschlag erkannte ich mich in den Zügen der gealterten Ballerina.
Die Tänzer gruppierten sich neu und wiederholten die Passage, die sie soeben wiederholt hatten. Jeder Schritt wirkte nun, als hätte sich die Schwerkraft verdoppelt oder als würde die Zeit jede Bewegung verformen, sie dehnen, sie gerinnen und schließlich stocken lassen, achtundfünfzig Herzschläge lang, dann erlöste ein Zeichen das stumme Bild. Die Tänzer verteilten sich wieder im Raum und begannen von vorn.
Wir liebten uns erneut, ohne Hast, fast ohne Begierde, in einer schwebenden Art von Bewusstsein, ein unaufhörliches Ein- und Ausatmen, ein Du, ein Mantra. Worte kamen, Worte gingen, der Tag verlor seine Farben. Ein mattes Blau füllte das Zimmer. Aus einem traumgleichen Zustand heraus streifte mein Blick vom Bett aus die erschöpften Tänzer. Einige hatten sich auf den Boden gehockt, andere standen an die Wand gelehnt da, die Augen im Nirgendwo, Schweiß auf nackten Armen und Schultern.