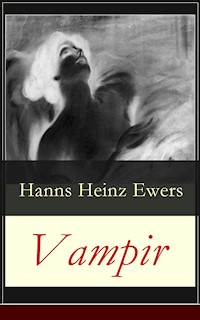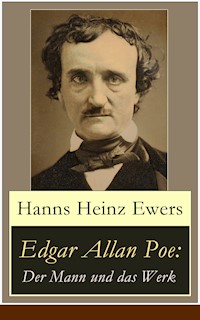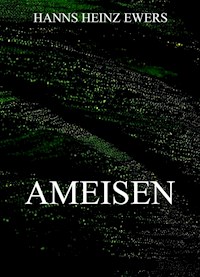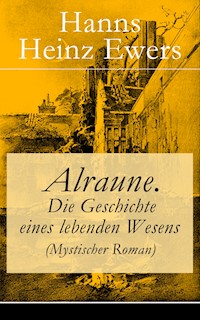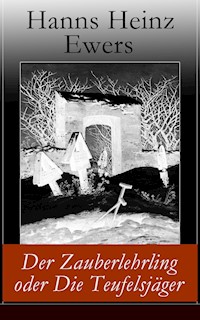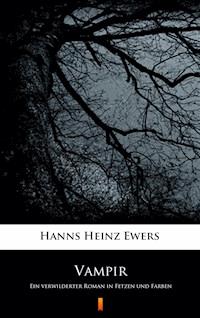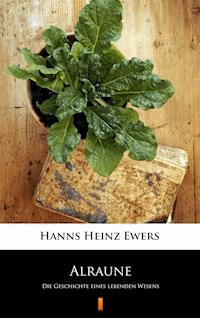Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Alraune ist das bekannteste Werk des deutschen Schriftstellers, mehrfach verfilmt und auch als Buch sehr erfolgreich. Ewers und sein alter ego Frank Braun, der Protagonist des Romans, erzählen die Geschichte der von ihnen selbst erschaffenen Kindfrau Alraune, der alle Männer hörig sind. Auch ihr Schöpfer, Frank Braun, verfällt mehr und mehr dem attraktiven Wesen ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 465
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alraune
Hanns Heinz Ewers
Inhalt:
Alraune
Auftakt
Erstes Kapitel, das zeigt, wie das Haus war, in dem der Gedanke Alraune in die Welt sprang
Zweites Kapitel, das erzählt, wie es geschah, dass man Alraune erdachte
Drittes Kapitel, das zu wissen tut, wie Frank Braun den Geheimrat überredete, Alraune zu schaffen.
Viertes Kapitel, das Kunde gibt, wie sie Alraunes Mutter fanden
Fünftes Kapitel, das vermeldet, wen sie zu ihrem Vater wählten, und wie der Tod Pate stand, als Alraune zum Leben kam
Intermezzo
Sechstes Kapitel, das davon handelt, wie das Kindlein Alraune heranwuchs
Siebentes Kapitel, das mitteilt, was geschah, als Alraune ein Mägdlein war
Achtes Kapitel, das ausführt, wie Alraune Herrin ward auf dem Sitze der Brinken
Neuntes Kapitel, das davon spricht, wer Alraunens Liebhaber waren und wie es ihnen erging
Zehntes Kapitel, das schildert, wie Wolf Gontram an Alraune zugrunde ging
Elftes Kapitel, das wiedergibt, welches Ende dem Geheimrat durch Alraune ward
Intermezzo
Zwölftes Kapitel, das berichtet, wie Frank Braun in Alraunens Welt tritt
Dreizehntes Kapitel, das erwähnt, wie die Fürstin Wolkonski Alraune die Wahrheit sagte
Vierzehntes Kapitel, das verzeichnt, wie Frank Braun mit dem Feuer spielte und wie Alraune erwachte
Fünfzehntes Kapitel, das sagt, wie Alraune im Parke lebte
Sechzehntes Kapitel, das verkündet, wie Alraune ein Ende nahm
Ausklang
Alraune, H. H. Ewers
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN:9783849642815
www.jazzybee-verlag.de
Alraune
Auftakt
Wie willst du leugnen, liebe Freundin, dass es Wesen gibt – keine Menschen, keine Tiere – seltsame Wesen, die aus der verruchten Lust absurder Gedanken entsprangen?
Gut, weisst du, meine sanfte Freundin, gut ist das Gesetz, gut ist alle Regel und alle strenge Norm. Gut ist der grosse Gott, der diese Normen schuf, diese Regeln und Gesetze. Und gut ist der Mensch, der sie wohl achtet, der seine Wege geht in Demut und Geduld und in der treuen Nachfolge seines guten Gottes.
Ein anderer aber ist der Fürst, der den Guten hasst. Er zerschlägt die Gesetze und Normen. Er schafft – merk es wohl – wider die Natur.
Er ist schlecht, ist böse. Und böse ist der Mensch, der so tut wie er. Er ist ein Kind des Satan.
Böse ist es, sehr böse, hineinzugreifen in die ewigen Gesetze, mit frecher Hand sie herauszureissen aus ihren ehernen Fugen.
Der Böse mag es wohl tun – weil ihm Satan hilft, der ein gewaltiger Herr ist; er mag schaffen nach seinem eigenen stolzen Wunsche und Willen. Mag Dinge tun, die alle Regeln zertrümmern, alle Natur umkehren und auf den Kopf stellen. Aber er hüte sich wohl: es ist Lüge nur und irres Blendwerk, was immer er schafft. Es ragt auf und wächst in alle Himmel – – aber es stürzt zusammen am letzten Ende und begräbt im Sturze den hochmütigen Narren, der es dachte –
Seine Exzellenz Jakob ten Brinken, Dr. med., Ord. Professor und Wirkl. Geh. Rat, schuf das seltsame Mädchen, schuf es – – wider alle Natur. Er schuf es, ganz allein, wenn auch der Gedanke einem andern gehörte. Und dieses Wesen, das sie taufen liessen und Alraune nannten, wuchs heran und lebte wie ein Menschenkind. Was es anfasste, das ward zu Gold, wo es hinblickte, da lachten die wilden Sinne. Wohin aber sein giftiger Atem traf, schrie alle Sünde, und aus dem Boden, den seine leichten Füsse traten, wuchsen des Todes bleiche Blumen. Einer schlug es tot, der war es, der es einst dachte: Frank Braun, der neben dem Leben herlief.
Nicht für dich, blondes Schwesterchen, schrieb ich dies Buch. Deine Augen sind blau und sind gut und wissen nichts von den Sünden. Deine Tage sind wie die schweren Trauben blauer Glyzenen, tropfen hinab zum weichen Teppich: so schreitet mein leichter Fuss weich dahin durch die sonnenglitzernden Laubengänge deiner sanften Tage. Nicht für dich schrieb ich dies Buch, mein blondes Kind, holdes Schwesterlein meiner traumstillen Tage –
Dir aber schrieb ich es, du wilde, sündige Schwester meiner heissen Nächte. Wenn die Schatten fallen, wenn das grausame Meer die schöne Goldsonne frisst, da zuckt über die Wogen ein rascher giftgrüner Strahl. Das ist das erste schnelle Lachen der Sünde über des bangen Tages Todesfurcht. Und sie reckt sich über die stillen Wasser, hebt sich hoch, brüstet sich in brandigen, gelben und roten, tief violetten Farben. Und die Sünde atmet durch die tiefe Nacht, speit ihren Pesthauch weit hinaus über alle Lande.
Und du fühlst wohl ihren heissen Hauch. Da weitet sich dein Auge, hebt sich frecher die junge Brust. Da fliegt ein Zittern über deine Nüstern, spreizen sich weit die fieberfeuchten Hände. Da fallen die bürgerlichen Schleier aller sanften Tage, da gebiert sich die Schlange aus schwarzer Nacht. Da reckt sich, Schwester, deine wilde Seele, aller Schanden froh, voll aller Gifte. Und aus Qualen und Blut, und aus Küssen und Lüsten jauchzt sie hinauf – schreit sie hinab – durch alle Himmel und Höllen –
Schwester meiner Sünden, dir schrieb ich dies Buch –
Erstes Kapitel, das zeigt, wie das Haus war, in dem der Gedanke Alraune in die Welt sprang
Das weisse Haus, in dem Alraune ten Brinken wurde – lange Zeit, ehe sie geboren, ehe sie noch gezeugt ward – dies Haus lag am Rhein. Ein wenig hinaus aus der Stadt, in der grossen Villenstrasse, die hinausführt vom alten erzbischöflichen Palast, der heute die Universität hält. Dort lag es. Und damals bewohnte es der Herr Justizrat Sebastian Gontram.
Man schritt, von der Strasse her, durch den langen hässlichen Garten, der nie einen Gärtner sah. Man kam zu dem Hause, von dem der Stuck fiel, suchte nach einer Schelle und fand keine. Man rief und schrie und es kam niemand. Endlich stiess man die Türe auf und ging hinein, stieg über die schmutzige, nie gewaschene Holztreppe. Und irgendeine grosse Katze sprang durch die Dunkelheit.
Oder aber – der grosse Garten lebte von tausend Affen. Das waren die Gontramkinder: Frieda, Philipp, Paulche, Emilche, Jösefche und Wölfche. Sie waren überall, staken in den Aesten der Bäume, krochen in tiefen Gruben in der Erde. Dann die Hunde, zwei freche Spitze und ein Bastardfox. Und dazu der Zwergpinscher des Herrn Rechtsanwalt Manasse, so ein Ding, wie eine braune Quittenwurst, kugelrund, kaum grösser wie eine Hand. Cyklop hiess er.
Und alles lärmte und schrie. Wölfchen, kaum ein Jahr alt, lag im Kinderwagen und brüllte, hoch, hartnäckig, stundenlang. Nur Cyklop konnte diesen Rekord halten, er kläffte, heiser und zerbrochen, unaufhörlich. Rührte sich nicht vom Platze, wie Wölfchen, schrie nur, heulte nur.
Die Gontrambuben rasten durch die Büsche, spät am Nachmittage. Frieda, die älteste, sollte aufpassen; achtgeben, dass die Brüder artig seien. Aber sie dachte: sie sind artig. Und sie sass hinten, in der zerfallenen Hollunderlaube, mit ihrer Freundin, der kleinen Prinzessin Wolkonski. Die beiden schwatzten und stritten sich, meinten, dass sie nun bald vierzehn Jahre alt würden und dann wohl heiraten könnten. Oder wenigstens könnte man einen Liebhaber haben. Aber sie waren fromm alle beide und beschlossen, noch ein wenig zu warten, vierzehn Tage noch, bis nach der ersten heiligen Kommunion.
Dann bekam man lange Kleider. Dann war man erwachsen. Dann konnte man einen Liebhaber haben.
Sie kamen sich sehr tugendhaft vor bei diesem Entschluss. Und sie überlegten, dass es gut wäre, sogleich zur Kirche zu gehen, in die Maiandacht.
Man musste sich sammeln in diesen Tagen, musste ernst sein und vernünftig.
»Und dann ist auch vielleicht der Schmitz da!« sagte Frieda Gontram.
Aber die kleine Prinzess rümpfte das Näschen: »Bah – der Schmitz!« machte sie.
Frieda fasste sie unter den Arm. »Und die Bavaren, die mit den blauen Mützen!«
Olga Wolkonski lachte. »Die –? Das sind – – Blasen! – Weisst du, Frieda, feine Studenten gehen überhaupt nicht in die Kirche.«
Das war nun wohl wahr, feine Studenten taten so etwas nicht.
Frieda seufzte. Sie schob rasch den Wagen mit dem schreienden Wölfchen zur Seite und trat nach Cyklop, der sie in den Fuss beissen wollte.
Nein, nein, die Prinzess hatte recht, es war nichts mit der Kirche. »Lass uns hierbleiben!« entschied sie. Und die Mädchen kehrten zurück zur Hollunderlaube.
– Alle die Gontramkinder hatten eine unendliche Gier zum Leben. Sie wussten es nicht – aber sie ahnten es, fühlten es so im Blute, dass sie sterben mussten, jung, frisch, mitten im Blühen. Dass sie nur einen kleinen Teil der Spanne Zeit hatten, die andern Menschen gegeben war. Und sie nahmen diese Zeit dreifach, lärmten und rasten, frassen und tranken sich übersatt am Leben. Wölfchen schrie in seinem Wagen, schrie für sich allein so viel wie drei andere Babies. Seine Brüder aber flogen durch den Garten, machten sich zahlreich, taten, als ob ihrer vier Dutzend wären, und nicht nur vier. Schmutzig, rotznasig und zerlumpt, immer irgendwo blutend, vom Schnitt in den Finger, vom zerschundenen Knie, oder irgendeinem tüchtigen Kratz.
Wenn die Sonne sank, schwiegen die Gontrambuben. Kehrten ins Haus zurück, gingen in die Küche. Schlangen gewaltige Haufen von Butterbröten, dick belegt mit Schinken und Wurst. Und tranken ihr Wasser, das die grosse Magd leicht färbte mit rotem Wein. Dann wusch sie die Magd. Zog sie aus, steckte sie in die Kübel, nahm schwarze Seife und die harte Bürste. Schrubbte sie, wie ein Paar Stiefel. Aber rein wurden sie doch nicht. – Und wieder schrien und tobten die wilden Jungen in ihren hölzernen Kübeln.
Dann, todmüde, krochen sie ins Bett, plumpsten hin wie Kartoffelsäcke, rührten sich nicht mehr. Stets vergassen sie sich zuzudecken; das besorgte die Magd.
Meist um diese Stunde kam Rechtsanwalt Manasse ins Haus. Er stieg die Treppe hinauf, schlug mit dem Stock an ein paar Türen; bekam keine Antwort und trat endlich ein.
Frau Gontram kam ihm entgegen. Sie war gross, fast doppelt so gross wie Herr Manasse. Der war ein Zwerg nur, kugelrund, und glich genau seinem hässlichen Hund, dem Cyklop. Kurze Stoppeln wuchsen ihm überall aus Wangen, Kinn und Lippen, und mitten heraus schaute die Nase, klein und rund, wie ein Radieschen. Wenn er sprach, kläffte er, es war, als wollte er immer zuschnappen.
»Guten Abend Frau Gontram,« sagte er. »Ist der Herr Kollege noch nicht zu Haus?«
»Juten Nabend Herr Rechtsanwalt,« sagte die grosse Frau. »Machen Sie et sich bequem.«
Der kleine Manasse schrie: »Ob der Herr Kollege noch nicht zu Haus ist!? – Und lassen Sie das Kind hereinholen, man versteht ja sein eigen Wort nicht!«
»Wat?« fragte Frau Gontram. Dann nahm sie die Antiphone aus den Ohren. »Ach so!« fuhr sie fort. »Dat Wölfche! – Sie sollten sich doch auch so 'ne Dinger anschaffe, Herr Rechtsanwalt, dann höre Se nix.« Sie ging zur Tür und schrie: »Billa, Billa! – Oder Frieda! Hört ihr nit? Schafft dat Wölfche int Haus!«
Sie war noch im Morgenkleid, aprikosenfarbig. Sie hatte gewaltiges, kastanienbraunes Haar, unordentlich aufgesteckt, halb herunterfallend. Ihre schwarzen Augen schienen unendlich gross, weit, weit aufgerissen, und voll sengenden, unheimlichen Feuers. Aber die Stirne höhlte sich an den Schläfen, eingefallen war die schmale Nase und die bleichen Wangen spannten sich eng über die Knochen. Grosse hektische Flecken brannten hell auf –
»Haben Sie 'ne jute Zigarre, Herr Rechtsanwalt?« fragte sie.
Er nahm sein Etui heraus, ärgerlich, wütend fast. »Wie viele haben Sie denn schon geraucht heute, Frau Gontram?«
»'n Stücker zwanzig,« lachte sie. »Aber Sie wissen ja, dat dreckige Zeug für vier Pfennig et Stück! – 'ne Abwechslung würd' mir jut tun. Da, jeben Sie mich die dicke da!« – Und sie nahm eine schwere, fast schwarze Mexiko.
Herr Manasse seufzte: »Na, was meinen Sie? Wie lang soll das noch so gehn?«
»Böh!« machte sie. »Regen Se sich nur nich auf. Wie lang? Vorjestern meinte der Herr Sanitätsrat: noch sechs Monat. – Aber wissen Se, jenau datselbe hat er vor zwei Jahren auch schon emal jemeint. Ich denk immer: et jaloppiert sich jarnix, et jeht hübsch im Trab mit die jaloppierende Schwindsucht.«
»Wenn Sie wenigstens nicht so viel rauchen wollten!« kläffte der kleine Rechtsanwalt.
Sie sah ihn gross an, zog die blauen, dünnen Lippen hoch über die blanken Zähne. »Wat? Wat, Manasse? Nich mehr rauche? Nu halten Se aber freundlichst die Luft an! Wat soll ich denn sonst tun? Kinder kriegen – alle Jahr eins – Haushalt führen mit all die Bäljer – dabei de Jaloppierende – – un nich mal rauche dürfe?« – Sie paffte ihm den dicken Qualm ins Gesicht, dass er hustete.
Er blickte sie an, halb giftig, halb liebend und bewundernd. Dieser kleine Manasse war frech wie keiner, wenn er vor der Barre stand, nie verlegen um einen Witz, um ein scharfes, schneidendes Wort. Kläffte, schnappte, biss um sich, ohne jeden Respekt und jede kleinste Furcht. – Hier aber, vor dieser dürren Frau, deren Leib ein Gerippe war, deren Kopf grinste wie ein Totenschädel, die seit Jahr und Tag zu dreiviertel im Grabe stand, und lachend das letzte Viertel selbst aufschaufelte, hier empfand er Angst. Diese unbändigen, schimmernden Locken, die immer noch wuchsen, immer stärker, immer voller wurden, als ob ihren Boden der Tod selbst düngte, diese ebenmässigen, strahlenden Zähne, die den schwarzen Stumpf der dicken Zigarre fest umschlossen, diese Augen, übergross, ohne Hoffnung, ohne Sehnsucht, fast ohne ein Bewusstsein ihrer leuchtenden Gluten – – – liessen ihn stumm werden und kleiner noch als er war, kleiner fast als sein Hund.
Oh, er war sehr gebildet, der Rechtsanwalt Manasse. Sie nannten ihn ein wanderndes Konversationslexikon, und es gab nichts, über das er nicht Bescheid wusste im Augenblick. Nun dachte er: sie schwört auf Epikur. Der Tod geht sie nichts an, meint sie. Solange sie lebt, ist er nicht da. Und wenn er da ist, so ist sie fort.
Er aber, Manasse, sah recht gut, dass der Tod da war, obwohl sie noch lebte. Längst war er da, schlich überall herum in diesem Hause. Spielte Blindekuh mit dieser Frau, die sein Mal trug, liess ihre gezeichneten Kinder schreien und rasen im Garten. Freilich – er galoppierte nicht. Ging hübsch im Trab, da hatte sie recht. Aber nur – – so aus Laune. Nur so – – weil es ihm Spass machte, zu spielen mit dieser Frau und ihren lebensgierigen Kindern wie die Katze mit den Fischlein im Goldfischglas –
Ohe, er ist gar nicht da! meinte diese Frau Gontram, die auf dem Longchair lag den langen Tag, die grosse schwarze Zigarren rauchte, nie endende Romane las und Antiphone in den Ohren trug, um der Kinder Lärm nicht zu hören. – Ohe, er ist gar nicht da!? – Nicht da? grinste der Tod und lachte den Rechtsanwalt an aus dieser jämmerlichen Maske heraus, paffte ihm den dicken Rauch ins Gesicht –
Der kleine Manasse sah ihn, sah ihn deutlich genug. Er starrte ihn an, überlegte lang, welcher Tod es wohl sei aus der grossen Gemeinde. Der von Dürer? Oder der von Böcklin? Oder irgendein wilder Harlekintod von Bosch oder Breughel? Oder gar so ein wahnsinniger, unverantwortlicher Tod von Hogarth, von Goya, von Rowlandson, Rops oder Callot?
Keiner war es von diesen. Der da vor ihm sass, war ein Tod, mit dem man umgehen konnte, war gut bürgerlich und dazu romantisch, war ein rheinländischer Tod, ein Rethelscher. War einer, der mit sich reden liess, einer, der Witz im Leibe hatte, der rauchte und Wein trank und lachen konnte –
»Es ist gut, dass er raucht!« dachte Manasse. »Das ist sehr gut: so riecht man ihn nicht –«
Dann kam der Justizrat Gontram.
»Guten Abend, Collega!« sagte er. »Auch schon da? Das ist recht.« Und er begann eine lange Geschichte, erzählte genau, was alles passiert war heute, auf dem Bureau und vor Gericht.
Lauter merkwürdige Sachen. Was nur Juristen passieren kann im langen Leben, das passierte Herrn Gontram Tag für Tag. Höchst seltsame Begebnisse, manchmal lustig und komisch genug und manchmal blutig und höchst tragisch.
Nur – nicht ein Wort war wahr daran. Der Justizrat hatte dieselbe unbesiegbare Scheu vor der Wahrheit, die er auch vor dem Bad, ja vor der Waschschüssel hatte, er log, wenn er den Mund aufsperrte, und wenn er schlief, träumte er von neuen Lügen. Jedermann wusste, dass er log, aber jedermann hörte doch gerne ihm zu, denn seine Lügengeschichten waren lustig und gut, und waren sie es einmal nicht, so war doch gut die Art, wie er sie auftischte.
Ein guter Vierziger war er, mit schon grauem, kurzem, sehr lückigem Barte und schütterem Haar. Einen goldenen Zwicker trug er an langer schwarzer Schnur, der stets schief über der Nase hing, und die blauen kurzsichtigen Augen sehen liess. Unordentlich war er, schlampig und ungewaschen, stets mit Tintenflecken auf den Fingern.
Er war ein schlechter Jurist und war sehr gegen jede Arbeit. Die überliess er seinen Referendaren – die aber auch nichts taten, nur zu ihm kamen aus diesem Grunde und sich oft wochenlang nicht sehen liessen im Bureau. Ueberliess sie dem Bureauvorsteher und den Schreibern, die schliefen. Und wenn sie einmal wachten, so machten sie einen Schriftsatz, der lautete: »Ich bestreite.« Und stempelten den Namenszug des Justizrats darunter.
Und dennoch hatte er eine sehr gute Praxis, viel besser wie die des so kenntnisreichen und gewitzten Manasse. Er verstand die Sprache des Volkes und konnte schwatzen mit den Leuten. Er war beliebt bei allen Richtern und Anwälten, weil er nie Schwierigkeiten machte, alles seinen Gang gehen liess. Vor der Strafkammer und vor den Geschworenen war er Goldes wert, das wusste man wohl. Einmal sagte ein Staatsanwalt: »Ich beantrage, dem Angeklagten mildernde Umstände nicht zu versagen: Herr Justizrat Gontram verteidigt ihn.«
Mildernde Umstände – – die bekam er stets für seine Klienten. Aber Manasse bekam sie selten genug, trotz seiner Gelehrsamkeit und seiner scharfen Rede.
Und dann war da noch etwas. Justizrat Gontram hatte ein paar Fälle gehabt, grosse, gewaltige Prozesse, die Aufsehen erregten durchs ganze Land. Hatte sie durchgekämpft durch lange Jahre, in allen Instanzen, und sie schliesslich gewonnen. Dann nämlich erwachte plötzlich in ihm eine seltsame, irgendwo schlafende Energie. So eine völlig verfahrene Sache, ein sechsmal verlorener, beinahe unmöglicher Prozess, der von Anwalt zu Anwalt ging, so ein Fall mit verzwicktesten internationalen Fragen – – von denen er keine Ahnung hatte – – das mochte ihn interessieren. Die Brüder Koschen aus Lennep, dreimal zum Tode verurteilt, hatte er schliesslich doch freibekommen, im vierten Wiederaufnahmeverfahren, trotz eines haarscharfen Indizienbeweises. Und in dem grossen Millionenstreit der Galmeibergwerke von Neutral-Moresnet, in dem kein Jurist in drei Ländern sich auskannte – – und gewiss Gontram am allerwenigsten – – hatte er doch letzten Endes ein obsiegendes Urteil erzielt. Nun hatte er, seit drei Jahren, den grossen Ehegültigkeitsprozess der Fürstin Wolkonski.
Und merkwürdig: nie sprach dieser Mensch je über das, was er wirklich geleistet hatte. Jedem, den er traf, log er die Ohren voll mit seinen frech erfundenen juristischen Heldentaten – – nicht eine Silbe aber kam über seine Lippen über das, was er wirklich durchsetzte. So war es schon: er verabscheute alle Wahrheit.
– Frau Gontram sagte: »Dat Abendessen kommt jleich. Und en Böwlche hab ich auch als anjesetzt. Frischer Waldmeister. – – Soll ich mich noch umziehe jehn?«
»Bleib nur so, Frau,« entschied der Justizrat, »der Manasse hat nichts dagegen.« Er unterbrach sich: »Herrgott, wie das Kind schreit! Kannst du es denn nicht still kriegen?«
Die Frau ging mit langen, langsamen Schritten an ihm vorbei. Oeffnete die Tür zum Vorzimmer; dorthin hatte die Magd den Kinderwagen geschoben. Und sie nahm Wölfchen, trug es hinein und setzte es in den hohen viereckigen Babystuhl.
»Kein Wunder, dat et so schreit!« sagte sie ruhig. »Et is janz nass.« Aber sie dachte nicht daran, es trocken zu legen. »Bis doch still, kleine Teufel,« fuhr sie fort, »siehst du denn nich, dass mer Besuch haben?«
Aber das Wölfchen liess sich durchaus nicht stören durch den Besuch. Herr Manasse stand auf, klopfte es, streichelte es auf die dicken Backen, brachte ihm den grossen Hampelmann zum Spielen. Doch das Kind stiess den Hampelmann fort, brüllte, schrie unaufhörlich. Und Cyklop begleitete es unter dem Tisch her.
Da sagte die Mama: »Wart nur, lieb Zuckerplätzche. Ich hab wat für dich.« Sie nahm den schwarzen, zerkauten Stummel aus den Zähnen und schob ihn dem Baby in den Mund. »Da, Wölfche, dat is lecker!? Wat?«
Und das Kind war still im Augenblick, lutschte und sog, strahlte überglücklich aus grossen, lachenden Augen.
»Na, sehen Se, Herr Rechtsanwalt, wie man mit Kinder umjehen muss?« sagte die grosse Frau. Sicher und still sprach sie, völlig ernst. »Aber ihr Männer versteht nix von Kinder.«
– Die Magd kam, meldete, dass gedeckt sei. Dann, während die Herrschaft ins Speisezimmer ging, schritt sie mit tappigen Schritten auf das Kind zu. »Bäh!« machte sie und riss ihm den Stummel aus dem Mund.
Sofort begann Wölfchen wieder zu heulen. Sie nahm es auf den Arm, wiegte es hin und her, sang ihm ein schwermütiges Liedchen aus ihrer wallonischen Heimat. Doch hatte sie nicht mehr Glück wie Herr Manasse; das Kind schrie nur und schrie. Da nahm sie den Stummel wieder her, spuckte darauf, rieb ihn ab an der schmutzigen Küchenschürze, um das immer noch glimmende Feuer zu ersticken. Gab ihn zurück in Wölfchens roten Mund.
Nahm das Kind, zog es aus, wusch es, gab ihm reine Sachen und bettete es weich in sein Bettchen. Wölfchen rührte sich nicht, liess alles ruhig geschehen, still und zufrieden. Und es schlief ein, selig strahlend, immer in den Lippen den grässlichen schwarzen Stummel.
O ja, sie hatte schon recht, diese grosse Frau. Sie verstand eben was von Kindern. Wenigstens – von den Gontramkindern.
Drinnen speisten sie zu Nacht und der Justizrat erzählte. Sie tranken einen leichten Wein von der Ruwer; erst zum Schlusse brachte Frau Gontram die Bowle.
Ihr Mann schnüffelte kritisch. »Lass doch was Sekt heraufholen,« sagte er.
Aber sie setzte die Bowle auf den Tisch: »Mer han keine Bowlesekt mehr. – – Un nur noch eine Flasch Pommery is im Keller.«
Er sah sie gross an, über seinen Zwicker weg, schüttelte bedenklich den Kopf. »Na, weisst du, du bist eine Hausfrau! Wir haben keinen Sekt und du sagst nicht ein Wörtchen davon? So was! Keinen Sekt im Haus! – Lass die Flasche Pommery heraufholen. – Eigentlich viel zu schad für die Bowle.«
Er wiegte den Kopf hin und her. »Kein Sekt! So was!« wiederholte er. »Wir müssen gleich welchen anschaffen. Komm Frau, bring mir Feder und Papier; ich muss der Fürstin schreiben.«
Aber als das Papier vor ihm lag, schob er's wieder hinüber. »Ach,« seufzte er, »ich hab den ganzen Tag soviel gearbeitet. Schreib du, Frau, ich diktiere dir.«
Frau Gontram rührte sich nicht. Schreiben? Das hätte ihr gerade gefehlt! »Fällt mich nicht ein,« sagte sie.
Der Justizrat sah zu Manasse hinüber. »Wie wär es, Herr Collega? Könnten Sie mir nicht den Gefallen tun? Ich bin so abgespannt.«
Der kleine Rechtsanwalt sah ihn wütend an. »Abgespannt?« höhnte er. »Wovon denn? Vom Geschichtenerzählen? – Ich möchte nur mal wissen, wovon Sie immer alle Finger voll Tinte haben, Herr Justizrat! Vom Schreiben doch gewiss nicht.«
Frau Gontram lachte. »Ach, Manasse, dat ist noch von letzte Weihnachte her, als er den Jungens die schlechten Zeugnisse unterschreiben musste! – – Uebrigens, wat zankt ihr euch? Lasst doch die Frieda schreiben.«
Und sie schrie durch das Fenster hin nach Frieda.
Frieda kam und mit ihr kam Olga Wolkonski.
»Das ist nett, dass du auch da bist!« begrüsste sie der Justizrat. »Habt ihr schon zu Abend gegessen?«
Doch die Mädchen hatten gegessen, unten in der Küche.
»Setz dich her, Frieda,« gebot der Vater, »hierher.« Frieda gehorchte. »So! Nun nimm die Feder und schreib, was ich dir sage.«
Aber die Frieda war ein echtes Gontramkind, sie hasste das Schreiben. Im Nu war sie aufgesprungen vom Stuhl. »Nee, nee!« schrie sie. »Olga soll schreiben, die kann das viel besser als ich.«
Die Prinzess stand am Sofa; sie wollte auch nicht. Aber ihre Freundin hatte ein Mittel, sie gefügig zu machen. »Wenn du nicht schreibst,« flüsterte sie, »leih ich dir keine Sünden für übermorgen!«
Das half. Uebermorgen war Beichttag, und ihr Beichtzettel sah noch sehr dürftig aus. Sündigen durfte man nicht in dieser ernsten Kommunionzeit, aber Sünden beichten musste man doch. Musste sich streng erforschen, nachdenken und suchen, ob man nicht irgendwo noch eine Sünde finde. Und das verstand die Prinzess ganz und gar nicht. Frieda aber konnte es prächtig. Ihr Beichtzettel war der Neid der ganzen Klasse, besonders Gedankensünden erfand sie grossartig, gleich dutzendweise auf einmal. Sie hatte das vom Papa: sie konnte mit ganzen Haufen von Sünden aufwarten, nur wenn sie einmal wirklich eine beging, so erfuhr der Beichtvater gewiss nichts davon.
»Schreib, Olga,« flüsterte sie, »dann leih ich dir acht dicke Sünden.«
»Zehn,« forderte die Prinzessin. Und Frieda Gontram nickte; es kam ihr gar nicht darauf an, sie hätte zwanzig Sünden gegeben, um nicht schreiben zu müssen.
Olga Wolkonski setzte sich an den Tisch, nahm die Feder und sah fragend auf.
»Also schreib!« sagte der Justizrat. »Verehrte Frau Fürstin – –«
»Ist das für die Mama?« fragte die Prinzess.
»Natürlich, für wen denn sonst? Schreib! – Verehrte Frau Fürstin –«
Die Prinzess schrieb nicht. »Wenn es für die Mama ist, kann ich doch auch schreiben: Liebe Mama!«
Der Justizrat wurde ungeduldig. »Schreib, was du willst, Kind, nur schreib.«
Und sie schrieb: »Liebe Mama!«
Und dann weiter nach dem Diktat des Justizrats:
»Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass unsere Angelegenheit nicht recht weiterkommt. Ich muss soviel nachdenken und man kann nicht nachdenken, wenn man nichts zu trinken hat. Wir haben aber keinen Tropfen Sekt mehr im Hause. Schicken Sie uns also gefälligst, im Interesse Ihres Prozesses, einen Korb Bowlensekt, einen Korb Pommery und sechs Flaschen – –«
»St. Marceaux!« rief der kleine Rechtsanwalt.
»St. Marceaux –« fuhr der Justizrat fort. »Das ist nämlich die Lieblingsmarke von Collega Manasse, der auch manchmal hilft.
Mit besten Grüssen Ihr –«
– »Nun sehen Sie, Collega,« sagte er, »wie bitter unrecht ihr mir tut! Nicht allein diktier ich den Brief, ich unterschreib ihn auch noch eigenhändig!« Und er setzte seinen Namen hin.
Frieda wandte sich halb um vom Fenster. »Seid ihr fertig? Ja? Na, dann will ich euch nur sagen, dass es ganz unnötig war. Eben ist Olgas Mama vorgefahren und kommt nun gerade durch den Garten.« – Sie hatte die Fürstin längst gesehen, hatte aber hübsch still geschwiegen und nicht unterbrochen. Wenn die Olga schon zehn schöne Sünden bekam, so sollte sie doch auch etwas arbeiten dafür! So waren alle die Gontrams, Vater, Mutter und Kinder: sie arbeiteten sehr, sehr ungern, aber sie sahen recht gerne zu, wenn das andere taten.
Die Fürstin trat ein, dick und aufgeschwemmt, grosse Brillanten an den Fingern und den Ohren, am Halse und im Haar, masslos ordinär. Sie war eine ungarländische Gräfin oder Baronin; irgendwo im Orient hatte sie den Fürsten kennen gelernt. Eine Heirat war zustande gekommen, das war sicher; aber sicher war auch, dass gleich von Anfang an von beiden Seiten geschwindelt wurde. Sie wollte diese Ehe, die aus irgendwelchen Gründen von vornherein unmöglich war, dennoch gesetzlich durchsetzen, und der Fürst wollte dieselbe Ehe, die er wohl für möglich hielt, durch kleine Formfehler gleich beim Abschluss zu einer ungültigen machen. Ein Netz von Lügen und frechem Schwindel: ein wahres Fressen für Herrn Sebastian Gontram. Alles wankte hier, nichts stand fest, jede kleinste Behauptung wurde prompt von der Gegenseite widerlegt, jeder Schatten eines festen Gesetzes wurde durch das eines andern Staates wieder ausgelöscht. Nur eins blieb: die kleine Prinzess – – sowohl Fürst wie Fürstin bekannten sich als Vater und Mutter und beanspruchten Olga für sich: dieses Produkt ihrer seltsamen Ehe, dem so viele Millionen zufallen mussten. Die Mutter war im Vorteil zur Zeit, war im Recht der Besitzenden –
»Setzen Sie sich, Frau Fürstin!« Der Justizrat hätte sich eher die Zunge abgebissen, als diese Frau ›Durchlaucht‹ anzureden; sie war seine Klientin und er behandelte sie nicht um ein Haar besser, wie die letzte Bauernfrau. »Legen Sie doch ab!« Aber er half ihr nicht.
»Wir haben gerade an Sie geschrieben,« fuhr er fort. Und er las ihr den schönen Brief vor.
»Aber bitte sehr!« rief die Fürstin Wolkonski. »Aber gewiss doch! Wird morgen in der Früh besorgt!« Sie öffnete ihre Tasche und zog einen schweren Brief heraus. »Sehen Sie, verehrter Herr Justizrat, gerade wegen unserer Sache kam ich. Da ist ein Schreiben vom Obergespan Grafen Ormos aus Gross-Becskerekgyartelep, wissen Sie – –«
Herr Gontram runzelte die Stirne: das fehlte noch! Selbst der König hätte ihm keine Arbeit zumuten dürfen, wenn er abends zu Hause war. Er stand auf, nahm den Brief. »Ist schon gut,« sagte er, »schon gut, das erledigen wir alles morgen im Bureau.«
Sie wehrte sich. »Aber es ist sehr eilig. Ist sehr wichtig – –«
Der Justizrat unterbrach sie. »Eilig? Wichtig? Nun sagen Sie mir bloss, was verstehen Sie davon, ob etwas eilig oder wichtig ist? Gar nichts! Nur im Bureau kann man das beurteilen.« Dann, im Tone wohlwollenden Vorwurfs: »Frau Fürstin, Sie sind doch eine gebildete Frau! Sie haben doch auch so eine Art von Erziehung genossen!? – Da müssen Sie doch wissen, dass man Leute nicht des Abends zu Hause mit Geschäften belästigt.«
Sie beharrte noch immer. »Aber im Bureau kann ich Sie ja doch nie erwischen, verehrter Herr Justizrat. Ich war in dieser Woche allein viermal –«
Nun wurde er fast ärgerlich. »Kommen Sie nächste Woche! Meinen Sie denn, dass man nur Ihren Kram allein hätte? Was glauben Sie wohl, was man sonst noch alles zu tun hat? Was mich allein der Mörder Houten für eine Zeit kostet? Und da handelt es sich um den Kopf und nicht nur um eine Handvoll Milliönchen.« Und er begann, schnurrte ab, unaufhörlich, erzählte eine ewige Geschichte von diesem merkwürdigen Räuberhauptmann, der nur in seiner Phantasie lebte, und von den juristischen Heldentaten, die er für diesen unvergleichlichen Lustmörder vollbrachte.
Die Fürstin seufzte, aber sie hörte zu. Lachte auch manchmal, immer am falschen Platze. Sie war die einzige von all seinen vielen Zuhörern, die nie fühlte, wie er log, und sie war auch die einzige, die seinen Witz nicht verstand.
»Nette Geschichten für die Kinder!« kläffte Rechtsanwalt Manasse. Die beiden Mädchen hörten gierig zu, starrten den Justizrat an mit weit offenen Augen und Mündern.
Aber der liess sich nicht unterbrechen. »Ach was, an so was kann man sich nicht früh genug gewöhnen.« Er tat so, als wenn Lustmörder das Allergewöhnlichste seien, was es gäbe im Leben, als ob man ihnen jeden Tag dutzendweise begegne.
Endlich war er zu Ende, sah nach der Uhr. »Zehn schon! Die Kinder müssen zu Bett! Trinkt noch rasch eine Glas Bowle.«
Die Mädchen tranken, aber die Prinzess erklärte, dass sie auf keinen Fall nach Hause ginge. Sie habe solche Angst und könne nicht allein schlafen. Und mit ihrer Miss auch nicht – – vielleicht sei die auch so ein verkleideter Lustmörder. Sie wolle bei ihrer Freundin bleiben. Sie fragte ihre Mama erst gar nicht, nur Frieda und deren Mutter.
»Meinswegen!« sagte Frau Gontram. »Aber verschlaft euch nicht, dass ihr zur rechten Zeit in die Kirch kommt.«
Die Mädchen knixten und gingen hinaus. Arm in Arm, eng umfasst.
»Fürchtest du dich auch?« fragte die Prinzess.
Frieda sagte: »Es ist alles gelogen, was der Papa sagt.« Aber Angst hatte sie trotzdem. Angst – – und daneben ein seltsames Wunschgefühl nach diesen Dingen. Nicht sie zu erleben – o nein, gewiss nicht. Aber sie sich auszudenken, sie auch so erzählen zu können. »Ach, das wären Sünden für die Beichte!« seufzte sie.
Oben trank man die Bowle aus, Frau Gontram rauchte noch eine letzte Zigarre. Herr Manasse war aufgestanden, hinausgegangen ins Nebenzimmer. Und der Justizrat erzählte der Fürstin eine neue Geschichte. Sie versteckte ihr Gähnen hinter dem Fächer, versuchte immer wieder auch einmal zu Wort zu kommen.
»Ach ja, liebster Herr Justizrat,« sagte sie rasch, »ich vergass es fast! Darf ich Ihre Frau Gemahlin morgen mittag mit dem Wagen abholen? Ein bisschen mitnehmen nach Rolandseck?«
»Gewiss,« antwortete er, »gewiss – – wenn sie will.«
Aber Frau Gontram sagte: »Ich kann nich ausfahre.«
»Und warum denn nicht?« fragte die Fürstin. »Es würde Ihnen doch gewiss recht gut tun, ein wenig hinauszukommen in die frische Frühlingsluft.«
Frau Gontram nahm langsam die Zigarre aus den Zähnen. »Ich kann nich ausfahre. Ich han keine anständige Hut aufzusetze – –«
Die Fürstin lachte, tat, als ob das ein Scherz hätte sein sollen. Sie wolle gleich morgen die Modistin schicken, mit neuen Frühlingsmodellen zum Aussuchen –
»Meinswegen,« sagte Frau Gontram. »Aber dann schicken Se die Becker, die von der Quirinusjass – die hat de besten.« Sie erhob sich langsam, betrachtete bedächtig ihren ausgebrannten Stummel. »Un jetzt jeh ich schlafe – gute Nacht!«
»O ja, es ist Zeit, ich muss auch gehen!« rief die Fürstin hastig. Der Justizrat brachte sie hinunter, durch den Garten zur Strasse. Half ihr in die Equipage, schloss dann bedächtig das Gartentor.
Als er zurückkam, stand seine Frau in der Haustüre, die brennende Kerze in der Hand.
»Mer könne nich zu Bett jehe,« sagte sie ruhig.
»Was?« fragte er. »Warum denn nicht?«
Sie wiederholte: »Mer könne nich zu Bett jehe. – Dä Manasse liegt als im Bett!«
Sie stiegen die Treppen hinauf in den zweiten Stock, gingen ins Schlafzimmer. In dem riesigen Ehebett lag, hübsch quer und fest schlafend, der kleine Rechtsanwalt. Seine Kleider hingen sorgfältig über dem Stuhl, die Stiefel standen daneben. Ein reines Nachthemd hatte er aus dem Schrank genommen und angezogen. Neben ihm, wie ein Igeljunges, knüllte sich sein Cyklop.
Justizrat Gontram nahm die Kerze und leuchtete.
»Und der Mann schimpft mich aus, dass ich faul sei!« sagte er in kopfschüttelnder Verwunderung. »Und ist selbst zu faul, um nach Haus zu gehen!«
»Sss!« machte Frau Gontram. »Sss, sonst weckste se alle beide auf.«
Sie nahmen Bettzeug und Nachtwäsche aus dem Schranke und gingen. Ganz leise. Frau Gontram machte unten zwei Lager zurecht, auf den Sofas.
Da schliefen sie.
Alle schliefen im weiten Hause. Unten neben der Küche Billa, die starke Küchenmagd, bei ihr die drei Hunde; im Nebenzimmer die vier wilden Buben, Philipp, Paulche, Emilche und Jösefche. Oben schliefen die beiden Freundinnen, in Friedas grossem Balkonzimmer; schlief nebenan Wölfche mit seinem schwarzen Tabakschnuller; schliefen im Salon Herr Sebastian Gontram und seine Frau. Im zweiten Stock schnarchten um die Wette Herr Manasse und sein Cyklop, und ganz oben, in der Mansarde, schlief Söfchen das Stubenmädchen, das vom Tanzboden zurückgekommen und leise hinaufgeschlichen war über die Treppen. Sie alle schliefen, schliefen. Zwölf Menschenkinder und vier scharfe Hunde.
Aber irgend etwas schlief nicht. Schlurfte langsam um das weite Haus –
Draussen, am Garten vorbei, zog der Rhein. Hob seine in Mauern geschnürte Brust, schaute in die schlafenden Villen, drängte sich eng an den Alten Zoll. Katzen und Kater schoben sich durch die Büsche, fauchten, bissen, schlugen einander, fuhren los mit runden, heiss funkelnden Augen. Nahmen sich, lüstern, versagend, in schmerzender, quälender Lust –
Und hinten, weit hinten aus der Stadt her, tönte der trunkene Sang wilder Studenten –
Etwas kroch um das weisse Haus am Rhein. Schlich durch den Garten, vorbei an zerbrochenen Bänken und lahmen Stühlen. Schaute wohlgefällig auf das Sabbathtreiben der liebegierigen Katzen –
Stieg um das Haus. Kratzte mit hartem Nagel an die Wände, dass der Stuck klirrend herabfiel. Knipste auch an die Türe, dass sie leise erbebte. Wie ein Wind, so leicht.
Dann war es im Haus. Schlurfte über alle Treppen, kroch bedächtig durch alle Zimmer. Blieb stehn, sah sich rings um, still lächelnd.
Schweres Silber stand im Mahagonibüfett, reiche Schätze aus der Kaiserzeit. Aber die Fensterscheiben waren gesprungen und die Sprünge mit Papier verklebt. Holländer hingen an den Wänden, gute Bilder von Koekkoek, Verboekhvoeven, Verwée und Jan Stobbaerts. Aber sie hatten Löcher und die alten Goldrahmen waren schwarz von Spinnweben. Aus des Erzbischofs bestem Saale stammte der herrliche Lüster – aber seine zerbrochenen Kristalle klebten von Fliegendreck.
Etwas schlich durch das stille Haus. Und wo es hinkam, da brach etwas. Nur ein Nichts fast, nur eine unnennbare Kleinigkeit. Aber wieder und immer wieder.
Wo es hinkam, wuchs aus der Nacht ein kleinstes Geräusch. Knirschte hell eine Diele, löste sich ein Nagel, bog sich ein altes Möbel. Knarrte es in den verquollenen Läden oder klirrte seltsam zwischen den Gläsern –
Alles schlief in dem grossen Hause am Rhein. Aber irgend etwas schlurfte langsam herum –
Zweites Kapitel, das erzählt, wie es geschah, dass man Alraune erdachte
Die Sonne war schon herunter, und die Kerzen brannten im Kronleuchter des Festzimmers, als Geheimrat ten Brinken eintrat. Er sah feierlich genug aus, war im Frack, den grossen Stern auf dem weissen Hemd und die Goldkette im Knopfloch, von der zwanzig kleine Orden baumelten. Der Justizrat stand auf, begrüsste ihn, stellte ihn vor, und der alte Herr ging herum um die Tafel mit einem abgetragenen Lächeln, sagte jedem ein süsses Wort. Bei den Festmädchen blieb er stehn, überreichte ihnen hübsche Lederetuis mit Goldringen, einen Saphir für die blonde Frieda und einen Rubin für die schwarze Olga. Hielt ihnen beiden eine sehr weise Ansprache.
»Wollen Sie nachexerzieren, Herr Geheimrat?« fragte Herr Sebastian Gontram. »Wir sitzen schon seit vier Uhr da – siebzehn Gänge! Fein, was? Da ist das Menü – suchen Sie sich was aus!« Aber der Geheimrat dankte, er habe schon gegessen –
Dann trat Frau Gontram ins Zimmer. Im blauen, etwas altmodischen, seidenen Schleppkleide, hochfrisiert.
»Mer könne kein Eis esse,« rief sie, »dat Billa hat dä Fürst Pückler in der Backofe jestellt!«
Da lachten die Gäste: so etwas musste ja kommen, sonst fühlte man sich nicht wohl im Gontramhause. Und Rechtsanwalt Manasse rief, man solle die Schüssel hereinholen, das sähe man nicht alle Tage: Fürst Pückler frisch aus dem Backofen!
Geheimrat ten Brinken suchte nach einem Stuhle. Er war ein kleiner Mann. Glattrasiert, dicke Tränensäcke unter den Augen; er war hässlich genug. Wülstig hingen die Lippen, fleischig die grosse Nase. Tief hing deckend das Lid über dem linken Auge, aber das rechte stand weit offen, schielte lauernd hinaus.
Jemand sagte hinter ihm: »Tag, Ohm Jakob.«
Das war Frank Braun.
Der Geheimrat wandte sich, es schien ihm wenig angenehm, den Neffen hier zu treffen. »Du hier?« fragte er. »Nun, ich hätte es mir eigentlich denken können.«
Der Student lachte. »Aber natürlich! Bist ja so weise, Onkel. Übrigens bist du ja auch da. Und bist da, ganz offiziell, als Wirklicher Geheimer und als Universitätsprofessor, im stolzen Schmucke all deiner Orden. Ich aber bin nur ganz inkognito da – – das Korpsband steckt in der Westentasche.«
»Das beweist eben dein schlechtes Gewissen,« sagte der Onkel. »Wenn du erst –«
»Ja, ja!« unterbrach ihn Frank Braun. »Ich weiss es schon. Wenn ich erst so alt bin wie du, dann darf – – und so weiter – – das wolltest du doch sagen? Allen Heiligen sei Dank, dass ich noch nicht zwanzig bin, Ohm Jakob. Ich befinde mich ganz wohl dabei.«
Der Geheimrat setzte sich. »Ganz wohl, das kann ich mir denken. Bist im vierten Semester und tust nichts als raufen und saufen, fechten, reiten, lieben und dumme Streiche machen! Hat dich darum deine Mutter zur Universität geschickt? – Sag, Junge, warst du überhaupt schon einmal in einem Kolleg?«
Der Student füllte zwei Kelche. »Da, Ohm Jakob, trink, dann wirst du's leichter ertragen! Also: im Kolleg war ich schon, und zwar nicht nur in einem, sondern in einer ganzen Reihe. In jedem genau einmal – – und öfter gedenke ich auch nicht mehr hinzugehen. – Prosit!«
»Prosit!« sagte der Geheimrat. »Und du meinst, das sei völlig genug?«
»Genug?« lachte Frank Braun. »Ich meine, es sei sogar viel zu viel. Sei vollkommen überflüssig gewesen! Was soll ich im Kolleg? Es ist schon möglich, dass andere Studenten eine ganze Masse lernen können bei euch Professoren, aber ihr Hirn muss dann eingestellt sein auf diese Methode. Meins ist es nicht. Ich finde euch alle, jeden einzelnen, unglaublich albern und langweilig und dumm.«
Der Professor sah ihn gross an. »Du bist ungeheuer arrogant, mein lieber Junge,« sagte er ruhig.
»Wirklich?« Der Student lehnte sich zurück, schlug die Beine übereinander. »Wirklich? Ich glaube es kaum, aber ich meine, wenn's auch so wäre, möchte es nichts schaden. Denn sieh mal, Ohm Jakob, ich weiss doch genau, warum ich das sage. Erstens, um dich ein bisschen zu ärgern – – du siehst nämlich sehr komisch aus, wenn du dich ärgerst. Und zweitens, um nachher zu hören von dir, dass ich doch recht habe. Du, Onkel, zum Beispiel, bist ganz gewiss ein recht schlauer alter Fuchs, sehr gescheit und sehr klug und du weisst eine ganze Menge. Aber im Kolleg, siehst du, bist du ebenso unerträglich wie deine verehrten Herren Kollegen. – Sag selber, möchtest du sie vielleicht im Kolleg geniessen?«
»Ich? – Nun, ganz gewiss nicht,« sagte der Professor. »Aber das ist auch ein ander Ding. Wenn du erst – na ja, du weisst es schon. – Aber nun sag mir, Junge, was in aller Welt führt dich hierher? Du wirst mir zugeben müssen, dass es nicht ein Haus ist, in dem dich deine Mutter gerne sehen möchte. Was mich anbetrifft –«
»Schon gut!« rief Frank Braun. »Was dich angeht, so weiss ich Bescheid. Du hast dieses Haus an Gontram vermietet und da er sicher kein pünktlicher Zahler ist, so ist es immer gut, wenn man sich von Zeit zu Zeit sehen lässt. Und seine schwindsüchtige Frau interessiert dich natürlich als Mediziner – – alle Ärzte der Stadt sind ja begeistert von diesem Phänomen ohne Lungen. Dann ist da noch die Fürstin, der du gerne dein Schlösschen in Mehlem verkaufen möchtest. – Und schliesslich, Onkelchen, sind die zwei Backfische da, hübsches frisches Gemüse, nicht wahr? – Oh, in allen Ehren natürlich, bei dir ist immer alles in allen Ehren, Ohm Jakob!«
Er schwieg, brannte eine Zigarette an und stiess den Rauch aus. Der Geheimrat schielte ihn an mit dem rechten Auge, giftig und lauernd.
»Was willst du damit sagen?« fragte er leise.
Der Student lachte kurz auf. »O nichts, gar nichts!« Er stand auf, nahm vom Ecktisch eine Zigarrenkiste, öffnete sie, reichte sie dem Geheimrat hin. »Da rauch, lieber Oheim. Romeo und Juliette, deine Marke! Der Justizrat hat sich gewiss nur für dich in die Unkosten gestürzt.«
»Danke!« knurrte der Professor. »Danke! – Noch einmal: was willst du damit sagen?«
Frank Braun rückte seinen Stuhl näher heran.
»Ich will dir antworten, Ohm Jakob. – Ich mag nicht mehr leiden, dass du mir Vorwürfe machst, hörst du? Ich weiss selbst recht gut, dass das Leben ein wenig wüst ist, das ich führe. Aber lass das – – dich geht's nichts an. Ich bitte dich ja nicht, meine Schulden zu zahlen. Nur verlang ich, Onkel, dass du nie wieder solche Briefe schreibst nach Hause. Du wirst schreiben, dass ich sehr tugendhaft, sehr moralisch sei, tüchtig arbeite, Fortschritte mache. Und solches Zeug. – Verstehst du?«
»Da müsste ich ja lügen,« sagte der Geheimrat. Es sollte liebenswürdig klingen und witzig, aber es klang schleimig, als ob eine Schnecke ihren Weg zöge.
Der Student sah ihn voll an. »Ja, Onkel, da sollst du eben lügen. Nicht meinetwegen, das weisst du wohl. Der Mutter wegen.« Er stockte einen Augenblick, leerte sein Glas. »Und um diese Bitte, dass du der Mutter was vorlügen mögest, ein wenig zu unterstützen, will ich dir nun auch erzählen, was ich vorhin – – damit sagen wollte.«
»Ich bin neugierig.« sagte der Geheimrat. Ein wenig fragend, unsicher.
»Du kennst mein Leben,« fuhr der Student fort und seine Stimme klang bitter ernst, »du weisst, dass ich – heute noch – ein dummer Junge bin. So meinst du, weil du ein alter und kluger Mann bist, hochgelehrt, reich, überall bekannt, bedeckt mit Titeln und Orden, weil du dazu mein Oheim bist und meiner Mutter einziger Bruder, dass du ein Recht habest, mich zu erziehen. Recht oder nicht – du wirst es nie tun; niemand wird es tun – nur das Leben.«
Der Professor klatschte sich auf die Knie, lachte breit.
»Ja, ja – das Leben! Warte nur, Junge, es wird dich schon erziehen. Es hat scharfe Kanten und Ecken genug. Hat auch hübsche Regeln und Gesetze, gute Schranken und Stachelzäune.«
Frank Braun antwortete: »Die sind nicht für mich da. Für mich so wenig wie für dich. Hast du, Ohm Jakob, die Kanten abgeschlagen, die Stacheldrähte durchschnitten und gelacht über alle Gesetze – – nun wohl, so werde ich es auch können.«
»Hör zu, Onkel,« fuhr er fort, »ich kenne auch dein Leben gut genug. Die ganze Stadt kennt es und die Spatzen pfeifen deine kleinen Scherze von den Dächern. Aber die Menschen tuscheln nur, erzählen sich's in den Ecken, weil sie Angst haben vor dir, vor deiner Klugheit und deinem Gelde, vor deiner Macht und deiner Energie. – Ich weiss, woran die kleine Anna Paulert starb, weiss warum dein hübscher Gärtnerbursche so schnell fort musste nach Amerika. Ich kenne noch manche deiner kleiner Geschichten. Ah, ich goutiere sie nicht, gewiss nicht. Aber ich nehme sie dir auch nicht übel. Bewundere dich vielleicht ein wenig, weil du, wie ein kleiner König, so viele Dinge ungestraft tun kannst. – Nur begreif ich nicht recht, wie du Erfolg haben kannst bei all den Kindern – – du, mit deiner hässlichen Fratze.«
Der Geheimrat spielte mit seiner Uhrkette. Sah dann seinen Neffen an, ruhig, fast geschmeichelt. Er sprach: »Nicht wahr, das begreifst du nicht recht?«
Und der Student sagte: »Nein, ganz und gar nicht. Aber ich begreife gut, wie du dazu kommst! Längst hast du alles, was du willst, alles, was ein Mensch haben kann in den normalen Grenzen des Bürgertums. Da willst du hinaus. Der Bach langweilt sich in seinem alten Bett, tritt hier und da frech über die engen Ufer. – Es ist das Blut.«
Der Professor hob sein Glas, rückte es hinüber. »Giess mir ein, mein Junge,« sagte er. Seine Stimme zitterte ein wenig und es klang eine gewisse Feierlichkeit heraus. »Du hast recht: es ist das Blut. Dein Blut und mein Blut.« Er trank und streckte seinem Neffen die Hand hin.
»Du wirst an Mutter so schreiben, wie ich es gerne möchte?« fragte Frank Braun.
»Ja, das werde ich!« antwortete der Alte.
Und der Student sagte: »Danke, Ohm Jakob.« Dann nahm er die ausgestreckte Hand. »Und nun geh, alter Don Juan, ruf dir die Kommunikantinnen! Sehen hübsch aus in ihren heiligen Kleidchen, alle beide, was?«
»Hm!« machte der Onkel, »Dir scheinen sie auch nicht schlecht zu gefallen?«
Frank Braun lachte. »Mir? Ach du mein Gott! – Nein, Ohm Jakob, da bin ich kein Rivale – heute noch nicht, heute hab ich noch höhere Ambitionen. Vielleicht – wenn ich einmal so alt bin wie du! – Aber ich bin nicht ihr Tugendwächter und die zwei Feströschen wollen ja nichts Besseres, als gepflückt werden. Einer tut's, und in kürzester Zeit – warum du nicht? Heh, Olga, Frieda! Kommt einmal her!«
Aber die beiden Mädchen kamen gar nicht heran, drängten sich an Herrn Dr. Mohnen, der ihre Gläser füllte und ihnen zweideutige Geschichten erzählte.
Die Fürstin kam; Frank Braun stand auf und bot ihr seinen Platz. »Bleiben Sie, bleiben Sie!« rief sie. »Ich habe ja noch gar nicht mit Ihnen plaudern können!«
»Einen Augenblick, Durchlaucht, ich will nur eine Zigarette holen,« sagte der Student. »Und mein Onkel freut sich schon die ganze Zeit darauf, Ihnen seine Komplimente machen zu dürfen.«
Der Geheimrat freute sich gar nicht darauf, hätte viel lieber die kleine Prinzess da sitzen gehabt. Nun aber unterhielt er die Mutter –
Frank Braun trat zum Fenster, als der Justizrat Frau Marion zum Flügel führte. Herr Gontram setzte sich nieder, drehte sich im Klavierstuhl und sagte: »Ich bitte um ein wenig Ruhe. Frau Marion wird uns ein Liedchen vorsingen.« – Er wandte sich zu seiner Dame. »Na, was denn, liebe Frau? – Wahrscheinlich wieder mal ›Les Papillons‹? Oder vielleicht ›Il baccio‹ von Arditi? – Na, geben Sie nur her!«
Der Student schaute hinüber. Sie war immer noch schön, diese alte, aufgemachte Dame, und man glaubte ihr schon die vielen Aventüren, die über sie erzählt wurden. Damals, als sie die gefeiertste Diva Europas war. Nun aber lebte sie schon seit bald einem Vierteljahrhundert in dieser Stadt, still, zurückgezogen in ihrer kleinen Villa. Machte jeden Abend einen langen Spaziergang durch ihren Garten, weinte dort eine halbe Stunde an dem blumigen Grabe ihres Hündchens –
Jetzt sang sie. Längst gebrochen war diese herrliche Stimme, aber doch war ein seltener Zauber in ihrem Vortrage aus alter Schule. Auf den geschminkten Lippen lag das alte Lächeln der Siegerin und unter dem dicken Puder versuchten die Züge ihre ewige Pose bestrickender Lieblichkeit. Ihre dicke, verfettete Hand spielte mit dem Elfenbeinfächer und die Augen suchten wie einst aus allen Ritzen den Beifall zu ziehen.
O ja, sie passte hierher, Madame Marion Vère de Vère, passte in dies Haus, wie alle andern, die zu Gast waren. Frank Braun sah sich um. Da sass sein teurer Onkel mit der Fürstin, und hinter ihnen, an die Tür gelehnt, standen Rechtsanwalt Manasse und Hochwürden Kaplan Schröder. Dieser dürre, lange, schwarze Kaplan Schröder, der der beste Weinkenner war an der Mosel und an der Saar, der den erlesensten Keller führte und ohne den eine Weinprobe schier unmöglich schien im Lande. Schröder, der ein unendlich kluges Buch geschrieben hatte über des Plotinus krause Philosophie und der zugleich die Possen schrieb für das Puppentheater des Kölner Hänneschen. Der ein glühender Partikularist war, der die Preussen hasste, der, wenn er vom Kaiser sprach, nur an den ersten Napoleon dachte und alljährlich am fünften Mai nach Köln hinüberfuhr, um in der Minoritenkirche dem feierlichen Hochamte für die Toten der ›Grande Armée‹ beizuwohnen.
Da sass der gewaltige, goldbebrillte Stanislaus Schacht, cand. phil. im sechzehnten Semester, zu behäbig, zu faul sich auch nur zu erheben vom Stuhle. Seit Jahren wohnte er, als möblierter Herr, bei Frau Witwe Prof. Dr. v. Dollinger – – nun waren ihm längst Hausherrnrechte dort eingeräumt. Und diese kleine, hässliche, überschlanke Frau sass bei ihm, füllte ihm immer von neuem das Glas, lud immer höhere Portionen Kuchen auf seinen Teller. Sie ass nichts – aber sie trank nicht weniger wie er. Und mit jedem neuen Glas wuchs ihre Zärtlichkeit; liebend strich sie die knochigen Finger über seine mächtigen Fleischerarme.
Neben ihr stand Karl Mohnen, Dr. jur. und Dr. phil. Er war ein Schulkamerad von Schacht und dessen grosser Freund, studierte nun ebensolange wie der. Nur musste er immer Examina machen, musste immer umsatteln; augenblicklich war er Philosoph und dicht vor seinem dritten Examen. Er sah aus wie ein Kommis im Warenhaus, rasch, hastig und immer bewegt; Frank Braun dachte, dass er sicher noch einmal zum Kaufmann übergehen würde. Da würde er gewiss sein Glück machen, so in der Konfektionsbranche, wo er Damen zu bedienen hätte. Er suchte immer nach einer reichen Partie – – auf der Strasse. Machte Fensterpromenaden, hatte auch ein artiges Geschick, Bekanntschaften anzuknüpfen. Besonders reisende Engländerinnen krallte er gern an, aber leider – hatten sie nie Geld.
Noch einer war da, der kleine Husarenleutnant mit dem schwarzen Schnurrbärtchen, der jetzt plauderte mit den Mädchen. Er, der junge Graf Geroldingen, der in jeder Theatervorstellung hinter den Kulissen zu finden war, der ganz hübsch malte, talentvoll geigte und dabei doch der beste Rennreiter war im Regiment. Und der nun Olga und Frieda etwas von Beethoven erzählte, was sie grässlich langweilte und was sie nur anhörten, weil er ein so hübscher kleiner Leutnant war.
O ja, sie gehörten alle hierher, ohne Ausnahme. Hatten alle ein wenig Zigeunerblut – trotz ihrer Titel und Orden, trotz Tonsuren und Uniformen, trotz Brillanten und goldenen Brillen, trotz aller bürgerlichen Stellungen. Waren irgendwo angefressen, machten irgendwie kleine Umwege, seitab von den eingefassten Pfaden bürgerlichen Anstandes.
Ein Gebrüll ertönte, mitten hinein in Frau Marions Gesang. Es waren die Gontrambuben, die sich prügelten auf der Treppe; ihre Mutter ging hinaus, sie zur Ruhe zu bringen. Dann kreischte Wölfchen im Nebenzimmer und die Mädchen mussten das Kind hinauftragen in die Mansarden. Sie nahmen Cyklop mit, betteten beide zusammen in den engen Kinderwagen.
Und Frau Marion begann ihr zweites Lied: den ›Schattentanz‹ aus Meyerbeers Dinorah.
– Die Fürstin fragte den Geheimrat nach seinen neuesten Versuchen. Ob sie wieder einmal kommen dürfe die merkwürdigen Frösche zu sehen, die Lurche und die hübschen Äffchen?
Ja gewiss, sie möge nur kommen. Auch die neue Rosenzucht solle sie sich ansehen, in seinem Mehlemer Schlösschen, und die grossen weissen Kamelienhecken, die sein Gärtner dort anpflanzte.
Aber der Fürstin waren die Frösche und Affen interessanter als die Rosen und Kamelien. Und so erzählte er von seinen Versuchen der Übertragung von Keimzellen und der künstlichen Befruchtung. Sagte ihr, dass er gerade ein hübsches Fröschlein da habe mit zwei Kopfenden und ein anderes mit vierzehn Augen auf dem Rücken. Setzte ihr auseinander, wie er die Keimzellen ausschneide aus der Kaulquabbe und sie übertrage auf ein anderes Individuum. Und wie sich die Zellen fröhlich weiter entwickelten im neuen Leibe und nach der Verwandlung Köpfe und Schwänze, Augen und Beine hervortrieben. Sprach ihr dann von seinen Affenversuchen, erzählte, dass er zwei junge Meerkatzen habe, deren jungfräuliche Mutter, die sie nun säugte, nie einen männlichen Affen sah –
Das interessierte sie am meisten. Sie fragte nach allen Details, liess sich bis ins kleinste genau auseinandersetzen, wie er es anstelle, liess sich alle griechischen und lateinischen Worte, die sie nicht verstand, hübsch in deutsch wiedergeben. Und der Geheimrat triefte von unflätigen Redensarten und Gebärden. Der Speichel tropfte ihm aus den Mundwinkeln, lief über die schleppende, hängende Unterlippe. Er genoss dieses Spiel, dieses koprolale Geschwätz, schlürfte wollüstig die Klänge schamloser Worte. Und dann, dicht bei einem besonders widerlichen Worte, warf er sein ›Durchlaucht‹ hinein, trank mit Entzücken den Kitzel dieses Gegensatzes.
Sie aber lauschte ihm, hochrot, aufgeregt, zitternd fast, sog mit allen Poren diese Bordellatmosphäre, die sich breit aufputzte in dem dünnen wissenschaftlichen Fähnchen –
»Befruchten Sie nur Äffinnen, Herr Geheimrat?« fragte sie atemlos.
»Nein,« sagte er, »auch Ratten und Meerschweinchen. Wollen Sie einmal zusehen, Durchlaucht, wenn ich – –« Er senkte seine Stimme, flüsterte beinahe.
Und sie rief: »Ja, ja! Das muss ich sehen! Gerne, sehr gerne! – – Wann denn?« – Und sie fügte hinzu, mit schlecht gemachter Würde: »Denn wissen Sie, Herr Geheimrat, nichts interessiert mich mehr als medizinische Studien. – Ich glaube, ich wäre ein sehr tüchtiger Arzt geworden.«
Er sah sie an, breit grinsend. »Zweifellos, Durchlaucht!« Und er dachte, dass sie gewiss noch eine viel bessere Bordellmutter geworden wäre. Aber er hatte sein Fischlein im Garn. Begann wieder von der Rosenzucht und den Kamelienhecken und seinem Schlösschen am Rhein. Es sei ihm so lästig, und er habe es nur aus Gutmütigkeit übernommen. Und die Lage sei eine so ausgezeichnete – – und erst die Aussicht. – Und vielleicht, wenn Ihre Durchlaucht sich nun endlich entschliessen wolle, könne –
Die Fürstin Wolkonski entschloss sich, ohne einen Augenblick zu zögern. »Ja, Herr Geheimrat, ja gewiss, natürlich nehme ich das Schlösschen!« – Sie sah Frank Braun vorbeigehn und rief ihn an: »Ach, Herr Studiosus! Herr Studiosus! Kommen Sie doch! Ihr Herr Onkel hat mir versprochen, mir einige seiner Experimente zu zeigen – – ist das nicht entzückend liebenswürdig? Haben sie es auch schon einmal gesehen?«
»Nein,« sagte Frank Braun. »Es interessiert mich gar nicht.«
Er wandte sich, aber sie hielt ihn am Ärmel fest. »Geben Sie – geben Sie mir eine Zigarette! Und – ach ja, bitte ein Glas Sekt.« Sie zitterte im heissen Kitzel, über ihre Fleischmassen kroch ein perlender Schweiss. Ihre groben Sinne, aufgepeitscht von den schamlosen Reden des Alten, suchten ein Ziel, brachen wie breite Wogen über den jungen Burschen.
»Sagen Sie mir, Herr Studiosus – –« ihr Atem keuchte, ihre mächtigen Brüste drohten das Mieder zu sprengen. – »Sagen Sie mir – – glauben Sie, dass – dass der Herr Geheimrat – – seine Wissenschaft, seine Experimente mit der – der künstlichen Befruchtung – auch auf Menschen anwenden könnte?«
Sie wusste recht gut, dass er's nicht tat. Aber sie musste dieses Gespräch fortsetzen, weiterführen um jeden Preis. Da, mit diesem jungen und frischen, hübschen Studenten.