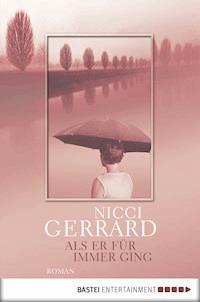
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Es gibt eine andere." Plötzlich ist Irene eine verlassene, alleinerziehende Ehefrau, die am Betrug ihres Mannes zu zerbrechen droht. Verstört taumelt sie durch ihren Alltag - bis sie sich an die strahlende Irene erinnert, die die Nächte durchtanzte und 'Ja' sagte zum Leben, und das Kribbeln im Bauch wiederentdeckt. "Pures Leben. Sensibel: Nicci Gerrards Roman über Trennung und Neuanfang" Madame
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 464
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Dreizehn
Vierzehn
Fünfzehn
Sechzehn
Siebzehn
Achtzehn
Neunzehn
Zwanzig
Einundzwanzig
Zweiundzwanzig
Dreiundzwanzig
Vierundzwanzig
Fünfundzwanzig
Sechsundzwanzig
Siebenundzwanzig
Achtundzwanzig
Neunundzwanzig
Dreißig
Einunddreißig
Zweiunddreißig
Dreiunddreißig
Vierunddreißig
Fünfunddreißig
Über die Autorin
Nicci Gerrard ist der weibliche Teil des bekannten Autorenteams Nicci French. Unter diesem Pseudonym hat die englische Journalistin mit ihrem Ehemann Sean French bereits zahlreiche Romane im Spannungsgenre veröffentlicht. »Als wir Töchter waren«, ihr erster Soloauftritt, war eine bewegende Familiengeschichte und begeisterte weltweit eine große Leserschaft. Auch mit ihrem zweiten Roman beweist Nicci Gerrard, dass sie jenseits der Spannungsliteratur zu fesseln vermag.
NICCIGERRARD
ALS ER FÜR IMMER GING
ROMAN
Aus dem Englischen von Gabriele Gockel und Rita Seuß
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
© 2005 by Nicci Gerrard
Titel der englischen Originalausgabe:
»Solace«
Originalverlag: PENGUIN BOOKS Ltd, London
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2006/2014 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Regina Maria Hartig
Umschlaggestaltung: Gisela Kullowatz
unter Verwendung eines Entwurfs von Christina Krutz Design
Titelbild: © CuboImages/mauritius images und
Getty Images/Photonica/Dirk Anschütz
E-Book-Produktion: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN 978-3-7325-0432-9
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Für Edgar, Anna Hadley und Molly
Eins
Wann hatte alles angefangen? Sie würde es nie mit Sicherheit wissen, auch wenn sie später die Spuren bis zu einem Abend im frühen Winter zurückverfolgte, wie man mit dem Finger auf der Landkarte dem Lauf eines breiten Stroms bis zum kaum sichtbaren Rinnsal seiner Quelle nachgeht. Sie erinnerte sich an die Kälte und Dunkelheit draußen und an den feuchten, stürmischen Wind. An das Klappern von Mülltonnendeckeln, das Zischen von Autoreifen in Pfützen, das Rascheln von Sträuchern und das Knarren sich biegender Bäume. Drinnen war es warm, und im Lichtschein der Lampen und Kerzen wirkte das Zimmer wie eine tiefe Höhle im geheimen Herzen Londons. Sie grübelte so lange darüber nach, was geschehen sein mochte, bis sie nicht mehr auseinander halten konnte, was sie wirklich wusste und was sie sich nur einbildete. Sie leuchtete die dunklen Winkel aus, füllte die Momente mysteriösen Schweigens mit dem vielsagenden Gemurmel ihrer Stimmen und gab sich dem Bild hin, das die beiden zusammen zeigte – der Augenblick, in dem ein Streichholz angerissen wird, die kalte Flamme am trockenen Zunder leckt, ohne dass jemand auch nur ahnt, was für ein verheerender Brand daraus entstehen wird. Hätten sie ihn verhindert, wenn sie es gewusst hätten? Hätten sie die Flamme ausgepustet und es dabei belassen – bei dem Augenblick, der eine Möglichkeit eröffnete, an den sie sich später, wenn überhaupt, mit einem wehmütigen Gefühl für die Gefährlichkeit des Lebens erinnern würden?
Und sie selbst, Irene? Wenn sie das Zerstörerische, das jener Abend barg, unbemerkt hätte abwenden, es mit einem einfachen Klick hätte ausschalten können, hätte sie es getan? Hätte sie es wirklich getan?
Es war schon spät, als die Gäste einzeln oder zu zweit aufbrachen. Irene beobachtete, wie sie sich über Adrian beugten, der sich auf dem durchgesessenen Sofa zurückgelehnt hatte. Sie klopften ihm auf die Schulter, umarmten und küssten ihn und versicherten, es habe Spaß gemacht, er sei wunderbar gewesen, brillant. Der Anfang einer großen Zukunft, sagten sie, ohne es selbst zu glauben, denn er hatte nur zwei kurze Auftritte gehabt, das zweite Mal als Leiche in einer Ecke des Fernsehschirms, die nackten Beine grässlich bleich und behaart. Daran, wie er die Gäste anlächelte, leicht betrunken, erkannte Irene, dass er selbst es zwar auch nicht so ganz glaubte, aber im Rausch und im Überschwang der Hoffnung die Kontrolle verloren hatte. Er starrte auf die schwangere Sarah, deren Bluse sich über dem Bauch spannte, sodass sich die Umrisse ihres Nabels abzeichneten, und atmete Gregs Geruch nach Zigaretten und Aftershave und den raffinierten Duft von Monas herbem Parfum ein.
Alle anderen wirkten ungezwungen und relaxt. Der Schein des Kaminfeuers ließ ihre Konturen verschwimmen, Alkohol und Müdigkeit hatten ihre Ecken und Kanten geglättet, doch Irene fühlte sich angespannt und war auf der Hut, eine Frau mit Profil und klaren Standpunkten. Sie wusste, wie sich Adrian gerade fühlte, als wäre sie an seiner Stelle. Ein leichter, pochender Kopfschmerz über seinem linken Auge. Morgen würde er einen trockenen Mund haben, unter Übelkeit leiden und schlecht gelaunt sein. Er würde die Kinder anschnauzen, sich beim Rasieren schneiden und sein verkatertes Gesicht besorgter als sonst im Spiegel anstarren. Jetzt aber setzte er ein noch breiteres Grinsen auf, spürte, wie die Haut um den Mund spannte, und goss sich ein weiteres Glas Wein ein, das er in schnellen, gierigen Schlucken leerte, ohne sich um Irenes besorgten Blick zu kümmern. Er schüttelte Gary die Hand, küsste Lisa auf den Mundwinkel und erklärte den Gästen, sie müssten noch nicht gehen. Sie sollten noch ein bisschen bleiben. Er wollte nicht, dass der Abend zu Ende ging und der nächste Tag kam, das kalte blaugraue Licht des Morgens.
Dann weinte irgendwo ein Kind und rief schluchzend: »Mami! Ma-amiiii!« Irene stand sofort auf, drehte den letzten Gästen den Rücken zu und lief die Treppe hoch, über den abgewetzten Flurteppich ins Bad, wo Clem im Halbdunkel auf den kalten Fliesen kniete, über die Toilettenschüssel gebeugt, und wimmerte. Irene kauerte sich neben ihre Tochter, legte ihr die kühle Hand auf die feuchte Stirn und murmelte tröstende Worte. »Mein Püppchen«, sagte sie, »mein Engel.« Sie hörte Stimmen, die sich verabschiedeten, und dass Türen geöffnet und geschlossen wurden. »Es wird wieder gut«, sagte sie. »Alles wird gut.« Sie wusste, dass sie nicht nur ihrer Tochter, sondern auch sich selbst Mut zusprach. Sie hatte keine Lust, wieder hinunterzugehen, jetzt noch nicht.
Deshalb konnte sie sich nur ausmalen, was dort unten als Nächstes geschah. Sie ließ es in ihrer Phantasie so lebendig werden, dass sie das Gefühl hatte, sie sei dabei gewesen, im Dunkeln, als heimliche Beobachterin. Schließlich war nur noch Frankie geblieben; sie saß am Tisch, auf dem noch die Reste des Abendessens standen, die Beine leicht gespreizt, sodass Adrian ihre weichen Schenkel sehen konnte. Sie trug eine dünne, weite Bluse, und wenn sie sich vorbeugte, erhaschte er einen Blick auf die Rundungen ihrer Brüste. Für einen Moment wirkte sie auf ihn wie ein Kunstwerk, zeitlos und wohlkomponiert: das Kornblumenblau ihrer Bluse und der sanfte Glanz ihrer kräftigen nackten Unterarme, während die Kerzen hinter ihr das Durcheinander auf dem Tisch beleuchteten und das Besteck matt schimmern ließen; die orangefarbenen Kringel der Mandarinenschalen, die weißen Teller mit den zerknüllten bunten Papierservietten und den Essensresten. Als sie ihr Weinglas nahm und es bis auf den letzten Tropfen leerte, sah er das Spiel ihrer Halsmuskeln und den roten Abdruck ihrer Lippen auf dem Glasrand. Einen Schuh hatte sie halb abgestreift. Ihr Haar war in Unordnung, und eine dunkelblonde Strähne fiel ihr über die Wange. Sie lächelte ihn an und stand auf, mit einer Hand auf den Tisch gestützt. Er registrierte Irenes eilige Schritte auf den nackten Holzdielen in einem Zimmer im oberen Stock, das Schlagen einer Tür, das laute Husten eines Kindes. Dann war es wieder still.
Irene selbst hatte darauf bestanden, ein paar Freunde einzuladen und sich gemeinsam den Film anzusehen, in dem er mitspielte. Die Produktionsfirma hatte schon vor Wochen ein Videoband davon geschickt. An diesem Abend lief er im Fernsehen. Adrians Name erschien am Ende des Abspanns in kleineren Buchstaben und schnellerem Durchlauf als die Namen der Hauptdarsteller. TV Times hatte den Film als »belanglos« bezeichnet, und Adrian stimmte insgeheim zu, aber Irene hatte gesagt, es sei trotzdem ein Anlass zum Feiern. Sie hatte fünfzehn Gäste eingeladen, gute Bekannte, und einige von ihnen kamen in Begleitung, sodass sie schließlich in dem kleinen Wohnzimmer zu zweiundzwanzig waren. Den Tisch hatten sie an die Wand gerückt, Stühle und Kissen um den Fernseher gruppiert. Irene hatte mit Tomaten und Käse gefüllte Blätterteighörnchen gebacken; sie waren im Ofen aufgeplatzt und hatten ihren Inhalt in schwarzen Blasen übers Backblech ergossen. Es gab dicke Scheiben Cheshire-Käse, dazu eingelegtes Gemüse und knusprige Baguettes, die Irene im Ofen aufgebacken hatte; Mandarinen mit narbigen, dicken Schalen in Netzen; Hackfleischpasteten mit Gittermuster; einen Kasten Bier aus dem Getränkemarkt und einen Karton chilenischen Rotwein, ein Sonderangebot. Irene hatte die angeschlagenen Teller, Bier- und Weingläser aus dem Schrank geholt und auf den Tisch gestellt, die Papierservietten dazugelegt, die noch von Sashas Geburtstagsfeier übrig waren, und die Kerzen fest in die Glasständer gedrückt. Dann erschienen die Freunde und brachten Sekt mit, ließen die Korken an die Decke knallen und tranken so viel, dass sie gar nicht merkten oder sich nicht darum scherten, wie jämmerlich der Film tatsächlich war. Irene hatte ein Zeichen der Zuversicht setzen wollen, aber das Ganze hatte auch etwas Elegisches. Vielleicht markierte dieser Filmauftritt tatsächlich den Beginn eines neuen Abschnitts, wie die Freunde meinten, als sie die Gläser hoben, um ihm herzlich zuzuprosten. Vielleicht war es aber auch nur der undramatische Abgesang einer Karriere, die nie wirklich begonnen hatte.
Jetzt war Irene oben und nur noch Frankie bei ihm. Die Ellbogen breit auf den Tisch gestützt, lächelte sie ihn an, während hinter ihr eine Kerze aufflackerte und Schatten warf, bevor sie erlosch. Frankie stand auf, leicht torkelnd, kichernd.
»Ich sollte gehen«, sagte sie. »Sieh mal, wie spät es ist. Morgen früh komme ich nicht aus den Federn.«
»Bleib noch«, sagte er. »Wenn du jetzt gehst, ist niemand mehr da und alles ist vorbei. Was fange ich dann mit mir an? Bleib. Leiste mir Gesellschaft. Bleib hier und trink noch ein Glas.«
»Nein, wirklich nicht. Ich wollte eigentlich gar nicht so lange bleiben.«
»Es ist nicht spät. Erst –« Er starrte auf seine Uhr und blinzelte. Die Zahlen verschwammen vor seinen Augen.
»Ich ruf mir ein Taxi, wenn ich darf. Die U-Bahn fährt nicht mehr, und um diese Uhrzeit möchte ich in Hackney nicht gern zu Fuß unterwegs sein.«
»Bitte.« Er machte eine Handbewegung Richtung Telefon. »Ich komme nicht hoch.«
Sie tippte die Nummer ein, nannte die Adresse, setzte sich auf den Boden neben das Sofa und schlug die Beine übereinander, sodass ihr Rock hochrutschte. Er schaute weg, dann wieder hin.
»Zehn Minuten«, sagte sie. »Höchstens. Sag Irene schönen Dank.«
»Sie wird bestimmt gleich runterkommen. Clemmie hat sich irgendetwas eingefangen, ihr ist ständig übel.«
»Mach dir keine Sorgen.«
»Schenk mir noch ein Glas Wein ein.«
»Meinst du wirklich?«, fragte sie, goss das Glas jedoch voll und nahm selbst einen Schluck, bevor sie es ihm reichte. Am Rand zeichnete sich ein roter Fleck ab, und er hob den Kopf und setzte das Glas dort an, wo ihre Lippen es berührt hatten. Er trank gierig und spürte, wie seine Muskeln erschlafften, die Gedanken sich überschlugen, seine Worte bedeutungslos wurden, zerfielen.
Er hatte Frankie bisher nie besondere Beachtung geschenkt. Seit über zwölf Jahren spielte die jüngere Schwester der ältesten Freundin seiner Frau nur ganz am Rand eine Rolle in seinem Leben. Er sah von seinem Platz aus, dass sie keinen BH trug und volle, weiche Brüste hatte; ihre Waden waren muskulös, und an ihren langen Ohrläppchen klimperten glänzende Metallohrringe. Zwischen ihren dichten Augenbrauen verlief eine winzige weiße Narbe, ihr Haarscheitel war nicht ganz gerade und ihr Make-up leicht verschmiert. Alles an ihr wirkte weich, schemenhaft, geheimnisvoll.
»Ich glaube, ich bin ein bisschen betrunken«, sagte er. Wenn er jetzt die Augen zumachte, würde das Zimmer kippen und er den Boden unter den Füßen verlieren. Er nahm noch einen Schluck.
Frankie legte ihre Hand sehr sanft auf seinen Oberschenkel. »Das ist dein Abend«, sagte sie. Einen Augenblick lang betrachtete er ihre schlanken Finger auf seinem Bein, die perlweiß schimmernden Nägel. Oben schloss sich leise eine Tür. Adrian stellte das Weinglas ab und legte seine Hand auf Frankies blonden, warmen Kopf, ohne sie anzuschauen. Er sah vor sich, wie Irene oben an der Schlafzimmertür stand und sich vergewisserte, dass alles in Ordnung war. So wie jeden Abend, den Kopf etwas geneigt und mit gespannter Miene. Adrian griff fester in Frankies Haarschopf und zog sie näher zu sich. Sie schlug die Beine auseinander, richtete sich halb auf und beugte sich zu ihm. Ihr Atem roch nach Wein. Als er mit dem Daumen über ihre Brustwarzen strich, die unter der dünnen Bluse deutlich hervortraten, entfuhr Frankie ein leises Stöhnen. Ihr Haar streifte sein Gesicht. Ihre Lippen öffneten sich leicht.
»Mein Gott, ich hätte Lust, dich zu vögeln«, sagte er, ohne sich zu bewegen.
Sie hörten die Schritte auf der Treppe, und Frankie ließ sich auf den Boden neben ihm zurücksinken. Sie schlug erneut die Beine übereinander und strich sich das Haar hinter die Ohren.
»Entschuldigung«, sagte Irene und trat ein, Bettwäsche unter dem Arm. Sie trug einen dicken, in der Taille gegürteten Frotteemantel mit hochgekrempelten Ärmeln und hatte sich bereits das Gesicht gewaschen. Das Haar war aus dem schmalen Gesicht nach hinten gekämmt, sie roch nach Lavendelseife und Feuchtigkeitscreme und auch ein wenig nach Erbrochenem. »Clemmie hat sich übergeben. Ich musste sie waschen und das Bettzeug wechseln.«
»Ich hätte dir helfen sollen«, sagte Adrian. »Entschuldige. Warum hast du mich nicht gerufen?«
»Die Ärmste«, sagte Frankie. »Kann ich irgendwas tun?«
»Nein, ist schon gut.« Irene sah die beiden an, die so nah zusammensaßen. Adrians Gesicht war gerötet. »Möchtet ihr noch einen Kaffee?«
»Ich werde gleich gehen. Mein Taxi müsste längst hier sein.«
Und als es kurz darauf an der Haustür läutete, zog Frankie ihren dicken Mantel an, schlang sich einen Samtschal um den Hals, griff nach ihrer Tasche, verabschiedete sich von Irene mit einem Kuss auf beide Wangen und einer kurzen Berührung ihrer schmalen Schultern und legte Adrian beiläufig eine Hand auf den dicken, heißen Kopf.
»Bis bald«, sagte er liebenswürdig, obwohl es ihm schwer fiel, nicht laut aufzustöhnen. Nahezu überwältigt von Wollust und Schuld, konnte er das eine nicht mehr vom anderen unterscheiden.
Zwei
»Ich glaube, es hat alles gut geklappt«, sagte Irene. »Hat es dir gefallen?«
»Ja«, antwortete er. »Gut. Danke. Du hast dir meinetwegen viel Mühe gemacht.«
»Ach.« Sie sah zu ihm hinunter. »Das war doch das Mindeste, was ich tun konnte.«
»Danke«, sagte er noch einmal. Er blickte in ihre ehrlichen grauen Augen mit den winzigen Krähenfüßen und auf ihren großen, von feinen Falten umrahmten Mund.
»Alles in Ordnung bei dir?«, fragte sie.
»Ja. Ich bin nur etwas müde. Irene?«
»Mmm.«
»Wir sollten mal wieder zusammen wegfahren, so wie früher. Wie in alten Zeiten.«
»Ab ins Bett!«, sagte sie und dachte an überzogene Konten, Termine, die Tagesmutter, Heimweh.
»Es ist mein Ernst. Irgendwohin, wo im Februar die Sonne scheint, nur du und ich. Die Kinder kommen inzwischen auch ohne uns zurecht. Es ist lange her, dass wir so etwas gemacht haben. Wir könnten…«
»Nun komm schon«, sagte sie und streckte ihm die Hand entgegen. Er nahm sie und bemerkte, dass ihre Nägel abgekaut waren und ihr Ehering locker saß.
»Sollen wir nicht erst noch aufräumen?«
»Lass nur. Das hat Zeit bis morgen.«
Er beobachtete, wie sie den Morgenmantel auszog und an den Türhaken hängte. Sie war blass, hatte Sommersprossen auf den Schultern, einen Leberfleck an der Hüfte und vorstehende Rippenknochen. Früher war sie schlank und flink gewesen – wie eine Flamme, hatte er, von Liebe überwältigt, einmal zu ihr gesagt; wie eine Wildblume. Jetzt hingegen war sie mager. An ihren Armen sah man die Sehnen, und ihre Haut war schon ein wenig schlaff. Es fiel ihm schwer, keinen Vergleich mit dem anderen herrlichen Körper anzustellen, der in einem Tarnwerk aus Blättern wie eine reife Frucht geleuchtet hatte. Und als sich Irene neben ihm in das Bett legte, das sie seit zehn Jahren teilten, umarmte und küsste er sie und spürte dabei ihre hervorstehenden Rückenwirbel wie einen Reißverschluss an seiner Brust.
»Ich rieche immer noch nach Erbrochenem.«
»Das macht nichts.«
Er legte eine Hand auf ihren flachen Bauch zwischen ihren spitzen Beckenknochen. Sie achtete sorgfältig darauf, ihn weder abzuweisen noch zu ermuntern.
»Ich liebe dich«, sagte er in ihr Haar. Ihm war schwindlig, und wenn er tief einatmete, spürte er eine leichte Übelkeit. »Du weißt, dass ich dich liebe, oder?«
»Mmm. Ich dich auch.«
Er schob seine Hand weiter nach unten. »Irene?«
»Mmm?« Sie verharrte völlig reglos und starrte mit weit aufgerissenen Augen in die Dunkelheit.
»Ach, nichts. Schlaf gut.«
Sie murmelte leise. Er rollte sich auf den Rücken, legte den Arm über die Augen und spürte, wie die Wände auf ihn zustürzten.
Irene blickte in den Flur hinaus. Sie ließ die Tür immer einen Spalt offen, damit sie die Kinder nachts hören konnte. Ein fahlgelber Streifen Licht fiel vom Treppenabsatz auf den Teppich. Sie wartete, bis Adrian tief atmete, glitt aus dem Bett, streifte sich den Frotteemantel über und ging in das Zimmer, das sich Clemmie und Agnes teilten. Die beiden niedrigen Betten waren durch einen schmalen Gang getrennt, der in ihren Spielen ein Fluss, ein wütendes Feuer oder ein Abgrund war, den sie durch einen heldenhaften Sprung überwinden mussten. Agnes verfehlte allerdings oft das Ziel und landete mit einem Aufschrei der Enttäuschung und Verzweiflung auf dem Holzfußboden. Clemmie schlief, den Kopf auf ein Handtuch gebettet, neben sich einen Eimer. Sie hatte hektische rote Flecken auf den Wangen, und – wie Irene durch Auflegen der Hand prüfte – eine feuchte Stirn. Clemmies Rücken war glühend heiß. Ein schwerer, säuerlicher Geruch umgab sie.
Irene wusste, dass sie jetzt keinen Schlaf finden würde, obwohl sie vor wenigen Stunden, während des Films, mehrmals so von Müdigkeit übermannt worden war, dass sie die Augen weit aufreißen und sich aufrecht in die Kissen setzen musste, um nicht einzuschlafen. An ihrem Wein, dem einzigen des ganzen Abends, hatte sie nur genippt. In letzter Zeit schenkte sie sich nie mehr als ein Glas zum Essen ein, und selbst das rührte sie oft kaum an. Sie warf noch einen Blick in Sashas Zimmer, bevor sie hinunter in die Küche tappte, wo sich die Teller im Spülbecken stapelten und der Tisch mit verschmierten Gläsern, leeren Bierflaschen, zusammengeknüllten Papierservietten und Brotresten übersät war.
Irene steckte Clemmies Bettzeug in die Waschmaschine. Sie streifte sich Gummihandschuhe über, hob die Teller aus dem Spülbecken und füllte es mit heißem Wasser und Spülmittel. Sie ging systematisch vor, wusch erst das Besteck ab, dann die Gläser und am Schluss die Teller und Schüsseln. Sie leerte die Aschenbecher und schwenkte die Wein- und Bierflaschen aus, bevor sie sie in die Kiste für den Glascontainer stellte; sie legte die Kissen wieder auf die Stühle, fuhr mit dem Staubsauger über den Teppich und in staubige Ecken, und das alte Gerät verschlang rasselnd Krümel und Staub und bunte Perlen. Obwohl ihre Augen vor Müdigkeit brannten, war an Schlaf jetzt nicht zu denken. Es verschaffte ihr Befriedigung, das Zimmer wieder in seinen normalen Zustand zurückzuverwandeln, die Dinge an ihren Platz zu legen und zu wissen, dass es am Morgen so aussehen würde, als wäre am Vorabend nichts geschehen.
Inzwischen war es drei Uhr. Irene stellte sich vor, wie viele Leute um diese Zeit ebenfalls noch wach waren, sich liebten, Tabletten schluckten, Gedichte schrieben, in ihre Kissen schluchzten, neugeborene Babys an ihren wunden Brustwarzen nuckeln ließen und darauf warteten, dass ein Streifen grauen Tageslichts durch die Vorhänge fiel. Im Schrank standen verschiedene Packungen Tee: Zitrone-Ingwer, Zitrone-Eisenkraut, schwarze Johannisbeere, Minze, Kamille, ein »Beruhigungstee«, der staubig roch wie Heu oder Geranien. Sie hängte einen Beutel Zitrone-Eisenkraut in einen Becher und goss kochendes Wasser darüber, breitete das gewaschene Bettzeug auf dem Heizkörper aus und setzte sich dann mit untergeschlagenen Beinen im dunklen Wohnzimmer aufs Sofa. Sie legte die aufgesprungenen Hände um den Teebecher und trank in langsamen Schlucken, während ihr der wohlriechende Dampf ins Gesicht stieg. Regen peitschte gegen das Fenster. Sie fröstelte und zog den Gürtel ihres Morgenmantels enger.
Wenn man nicht schlafen kann, erscheint alles in einem grelleren Licht. Als sie Adrian am Abend in dem Fernsehspiel gesehen hatte, hatte sie sich endlich eingestanden, dass sie nicht mehr an seinen Erfolg als Schauspieler glaubte und diesen Glauben wohl schon vor langer Zeit verloren hatte. Sein Gesicht, in Wirklichkeit lebendig und sinnlich, wirkte auf dem Bildschirm merkwürdig flach und ausdruckslos wie eine überbelichtete Fotografie. Überrascht hatte sie zur Kenntnis genommen, was ihr bis dahin entgangen war: dass sein Haaransatz zurückwich, dass er um die Taille Speck angesetzt und leichte Hängebacken bekommen hatte. Sie hatte sich umgedreht und ihn beobachtet, während er sich selbst auf dem Bildschirm betrachtete. Sein spöttisches Grinsen vom frühen Abend war einer feierlichen Aufmerksamkeit gewichen. Mitleid durchzuckte sie wie ein Stromschlag, als sie erkannte, dass er zufrieden war mit dem Ich, das ihm entgegentrat. Seine Lippen formten lautlos die Sätze, die sein Ebenbild auf dem Bildschirm sprach, und er zeigte die Andeutung eines verschmitzten Lächelns. Ihr Herz zog sich zusammen. Sie legte die Hand auf seinen Arm und drückte ihn fest, aber er reagierte nicht. Er hatte keine Ahnung.
Nun fühlte sie sich ausgebrannt vor Erschöpfung, Beklemmung und Liebe. Unvorstellbar, dass sie ihn oder einen anderen Mann jemals wieder begehren würde. Aber zu dieser nächtlichen Stunde bestand der Trick darin, nicht weiter darüber nachzudenken.
Irene war auf dem Sofa eingeschlafen und kurz vor sechs Uhr plötzlich aufgewacht, fröstelnd und ganz steif. Eine Weile wusste sie nicht, wo sie war. Ja, sie hatte das irritierende Gefühl, nicht einmal zu wissen, wer sie war. Durch ihren Kopf rauschte eine Flut von Empfindungen und Regungen, endlose Erinnerungen, die nicht unbedingt etwas mit ihr zu tun hatten. Sie blieb regungslos liegen, die Hände auf dem groben Stoff des Kissens, und wartete, dass sich die Dinge entwirrten und zu ihr zurückkehrten. Allmählich gewöhnten sich ihre Augen an das Dämmerlicht, und sie erkannte die Sessel, den Tisch, die vom oberen Absatz her schwach beleuchtete Treppe. Nun konnte sie sich auch vorstellen, was sie nicht sah: den Teppich mit der abgewetzten Stelle unter dem Tisch, das Zickzackmuster der Kissen. Sie setzte sich auf, rieb sich die Augen und stand auf.
Sie war gerade in die vom Badeöl glitschige Wanne gestiegen, als Agnes erwachte und hereinmarschiert kam. Ihre Füße stampften schwer über die Fliesen, und sie blinzelte unter ihrem zotteligen hellblonden Schopf.
»Ist jetzt Morgen?«, fragte sie.
»Er fängt gerade an.«
Ohne ein weiteres Wort zog Agnes das Nachthemd aus und stieg ins Wasser. Pummelig wie sie war, machte sie es sich zwischen den Beinen ihrer Mutter bequem wie ein selbstzufriedener kleiner Buddha, obwohl ihr das Wasser bis zum Hals reichte. Sie griff nach dem Stück Seife am Beckenrand, betrachtete es neugierig und biss hinein. Nach wenigen Sekunden rutschte ihr die Seife aus der kleinen Faust, aber sie verzog keine Miene. Doch dann öffnete sie den Mund und stieß einen heiseren Schrei aus, während weiche Seifenbrocken von ihrer schäumenden Zunge fielen und sie die Arme ins Wasser warf.
»Ach, Aggie, nein! Nicht schon wieder«, sagte Irene. »Los, raus aus dem Wasser! Wir müssen dir den Mund ausspülen, bis der Geschmack weg ist.«
Irene kletterte aus der Wanne und hob Agnes, die immer noch wie besinnungslos brüllte, über den Rand. Die Kleine strampelte mit den nassen Beinen, und ihr öliger Körper entwand sich Irenes Griff wie ein dicker, sich schlängelnder Aal.
»Spuck aus!«, sagte Irene und füllte einen Plastikbecher mit Wasser. »Spuck alles aus!«
»Huuuuuuuu.«
»Spuck aus!«
»Du hast mich geweckt. Warum hast du nichts an?«
»Ach, Clem. Tut mir leid. Geht es dir besser? Du hättest nicht aufstehen sollen.«
»Huuuuuuu.«
»Was hat sie? Ist sie auch krank?«
»Sie hat nichts. Geh wieder ins Bett. Spuck aus, Aggie!«
»Ich habe geträumt, ich fliege.«
»Wie schön!«, sagte Irene zerstreut und fuhr fort, kaltes Wasser in Aggies plärrenden Mund zu schütten.
»Nein, denn ich hatte ständig Zusammenstöße. Mit Fensterscheiben, Kühen, allem Möglichen. Es hat wehgetan.«
»Wahrscheinlich weil du krank bist.« Irene musterte Clem aufmerksam: die wächserne Blässe ihrer Haut und die feuchten, kurz geschnittenen Haare, die über der Stirn abstanden. »Man hat oft komische Träume, wenn man krank ist. Ich habe immer geträumt, ich würde von Riesenameisen gejagt, die auf den Hinterbeinen standen.«
»Hatten sie Gras im Mund?«
»Was?«
»Huuuuuuuu.«
Als es acht Uhr war, hatte Irene das Frühstück für Agnes gemacht, die morgens nichts anderes als Weißbrot ohne Rinde mit Erdbeermarmelade essen wollte. Sie hatte Clems Fieber gemessen – knapp über achtunddreißig Grad –, und ihre Tochter roch immer noch nach Erbrochenem. Sie hatte Sasha zugehört, die für ihre Klavierprüfung zum Abschluss des ersten Unterrichtsjahres übte. Ihre dünnen Beine in der gestreiften Strumpfhose traten die Pedale, während die kleinen Finger die richtigen Tasten suchten und ihre rosa Zunge zwischen den geschürzten Lippen hervorspitzte. Irene hatte kurz zu Adrian hineingeschaut, der auf dem Rücken lag und tief und fest schlief, eine Hand über den Augen, einen Fuß unter der Bettdecke hervorgestreckt, mit einem in der Kehle rasselnden Atem, der beinahe ein Schnarchen war. Sie warf seine schmutzige Wäsche in den Korb in der Ecke, und da sie erst später zur Arbeit musste, nahm sie eine alte Hose und ein altes T-Shirt vom Stuhl und holte eine saubere Unterhose und saubere Socken aus einer Schublade. Adrian bewegte sich im Halbschlaf, zog die Decke fester um sich und drehte ihr den Rücken zu. Tief in ihr regte sich Groll, aber sie ignorierte ihn und räumte die halb vollen Becher mit kaltem Tee von seinem Nachttisch.
Adrian beobachtete sie im Schutz seines Arms. Sie trug unförmige, ausgewaschene Jeans und ein senffarbenes Sweatshirt mit ausgefransten Ärmeln, das einmal ihm gehört hatte. Wo sie mit den Fingern hindurchgefahren war, stand ihr Haar nach allen Seiten ab. In letzter Zeit trug sie immer häufiger sackartige, praktische Kleidung und war ständig in Bewegung – so wie jetzt, da sie etwas vom Boden aufhob und den verschmierten Spiegel abwischte. Sie war immer in Eile, immer auf dem Sprung, sie lief mit ihren starken Fußgewölben pausenlos umher, als wolle sie gleich zum Spurt ansetzen; ihre Augen flackerten, wenn sie mit ihm sprach, während sie bereits in den Blick nahm, was sie als Nächstes zu tun hatte. Als er sie kennen lernte, trug sie luftige Röcke, durch die man ihre schlanken Beine sehen konnte, und leuchtende Tops, und eine goldblonde Haarpracht fiel ihr über den Rücken. Doch vor zehn Monaten hatte sie sich die Mähne gestutzt; hatte sich mitten in der Küche die Locken abgeschnitten, die wie schillernde Bänder auf die Fliesen segelten. Jetzt wirkte ihr Gesicht merkwürdig nackt und kindlich. Im Sommer bekam sie selbst auf den Lippen Sommersprossen. Er erinnerte sich noch, wie er zum ersten Mal ihr Gesicht in die Hände genommen und gespürt hatte, dass sie lächelte, als er sie auf den breiten, gesprenkelten Mund küsste. Das war lange her. Auch auf ihrem Rücken fanden sich Sommersprossen, ebenso auf ihren Schenkeln unterhalb des goldenen Haarflaums, den Rücken ihrer rauen Hände, den Handgelenken und – vereinzelt – sogar auf den Knien. Er betrachtete sie, wie sie mit verkrampften, hochgezogenen Schultern stirnrunzelnd in den feuchten eintönigen Himmel schaute und an den Fingernägeln kaute.
»Ich steh gleich auf«, murmelte er mit belegter Stimme. Seine Zunge war wie Leder.
Aber er blieb noch ein paar Minuten liegen, bemüht, nicht an den vergangenen Abend zu denken, der ihm so unwirklich und seltsam vorkam wie ein Traum, an den man sich kaum erinnert und der einen dennoch nicht loslässt.
Drei
Fast drei Wochen vergingen, bis Adrian Frankie wiedersah. Seit jenem Abend, an dem er sie nicht geküsst hatte, spielte er öfter mit dem Gedanken, sie anzurufen, auch wenn er wusste, dass er es am Ende doch nicht tun würde. Er kannte ihre Nummer inzwischen auswendig, obwohl er alles tat, um sie zu vergessen. In der Woche, als er für Garys Firma die Aktenablage machte, an den Freitagnachmittagen und Samstagvormittagen, wenn er frühpubertierenden Mädchen Schauspiel- und Gesangsunterricht erteilte – Mittelschichtgören, die sich einbildeten, Schauspielerinnen werden zu müssen, weil sie gern im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit standen, oder deren Mütter ein entsprechendes »Talent« bei ihren Kindern entdeckt hatten –, und in den Stunden, in denen er müßig zu Hause herumlungerte, vor dem Fernseher saß und mehr als nur eine Dose Bier öffnete – in all diesen Stunden stellte er sich vor, wie es wäre, wenn er den Hörer ans Ohr halten und den Hauch ihrer Stimme hören würde. Vielleicht wäre sie verwirrt: »Adrian? Ach ja, der Adrian.« Oder kühl und missbilligend, glühend vor Verlegenheit, oder vielleicht würde ein Mann abheben und fragen, ob er etwas ausrichten könne. Manchmal malte er sich jedoch aus, ihre Stimme klänge heiser und erwartungsvoll… Aber natürlich wusste er, wenn er nach dem Hörer griff, wie lächerlich es war, wie gefährlich und falsch, auch nur daran zu denken. Schon bei diesem unmöglichen Gedankenspiel brach ihm der Schweiß aus. Er dachte an Irene mit ihrem Kurzhaarschnitt und ihren schäbigen Jeans und wartete, dass sie von der Arbeit nach Hause kam. Sie schob das Fahrrad mit Aggie auf dem Sitz, während die beiden anderen neben ihr hertrotteten. Alle mochten Irene. Sie war engagiert, loyal und zäh, sie sagte, was sie dachte, und man konnte sich auf sie verlassen. Aber es war ihnen schleierhaft, wie sie es schaffte, alles zu vereinbaren: den Beruf, die Kinder und – die Stimmen senkten sich zu einem verschwörerischen Flüstern – na, du weißt schon, all das. Die liebe Irene, sagten sie. Die arme Irene.
Eigentlich war Irene Grundschullehrerin, aber nun unterrichtete sie Kinder und, seltener, Erwachsene mit einer Lese-Rechtschreib-Schwäche. Sie arbeitete in einem großen kalten Zimmer im ersten Stock eines großen grauen Hauses im Norden Londons, das den Quäkern gehörte. Ein Elektroofen war vorhanden, eine Schiefertafel hing an der Wand, und unter dem Tisch stand eine Kiste mit schäbigen, ausrangierten Spielsachen. Vom Erkerfenster sah man hinunter auf einen ungepflegten Park, wo der Wind Abfall und welkes Laub aufwirbelte. Mit den Jahren wurden die Spaziergänger im Park und die Leute, die mit belegten Broten und Büchern auf den beiden Bänken saßen, ein vertrauter Anblick für Irene. Sie kannte die Frau, die von ihren zwei rotbraunen Settern durch den Park gezerrt wurde, den Landstreicher mit dem krebsroten Gesicht und den glasigen blauen Augen, der jeden Tag Punkt elf Uhr auftauchte, einen Einkaufswagen mit prall gefüllten Plastiktüten vor sich herschob, sich schließlich auf die hintere Bank setzte und regungslos auf die verkümmerten Rosenbüsche starrte, als habe er gelernt, sich vor verächtlichen Blicken zu schützen, indem er sich in ein weiteres unansehnliches Objekt in der urbanen Landschaft verwandelte; oder den schmächtigen Schwarzen mit Brille, der täglich zur Mittagszeit erschien, mit seiner Zeitung, einem Plastikschälchen voller Salat und einem grünen Apfel, den er an seinem Hosenbein polierte, bevor er hineinbiss.
Am Montagvormittag machte Irene gewöhnlich einen Einstufungstest mit den neuen Schülern, die ihr der Schulpsychologe aus den örtlichen Gesamtschulen geschickt hatte. Sie diktierte ihnen einfache Wörter, forderte sie auf, Zahlenreihen zu wiederholen oder in einem Wort bestimmte Laute zu erkennen. Die Schüler brüteten über ihren Aufgaben, mühten sich mit ihren Füllfederhaltern ab, malten verdrehte und verstümmelte buchstabenähnliche Zeichen, die die Seite hinunterpurzelten, und taten alles, um in ihren benebelten Köpfen eine Bedeutung zu finden. Ihre Gesichter verzerrten sich in verzweifelter Konzentration. An den anderen Tagen, außer am Freitagvormittag, unterrichtete Irene gewöhnlich nur jeweils zwei Kinder. Oft war außer ihnen niemand in dem alten Haus, und manchmal, wenn die Kinder über ihre Arbeitsblätter gebeugt waren, bekam die Stille etwas Schweres, Einschläferndes. Das Scharren der Füller auf dem Papier, das Klicken der Rechenperlen, das leise Rascheln beim Umblättern der Seite. Manches Kind rutschte auf seinem Stuhl hin und her und kratzte sich den erhitzten, wirren Kopf.
Gewöhnlich beendete sie die Arbeit um halb sechs. Sie brauchte fünfundzwanzig Minuten, um ihr Lehrmaterial im Fahrradkorb zu verstauen, ihre gelbe Regenjacke anzuziehen und die verkehrsreichen Straßen zwischen hupenden Autos und gelblichen Auspuffschwaden zur Tagesmutter zu radeln und die kurze Strecke nach Hause zurückzulegen. Im Winter, wenn Dunkelheit und Kälte den Weg beschwerlicher machten, das Wasser der Pfützen von den Reifen hochspritzte, sodass ihre Beine von Schmutz übersät waren und die Nässe in ihre Schuhe drang, dauerte es etwas länger.
In ihren Pausen – mittwochs zum Beispiel, wenn sie am Mittag mehr als zwei Stunden frei hatte, oder freitagmorgens und oft auch dienstags in der ausgedehnten Mittagspause – ging sie regelmäßig ins Kino, das drei Minuten von ihrem Arbeitsplatz entfernt lag. Es war kein glitzerndes Multiplexkino mit nackten Fassaden und Dutzenden von Bildschirmen, Ticketautomaten und Selbstbedienungsautomaten für Popcorn in Eimern, sondern ein unabhängiges Kino, das schon bessere Zeiten gesehen hatte und keine große Auswahl bot. Die roten Plüschsitze waren an den Kanten verschlissen, der Teppich voller Flecken, und auch die Frau hinter der Glasscheibe am Eingang war alt und schmuddelig. Sie hatte einen Hängebusen, einen Damenbart und blondierte Haare, die ein faltiges Gesicht mit Tränensäcken unter den Augen umrahmten. Ihr Name war Elspeth. Sie kaute unablässig Kaugummi und ließ Irene manchmal umsonst rein, vor allem wenn der Film bei ihrer Ankunft schon halb zu Ende war, was regelmäßig vorkam, oder wenn sie wusste, dass Irene den Film schon einmal oder mehrmals gesehen hatte – wie Der sechste Sinn (viermal), Stadt der Götter (dreimal), About Schmidt (dreimal) und Catch me if you can (zweimal). Irene erzählte nie jemandem von diesen Ausflügen. Manchmal ging sie sogar mit Adrian oder Freunden in einen Film, ohne zu erwähnen, dass sie ihn bereits kannte. Es verschaffte ihr einen merkwürdigen Kitzel, eine prickelnde Lust am Verbotenen, dass ein paar Stunden lang niemand ahnte, wo sie war.
An diesem Mittwoch – eine Woche vor Weihnachten und zwei Tage vor Beginn der Schulferien, nachdem sie erst um zwei Uhr früh ins Bett gekommen war, weil sie Schokoladenkekse und Rosinenscones für die schulische Weihnachtsfeier gebacken hatte – sah sich Irene zum zweiten Mal Adaptation an. Sie kaufte sich eine Eintrittskarte, einen Riegel Milchschokolade und eine Tasse bitteren, fast schon kalten Kaffee und betrat den Saal. Zuerst glaubte sie, er sei leer, dann bemerkte sie in einer der hinteren Reihen einen Mann, der ein Sandwich aß und auf die Werbung starrte, die soeben begonnen hatte. Daher suchte sie sich einen Platz ein paar Reihen weiter vorn auf der entgegengesetzten Seite. Systematisch und routiniert entledigte sie sich ihres Mantels und Schals, schnürte ihre Stiefel auf und streifte sie ab. Sie schaltete ihr Handy aus und ließ es in ihre Handtasche gleiten, dann lehnte sie sich zurück, breitete ihren Mantel wie eine Decke über sich, packte den Schokoriegel aus und verzehrte ihn langsam zwischen zwei Schlucken Kaffee. Es war heiß hier drin, herrlich dunkel, und sie wusste, dass Sasha und Clem jetzt im Speisesaal ihrer Schule zu Mittag aßen, wo es nach Schweiß und Bohnerwachs roch, und dass die Tagesmutter Aggie inzwischen in die Spielgruppe gebracht hatte, wo sie dicke weiße Papierbögen mit Farbe bekleckerte und »Auf der Mauer, auf der Lauer« singen lernte, mit allen dazugehörigen Bewegungen. Alle waren in bester Obhut. Die Musik und die Stimmen, die von der Leinwand dröhnten, waren wie eine tröstliche Mauer zwischen Irene und der Außenwelt und schirmten sie vom feuchten, kalten Grau ab. Irene wartete darauf, dass sich ihre Anspannung löste.
An diesem Tag schlief sie nach zehn Minuten ein. Nicholas Cage hockte mit einer Schreibblockade vor dem Computer, als ihr die Augen zufielen. In ihrem Mund war der Geschmack von Schokolade, und unter ihrem kratzigen Wollmantel wurde ihr wohlig warm, ihre Glieder wurden schwer. Die Worte, die er sprach, waren bald nur noch ein monotones Summen, während sie sich tiefer in ihrem Sessel vergrub, den Kopf in die Armbeuge gebettet. Sie ließ sich gehen, entspannte sich. Irgendwann wachte sie auf und sah einen Mann mit strähnigen Haaren und einem zahnlosen Lächeln, der durch graues, morastiges Wasser watete, und später wachte sie erneut auf, als laute Schüsse in ihre Träume fielen und sie verwirrten. Sie blickte in ein riesiges, trauriges Gesicht, über dessen zerfurchte Wangen Tränen rollten.
Beim Abspann richtete sie sich auf, blinzelte ein paar Mal, um klarer zu sehen, streckte sich und gähnte ausgiebig. Sie fuhr sich mit den Fingern durchs Haar, zog die Stiefel wieder an und schnürte sie zu. Dann aß sie das letzte Stückchen Schokolade und knüllte die Folie zu einem Kügelchen zusammen, das sie unter den Vordersitz schnippte. Aus der grenzenlosen Welt des Schlafs führen alle Wege zurück in das enge labyrinthische Ich. Sie zog den Mantel an, legte den Schal um und begab sich zum Ausgang.
An jenem Abend, wenige Tage vor Weihnachten, wollten Adrian und Irene die Party besuchen, zu der Karen jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit einlud. Der Champagnercocktail, der dort serviert wurde – in Kräuterlikör aufgelöste Zuckerwürfel mit einem kräftigen Schuss Brandy und mit Schaumwein aufgegossen –, machte redselig, noch bevor man das erste Glas geleert hatte. Nach dem zweiten war man richtig beschwipst.
Adrian sprach unten mit der Babysitterin und schrieb ihr die Telefonnummer auf, unter der sie in dringenden Fällen zu erreichen waren. Die Party fand in der Nachbarschaft statt, sie wären also notfalls in wenigen Minuten zu Hause. Irene war oben und zog sich um. Sie probierte ein kurzes schwarzes Kleid an, das für eine Jüngere als sie gedacht war, dann ein rotes, das völlig deplatziert wirkte, obwohl sie sich sonst immer darin gefallen hatte, und schließlich ein altes Samtkleid mit einem hellen Fleck auf der Brust – Zahncreme? Porridge? –, das deshalb auch nicht in Frage kam. Schließlich entschied sie sich wie gewöhnlich für die ausgestellte, seidig glänzende schwarze Hose und ein elfenbeinfarbenes ärmelloses Top, das mit winzigen Blümchen bestickt war. Adrian hatte es ihr zu ihrem letzten Geburtstag geschenkt, doch sie hatte noch keine Gelegenheit gehabt, es zu tragen. Sie musterte sich im Spiegel und fand, dass es ihr nicht besonders gut stand; es ließ sie knochig und blass aussehen. Als sie Adrians ungeduldige Stimme hörte, die zur Eile mahnte, zuckte sie mit den Schultern. Sie legte Ohrringe an und trug roten Lippenstift auf, der ihren Mund in dem bleichen Gesicht wie eine klaffende Wunde wirken ließ. Einen Augenblick starrte sie sich angewidert an, dann wischte sie sich die Farbe von den Lippen.
»Ich komm ja schon! Sorry, sorry, sorry«, rief sie und eilte ins Bad. Aggie saß in Unterhose und Socken auf der feuchten Badematte, Adrians Rasierapparat in der Hand. Sie atmete schwer, gab aber keinen Laut von sich. Blut lief über ihre Wange und tropfte in ihren offenen Mund und den Hals hinunter auf ihre runden weißen Schultern. Ohne ein Wort ging Irene neben ihrer Tochter in die Knie und nahm ihr den Rasierapparat weg. Sie legte die Hand unter Aggies Kinn und beugte sich vor, um die Wunde zu begutachten, während sie gleichzeitig hinter sich nach Papiertüchern griff. Aggie hatte mehrere Schnitte auf der Oberlippe und eine blutende Schramme über die ganze Wange. Irene tupfte das Blut vorsichtig ab und murmelte dabei tröstliche Worte. Erst als Aggie das blutgetränkte Papier sah, begann sie, wie wild zu kreischen.
»Schscht, ist ja gut. Es ist gar nichts passiert.«
»Ich blute, Mami. Es hört gar nicht mehr auf.«
»Es wird gleich aufhören. Halt still!«
»Ich bin voller Blut. Ich bin verletzt. Mami! Mami!«
Während Irene weiter Papiertücher an Aggies Wange presste, wiegte sie das Kind in den Armen. Blut tropfte auf ihr neues Top. Sie hörte den Fernseher unten im Wohnzimmer und Adrians Schritte auf der Treppe, er nahm zwei Stufen auf einmal und rief ihren Namen.
»Irene, wir sind schon furchtbar… Um Himmels willen, was ist denn das?«
»Daddy, ich blute«, wimmerte Aggie.
»Mein Gott, was ist passiert? Ist alles in Ordnung?«
»Sie hat versucht, sich zu rasieren.«
»Mein Gott.« Er hockte sich neben sie und legte Aggie die Hand auf den Kopf. Das Blut hatte ihre Haarspitzen in steife Ranken verwandelt. »Soll ich einen Arzt rufen?«
»Nein. Es sind keine tiefen Wunden.«
»Gott sei Dank.«
»Du hast deinen Rasierapparat rumliegen lassen.«
Seine Miene versteinerte. Er fühlte sich angegriffen.
»Dann ist es also meine Schuld?«
»Das habe ich nicht gesagt. Ich sagte, dein Rasierapparat. Aber das ist jetzt egal.«
»Entschuldigung«, presste er hervor.
»Ach, es war ein unglücklicher Zufall«, sagte Irene und verdarb alles, indem sie hinzufügte: »Vermute ich mal.« Sie achtete nicht weiter darauf, dass Adrian das Gesicht verzog, drückte Aggie fester an sich, damit er nicht sah, wie sie zitterte, und zerknüllte noch einen Haufen Papiertücher, um das Blut zu stillen. »So was passiert schon mal«, sagte sie mit fester Stimme und demonstrierte damit ihren Edelmut.
»Entschuldige, Aggie, mein Schatz.« Adrian liebkoste die Kleine, die sich daraufhin schniefend und triumphierend zwischen ihre Eltern kuschelte. »Du bist ein tapferes Mädchen.«
»Nicht wahr?«
»Dein neues Top ist voller Blut, das wäscht sich doch wieder heraus, oder? Jedenfalls musst du was anderes anziehen.«
»Ich glaub, ich möchte lieber hier bleiben.«
»Hier bleiben?«
»Ich hätte keine Ruhe.«
»Wir könnten warten, bis es zu bluten aufgehört hat. Du hast doch selbst gesagt, dass die Schnitte nicht tief sind. Es macht dir doch nichts aus, bei Carol zu bleiben, Aggie?«
»Geh nicht, Mami«, sagte Aggie und fing erneut an zu schluchzen. »Geh nicht!«
»Es macht mir nichts aus, ehrlich«, sagte Irene. »Im Gegenteil, ich freue mich auf einen gemütlichen Abend mit den Kindern. Es war ein langer Tag. Geh du nur! Entschuldige mich bei Karen und sag, dass ich sie morgen anrufe. Und nimm das kleine Geschenk mit, es liegt auf dem Tisch.«
»Das ist dumm und nicht nötig. Und wenn jemand hier bleiben sollte, dann ich. Schließlich war es mein Fehler.«
»Nein. Ich möchte hier bleiben.«
»Bleib, Mami! Ich will nicht bei Carol sein.«
»Und Karen ist mehr deine Freundin als meine. Ich bleibe.«
»Bitte, Adrian, nun geh schon.«
»Du gehst sowieso selten aus.«
»Es wäre nicht in Ordnung.«
»Jetzt versteifst du dich aber.«
»Nein! Ich spiele nicht die Märtyrerin, wirklich nicht. Ich bleibe liebend gern hier.«
»Warum solltest du ein schlechtes Gewissen haben und ich nicht? Wenn du nicht gehst, geh ich auch nicht.«
»Sei nicht albern! Was hätte das für einen Sinn?«
Adrian wusste, dass Frankie, Karens Schwester, da sein würde. Er hatte an Frankie gedacht, während er sich besonders sorgfältig rasierte, sein dunkelrosa Hemd anzog, mit Mundwasser gurgelte und sich im Badspiegel betrachtete, bemüht, sich mit fremden Augen zu sehen.
»Bitte, Irene!«, sagte er flehentlich. »Bitte!«
»Jetzt geh schon! Viel Spaß.«
Noch bevor er den Mantel abgelegt hatte, trank er einen Champagnercocktail. Der Alkohol nahm ihm die Befangenheit. Er betrat den Raum, in dem sich die Leute drängten. In einer Ecke stand der glitzernde Weihnachtsbaum, vom Lampenschirm hingen Mistelzweige, und Adrian wurde sofort von einer Gruppe in Beschlag genommen, die über Flüchtlinge diskutierte. Aber er hatte an diesem Abend keine Lust, Meinungen zu äußern. Er schlenderte durch das Zimmer, trank noch ein Glas, küsste eine erhitzt aussehende Karen auf beide Wangen, richtete Irenes Grüße aus und stimmte in das Lied »In the Bleak Midwinter« ein, das vor dem Weihnachtsbaum spontan angestimmt wurde. Karens Tochter und deren Freund, die in einer Ecke standen, sahen einander an und verdrehten die Augen. Adrian rieb sich das Gesicht. Ihm war bewusst, dass er für sie nur ein alberner Mann in den mittleren Jahren war, der zu viel trank und auf Partys mit Frauen in den mittleren Jahren flirtete. Frankie hatte er noch immer nicht entdeckt, vielleicht war sie in der Küche oder saß auf der Treppe. Es war ihm unbegreiflich, warum eine Frau, der er seit über einem Jahrzehnt mehrmals jährlich begegnete, plötzlich eine solche Macht über ihn haben konnte, dass sein Herz wie wild hüpfte und sein Mund trocken wurde. Das Beste wäre, wenn sie überhaupt nicht da wäre, und doch zog es ihn unwillkürlich in die Küche. Er redete sich ein, er brauche noch einen Drink und eine dieser Mince Pies, die Karen jedes Mal servierte.
Dort war Frankie nicht, aber vor der offenen Hintertür stand Sarah, beide Hände auf dem straff gewölbten Bauch, und machte ein leidendes Gesicht.
»Alles in Ordnung?«
»Ich glaube – ich glaube, es geht los. Ganz plötzlich.«
»Das Baby?«
»Ja. Es ist viel zu früh, Adrian.«
»Wie früh?«
»Vier Wochen.« Sie stieß ein leises Wimmern aus und krümmte sich. Als er ihr den Arm um die Schulter legte, lehnte sie sich an ihn. Sie verströmte einen säuerlichen Geruch. Schweiß stand ihr auf der Stirn und bildete Perlen auf der Oberlippe.
»Setz dich, hier, so, ich geh Gary suchen. Vier Wochen sind völlig in Ordnung. Glaub mir, ich kenn mich aus mit Wehen. Keine Angst! Versuch herauszufinden, in welchen Abständen die Kontraktionen kommen.«
»Eine nach der anderen. Ständig.«
»Ständig? O mein Gott. Warte.«
Er schoss aus der Küche, rief nach Gary und erklärte jedem, Sarahs Baby komme, es sei ein Notfall. Bald wussten alle Bescheid. Die Frauen scharten sich um Sarah, erteilten ihr Ratschläge, sagten, sie müsse gleichmäßig atmen und Ruhe bewahren. Schließlich halfen sie ihr beim Aufstehen, und sie taumelte gekrümmt zur Tür. Die Männer verfrachteten Gary in seinen Mantel, erkundigten sich, ob er auch wirklich Auto fahren könne und nicht zu viel getrunken habe, klopften ihm auf die Schulter und reichten ihm die Autoschlüssel. Karen lief zum Kühlschrank und gab ihnen eine Flasche Mineralwasser mit, und Mac knickte in einem Anfall beschwipster Freigebigkeit die zähen blühenden Stängel von der Winterclematis ab, die im Flur in einem Topf stand, und drückte sie Gary in die Hand.
»Die Tasche«, sagte Gary. Er starrte verdutzt auf die Blumen in seiner Hand. »Die Tasche, die wir packen sollten. Wir haben sie nicht dabei. Ein Nachthemd und Unterwäsche, Wasserspray und Fruchtsaft und Kleingeld fürs Telefon… Wir dachten ja nicht, dass es jetzt schon…«
»Mach dir keine Sorgen wegen der Tasche«, sagten sie.
»Ich wollte eine Musikkassette aufnehmen und Massageöl kaufen…«
»Fahr einfach nur ins Krankenhaus! Ruf uns an! Viel Glück.«
Die beiden wurden zur Haustür eskortiert, einige folgten ihnen noch hinaus auf den Gehsteig und riefen ihnen aufmunternde Worte nach.
»Da hätten wir ja das Kind in der Krippe«, sagte jemand, und alle lachten laut.
Adrian begleitete sie zum Auto, und gerade in dem Moment, als Sarah laut aufstöhnte, schlug er die Tür hinter ihr zu. Dann kehrte er in die Küche zurück. Im Garten standen ein paar Gäste zusammen und rauchten. Er sah ihre dunklen Silhouetten, die glühenden Punkte ihrer Zigaretten, ein plötzlich aufflammendes Streichholz. Einen Augenblick fühlte er sich wie verloren, und in panischer Beklemmung wünschte er, Irene wäre hier bei ihm, aus all den Gründen, aus denen er sich manchmal ersehnte, ihr zu entfliehen: Sie durchschaute ihn, bei ihr wusste er genau, wer er war und wo seine Grenzen lagen. Das Herz war ihm schwer, und er hatte das Gefühl, gleich in Tränen auszubrechen. Er schenkte sich noch ein Glas Champagner ein, drehte sich, während er es an die Lippen führte, und blickte Frankie direkt ins Gesicht.
Sie trug ein erdbeerfarbenes Kleid mit einer extravaganten schwarzen Bordüre um den Ausschnitt; ihr Mund war dunkelrosa geschminkt, die Haare hatte sie im Nacken zusammengebunden, ein paar lose Strähnen umrahmten kunstvoll ihr Gesicht. Sie trug grotesk hochhackige Schuhe und ein Band um ein Fußgelenk, wodurch sie ein wenig x-beinig wirkte; ihr Handgelenk schmückte eine große Herrenuhr mit Digitalanzeige. Unwillkürlich verglich er Frankies verschwenderisch bunte Kleidung mit Irenes üblichen Sachen in Grau, Schwarz, Braun und Beige; Frankies zartes Fleisch mit Irenes magerem, verkniffenem Gesicht und den knochigen Armen. Frankie war nur sechs, sieben Jahre jünger als seine Frau und zehn, elf Jahre jünger als er, aber sie schien einer anderen Welt anzugehören – einer Welt, die er hinter sich gelassen hatte, ohne es zu merken, und nach der er sich plötzlich verzehrte.
»Oh«, sagte er, nervös wie ein Teenager. Der Champagner schwappte über den Glasrand. »Du bist ja doch hier.«
»Schon eine Ewigkeit.«
»Dann hättest du mir wenigstens guten Tag sagen können.«
Sie zog die Schultern hoch, lachte verlegen und zupfte am Träger ihres Kleides.
»Frankie, wir gehen.« Ein Mann in einem Ledermantel, den Adrian vom Sehen kannte, stand hinter ihr und legte besitzergreifend die Hand auf ihre Schulter. »Ich habe den anderen versprochen, dass wir mit zum Essen gehen, drüben beim Inder.«
»Gut«, sagte sie. »Ich komme sofort.«
»Lass uns nicht warten, okay? Hier ist dein Mantel«, sagte er, warf den Mantel auf den nächstbesten Stuhl und verschwand. Frankie wandte sich wieder Adrian zu.
»Also dann, tschüss!«, sagte sie.
»Tschüss!«, erwiderte er perplex. Dann fiel ihm ein, dass er irgendwann einmal etwas von einem langjährigen Freund gehört hatte – eine wechselhafte Beziehung, mit der, wie Karen Irene erzählt hatte, Frankie sehr unzufrieden sei. Er war überrascht, wie sehr ihm das zusetzte.
Er musste sein Glas abstellen und stützte sich Halt suchend auf den Tisch. Da legte sie ihre Hand neben seine und lächelte, und er schob seine Hand ein Stück näher, sodass sich ihre Zeigefinger leicht berührten. Bildete er es sich ein oder erwiderte sie den Druck? Sein ganzer Körper schien durch diesen einen Punkt zu pulsieren.
»Wir sehen uns später.« Sie zog ihre Hand weg.
»Ich würde mich freuen.«
»Ich mich auch.«
Sie schlüpfte in ihren Mantel und kramte ein ungleiches Paar Wollhandschuhe aus den Taschen, einen gestreiften und einen einfarbigen – ein Detail, das ihn Hoffnung schöpfen ließ. Irgendwie wirkte sie zugänglicher. Dann war sie verschwunden, und er stand neben den Mince Pies und rang nach Luft. Er griff nach einem fremden, halb gefüllten Glas und stürzte den Inhalt hinunter, obwohl ihm ziemlich übel war.
Irene saß am Bett ihrer Tochter, bis diese eingeschlafen war. Aggies Oberlippe war geschwollen, und auf einer Wange hatte sie eine rote Schramme, an der ihr Haar klebte. Dann ging Irene hinunter, schickte Carol nach Hause, machte für die anderen beiden Mädchen pochierte Eier auf Toast und setzte sich zu ihnen an den Küchentisch. Clem stach in die Haut des Eidotters, der sich über den Teller ergoss; ihr Mund war mit verkrustetem Eigelb verschmiert. Sasha schnitt den Toast fein säuberlich in kleine Quadrate, die sie nacheinander ordentlich in den Mund steckte.
Nach dem Essen setzte sie sich in Sashas Schlafzimmer und las den beiden zum dritten Mal Winter im Mumintal vor. Clem hatte sich in ihrem Jungenpyjama auf den Teppich gekauert. Wenn man es nicht besser wüsste, dachte Irene, würde man sie für einen Jungen halten mit ihren kurzen Haaren, ihrer eindeutigen Jungenkleidung, den Fußballpostern über ihrem Bett, den beim Fallen auf dem Spielplatz aufgeschürften Knien und der Hartnäckigkeit, mit der sie sich das Weinen verkniff. Clem hatte die Knie unters Kinn gezogen, fummelte an ihren Zehennägeln herum und machte ein finsteres Gesicht. Sasha saß am Tisch neben dem Fenster und zeichnete auf ein Blatt Papier ein kompliziertes geometrisches Muster, dessen Felder sie mit unterschiedlichen Farben ausmalte. Irene sah vom Buch hoch und beobachtete sie. Ihr Haar war zu ordentlichen Zöpfen geflochten, ihr Nachthemd bis oben zugeknöpft, ihr Rücken kerzengerade; ihre Zunge berührte ihre Oberlippe, und sie konzentrierte sich ganz auf die präzise ineinander greifenden Formen.
»Dieses Wochenende kaufen wir einen Baum«, sagte Irene. »Wir könnten ihn am Samstag gemeinsam schmücken.«
»Wir alle zusammen?«, fragte Sasha.
»Ja, natürlich.«
»Daddy auch.«
»Sag es ihm.«
»Sag du es ihm.«
»Okay.«
Irene räumte die keineswegs unordentliche Küche auf. Danach belegte sie einen Cracker mit einer Scheibe Käse, schenkte sich ein halbes Glas Rotwein ein und schwenkte es. Nachdem sie den trockenen Imbiss zwischen kleinen Schlucken Wein vertilgt hatte, schälte sie sich eine Orange und zerteilte sie in Stücke, von denen sie sorgfältig die weiße Haut entfernte. Sie aß bedächtig, dann ging sie ins Wohnzimmer und sah sich die Abendnachrichten an: Hungersnöte, bevorstehender Schneefall; ein zwölfjähriges Mädchen, das von ihrem dreizehnjährigen Freund schwanger war; ein Verkäufer der Obdachlosenzeitung Big Issue, der im Lotto gewonnen hatte; eine neue dunkelrote Karottensorte.
Auf einmal verspürte sie das Bedürfnis, mit jemandem zu reden. Sie nahm den Hörer ab und wählte die Nummer ihres Halbbruders, der seit einem Jahr mit seiner Freundin in Südfrankreich lebte. Jem war fünf Jahre jünger als Irene, und schon vor seiner Geburt hatte Irene ihn mit bitterer, rasender Eifersucht gehasst: Seine Mutter hatte ihr den über alles geliebten Vater weggenommen. Jem war der Kuckuck im Nest. In ihren wütenden Gedanken war dieser Junge die Ursache allen Übels. Ohne ihn wäre ihr Leben weitergegangen wie in einem Bilderbuch mit reinen Farben: die entzückende kleine Irene zwischen Mama und Papa, die ihre Tochter an der Hand hielten. Aber dann hatte er sich plump in ihr Leben gedrängt.
Selbst als sie ihr Brüderchen zum ersten Mal sah – sein rotes Gesicht, die faltige Haut, zahnlos und plärrend – und er ihren Finger in seine kleine Faust nahm und nicht mehr losließ, blieb ihre Feindseligkeit bestehen. Sie wollte nichts mit ihm zu tun haben. Sie wollte ihn nicht lieb haben. Sie wollte ihren Vater bei den seltenen Gelegenheiten, an denen er sich blicken ließ, ganz für sich allein haben, weit weg von diesem fremden Haus, das nach Windeln und Talkumpuder roch und voll war mit Fotos von Leuten, die sie nicht kannte. Sie wollte nicht da sein, wo ihr neugeborenes Brüderchen war, das lediglich ein paar unartikulierte Laute ausstoßen, seinen Fuß in die Hand nehmen oder den Zeh in den Mund stecken musste, damit alle vor Entzücken dahinschmolzen. Genauso wenig wollte sie Zeit mit ihrer neuen Stiefmutter verbringen, die ihre blond gesträhnten Haare auf dem Kopf auftürmte und eine dreckige Lache hatte und deren Kleider nach Hyazinthen rochen.
Dann hatte ihr Vater – so schnell wie die erste – auch seine zweite Ehefrau verlassen. Er hatte nur einen Koffer mitgenommen und die Hemden mit abgewetztem Kragen, Packungen mit Multivitamintabletten, Schuldenberge und einen Brief zurückgelassen, in dem stand, dass er sich schäbig benommen und anderen wehgetan habe, jedoch seinem Herzen folgen müsse und um Verzeihung bitte. Er folgte seinem Herzen nach Wimbledon, dann nach Dorset und schließlich nach Amerika, wo er jetzt lebte.
Danach hatte Irene ihren Halbbruder nicht mehr wiedergesehen, ja sie hatte fast vergessen, dass er überhaupt existierte. Er war eine Gestalt aus ihren überschatteten frühen Lebensjahren, ein plärrendes Baby mit Koliken und rotblondem Haar in einem Haus, an das sie sich kaum noch erinnern konnte – außer dass dort Brennnesseln und Fingerhut in dem kleinen Hinterhof wuchsen und es eine dunkle Speisekammer gab mit Dosenmilch und Flaschen selbst gemachten Weins. Nur selten kam ihr zu Bewusstsein, dass sie einen Bruder hatte. Nach diesen turbulenten Anfängen lebte sie als Einzelkind bei ihrer tapferen alleinerziehenden Mutter. Nur sie beide gegen den Rest der Welt. An der Hand ihrer Mutter ging sie zur Schule, nach dem Abendessen spielten sie zusammen Scrabble und legten Patiencen, und jeden Sommer machten sie eine Woche Ferien in einer Bed-and-Breakfast-Pension in Cornwall.
Auch wenn Männer auftauchten, was nicht selten vorkam, existierte für Irene nur ihre Mutter, denn die Männer waren nur Durchreisende. Ihre braunen, schwarzen oder rotblonden Männerhaare im Waschbecken, ihr Rasierzeug auf der Ablage im Bad, ihre Mäntel über der Stuhllehne und ihre Schuhe am Fuß der Treppe; Stimmen, die spätnachts aus dem Schlafzimmer ihrer Mutter in ihr Zimmer drangen. Gemurmel, Kichern, Rufe, manchmal lang gezogene animalische Seufzer, bei denen Irene den Kopf in die Kissen vergrub oder sich die Finger in die Ohren steckte und bis hundert zählte. Am Ende gingen sie alle wieder fort, stießen den Stuhl geräuschvoll auf dem gefliesten Fußboden zurück, schlugen die Tür zu, brüllten noch ein letztes Wort die Treppe hinauf, und die gewohnte Ruhe kehrte wieder ein. Dann saßen sie und ihre Mutter am Küchentisch und aßen gekochte Eier oder Lammkoteletts, während die Uhr über der Tür leise tickte; und Irene hatte in all den Jahren immer das Gefühl, dass ihr eigentliches Leben noch gar nicht begonnen hatte.
Als sie voller Euphorie ihr stilles Zuhause verließ, um aufs College zu gehen, tat sie es mit schlechtem Gewissen – und dieses Gefühl verstärkte sich noch, als sie nach dem Examen in den Süden von Angola ging, um den Kindern eines Dorfes Englischunterricht zu erteilen. Trotzdem konnte sie gar nicht fassen, wie ungebunden man sein konnte. Sie fühlte sich seltsam leicht, als berührten ihre Füße kaum den Boden.





























