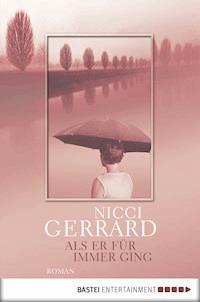3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Das persönlichste Buch der Bestsellerautorin
Was verlieren wir, wenn wir unsere Erinnerung verlieren? Wie hilflos demente Menschen sind und wie schmerzhaft das auch für deren Angehörige ist, erfuhr die Journalistin und Romanautorin Nicci Gerrard am Schicksal ihres Vaters. Als er nach zehnjährigem Leiden starb, entschloss sie sich, dieses Buch zu schreiben. Wie ein roter Faden durchzieht die bewegende Schilderung ihrer persönlichen Erfahrung diesen Text, der teils Reportage über die medizinischen Zusammenhänge und den unwürdigen Umgang mit den Betroffenen in Kliniken und Heimen, teils philosophische Betrachtung über das Erinnern ist. Die Autorin erlebt in unserer Gesellschaft eine große Gefühlskälte gegenüber den Erkrankten, die nicht mehr selbst für sich einstehen können. Dem setzt sie viele Beispiele entgegen, die Hoffnung machen. Ein in seiner Vielschichtigkeit ganz besonderes Buch, das durch sein Engagement, seine Wärme und Mitmenschlichkeit besticht. Denn Liebe kennt kein Vergessen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 578
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Zum Buch:
Was verlieren wir, wenn wir unsere Erinnerung verlieren? Wie hilflos demente Menschen sind und wie schmerzhaft das auch für deren Angehörige ist, erfuhr die Journalistin und Romanautorin Nicci Gerrard am Schicksal ihres Vaters. Als er nach zehnjährigem Leiden starb, entschloss sie sich, dieses Buch zu schreiben. Wie ein roter Faden durchzieht die bewegende Schilderung ihrer persönlichen Erfahrung dieses Buch, das teils Reportage über die medizinischen Zusammenhänge und den unwürdigen Umgang mit den Betroffenen in Kliniken und Heimen, teils philosophische Betrachtung über das Erinnern ist. Die Autorin erlebt in unserer Gesellschaft eine große Gefühlskälte gegenüber den Erkrankten, die nicht mehr selbst für sich einstehen können. Dem setzt sie viele Beispiele entgegen, die Hoffnung machen. Ein in seiner Vielschichtigkeit ganz besonderes Buch, das durch sein Engagement, seine Wärme und Mitmenschlichkeit besticht. Denn Liebe kennt kein Vergessen.
»Dies ist ein einfühlsames, kundiges, engagiertes und höchst notwendiges Buch.« The Independent
Zur Autorin:
Nicci Gerrard, geboren 1958 in Worcestershire, Shropshire, studierte englische Literatur in Oxford. Sie ist Journalistin und Romanautorin. Zusammen mit Ehemann Sean French schreibt Nicci Gerrard höchst erfolgreiche Kriminalromane und Thriller unter dem Pseudonym Nicci French. Von Nicci Gerrard erschienen auf Deutsch unter anderem Als wir Töchter waren und Das Fenster nach innen. Sie lebt zusammen mit ihrem Mann in Südengland.
Nicci Gerrard
WAS DEMENZUNS ÜBERDIE LIEBE SAGT
Aus dem Englischenvon Maria Andreas
C. Bertelsmann
Die Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel »What Dementia Teaches Us about Love« bei Allen Lane, an imprint of Penguin Random House UK, London.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
© der Originalausgabe: 2019 Nicci Gerrard
© 2021 C. Bertelsmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH
Covergestaltung: Jorge Schmidt, München
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
Druck und Bindung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN978-3-641-26257-0V002
www.cbertelsmann.de
Für John Gerrard:Du musstest loslassen, ich muss dich gehen lassen.
Und für Patricia Gerrard, Jackie Gerrard-Reis, Tim Gerrard, Katie Jackson: mit Dankbarkeit und für immer in Liebe.
»Der Abgrund hat keinen Biographen.«
Emily Dickinson
Inhalt
Anfänge
1 Den Tatsachen ins Auge blicken
2 Älter werden
3 Das Gehirn, der Geist und das Selbst
4 Erinnern und Vergessen
5 Die Diagnose
6 Scham
7 Die Pflegenden
8 Weltverbunden durch die Kunst
9 Im Heim zu Hause?
10 Die späteren Stadien
11 Krankenhäuser
12 Am Ende
13 Abschied nehmen
14 Tod
Neuanfang
Dank
Anmerkungen zu den Quellen
Bibliografie
Quellennachweis
Personen- und Sachregister
Anfänge
»O, der Geist, Geist hat Gebirge, Sturzklippen, grausig, jäh, von niemandem erlotet …«
Gerard Manley Hopkins
Im Jahr vor seinem Tod fuhr mein Vater im Sommer mit uns nach Schweden. Da hatte er schon über zehn Jahre lang mit seiner Demenz gelebt, und ganz allmählich – undramatisch, liebenswürdig, klaglos – machte er sich davon, Erinnerungen fielen von ihm ab, Worte blieben aus, er erkannte immer weniger; die große Auflösung ging ihren Gang. Aber in diesem Urlaub war er sehr glücklich. Er besaß eine tiefe Liebe zur Natur, in der er sich zu Hause fühlte; er kannte die Namen heimischer Vögel und Insekten, Wildblumen und Bäume. Ich erinnere mich, wie er mich als kleines Mädchen einmal in den Wald mitnahm, zum Morgenkonzert der Vögel. Wir standen unter dem Blätterdach, mitten im schallenden Gezwitscher, und er brachte mir bei, wie die Misteldrossel sang und wie die Amsel. Zumindest bilde ich mir ein, dass ich mich daran erinnere. Vielleicht erfinde ich die Geschichte auch nur, damit ich sie mir erzählen kann, wenn ich traurig bin.
In Schweden ging mein Vater in den Wald und sammelte Pilze, er besuchte ein fröhliches Krebseessen, bei dem er Aquavit trank und sich einen Blumenkranz aufs weiße Haar setzte. Er saß mit einer Palette Aquarellfarben vor der Wiese, auch wenn es sein Pinsel nie ganz aufs Papier schaffte. Und einmal nahmen wir ihn abends mit in die Sauna – er war immer leidenschaftlich gern in die Sauna gegangen, weil es ihn an die sorglose Zeit erinnerte, die er als junger Mann in Finnland verbracht hatte. Danach halfen wir ihm in den See. Es war ein schöner Abend, über allem lag weiches Dämmerlicht, der Mond schien aufs Wasser vor dem dunklen Hintergrund der Bäume. Ich erinnere mich an die Stille, nur dann und wann plätscherte eine Welle an den Steg.
Mein gebrechlicher alter Vater schwamm ein paar Meter hinaus und fing dann an zu singen. Ich hatte das Lied noch nie gehört, hörte es auch danach nie wieder. Er schwamm in kleinen Kreisen und sang vor sich hin. Dabei sah er ganz vergnügt aus, glücklich sogar, doch gleichzeitig wirkte die Szene furchtbar einsam, als wäre auf der Welt niemand mehr übrig geblieben als mein Vater im Halbdunkel, in der überwältigenden Stille, mit dem See, dem Wald, dem Mond und den am Himmel versprengten Sternen.
Die Ränder des Selbst sind weich, seine Hülle ist dünn und durchlässig. In diesem Moment konnte ich glauben, dass mein Vater eins war mit der Welt, sie strömte in ihn hinein, und er verströmte sich in sie. In diesem wohlwollenden Augenblick existierte sein von den Jahren angeschlagenes, von der Demenz zersplittertes Selbst jenseits von Sprache, Bewusstsein und Angst; es verlor sich in der Vielfalt der Dinge und war gleichzeitig darin geborgen, aufgehoben im unermesslichen Wunder des Lebens.
Oder zumindest sage ich mir das jetzt, drei Jahre später beim Versuch, eine Krankheit zu begreifen, die die Macht hat, das Selbst zu demontieren, eine Krankheit, die wie ein nächtlicher Räuber in das Haus schleicht, das ein Menschenleben lang aufgebaut wurde, um es, hinter den aufgebrochenen Türen feixend, zu verwüsten, auszuplündern und zu schleifen. Im Februar nach dem Schwedenurlaub kam mein Vater wegen schlecht heilender Beingeschwüre ins Krankenhaus. Die Besuchszeiten waren strikt reglementiert, und dann wurde die Station wegen eines Norovirus-Ausbruchs praktisch ganz geschlossen, was bedeutete, dass mein Vater viele Tage lang allein war: Niemand hielt seine Hand, sprach seinen Namen aus, sagte ihm, dass er geliebt wurde. Niemand hielt seine Verbindung zur Welt. Seine Geschwüre heilten, aber ohne sein geliebtes Zuhause, ohne seine vertraute Routine, umgeben nur von Fremden und Maschinen, verlor er bald die Orientierung und das bisschen Kontrolle über sich, das er noch gehabt hatte. Zwischen pflegerischer Versorgung und einfühlsamer Pflege liegt ein tiefer Abgrund, in den mein Vater hinabstürzte.
Als er endlich nach Hause durfte, war er nur noch Haut und Knochen, ein gespenstischer Schatten seiner selbst; er konnte sich nicht mehr bewegen, nicht mehr sprechen und war völlig verloren. Keine Sauna mehr für ihn, keine Wälder, keine Seen, keine Blumen im Haar; er lebte nicht mehr in der Dämmerung der Krankheit, sondern in ihrem dichten und immer dichteren Dunkel. Als der Herbst in den Winter überging und ein scharfer, kalter Wind wehte, verließ er uns schließlich, nach monatelangem, extrem langsamem Dahinsterben. Die letzten Monate waren furchtbar gewesen: das kleine Zimmer unten, wo mein Vater in einem Pflegebett lag und wartete und wartete, während seine geliebten Vögel zum Futtertisch vor dem Fenster flogen; die immer gleichen Abläufe des Waschens, Essenreichens, Umlagerns; die Schwestern, Ärzte und Pfleger und die ganze Bürokratie von Krankheit und Tod; mitzuerleben, wie ein Geist erlosch, ein Körper verfiel und sich nicht das Geringste dagegen tun ließ. Diesen Erinnerungen an das erdrückende, sich so lange hinziehende Ende stelle ich die Erinnerung an meinen Vater in einem schwedischen See entgegen, an seinen Frieden dort im weichen Abendlicht und an jenes geheimnisvolle Verschmelzen des Selbst mit der Welt.
Früher habe ich oft gesagt, wir bestünden aus unseren Erinnerungen, aber was passiert, wenn unsere Erinnerungen verloren gehen? Wer sind wir dann? Wenn wir nicht mehr bei Verstand sind, wo sind wir dann? Wenn wir den Faden verloren haben, was ist dann mit der Geschichte, an der wir zeit unseres Lebens mitgewoben haben? Selbst am bitteren Ende kam mir nie der Gedanke, mein Vater sei nicht mehr er selbst, auch wenn ich spürte, dass er sich selbst verloren hatte. Er war fort und doch noch da, abwesend und doch machtvoll gegenwärtig. Etwas blieb jenseits von Sprache und Erinnerung bestehen, eine Spur vielleicht, den Furchen gleich, die das Leben in ihn gegraben hatte. Ihm war seine Liebenswürdigkeit geblieben, seine Vergangenheit lebte in seinem Lächeln weiter, in seinem Stirnrunzeln, in seiner Art, die buschigen silberweißen Augenbrauen hochzuziehen. Er mag uns nicht mehr erkannt haben, aber wir erkannten ihn. Ich weiß kein Wort für diesen unauslöschlichen Wesenskern – »Seele« hat man ihn früher genannt.
Die Zivilisation, die nach Kontrolle und Sicherheit strebt, kann nur einen dünnen Boden über die abgründigen Tiefen legen. Uns allen ist beunruhigend bewusst, wie wenig wir unser Leben in der Hand haben, wie brüchig das Ruder ist, mit dem wir Geist und Körper zu steuern versuchen, auch wenn wir dieses Bewusstsein gern in die hintersten Ecken schieben. Demenz stellt uns in allen ihren vielfältigen und oft qualvollen Ausprägungen vor die Frage, was es bedeutet, ein Ich, ein Mensch zu sein.
Demenz wird oft die Geißel unserer Zeit genannt, die »Krankheit des Jahrhunderts«.
2015 lebten im Vereinigten Königreich schätzungsweise 850 000 Menschen mit Demenz in einer ihrer Formen; noch einmal genauso hoch war wohl die Dunkelziffer der nicht Diagnostizierten. Da die Bevölkerung altert, wird bis 2021 ein Anstieg auf über eine Million und bis 2051 ein Anstieg auf über zwei Millionen erwartet. In den USA wurde 2017 die Zahl der Menschen mit Demenz auf 5,5 Millionen geschätzt. Nach Angaben der WHO leben weltweit etwa 47 Millionen Menschen mit Demenz. Alle drei Sekunden erkrankt jemand neu.
Oft heißt es, Demenz sei eine tickende Zeitbombe. In Wahrheit ist diese Bombe längst explodiert, aber leise, unter Verschluss, ungesehen: ein Zerstörungswerk im Verborgenen. Männer und Frauen, die mit einer Demenz leben, sind oft aus dem Blickfeld verschwunden, vergessen und verleugnet von einer Gesellschaft, die Unabhängigkeit, Wohlstand, Jugend und Erfolg zu ihren Werten erhebt und sich von allen Schwächen abwendet. Demenz erinnert uns daran, dass wir alt und hinfällig werden und schließlich sterben müssen. Von allen Krankheiten fürchten wir sie heute am meisten. Die Demenz ist »der Inbegriff des Leidens«, und wir werden sie genauso wenig los wie das Leiden selbst.
Dieses Leiden springt von den Betroffenen auf jene über, die für sie sorgen und sich um sie sorgen, auf die Gemeinschaft, in der sie leben, auf das ganze Land. Professor Sube Banerjee sieht die Demenz als »absolut respektlos gegenüber den Patienten, den Pflegenden, den Gesundheitssystemen, den Sozialdiensten … sie passt nicht in die Strukturen, die wir geschaffen haben«. Keine andere Krankheit definiert sich so sehr durch die Wucht, mit der sie nicht nur diejenigen trifft, die mit ihr leben, sondern auch die Menschen in ihrem Umfeld. Ihre Auswirkungen sind physiologischer, psychologischer, gesellschaftlicher, wirtschaftlicher, politischer und philosophischer Natur. Ihre Kosten sind unbezifferbar – ich meine nicht die finanziellen Kosten (nach Schätzung der Alzheimergesellschaft betragen sie allein im Vereinigten Königreich 26 Milliarden Pfund und weltweit 818 Milliarden Dollar; sie klettern ständig weiter, dürften 2018 die Billionenmarke erreicht haben und übersteigen damit die Kosten von Krebs, Schlaganfällen und Herzerkrankungen zusammen genommen). Sondern ich meine die Kosten, mit denen die Demenz uns menschlich belastet: Scham, Verwirrung, Angst, Sorgen, Schuldgefühle, Einsamkeit. Demenz wirft grundlegende moralische Fragen über die Gesellschaft auf, in der wir leben, über unsere Werte und über die Bedeutung des Lebens selbst.
Gleichzeitig sind wir die erste Generation, die sich wirklich bewusst mit dem Thema Demenz auseinandersetzt. In meiner Kindheit war Demenz kaum sichtbar und wurde selten eingestanden. Mein Großvater mütterlicherseits und meine Großmutter väterlicherseits litten daran. Das war mir bewusst, auch wenn der Deckmantel des Schweigens nie gelüftet wurde. Die beiden Großeltern waren einst in meinem Leben in kräftigen Farben vertreten gewesen und verblassten allmählich, bis sie wie ausradiert waren. Erst Autoritätspersonen und dann so hilflos, waren mir diese Menschen vielleicht sogar peinlich, die körperlichen Seiten ihrer Krankheit bereiteten mir Unbehagen. Aber ich dachte nicht darüber nach, wie das Leben für sie war, noch mochte ich mir ausmalen, welche Tragödie – oder manchmal welch hässliche Farce – sich da abspielte. Das D-Wort war ein Stigma, eine Quelle von Scham, Angst und Verleugnung; alles blieb hinter geschlossenen Türen.
Hier hat sich unser Bewusstsein in den letzten zwanzig, dreißig Jahren radikal verändert, was auch eine neue soziale, politische und moralische Verantwortung mit sich bringt. Heute können wir sehen, was früher im Verborgenen lag. In den Siebzigerjahren des letzten Jahrhunderts lebten im Vereinigten Königreich etwa 300 000 Menschen mit Demenz, spärlich übers Land verteilt. Heute ist die Zahl dreimal so hoch. In 25 Jahren wird mit etwa 1,7 Millionen Erkrankten gerechnet. In den USA erhöhte sich die Zahl der Todesfälle allein durch Alzheimer in den 15 Jahren zwischen 1999 und 2014 um 55 Prozent. Man besuche eine beliebige Klinikstation, und mehrere oder die meisten Betten sind von Menschen mit Demenz belegt, sogar auf einer Allgemeinstation. Man gehe in ein Altenheim. Man lese die Traueranzeigen. (Als ich daran dachte, dieses Buch zu schreiben, begann ich, eine Liste aller Prominenten anzulegen, die an dieser Krankheit starben, doch das gab ich bald auf: Es waren zu viele und wurden immer mehr, ich kam nicht hinterher.) Man braucht nur die Geschichten in den Medien zu verfolgen, ermutigende wie solche, bei denen man vor Kummer weinen möchte. Ich kenne kaum noch jemanden ohne engen persönlichen Bezug zu der Krankheit. Sie umgibt uns von allen Seiten, in unserer Familie und in unseren Genen, vielleicht in unserer eigenen Zukunft (etwa jeder Sechste über achtzig entwickelt Demenz, und je älter wir werden, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit; als lauere ein Heckenschütze im eigenen Garten). Wenn es Sie oder mich nicht trifft, dann einen Menschen, den wir lieben.
Wir können nicht länger über »die Betroffenen« reden, denn betroffen sind wir jetzt alle, und wie wir mit dieser Herausforderung umgehen, wird zu einer Frage unserer kollektiven Menschlichkeit. Denn in einer Zeit, in der Autonomie und Handlungsmacht so hoch im Kurs stehen, müssen wir uns ein paar Fragen stellen: Was schulden wir anderen und was schulden wir uns selbst? Wer ist wichtig? Warum scheinen manche Menschen weniger wichtig als andere? Warum werden manche Menschen ignoriert, nicht gesehen, vernachlässigt, verlassen? Was bedeutet es, ein Mensch zu sein, und was bedeutet humanes Handeln? Das Wort »wir« kommt uns leicht und unablässig von den Lippen. Es spricht von Gemeinschaft, Demokratie, Kooperation. Es erhebt den Anspruch auf eine kollektive Stimme, als säßen wir, wie die Politiker gern sagen, alle in einem Boot. Nun ja, das schon, aber das Boot ist eher ein Schiff, auf dem manche Menschen eine Kabine erster Klasse mit Seeblick und abendlichen Cocktails haben und andere nur einen Platz unten im Frachtraum, wieder andere bekommt man überhaupt nicht zu Gesicht. Auf sie fällt kein Licht, wir merken nicht einmal, dass sie mit uns an Bord sind. Und nicht wenige sind ins kalte Wasser gestürzt und ertrinken da draußen in der Dunkelheit, während die Combo weiterspielt.
Jene, die wir nicht sehen. Jene, die uns gleichgültig sind. Jene, um die wir nicht trauern. Jene, die wir vernachlässigen und dem Sterben überlassen … Wäre mein Vater ein wichtiger Mann gewesen, dann hätte man ihn in der Zeit seiner größten Not vielleicht anders behandelt, wage ich zu vermuten. Natürlich war er wichtig, aber nur für die, die ihn kannten und liebten und mit ihm verbunden waren. Die Kostbarkeit jedes Lebens sollte als Grundwert in jedem System, jeder Gesellschaft verankert sein, damit wir nicht erst ein Gefühl von Identifikation aufbringen müssen, um einander zu helfen. Wir alle sind einander verpflichtet, auch denen, für die wir so gar nichts übrig haben, denn die Welt »ist uns gemeinsam gegeben«, um sie miteinander zu teilen und weiterzureichen. Es gibt kein Ich ohne Du, kein Ich ohne Wir. Letzten Endes hängen wir alle von dem Mitgefühl aller anderen ab und sollten uns leidenschaftlich und ohne Wenn und Aber für alle, für jeden und jede einsetzen und sie wertschätzen – nicht aus Liebe, sondern aus unserer gemeinsamen Menschlichkeit heraus.
In den letzten Jahren habe ich viel über die Bedeutung von Regeln und Begrenzungen nachgedacht: über die Mauern von Institutionen, an denen Gebote – du sollst nicht – angeschlagen sind, über die Zäune rings um Gärten, über die Türen, die fest verschlossen oder offen sein können, über die Landesgrenzen, die oft durchlässiger sind, als ich dachte, über den Geist, der in den Grenzen des Körpers lebt, über den Körper, der uns sowohl birgt als auch der Welt aussetzt, über das Ich und das Wir, über uns und sie, über das Selbst und die anderen. Wie weit sind wir miteinander verbunden und wie weit voneinander getrennt? Wie weit sind wir eigenständige Individuen und wie weit Teil eines öffentlichen, gemeinschaftlichen Lebens? Wie sehr können – sollten – wir uns auf andere verlassen, und wie verlässlich sind wiederum wir? Welche Verantwortung haben wir der Welt gegenüber, in der wir leben, und welche Verantwortung haben wir andererseits uns selbst gegenüber?
Als Mutter erkenne ich manchmal nur schwer, wo meine Kinder aufhören und wo ich anfange (obwohl sie jetzt alle erwachsen sind und ich es längst hätte lernen sollen). Manchmal fühle ich mich ungeschützt wie eine offene Wunde und weiß nicht, wie ich Nein sagen soll. Zugleich war ich zeit meines Lebens Feministin und rückhaltlos vom Recht überzeugt, über das eigene Leben selbst zu verfügen – zumindest teilweise. Bindungen, Verantwortung und an erster Stelle die Liebe bedrohen ständig die eigene Autonomie. Das Zwangsjackengefühl, das mich manchmal bei meinen Verpflichtungen überkommt, ist eine Angst vor Selbstverlust. Wir alle müssen uns abgrenzen, um ein Selbst zu besitzen, und wir alle müssen in diese Abgrenzung Breschen schlagen, um in einer Welt der Beziehungen und Verbindungen zu leben – denn welche andere Welt gäbe es? Das ist kein Balanceakt, den wir angespannt auf einem Hochseil zwischen zwei konträren Imperativen vollziehen, sondern ein ständiges Fließen, in dem wir ein paar Schritte vor und wieder zurück machen, geben und behalten, die Arme in die Welt ausstrecken und uns vor ihr zurückziehen.
Demenz durchbricht dieses unablässige, subtile Verhandeln mit der Welt, diese Ebbe und Flut der Gegenseitigkeit. Stück für Stück werden diejenigen, die mit der Krankheit leben, hilfloser und immer abhängiger von der Gnade anderer, von der Freundlichkeit Nahestehender wie Fremder. Die Vorstellung, wie einsam und ausgeschlossen sie sich manchmal fühlen müssen, ist schwer erträglich. Vor einigen Wochen besuchte ich mit Sean, meinem Mann und Schreibpartner, in einem Pflegeheim einen seiner Verwandten, der an Demenz leidet. Als wir gingen, wankte eine alte Frau mit schulterlangem weißem Haar auf uns zu; sie trug eine fröhliche rote Jacke und eine Perlenkette, doch auf ihrem Gesicht spiegelte sich tiefer Schmerz. Ich blieb stehen; da griff sie nach meinen Händen und sackte vor Gram tief in sich zusammen. »Lieder des Trosts«, sagte sie, »Lieder des Trosts.« Ich sah mich nach Hilfe um und versicherte ihr, bald werde jemand kommen. »Niemand wird kommen«, erwiderte sie. »Niemand ist da. Lieder des Trosts.« Eine Mitarbeiterin kam und löste die gebeugte Gestalt von mir. Sie erklärte, als wäre damit alles wieder im Lot, dass die Frau sich immer so benehme, und führte sie davon. »Lieder des Trosts.« Was hätte ich tun sollen? Was tun wir?
Erkunden, was Demenz bedeutet und welche furchtbaren Verluste sie uns zufügt, heißt darüber nachdenken, wie weit wir als Gesellschaft und als Einzelne Verantwortung tragen, wenn andere leiden. Was wir einander schulden, was uns am Herzen liegt, was in dieser Welt zählt, die wir alle miteinander teilen. Wer zählt.
Fällt das Wort »Demenz«, dann springen viele gedanklich gleich zum Ende, das sie sich dabei vorstellen. Sie sehen sich oder einen geliebten Menschen verwirrt im Bett liegen, aller Erinnerungen und Fähigkeiten beraubt; sie sehen sich hilflos wie greise Säuglinge (obwohl der Vergleich zwischen alten Menschen am Ende ihres Lebens und kleinen Kindern grausam unpassend ist), als Tiere, als nur noch dahinvegetierendes Gemüse, als Gegenstand, an dem andere herumhantieren oder, schlimmer noch, den sie vernachlässigen. Viele verkünden sehr emotional, wie entschlossen sie sind, ihr Leben lange vor einem solchen Ende selbst zu beenden, und manche tun es auch. Berühmt wurde Mary Warnocks Plädoyer für die Erlaubnis, Menschen »einzuschläfern«. Das klingt brutal und löste heftige Kontroversen aus, und doch ist das Argument nicht ganz abwegig, dass wir Tiere einschläfern, wenn ihr Leben nur noch aus unerträglichem Leiden besteht, einem Menschen jedoch den Gnadentod verweigern, sodass er über die Grenzen des Ertragbaren hinaus leiden muss. Was wir einem Hund nicht antun würden, tun wir uns selbst an.
Aber die Demenz hat wie auch die Trauer viele Phasen, und hier wie dort sind sie selten klar abgegrenzt und stabil. Die Diagnose ist kein Urteil, sondern der Beginn eines Prozesses, der Jahre, sogar Jahrzehnte dauern kann und genauso viel Hoffnung, Freude und Abenteuer bringen kann wie Angst, Leid und herzzerreißenden Verlust.
Dieses Buch ist eine Reise durch diese Stadien des Verlusts, von den ersten leisen Anzeichen der Krankheit bis zur fortgeschrittenen Demenz am Lebensende, die in ihrer radikalsten Form wie eine grausame Demontage des Selbst und ein Zusammenbruch jeder Sinnhaftigkeit erscheinen kann. Es fragt danach, was Demenz bedeutet, sowohl für die Menschen, die damit leben, als auch für jene, die sie lieben. Es nimmt die menschenfreundlichsten und die inhumansten Formen professioneller Intervention unter die Lupe und fragt, wie weit berufliche Pflegekräfte für jene sorgen können, die uns am Herzen liegen, und wie weit Einzelne und Familien eine Last schultern müssen, die das eigene Leben erdrücken kann und es oft genug auch tut. Es erkundet die Demenz von außen und, soweit möglich, auch von innen. Es betrachtet die neue, verstörende Kunst, die zum Thema Demenz entsteht – für mich eine Form psychologischer Moderne, die uns helfen kann, uns das Unvorstellbare vorzustellen und für das seinem Wesen nach Wortlose eine Sprache zu finden, die uns bis zur Schwelle des Dunkels heranführt. Es lotet das Leid auf dem Weg ins Dunkel aus, sowohl bei den Erkrankten selbst als auch bei denen, die für sie sorgen. Und es richtet den Blick auf das Danach: auf den Tod, die Trauer und die Gnade eines Endes. Es versammelt Geschichten von Pflegerinnen und Pflegern, Ärzten, Wissenschaftlern, Therapeuten, Philosophen, Künstlern, vor allem aber Geschichten von Menschen, die mit der Krankheit leben, und von denjenigen, die sie begleiten, die das Unerträgliche tragen und zu Weichenstellern werden, zum Gedächtnis und zur Stimme. Die Demenz weckt, was Atul Gawande die »Beharrlichkeit der Seele« nennt.
Mein Reiseführer war mein Vater, erst noch gut bei Kräften, dann immer gebrechlicher; manchmal verschwand er auch aus meinem Blickfeld, aber sein Geist hat mich nie losgelassen, und das wird auch immer so bleiben.
Die frühen Stadien bedeuten für den Erkrankten vielleicht die größte Tortur, zumindest hoffe ich darauf, dass das Vergessen auch eine Art Erleichterung bringt. Anfangs können Menschen mit Demenz ihre Gefühle durchaus ausdrücken. Später wird es immer schwieriger, zuletzt ist es kaum noch möglich. Wie muss das sein? Oft wache ich in den frühen Morgenstunden auf, bevor es hell wird, und einen erschreckenden Moment lang kann ich mich nicht erinnern, wo ich bin, nicht einmal, wer ich bin. Auf die entsetzliche Leere folgt eine siedend heiße Angst. Gibt das einen Vorgeschmack darauf, wie es sich anfühlt? Oder jenes Gefühl beschämender Desorientierung, wenn man den Überblick verloren hat, matt in einem Gedankenwirrwarr treibt, ohne Fuß fassen zu können, ohne die Welt sortieren zu können, eher ein Objekt als ein Subjekt: Ist es das?
Vor ein paar Monaten bin ich mitten in der Nacht mit dem Rad einen Kanal entlanggefahren; es war sehr dunkel und unheimlich, mein Raumempfinden ausgehebelt. Das von Wasserlinsen bedeckte Wasser sah aus wie fester Boden, der feste Boden dagegen schwankte und verschob sich unter dem schmalen Lichtstrahl meiner Fahrradlampe. Dicht über mir Fledermäuse wie dunkle Fetzen, plötzlich Stimmen in der Ferne, dann Stille. Sowohl in dieser äußeren Umgebung als auch innerlich fühlte ich mich unsicher, klein und instabil, Angst schlug über mir zusammen. Es gab mir einen scheußlichen Ruck im Magen, als mir der Gedanke kam, Demenzerkrankte könnten in den frühen Stadien genau das Gleiche empfinden wie ich hier: Alles, was einmal sicher war, verliert seine Gestalt, Dinge ballen sich im Dunkeln zusammen. Aber natürlich weiß ich es nicht. Die Psyche ist unendlich geheimnisvoll. Und wenn es schon schwer ist, sich die Anfangsstadien vorzustellen, in denen sich die Betroffenen noch äußern können, wie viel schwerer lässt sich dann erfassen, wie sich eine fortgeschrittene Demenz anfühlen muss, ein Zustand jenseits von Sprache. Es muss eine existenzielle Einsamkeit und sogar Verzweiflung damit verbunden sein, wenn man zum Schatten seiner selbst wird.
Denn wie beobachtet das Ich, dass das Ich davonzieht, wie kann Sprache ihre eigene Auflösung fassen? Im Gespräch mit Menschen, die mit Demenz leben, kann es zu vielsagenden Lücken kommen, wenn sie ihr Erleben beschreiben und ihnen die Worte wegrutschen. Wenn wir über diese Menschen sprechen – und zwangsläufig sind viele Berichte über fortgeschrittene Demenz aus der Außensicht geschrieben –, dann greifen wir zu Metaphern und lassen die Sprache nach dem tasten, was jenseits der Worte liegt. Von Dantes Bild des Schiffs, das beim Einlaufen in den Hafen die Segel streicht, bis zum Vergleich mit einem durcheinandergeratenen Satz Spielkarten suchen wir nach Wegen, den unbegreiflichen Untergang des Selbst zu begreifen. Ich persönlich habe meinen Vater abwechselnd als großes Schiff beschrieben, das sich aus seiner Verankerung gelöst hat und ins Meer hinaustreibt, als eine Stadt, in der die Lichter eines nach dem anderen erlöschen, als eine bombardierte Großstadt, als Eisscholle, die in immer kleinere Stücke zerbricht, bis es keinen Platz mehr zum Stehen gibt. Eine Freundin fand das Bild eines Manuskripts, das in winzige Fetzen zerrissen wird, eine andere sprach von einer kostbaren Glasvase, die zu Bruch geht. Bilder von Schiffen häufen sich auffallend – ein Boot, das im Nebel verschwindet, »ein Schiff, das in eine Windstille geraten ist. Plötzlich kommt ein kleiner Wind auf, und ich fahre wieder. Dann hat mich die Welt wieder im Griff, und ich kann mich weiter mitbewegen.«
Das Bild der Seefahrt beschwört sowohl den Schrecken als auch das Geheimnisvolle herauf; dieser Metapher, die so erhaben wie gnädig über die Gräuel der Tiefe hinwegsegelt, ist eine feierliche Würde zu eigen. In seinem Gestameld liedboek, einer quälenden Meditation über die frühe, grausame Demenz seiner Mutter, müht sich der belgische Schriftsteller Erwin Mortier ab, dem Bedeutungslosen und Formlosen Form und Bedeutung abzuringen. Er schildert eine Krankheit, die keineswegs erhaben ist, sondern bösartig, die sich wie eine Ratte durch den Untergrund wühlt und mit scharfen gelben Zähnen die Drähte durchnagt – sie wringt seine Mutter aus »wie einen Putzlappen« und schleudert sie in eine Ecke. Sie ist abgestandener Morast, das Meer bei Ebbe, wenn das Wasser davonfließt. Seine Mutter ist ein verschlossener Käfig mit einem vor sich hin rostenden mechanischen Singvogel, ein Stundenglas aus Haut und Knochen, ein langsam zusammenfallendes Haus, eine Sprachruine, ein altes Röhrenradio, ein Eulenküken im Gewirr eingestürzter Dachbalken, ein einziger großer Fluchtpunkt.
Demenzmetaphern evozieren Verschwinden und Auflösung (das Meer, der Nebel, das Einholen der Segel), aber auch Rostfraß, Brüche, ein Wegrutschen, bei dem einem mulmig wird, eine unheimliche Mutation des Selbst. Metaphern sind der Versuch, einem Phänomen Sinn und Form zu geben, das sich beidem entzieht; sie schlagen eine schwankende Brücke zwischen dem Bekannten und dem, was wir nicht wissen können, und signalisieren gleichzeitig die Unlösbarkeit dieser Aufgabe. Vom Ozean bleibt Morast, vom Haus nur die Grundmauern. Schrecken schlägt um in Grauen, das Grauen wird plötzlich von Hoffnung aufgehellt, wenn ein Lichtstrahl durch das Wrack fällt. Sprache wird strapaziert, um einen Zustand zu fassen, der wesentlich mit dem Ausfall von Sprache zu tun hat, mit der scheiternden Verbindung des Selbst mit der Welt. Worte versagen.
Aber Worte sind nicht die einzige Art, sich mitzuteilen. Auf meinem Schreibtisch liegen Abbildungen der Selbstporträts des deutsch-amerikanischen Malers William Utermohlen, der in London lebte. Ich bin ihm nie begegnet, habe aber viele Stunden mit seiner Witwe gesprochen, Patricia Utermohlen. Oft nehme ich mir seine Bilder vor, um mich an die besonderen Schrecken der Demenz zu erinnern. Utermohlen erhielt 1995, als er 61 Jahre alt war, die offizielle Diagnose Alzheimer, aber erste Spuren seiner Krankheit lassen sich schon in seinen »Konversationsstücken« aus den frühen Neunzigerjahren entdecken. Er betrachtete sich mit schonungslosem Blick und malte sich sogar noch, während ihm sein Selbstgefühl verloren ging. Seine Selbstporträts der nächsten fünf Jahre wecken Gefühle qualvoller Instabilität und gespenstischen Selbstverlusts. In den ersten Bildern ist er erkennbar er selbst, sein schmales Gesicht hat jedoch einen argwöhnischen Ausdruck (er war, erzählt Patricia, ein ängstlicher und enttäuschter Mensch). Rasch verflacht dann die Perspektive, das Raumgefühl geht verloren. Utermohlen befindet sich innerhalb der Welt des Selbstverlusts und ist gleichzeitig deren Beobachter. Er bannt die Demenz auf die Leinwand. Der Neuropsychologe Professor Seb Crust, einer seiner Ärzte, erinnert sich an ihre erste Begegnung; Utermohlen fertigte dabei eine geschickte Skizze von sich an, bei der allerdings beide Arme aus derselben Schulter wuchsen. Die Porträts sind eine einzigartige Dokumentation seines subjektiven Erlebens. Die Ordnung und der sensorische Reichtum der ersten Bilder weichen einer beunruhigenden Fremdheit, einer Aushebelung normaler Sinneserfahrung – die Wände kippen, Perspektiven werden instabil, der Tisch hebt sich, Gegenstände schweben herum, und ein böser Wind weht durch den aufgesprengten Raum, in dem der Künstler sitzt und zusieht, was aus ihm wird – oder besser gesagt, wie er zerfällt. Dinge sind zerrissen, zerbrochen, zermalmt; sie lösen sich auf und gehen verloren. Der Raum leert sich, und zum Schluss ist der Maler allein in einem Vakuum. Das Gesicht, das Selbst tritt zurück und verschwindet im Schatten. Im letzten Porträt ist Utermohlen nur noch ein hingekritzelter Totenschädel.
Einzeln betrachtet sind Utermohlens Selbstporträts tieftraurig. Als Serie wirken sie erschreckend, wie sie über einen längeren Zeitraum hinweg den Verlust nachzeichnen, das Leiden, das allmähliche, unvermeidliche Wegbrechen von allem, was den Maler als Mensch zusammenhält. Und doch lebte William Utermohlen mehrere Jahre lang mit seiner Alzheimererkrankung zu Hause mit seiner Frau und seinen Bildern; er sah Freunde und schwamm weiterhin im großen Strom des Lebens. Vor allem konnte er fortfahren, sich auszudrücken, der Leinwand sein Signum einzuprägen und zu sagen: Hier bin ich. Mensch sein heißt, eine Stimme zu haben – und mit Stimme meine ich, was unsere inneren und äußeren Welten verbindet, das feine und wundersame Kommunikationsgewebe, das uns in Gemeinschaft mit anderen leben lässt, sodass wir nicht einsam in unserem Selbst eingekapselt bleiben müssen. Es gibt viele Möglichkeiten, eine Stimme zu entwickeln und in die Welt hinauszurufen.
Auch wenn das Gedächtnis auf und davon ist, die Sprache zersplittert und verloren, die Fähigkeit des Erkennens weggebröckelt, wenn sich kaum noch am Konzept eines Selbst festhalten lässt, gibt es immer noch Wege, den Menschen zu finden, der im havarierten Körper gefangen ist, ihn zu hören und ihm zu bestätigen, dass er immer noch ein Mensch ist, kostbar und einer von uns.
Einer meiner Freunde starb mit fünfzig, nachdem er ein Jahrzehnt lang mit einem Hirntumor gelebt hatte. Das ist zehn Jahre her, aber ich träume immer noch recht oft von ihm. Ich freue mich jedes Mal über meinen nächtlichen Besucher und erinnere mich dann wieder, wie sehr ich ihn vermisst habe. In mehreren Träumen der letzten Zeit sind wir miteinander Trampolin gesprungen. Manchmal merkt er gar nicht, dass er tot ist, aber ich merke es, und wir unterhalten uns darüber. Manchmal glaube ich, er ist wieder da und sein Tod war ein Irrtum oder selbst ein Traum, oder die Wachwelt erlaubt mir einfach keinen Zugang zu ihm. Aber soweit ich weiß, habe ich kein einziges Mal von meinem Vater geträumt. Er besucht mich nie. Vielleicht, weil ich nicht ganz davon überzeugt bin, dass er gestorben ist. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich könnte eine zweite Chance bekommen und diesmal alles besser machen. Ich würde schneller bemerken, was mit ihm geschieht, und könnte es ungeschehen machen, könnte die Uhr zurückdrehen, die seinem Tod entgegen tickte. »Hallo, Nic«, würde er sagen und mir die Hand entgegenstrecken.
Ich möchte meinen Vater so in Erinnerung behalten, wie er vor seiner Krankheit war, und das tue ich auch – aber das Bild, das am häufigsten in mir aufblitzt und mich hinterrücks überfällt, ist sein Anblick in den letzten Monaten, wenn ich ihn durchs Fenster sehe, wie er hoch abgestützt auf seinem Pflegebett liegt und in den Garten hinausstarrt, den er geschaffen und geliebt hat. Schon fort und immer noch da, Teil des Lebens und doch daraus verbannt. Kurz nach dem Tod meines Vaters habe ich mit einer Freundin eine Initiative gegründet, die für eine sensiblere Krankenhauspflege dementer Patienten kämpft. Natürlich weiß ich, dass ich damit auch ein bisschen meinen Vater zu retten versuche, der nicht mehr zu retten ist. Und beim Schreiben dieses Buches wird mir klar, dass ich insgeheim auch schreibe, »um zu beichten«, oder wie es der französische Philosoph Jacques Derrida ausdrückt: Jedes Schreiben ist eine Bitte um Vergebung.
1
Den Tatsachen ins Auge blicken
»Ich bin! Doch was, weiß niemand, niemand schert’s.«
John Clare
Sean und ich haben ein Haus in einem sehr wohnlichen Viertel in Nordlondon, wo wir unter dem Namen Nicci French unsere Psychothriller schreiben. An der baumgesäumten Straße stehen schmucke viktorianische Reihenhäuser mit gepflegten Gärten und Geranien in den Fensterkästen. Es gibt eine kleine Grünfläche, wo die Leute für ihre Hunde Stöckchen werfen, und einen Spielplatz. Es gibt eine Grundschule; werktags warten jeden Morgen Scharen kleiner Kinder vor den Toren, helles Stimmengewirr steigt auf. Ein paar Minuten entfernt gibt es Restaurants, Cafés und Läden. Und ganz am Ende der Straße steht ein riesiges Gefängnis mit hohen, stacheldrahtbewehrten Mauern. Auf seiner Rückseite liegen unmarkierte Gräber, wo früher die Hingerichteten begraben wurden. Manchmal sehe ich fensterlose Transporter durch die Tore hinein- oder herausfahren, und nachts schweben oft Hubschrauber wie brummende Rieseninsekten über dem Gebäude und Suchscheinwerfer scannen das Dunkel. Manche wollen auch Drohnen entdeckt haben, die Drogen oder Handys abwerfen. Aber man kann nicht hineinsehen, ich habe nie einen Blick auf die Menschen werfen können, die dort inhaftiert sind, habe nie ihre Stimmen gehört.
Schlimmes, Schreckliches passiert in diesem Gefängnis, wo über 1200 Männer unter unmenschlichen Bedingungen leben, in überfüllten, dreckigen Räumen. Die für einen Bewohner gebauten, etwa dreieinhalb mal zweieinhalb Meter großen Zellen sind oft mit zwei Männern belegt, nur ein Schritt trennt die schlecht abgeschirmte Toilette vom Ess- und Schlafplatz. Die Toiletten sind oft verstopft, Abwässer sickern heraus, auf dem Boden liegt Müll, ein Tummelplatz für Schaben. Das Tagesbudget für die Mahlzeiten liegt kaum über 1,50 Pfund – so viel, wie Schweinefutter kostet. Drogen sind allgegenwärtig, besonders die neue »Zombiedroge« Spice, die einen semikomatösen Zustand erzeugt und die Insassen die Haft besser ertragen lässt. Banden kontrollieren das Geschehen. Schikanen, Gewalt und Selbstmord sind in dem Klima der Angst und des Elends an der Tagesordnung. Aber wir draußen leben unser behagliches Leben weiter und wollen uns keine Gedanken über diese Einrichtung nebenan machen. Die Männer darin sind aus den Augen, aus dem Sinn, weggesperrt von der Welt und ihrer menschlichen Grundrechte beraubt. Viele Leute meinen sogar, Gefangene hätten ihre Menschenrechte verwirkt und verdienten Bestrafung, wir seien ihnen nichts schuldig, im Gegenteil, in einer Kultur von Soll und Haben zahlen sie ihre Schulden. So kann man sie leicht vergessen: Einer von denen ist eben nicht einer von uns.
Wie wir empfinden und handeln, hängt oft davon ab, ob wir uns mit einer Person identifizieren können, ob sie uns gleicht oder für eine Welt steht, mit der wir vertraut sind oder die wir uns wünschen. Irgendwie empfinden wir dann Nähe, Intimität, und wenn diese Person in Gefahr ist, wird ein heftiger Rettungsimpuls in uns wach. Manche Menschen erleiden körperliche Verletzungen, werden missbraucht oder verschwinden, und in uns steigt eine Woge des Mitgefühls auf, die Sache geht uns zu Herzen. Andere Menschen verschwinden, und wir bleiben gleichgültig. Manche verschwinden, und wir wissen es nicht einmal.
Ende 1995 bis Anfang 1996 schickte mich der Observer zu dem langen, grausigen Prozess Rosemary Wests, über den ich berichtete. Frederick und Rosemary West waren ein scheinbar ganz gewöhnliches Paar, das mit seinen Kindern in der Provinz lebte, gut mit den Nachbarn auskam, Tee trank und am Sonntag den üblichen Braten in den Ofen schob. Über einen Zeitraum von 16 Jahren missbrauchten die beiden ihre eigenen Kinder und ermordeten sie, danach folterten und töteten sie andere junge Frauen. Sie waren Serienmörder, die ihre Opfer als lebende Sexutensilien benutzten, bevor sie sie in ihrem Garten vergruben. Fred West beging im Gefängnis Selbstmord, und so saß nur seine Frau auf der Anklagebank in einem Prozess, der das ganze Land erschütterte und heute noch nachklingt. In jenem Winter öffnete sich mehrere Wochen lang ein Fenster zu einer Welt, deren Existenz sich die meisten von uns nie hätten vorstellen können, eine Welt der Obszönität, Entmenschlichung und ungezügelten Gewalt. Es war, als hätten sich hier viele Jahre lang Szenen von Hieronymus Bosch abgespielt, in einem kleinen Reihenhaus in Gloucester, das zum Schlachthaus, Bordell und zur sadistischen Folterkammer wurde. Am Ende des Prozesses, als Rosemary West des zehnfachen Mordes für schuldig befunden und zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden war, fühlte ich mich wie vergiftet und hatte das Bedürfnis, mich irgendwie zu reinigen.
Aber neben Gefühlen des Entsetzens und der Besudelung durch den Dreck, der da aufgewühlt worden war, empfand ich auch ein weniger drastisches, dafür länger anhaltendes Verlustgefühl, das dazu führte, dass ich als Journalistin über andere Themen schreiben wollte, das sogar meine Weltsicht veränderte. Mehrere der jungen Frauen, die im Lauf der Jahre in das schwarze Loch der Cromwell Street 25 gesaugt worden waren, verschwanden so gut wie ohne Wellenschlag; manche wurden nie als vermisst gemeldet. Die Wests suchten sich Menschen aus, die wehrlos und machtlos waren, die im Heim gewesen, arbeitslos oder entwurzelt waren und keiner Gemeinschaft angehörten. Menschen ohne jegliche Sicherheitsnetze. Wenn diese Frauen und Mädchen abhandenkamen, wurden sie nicht vermisst. Es gab keine fieberhafte Suche, keinen landesweiten Schmerz, kein Wehklagen. Diese Menschen waren unsichtbar, und wenn sie verschwanden, blieben sie unsichtbar und weitgehend unbetrauert. Erst als viele Jahre später ihre Leichen gefunden wurden, wandten wir ihnen kurz unsere Aufmerksamkeit zu.
Einige Monate nach dem Ende des Prozesses verbrachte ich mehrere Wochen mit Londoner Prostituierten. Ich saß in schummrigen, überheizten Zimmern und hörte mir ihre Lebensgeschichten an, und wenn Kunden kamen, ging ich hinaus. Die Frauen waren alle jung, manche noch Teenager, die meisten waren körperlich misshandelt oder sexuell missbraucht worden und mit einer Ausnahme cracksüchtig. Fast alle hatten einmal in irgendwelchen Heimen gelebt. Auf meine Frage, was sie am liebsten tun würden, wenn sie die Chance dazu bekämen, antworteten mehrere – es brach mir fast das Herz: Am liebsten würden sie Pflegeeltern werden, um Kinder vor einem Schicksal wie ihrem eigenen zu bewahren. Sie wollten ihr jüngeres Selbst retten. Die Straße, in der sie arbeiteten, lag einen Steinwurf von unserer heutigen Wohngegend entfernt. Inzwischen ist das Viertel saniert und kühler Kommerz eingezogen, aber damals war es heruntergekommen und von Brachflächen umgeben, auf die die ärmsten der Frauen, die nicht einmal ein eigenes Zimmer hatten, ihre Kunden mitnahmen. Warum hatte ich sie nie bemerkt?
Wir leben in einem winzigen Lichtkegel, umgeben vom Dunkel all dessen, was wir nicht sehen. Wir sehen, wonach wir Ausschau halten und worauf wir bewusst den Blick richten. Es gibt ein Experiment, erstmals vor fast zwei Jahrzehnten durchgeführt und seither in unterschiedlichen Varianten wiederholt, das diese »Unaufmerksamkeitsblindheit« schön demonstriert: Den Versuchspersonen wird ein Video vorgeführt, dabei sollen sie stumm zählen, wie oft drei weiß gekleidete und drei schwarz gekleidete Basketballspieler den Ball untereinander abgeben. Nach ungefähr dreißig Sekunden betritt eine Frau im Gorillaanzug die Halle, blickt in die Kamera und trommelt sich auf die Brust, dann geht sie wieder hinaus. Schauen Sie sich dieses Video bewusst an, und Sie werden es nicht fassen, wie jemand die Gorillafrau übersehen kann. Aber die Hälfte der Versuchspersonen bemerken sie nicht. Sie sind damit beschäftigt, sich auf die Spieler zu konzentrieren, und halten nicht nach ihr Ausschau – und so bleibt sie unsichtbar.
Ich kann meine eigene Version dieser Geschichte erzählen. In den Sommerferien saßen einmal meine dreijährige Tochter, ihr älterer Bruder und ihr Cousin auf einem Steg und »fischten« mit ihren Spielzeugangeln. Meine Tochter saß zwischen den beiden, und urplötzlich kippte sie nach vorn und plumpste wie ein Stein in den See. Die beiden Jungen angelten seelenruhig weiter. Sie reagierten erst, als eine voll bekleidete Erwachsene an ihnen vorbeistürmte und ins Wasser sprang.
Wir sind alle innerhalb der Grenzen unseres Geistes gefangen. Es ist für uns unmöglich, die Welt zu sehen, in der wir leben, wir erkennen nur winzige, wie von Scheuklappen begrenzte Ausschnitte, auf die der Lichtstrahl unserer Aufmerksamkeit fällt. Als Jugendliche bemerkte ich vor allem andere Jugendliche. Als ich schwanger war, sah ich plötzlich die vielen Schwangeren und dann die Babys; später war die Welt voller kleiner Kinder und ihrer erschöpften Eltern, voller Alleinerziehender … Jetzt sehe ich unzählige gebrechliche Menschen, denen die Angst ins Gesicht geschrieben steht – aber nur, weil ich meinen Vater so gebrechlich und verängstigt gesehen habe.
Wir können nicht alles sehen, aber vielleicht können wir lernen, uns unserer Blindheit bewusst zu werden und uns zu sensibilisieren. Vor einigen Jahren arbeitete ich an einem Roman mit dem Titel Missing Persons und wanderte wochenlang durch London. Plötzlich sah ich, was immer schon da gewesen war: die Gestalten unter den Arkaden, Menschen, zusammengekauert in Toreinfahrten, in den U-Bahnhöfen, auf Bänken, in notdürftigen Zelten, Menschen, die Einkaufswagen mit ihren kläglichen, in Plastiktüten verstauten Habseligkeiten schieben, die Pappschilder halten mit der Bitte: »Helfen Sie mir!«, früh gealterte Menschen mit sonnenverbrannten, windgegerbten Gesichtern, verfilztem Haar und wuchernden Bärten. Diese Menschen versuchen, den Blick der Vorübergehenden aufzufangen, die sie allerdings meiden und einen großen Bogen um sie machen. Als ich in einer Großstadt durch eine düstere Unterführung gehe, bemerke ich Flyer auf den Säulen: »Wann hast du zuletzt einen obdachlosen Menschen gesehen?« Ein Stück weiter die Antwort: »Je mehr du siehst, desto weniger schaust du hin.« Die Obdachlosen und die Besitzlosen, die durch jedes Sicherheitsnetz gefallen sind, erinnern uns daran, was passiert, wenn uns das Glück verlässt. Am besten nicht hinsehen. Ist schließlich nicht einer von uns.
Jedes Menschenleben ist kostbar: Welch einfacher Gedanke, wie leicht kommt er uns über die Lippen, wie viel schwerer ist es, auch danach zu empfinden und zu handeln. Und wenn die leidenden Menschen anders sind als wir? Wenn sie von weit her kommen, in maroden Booten? Wenn sie in einem stinkenden Schlafsack in einer Toreinfahrt liegen, eine Bierdose in der Hand, neben sich einen hässlichen, treuen Hund?
Was ist, wenn sie alt, vergesslich, klapprig und durcheinander sind, Wesen aus einer Welt, über die wir lieber nicht nachdenken wollen? Jahrzehntelang waren in unserer Gesellschaft Menschen mit Demenz unsichtbar. Manchmal haben sie sich aus dem öffentlichen Raum zurückgezogen (oder wurden daraus entfernt) und sind nicht mehr im Blickfeld, sondern in Krankenhäusern, Pflegeheimen, hinter verschlossenen Türen. Manchmal sind sie auf eine noch existenziellere Weise unsichtbar. Hilflos und auf andere angewiesen, haben sie ihre gesellschaftliche Bedeutung eingebüßt und sind zu verlorenen, geisterhaften Gestalten geworden. Sie sind da und doch nicht da, ohne Teilhabe am großen Strom des Lebens. Auf sie fällt kein Licht.
Ich erinnere mich an einen Restaurantbesuch mit meinem Vater, als er in den Anfangsstadien des großen Niedergangs war. Er hatte Schwierigkeiten zu bestellen, war in einer Endlosschleife der Unentschlossenheit gefangen. Die junge Kellnerin sah uns an, grinste und rollte verschwörerisch mit den Augen, als wäre alles ein großer Witz. Als sie den Tisch verließ, folgte ich ihr und stauchte sie zusammen; sie war so verwirrt und erschrocken, dass ich mich sogleich für mein Verhalten schämte. Sie war nicht grausam, sondern wusste es nicht besser, begriff nicht. Sie dachte, hier liefe ein anderer Film – eine Komödie, keine Tragödie.
Unzählige Male habe ich miterlebt, wie Menschen auf alte Männer und Frauen, die in ihrer Verwirrtheit den reibungslosen Ablauf der Dinge störten, ungeduldig und vielleicht sogar ein wenig verächtlich reagierten (oft genug habe ich selbst so reagiert). Oder wie gute, hart arbeitende Ärzte und Krankenschwestern über ihre gebrechlichen, verwirrten Patienten sprachen, über deren Köpfe hinweg, anstatt sie selbst anzusprechen. Wie sie ohne Erklärung Plastikhandschuhe überstreiften, bevor sie sie berührten, als wären ihre Körper kontaminiert. Wie sie ihre Monitore anblickten anstelle der verletzlichen und oft verängstigten Person, die eine unvertraute Situation erlebte und ihre Hilfe brauchte. Wie sie ein wenig in Eile oder ein wenig gleichgültig wirkten, mit anderen Dingen beschäftigt. Ich werde einem der Ärzte meines Vaters immer dankbar sein, einem melancholischen, stets erschöpft aussehenden Osteuropäer, der meinem Vater ausnahmslos mit liebevollem Respekt begegnete. Ich weiß nicht, wie gut er als Klinikarzt war, aber mein Vater hatte in seinem Leben einen Punkt erreicht, an dem er keinen begnadeten Mediziner mehr brauchte, sondern einen mitfühlenden Menschen, der um Erlaubnis bat, sich auf sein Bett setzen und seine Hand nehmen zu dürfen, der voller Achtung mit ihm sprach, der ihn korrekt mit seinem Doktortitel anredete und ihn spüren ließ, dass er trotz aller Verluste ein Subjekt blieb, ein Ich.
Wie bei so vielen anderen Gruppen Vergessener ist es einfacher, die Menschen, die mit Demenz leben, zu vergessen, wenn man sie ein wenig dehumanisiert, ein wenig abwertet. Eine solche Haltung schleicht sich in die Art ein, wie wir über sie sprechen, wenn wir Klischees benutzen, ohne eine Sekunde lang darüber nachzudenken, welche Inhalte wir damit eigentlich transportieren: Wir sagen, dieser Mensch sei nicht mehr der, der er früher war; er sei nicht mehr ganz da und nicht mehr ganz er selbst. Er sei nur noch ein Schatten seiner selbst. Je gravierender die Einbußen, desto schonungsloser die Sprache: Wir sagen, dieser Mensch habe seine Persönlichkeit verloren. Wir sagen vielleicht sogar, er sei nur noch eine leere Hülle. Ein lebender Toter sozusagen.
Jedenfalls nicht einer von uns.
So zu denken, wertet uns alle ab.
Vor Jahren fiel eine meiner Töchter vom Pferd und verlor beim Sturz das Bewusstsein. Sie wurde mit dem Rettungswagen in die nächste Klinik gebracht, wo sie über Nacht bleiben musste, denn sie konnte sich weder an den Sturz noch an die vorangehenden Wochen erinnern, mehr noch, sie konnte keine neuen Erinnerungen bilden. Sie hing in einer Endlosschleife fest: Jedes Mal, wenn wir ihr erzählten, was passiert war, drückte sie ihre Überraschung in genau denselben Formulierungen aus, im selben Tonfall, mit derselben Miene komischer Fassungslosigkeit – und bat dann ein paar Minuten später erneut um eine Erklärung. Sie lag auf einer orthopädischen Station, auf der außer ihr und einer anderen Frau, die ihre Brille auf die Nasenspitze gerückt hatte und ruhig in einem Buch las, alle Patienten alt waren und Demenz hatten. Der Zustand meiner Tochter spiegelte in mancher Hinsicht den ihren, auch sie konnte sich nicht erinnern, aber bei ihr würde das Gedächtnis zurückkehren, bei ihnen nicht.
Seitdem habe ich viele Kliniken besucht und mich an die Lage dort gewöhnt, aber damals war ich sehr schockiert, es machte mir Angst, meine Tochter an einem Ort lassen zu müssen, wo Verzweiflung, Hilflosigkeit und Angst mit Händen zu greifen waren. Mehrere Frauen lagen mit offenem Mund im Bett, kraftlos und nicht ansprechbar; sie wirkten so krank, als hätten sie diese Welt schon verlassen. Eine Frau wand sich und schrie ein ums andere Mal: »Nein, nein, bitte nicht. Bitte nicht, Herr Lehrer!« Sie hielt sich den Bauch, weinte und rief: »Da unten ist es!« Sie durchlebte wohl ein altes Trauma; während die meisten Erinnerungen weggespült waren, blieb ihr dieses schlimme Erlebnis erhalten und wiederholte sich immer wieder, ein Albtraum, aus dem sie nicht erwachen konnte, weil sie ja schon wach war und in sich selbst gefangen. Auf mich wirkte die Szene wie eine neuzeitliche Hölle. Die Schwestern waren ausgesprochen geduldig und respektvoll, aber sie konnten unmöglich auf jede Patientin eingehen und hatten sich wahrscheinlich an den Zustand gewöhnt. Auf einer Station voller Menschen mit Demenz waren so viel Verzweiflung und Chaos normal, eine Art Hintergrundgeräusch.
Neulich besuchte ich eine Klinikstation, wo ich eine Patientin in größtem Elend erlebte. Sie konnte kaum sprechen, wusste aber, dass sie nach Hause wollte, nach Hause musste. Sie versuchte immer wieder, aus dem Bett zu steigen, um dorthin zu flüchten, wo sie sich geliebt und geborgen fühlte, wahrscheinlich ein Ort in ferner Vergangenheit. Eine junge Ärztin kam zur Visite, blieb bei ihr stehen und erklärte ihr, warum man sie nicht gehen lassen könne, sosehr sie es sich auch wünschte; hier zu bleiben sei zu ihrem eigenen Besten. Die Frau weinte, ihr Gesicht war tränennass, sie ließ sich nicht trösten.
Eine andere Station, ein anderer Moment: Eine Frau lag reglos da, nur ihre knochigen Hände flatterten; sie war so abgemagert, dass sich ihr Körper kaum unter der Decke abzeichnete. Am Tisch neben ihr stand ein Foto, auf dem eine strahlende junge Frau aus ferner Vergangenheit am Strand zu sehen war, knöcheltief in den Wellen, Hand in Hand mit einem Mann. Es fiel schmerzhaft schwer, diese beiden Frauen zur Deckung zu bringen, die eine im Bett, die andere am Strand, die eine verliebt in die Zukunft vor ihr, die andere kurz vor dem Tod.
Oder eine Situation in einem Pflegeheim, in dem ich die Mutter einer Freundin besuchte: Eine große, hagere Frau mit schiefen Zähnen trat zu mir heran und packte meine Hand. Sichtlich verstört, versuchte sie, mir etwas zu erzählen, ihre Augen glitzerten vor Mitteilungsdrang. Aber ich konnte aus ihrem Redeschwall keine einzige verständliche Silbe heraushören, sie sprach in einer Sprache, die niemand mit ihr teilte, in Worten, die keine waren. Niemand konnte sie verstehen. Das ist Einsamkeit.
Unser Umgang mit Demenz ist dabei, sich zu wandeln; die Krankheit, die früher verborgen wurde, ist jetzt anerkannt und wird diskutiert, ist Gegenstand politischer Initiativen, internationaler Forschung, weltweiter Kampagnen. Kein Land, keine Kommune entkommt der Krankheit, und fast überall hat man Wege gefunden, das Leben derer, die daran leiden, zu verbessern. Weltweit gibt es Tausende gemeinnütziger Organisationen, manche riesig und umfassend tätig wie die Alzheimergesellschaft, die in Dutzenden Ländern präsent ist, andere klein und auf ein spezifisches Thema ausgerichtet wie die winzige Organisation bei mir vor Ort, deren Schirmherrin ich bin, das »Creative Dementia Arts Network«. Hier liegt der Fokus auf dem wohltuenden Einfluss der Kunst bei Demenz.
Man begegnet der Krankheit auf fantasievollen neuen Wegen. In Ländern wie Holland, Dänemark und Deutschland gibt es Demenzdörfer, Orte, die es ihren Bewohnern ermöglichen, ihr Gefühl von Autonomie zu bewahren. In den USA wurde die partnerschaftliche »Dementia Friendly Initiative« gegründet, um landesweit das Bewusstsein für die Krankheit und die Demenzfreundlichkeit zu fördern. In Japan leben in der alternden Bevölkerung etwa fünf Millionen Menschen mit Demenz, eine Zahl, die sich bis 2025 auf sieben Millionen steigern wird; hier wurden unzählige modernste Geräte entwickelt, um gebrechliche und verwirrte Menschen zu überwachen und zu versorgen – zum Beispiel ein Teekannensensor, der eine Benachrichtigung an einen Angehörigen schickt, wenn einige Zeit kein Tee gekocht wurde, oder ein Anstecker mit QR-Code für den Fall, dass sich jemand verirrt, ein zunehmendes Problem, oder Roboter, die Essen bringen oder für Bequemlichkeit sorgen.
In Dänemark haben die meisten Kommunen Aktivitätszentren für Senioren eingerichtet, um das Risiko, das die Inaktivität birgt, zu verringern. In Dresden wurde in einem Pflegeheim eine ganze historische Ära (der DDR) nachgestellt, um bei den älteren Bewohnern Erinnerungen zu aktivieren und Vitalität zu wecken. Im Vereinigten Königreich und in vielen anderen Ländern wird in Kliniken und anderswo Gedächtnistraining angeboten, es gibt Supermärkte, in denen das ganze Personal den Anstecker »Demenzfreundlich« trägt, ganze Städte engagieren sich für das Ziel, demenzfreundlich zu werden. Es gibt Partnerschaften zwischen Kinderkrippen und Altenheimen, Kooperationen zwischen Betreutem Wohnen und Schulen, Wohnprogramme für Studenten, die mietfrei in einem Altenheim wohnen und dafür eine feste Stundenzahl den oft isolierten Bewohnern als Nachbarn zur Verfügung stehen; es gibt generationsübergreifende Wohnsiedlungen, Demenz-WGs …
Und Tag für Tag scheinen Konferenzen stattzufinden, bei denen Menschen aus der ganzen Welt zusammenkommen, um den gemeinsamen Wissensfundus zu erweitern und Ideen auszutauschen. Wir kennen die Zahlen, die furchterregenden Prozentangaben, die Grafiken mit Kurven, die wie zerklüftete Klippen in die Höhe steigen, hinauf in das Vergessen. Hollywoodfilme, persönliche Lebensberichte und Memoirs, die zum Bestseller werden, Dokumentarfilme, Theaterstücke, ernüchternde Schlagzeilen, aber auch optimistische. Das Wort »Demenz« ist beinahe zur gängigen Vorsilbe geworden. Als ich 2017 den auf einer Rennbahn veranstalteten UK-Demenzkongress besuchte, fand ich die große Halle voller Stände, die Demenzmatratzen anpriesen, Demenzdeko (Bilder von fließendem Wasser und bunten Blumen), Demenzuhren, – veröffentlichungen, – projekte, – ernährung, – pflegeheime, – patientenlifter … Die Behauptung, Menschen mit Demenz seien wie Unsichtbare, Verschwundene, scheint inzwischen lächerlich.
Und doch wandern alte Männer Korridore entlang, die Pyjamahose um die Knöchel. Alte Frauen weinen ungetröstet. Ärzte und Schwestern bekommen den Schwarzen Peter zugeschoben. Demenzpatienten werden »Bettblockierer« geschimpft oder in den USA »GOMER« (Get Out of My Emergency Room, Raus aus der Notaufnahme), und das engagierte Personal im Gesundheitswesen tut sein Bestes, um sie nicht als Objekte, Last, statistische Daten oder Problem zu sehen, damit jemand, der »Helft mir! Helft mir!« schreit, nicht als lästig wahrgenommen wird, seine gequälten Worte nicht als verbaler Tick.
Jahr für Jahr legen Zeitungsberichte die Vernachlässigung und Misshandlung offen, die hinter geschlossenen Türen vor sich gehen, weil der Pflegeberuf beklagenswert unterbezahlt und unterbewertet ist, weil jemand, der sich nicht erinnern kann, auch nichts erzählen kann, und weil wir in unserer Kultur die Alten, Gebrechlichen und kognitiv Beeinträchtigten infantilisiert und sogar dehumanisiert haben.
Demenz kann zu Seelennot und Verzweiflung führen. Im April 2017 wurde einem 95-Jährigen eine Gefängnisstrafe erlassen, zu der er verurteilt worden war, weil er versucht hatte, seine geliebte 88-jährige Ehefrau (»die schönste Frau der Welt«) mit einem Fäustelhammer und einer Keramikpfanne zu erschlagen, nachdem sie ihn wiederholt angefleht hatte, sie zu töten. Ihre geistige Gesundheit war »gefährdet«; er betreute sie allein und lehnte jede Hilfe sozialer Dienste entschieden ab. Sie wollte, dass er sie tötete, bevor sie in ein Krankenhaus oder ein Heim musste, »und ich habe es nicht hingekriegt«, sagte er zu den Polizeibeamten, die ins Haus kamen. »Und jetzt habe ich ihr Leiden nur vergrößert … ich wäre glücklich, wenn ich ein Mörder wäre. Bitte sagen Sie mir, dass ich sie umgebracht habe.«
Lieber sterben zu wollen, als abhängig und hilflos zu werden, aus einer 65-jährigen Ehe herausgerissen und in einem Heim untergebracht zu werden; der Versuch, den meistgeliebten Menschen zu töten, weil seine Zukunft als Hölle erscheint – was sagt das über unsere Kultur? Wenn ein Mensch kein Handelnder im moralisch-ethischen Sinn mehr ist, keine Kontrolle mehr über sein Leben hat, das Bewusstsein seiner selbst und seine rationale Denkfähigkeit verliert, kein Narrativ seines Lebens mehr herstellen kann, heißt das dann, dass er deshalb weniger Mensch ist und sein Leben weniger wertvoll? Was bedeutet es letztlich, zu leben? Demenz gehört zu den Störungen, die »ernsthaft die Fähigkeiten gefährden, die wir in der Regel als einzig dem Menschen zugehörig definieren: Gedächtnis, Persönlichkeit, Erkennen, Bewusstsein, Liebesfähigkeit, sogar das Empfinden von Hoffnung. Das Gehirn, der Verstand, der Geist und der Wille …, die den Kern des Menschseins ausmachen, sind beeinträchtigt.« Was bedeutet es für Menschen, »mit Defiziten zu leben, die ihnen einen Platz abseits der üblichen, zur Beschreibung des Menschseins herangezogenen Kriterien zuweisen«?
Andrea Gillies lebte zwei Jahre lang mit ihrer Schwiegermutter und deren rapide fortschreitender Alzheimererkrankung. In ihrem Buch Keeper, einem erschütternden Bericht über diese Zeit, fragt die Autorin: »Was nimmt Demenz uns weg?« Ihre Antwort: »Alles, auch noch das Letzte, von dem wir uns zu unserer Beruhigung einreden, nichts könne es uns nehmen.« Das ist der Abgrund der Demenz, der jede Sinnhaftigkeit verschlingt.
Am Tag nach dem Reitunfall holten wir unsere Tochter aus der Klinik ab. Ihre Fähigkeit, neue Erinnerungen zu bilden, kehrte langsam zurück, aber sie hatte keine Erinnerung an die Nacht, die sie unter all den Frauen verbracht hatte, die nach Hilfe riefen, schrien, fluchten, weinten. Und auch ich vergaß allzu schnell diese Schattenwelt von Verlust und Verzweiflung. Ich schloss die Tür zu dieser Welt – eine Weile lang.
2
Älter werden
»Das Alter ist gekommen … das Herz ist vergesslich.«
Altägyptische Schriftrolle
Wenn wir das Glück haben, dass unser Leben den erwarteten Lauf nimmt, dann werden »wir länger alt sein, als wir je jung gewesen sind.«
Die Weltbevölkerung altert. Wie ein UN-Bericht prognostiziert, wird der Anteil der über Sechzigjährigen zwischen 2015 und 2030 um 56 Prozent zunehmen, von 901 Millionen auf 1,4 Milliarden; im Jahr 2050 wird sich der Gesamtanteil der Senioren gegenüber 2015 verdoppelt haben und 2,1 Milliarden erreichen. Der Anteil der Menschen über achtzig, der sogenannten »ältesten Alten«, wächst weltweit sogar noch schneller: 2015 gab es 125 Millionen Menschen über achtzig, für 2050 wird eine Zahl von 434 Millionen erwartet. Entscheidend ist, dass die Zahl der Älteren schneller wächst als jede andere Altersgruppe, oder anders gesagt, der Anteil der Älteren an der Gesamtbevölkerung nimmt rasch zu. 2050 wird jeder, jede Fünfte über sechzig sein, in Ländern mit hohem Einkommen ist der Prozentsatz schon jetzt viel höher (in Japan zum Beispiel bei 33 Prozent). Im Vereinigten Königreich, wo die Lebenserwartung zeitweise sogar gesunken ist, lebten 2016 knapp unter 15 000 Hundertjährige; die Lebenserwartung eines neugeborenen Jungen lag bei 79,2 Jahren und die eines Mädchens bei 82,9 Jahren. Früher konnten Männer wie Frauen, wenn sie in Rente gingen, noch mit einer Handvoll Jahren rechnen, heute sind es 15 oder 20 Jahre, fast ein Viertel der durchschnittlichen Lebenszeit. Es wird darüber diskutiert, das »Alter« neu zu definieren und an der noch bleibenden Lebenserwartung auszurichten: Alt wäre man demnach, wenn die Lebenserwartung laut Statistik unter 15 Jahre fällt. Sechzig zu sein bedeutet heute nicht mehr dasselbe wie früher (das sage ich als fast Sechzigjährige), siebzig zählt kaum als alt.
Obwohl die Lebenserwartung so viel höher liegt und das Alter, wie auch immer definiert, ein mächtiges Stück im Tortendiagramm unseres Lebens geworden ist, sieht es nicht so aus, als hätten wir uns an diese Tatsache gewöhnt, sie begrüßt oder Möglichkeiten gefunden, unseren Lebenslauf daran anzupassen. Das Alter ist wie übrig gebliebenes Material, mit dem wir – als Einzelne und als Gesellschaft – nichts anzufangen wissen. In den USA liegt der Anteil der Rentner, die unter der Armutsgrenze leben, über 20 Prozent (in Australien bei erschreckenden 35 Prozent); viele Amerikaner leben in der Angst, im Ruhestand arm zu sein. Im Vereinigten Königreich leben etwa 1,7 Millionen Rentner unter der Armutsgrenze, ein Viertel der Haushalte in unzulänglichen Wohnverhältnissen. Mehr noch, einer neueren Umfrage zufolge fühlen sich drei Viertel der Älteren einsam; zwei Fünftel der über 75-Jährigen geben an, dass ihnen hauptsächlich der Fernseher Gesellschaft leistet.
Für manche, die Geld, Familie und Freunde haben, die gesund sind und mit denen es das Schicksal gut gemeint hat, kann das Alter eine sehr beglückende Zeit sein. Für andere bringt es Angst und Verzweiflung, das bittere Ende eines langen Lebens. Wie finanzieren wir die zusätzlichen Jahre? Wie sorgen wir besser für die, die alt sind und gesundheitliche Probleme haben? Wie schaffen wir in der Gesellschaft wieder ein Gleichgewicht, damit alle – die Jungen, die Menschen mittleren Alters, die Älteren und die ältesten Alten – einen Lebensinhalt finden und sich entfalten können? Und wie lange wird es dauern, bis es nicht mehr merkwürdig beschämend ist, irgendwie ein Versagen und eine Schande, alt zu sein?
Vor ein paar Jahren lief ich einmal durch ein großes Kaufhaus. Ich war spät dran und suchte nach Dingen, die ich nicht finden konnte; mir war heiß, und ich fühlte mich genervt, kribbelig und unwohl. Ich hastete einen Gang entlang, und da eilte mir eine Frau entgegen. Sie war hager, ein ganzes Stück älter als ich, schien gestresst und ziemlich schludrig gekleidet. Als ich näher kam, sah ich, dass ihre Bluse falsch geknöpft war. Ich hob die Hand, damit sie nicht mit mir kollidierte, und auch sie hob die Hand und lächelte mich verunsichert an. Ich blieb stehen. Sie blieb stehen. Wir blickten einander ein wenig mitleidig an. Da begriff ich mit einem Schlag, dass ich diese Frau war – ich sah mich selbst in einem Spiegel. Ich fühlte mich zutiefst gedemütigt. In der Regel bereiten wir uns auf unser Spiegelbild vor, aber hier wurde ich davon überrumpelt – und mein Selbstbild zersprang in tausend Scherben. Ich stand unvermittelt der Person gegenüber, als die mich die anderen sehen.
War ich so müde und verlottert? War ich so alt? Unmöglich. Diese Frau im Spiegel war nicht ich. Sie ist es nie.
Als ich in die U-Bahn steige, holt mich jener Moment wieder ein. Morgens ist der Zug voll, es gibt keine freien Plätze. Ich bleibe im Gang stehen, stecke mir die Kopfhörer ein, drehe die Musik auf und klinke mich aus.
Plötzlich steht ein höflicher junger Mann auf und bietet mir mit einer Geste seinen Platz an.