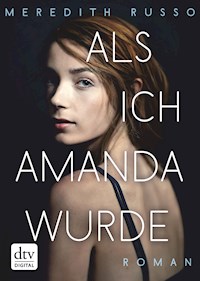
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Über die erste Liebe und die Angst, nicht akzeptiert zu werden Amanda Hardy hieß nicht immer Amanda. Früher war sie Andrew. Jetzt hat sie endlich die Operationen und die lange Hormontherapie hinter sich und ist auch biologisch ein Mädchen. Bei ihrem Vater in Tennessee, wo niemand sie kennt, möchte sie ein neues Leben beginnen. Zunächst scheint das auch zu klappen: Plötzlich gibt es Freundinnen statt Mobbing und bewundernde Blicke von Klassenkameraden. Doch dann verliebt sich Amanda. So richtig. Mit Grant erlebt sie eine wunderschöne Zeit. Er vertraut ihr und eigentlich will Amanda auch ihm vertrauen und ihm von ihrem früheren Leben erzählen. Nur wie? Amanda setzt auf Zeit – ein gefährliches Spiel ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 339
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Meredith Russo
Roman
Aus dem amerikanischen Englischvon Barbara Lehnerer
Für Vivian und Darwin, ohne die ich keine Mutter wäre.
Für Juniper, die mir mit ihren Geschichten so viele Anregungen für dieses Buch gegeben und mich in Krisenzeiten immer wieder ermutigt hat.
Für meine Eltern, die nicht ausgerastet sind, weil ich Kreatives Schreiben im Hauptfach studiert habe (und obendrein Frauenforschung im Nebenfach).
Für meine weiblichen und männlichen Vorgänger und all die unbestimmten Geschlechts, die mir meine heutigen Chancen und Freiheiten ermöglicht haben, weil sie revoltierten und kämpften, Seuchen überlebten, Freunde betrauerten und unvorstellbaren Kummer und Leid durchstanden.
Für meine Brüder und Schwestern und all die unbestimmten Geschlechts, weil sie jeden Tag mit innerer und äußerer Schönheit in einer Welt überleben, die weit davon entfernt ist, ihnen Sicherheit zu geben.
Für die Jungen und Mädchen und all die unbestimmten Geschlechts, die sich alleingelassen und ängstlich fühlen, keinen Ausweg sehen und glauben, nichts könne sich je für sie zum Besseren wenden.
Für all die, die es nicht geschafft haben und deren Namen wir nie vergessen werden: Rest in power!
Dieses Buch ist für euch alle.
KAPITEL 1
Im Bus roch es nach Schimmel, Maschinenöl und Schweiß. Während wir die Vorstädte von Atlanta hinter uns ließen, wippte ich mit dem Fuß auf und ab, kaute an einer Strähne meiner inzwischen langen Haare und hörte eine kleine bohrende Stimme, die mich daran erinnerte, dass ich erst eine halbe Stunde von zu Hause entfernt war; wenn ich an der nächsten Haltestelle ausstieg und zu Fuß zurückging, konnte ich bei Sonnenuntergang wieder in meinem schönen Zimmer in Smyrna sitzen und es würde im ganzen Haus nach Moms kohlehydratreichem Essen duften. Mom würde mich in den Arm nehmen, wir würden uns vor den Fernseher hocken und irgendeine bescheuerte Realityshow ansehen, sie würde nach der Hälfte einschlafen und nichts würde sich ändern.
Aber es musste sich etwas ändern. Weil ich mich verändert hatte.
Während ich aus dem Fenster auf die schnell vorüberziehenden Bäume starrte, war ich in Gedanken auf der Damentoilette eines Einkaufszentrums in Smyrna und durch meinen Kopf wirbelten die Bilder wie in einem Kaleidoskop: Das Mädchen aus meiner Schule und wie sie aufschrie, als sie mich erkannte. Ihr Vater, der hereinstürzte, seine schnellen, groben Hände an meinem Hals und meinen Schultern. Mein Körper, der auf dem Boden aufschlug.
»Alles okay mit dir?«, brüllte mir eine Stimme entgegen. Ich fuhr zusammen und sah einen Typen mit Ohrstöpseln, der das Kinn auf die Rückenlehne des Sitzes vor mir gestützt hatte. Er grinste schief und zog sie sich raus. »Sorry.«
»Kein Problem.«
Er starrte mich an und trommelte mit den Fingern auf die Kopfstütze. Irgendwie hatte ich das Gefühl, ich sollte mehr sagen, befürchtete aber, dass meine Stimme mich verraten würde.
»Wo geht’s denn hin?« Er hing jetzt wie eine Katze über der Rückenlehne seines Sitzes, es fehlte nicht viel und seine Arme hätten meine Schienbeine gestreift. Am liebsten hätte ich mich zu einem winzig kleinen, gepanzerten Ball zusammengerollt und in meinem Gepäck verkrochen.
»Nach Lambertville«, antwortete ich leise. »Hecate County.«
»Ich fahre nach Knoxville«, sagte er und ging nahtlos dazu über, mich über Gnosis Crank, seine Band, aufzuklären. Mir war schon klar, dass er sich bloß der Form halber nach mir erkundigt hatte, damit er anschließend von sich sprechen konnte, aber es war mir egal; dann musste ich nicht so viel reden. Er erzählte mir, dass er und seine Band ihren ersten bezahlten Gig in einer Bar in Five Points hätten.
»Cool«, sagte ich.
»Die meisten unserer Songs sind online, falls du mal reinhören willst.«
»Klar.«
»Wie bist du übrigens an das blaues Auge gekommen?«
»Ich …«
»Ist das dein Freund gewesen?«
Ich wurde rot. Er kratzte sich am Kinn. Er ging davon aus, dass ich einen Freund hatte. Dass ich ein Mädchen war. Unter anderen Umständen hätte ich mich riesig darüber gefreut.
»Nein, ich bin gestürzt.«
Sein Lächeln sah jetzt traurig aus.
»Das hat meine Mutter auch immer zu den Nachbarn gesagt. Sie hatte was Besseres verdient und das tust du auch.«
»Okay.« Ich nickte. Vielleicht hatte er recht, aber was ich verdiente und was ich vom Leben erwarten konnte, war zweierlei. »Danke.«
»Kein Problem.« Er steckte sich die Stöpsel in die Ohren, lächelte und fügte, wieder viel zu laut, hinzu: »War nett, dich kennenzulernen.« Dann setzte er sich auf seinen Platz zurück.
Während wir auf der I-75 in Richtung Norden fuhren, schrieb ich Mom eine SMS, dass es mir gut ginge und ich die Hälfte der Strecke schon hinter mir hätte. Sie liebe mich, schrieb sie zurück, aber zwischen den Zeilen las ich, wie besorgt sie war. Ich stellte sie mir ganz allein in unserem Haus vor: Carrie Underwood in Endlosschleife und raunende Ventilatoren an der Zimmerdecke. Ihre mehlbestäubten Hände auf dem Küchentisch und viel zu viele Plätzchen im Ofen, denn sonst hatte sie ja immer für zwei gesorgt. Hätte ich die Stärke besessen, normal zu sein, oder zumindest die Stärke, zu sterben, wären jetzt alle glücklicher.
»Nächster Halt: Lambertville«, rief der Busfahrer mit barscher, blechern klingender Stimme durch die Sprechanlage. Draußen vor den Fenstern hatte sich die Landschaft nicht die Spur verändert. Die Berge sahen aus wie vorher. Die Bäume sahen aus wie vorher. Wir hätten überall im Süden sein können, was so viel hieß wie nirgends. Die Art von Gegend, die mir für meinen Dad typisch zu sein schien.
Als der Bus mit einem Ruck hielt, zitterten meine Hände. Außer mir stand niemand auf. Der Musiker sah von seiner Zeitschrift hoch und nickte mir zu, während ich meine Sachen zusammensuchte. Ein älterer Mann mit lederner Haut und schweißbeflecktem Arbeitshemd ließ seine Augen über meinen Körper wandern, ohne Blickkontakt mit mir herzustellen. Ich sah stur geradeaus und tat, als würde ich nichts merken. Die Tür öffnete sich scheppernd, der Bus gab ein zischendes Geräusch von sich. Ich schloss die Augen und richtete flüsternd ein kurzes Stoßgebet an einen Gott, von dem ich nicht wusste, ob er mich noch anhören wollte, dann trat ich auf die Straße hinaus. Die ekelhaft dampfige Nachmittagshitze schlug mir wie eine Wand entgegen.
Ich hatte meinen Vater vor sechs Jahren zum letzten Mal gesehen und diesen Augenblick im Geist immer wieder durchgespielt. Wie ich auf ihn zulaufen und ihn umarmen würde, wie er mir einen Kuss auf die Stirn drücken und ich mich zum ersten Mal seit Langem sicher und beschützt fühlen würde.
»Bist du’s?«, fragte Dad. Seine Stimme klang durch das tiefe, rumpelnde Geräusch des Busmotors gedämpft. Er trug eine Sonnenbrille mit Drahtgestell und war schon halb ergraut. Tiefe Falten hatten sich um seinen Mund gegraben. Mom hatte immer »Lachfalten« dazu gesagt, weshalb mir nicht klar war, wie ausgerechnet er an sie gekommen war. Nur sein Mund sah noch genauso aus, wie ich ihn in Erinnerung hatte: derselbe waagerechte, dünne Strich.
»Hallo, Dad.« Die Sonnenbrille machte es mir leichter, ihn direkt anzusehen. Wir standen beide wie angewurzelt da.
»Hallo«, sagte er nach einer Weile. »Leg deine Sachen hinten rein.« Er öffnete die Heckklappe seines Kombis und stieg auf der Fahrerseite ein. Ich verstaute mein Gepäck und setzte mich neben ihn. An das Auto konnte ich mich noch erinnern; es war mindestens zehn Jahre alt, aber Dad kannte sich mit Maschinen aus. »Du musst hungrig sein.«
»Eigentlich nicht.« Ich hatte eine ganze Weile lang schon keinen Hunger mehr. Ich hatte auch schon eine ganze Weile lang nicht mehr geweint. Meist fühlte ich mich einfach wie betäubt.
»Du solltest aber etwas essen.« Er fuhr vom Parkplatz und warf mir einen Blick zu. Hinter den jetzt transparenten Brillengläsern sah ich trübe, gräulich-braune Augen. »In der Nähe meiner Wohnung ist ein Imbiss. Wenn wir gleich dort hinfahren, haben wir ihn ganz für uns allein.«
»Das wäre schön.« Dad war nie besonders gesellig gewesen, aber eine leise Stimme sagte mir, dass er nicht mit mir gesehen werden wollte. Ich atmete tief ein. »Deine Brille ist cool.«
»Ach ja?« Er zuckte mit den Achseln. »Mein Astigmatismus hat sich verschlechtert. Da hilft sie.«
»Gut, dass du was dagegen unternimmst.« Meine Stimme klang genauso hölzern und verlegen, wie ich mich fühlte. Ich sah auf meinen Schoß hinunter.
»Du hast meine Augen geerbt. Musst aufpassen.«
»Ja, Sir.«
»Wir gehen am besten bald zum Optiker. Dein Auge musst du wegen des Veilchens ohnehin ansehen lassen.«
»Ja, Sir.« Zwischen den Bäumen auf der linken Straßenseite tauchte eine Plakatwand mit der Karikatur eines Soldaten auf, der rote, weiße und blaue Funken sprühende Schüsse aus seiner Bazooka abfeuerte. GENERALBLAMMO’SFIREWORKSHACK. Wir fuhren jetzt in der Sonne, sodass Dads Augen wieder hinter der Brille versteckt waren, aber sein Gesicht hatte einen angespannten Ausdruck angenommen, aus dem ich nicht schlau wurde. »Was hat Mom dir eigentlich gesagt?«
»Dass sie sich Sorgen um dich gemacht hat. Sie meinte, du seist an eurem Wohnort nicht mehr sicher.«
»Hat sie dir auch erzählt, was in der Zehnten passiert ist? Als ich … im Krankenhaus war?«
Seine Fingerknöchel auf dem Lenkrad wurden weiß. Er blickte schweigend vor sich hin, während wir an einem alten Backsteinbau mit angelaufenem Kupferturm vorbeifuhren. Auf einem Schild stand NEWHOPEBAPTISTCHURCH. Im Hintergrund ragte ein Walmart empor.
»Darüber können wir später sprechen.« Er rückte die Brille zurecht und seufzte. Die Falten in seiner Haut schienen noch tiefer zu werden. Ich fragte mich, wie man in sechs Jahren so altern konnte, aber dann fiel mir ein, wie sehr auch ich mich verändert hatte.
»Tut mir leid. Ich hätte es nicht ansprechen sollen.« Ich sah auf die Tabakfarmen, die draußen vor dem Wagenfenster vorbeizogen. »Es ist nur … weil du mich nie angerufen oder mir geschrieben hast.«
»Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. War nicht so einfach, damit klarzukommen … mit all dem.«
»Und, kommst du jetzt besser damit klar, wo du mich gesehen hast?«
»Gib mir ein bisschen Zeit, Kleines.« Bei dem letzten, für ihn so gar nicht typischen Wort spitzte er die Lippen. »Wahrscheinlich bin ich einfach altmodisch.«
Dad fuhr jetzt langsamer und der Blinker tickte im gleichen Takt wie mein Herz. Wir hielten vor Sartoris Dinner Car, einem umfunktionierten Eisenbahnwaggon auf Betonfundament.
»Verstehe.« Ich stellte mir vor, wie ich auf Dad wirken musste, und alle negativen Eigenschaften, die ich je mit mir in Verbindung gebracht hatte, schossen mir durch den Kopf. »Aber ich heiße jetzt Amanda, falls du es vergessen haben solltest.«
»Okay.« Er schaltete den Motor aus, öffnete seine Tür und sagte zögernd: »Okay, Amanda. Das krieg ich hin.« Steif, wie es seine Art war – die Hände in den Hosentaschen, die Ellbogen abgewinkelt –, ging er auf die Tür des Diners zu, während mein Blick auf mein Spiegelbild im Wagenfenster fiel: ein schlaksiger Teenager mit langen braunen Haaren in Baumwollhemd und von der Busfahrt zerknitterten Shorts.
Eine Glocke läutete, als wir das leere Diner betraten, und eine schläfrig wirkende Kellnerin sah lächelnd auf. »Hallo, Mr Hardy!«
»Tag, Mary Anne«, sagte Dad mit breitem Grinsen, setzte sich an die Theke und winkte ihr zu. Mir wurde ganz seltsam zumute, als ich ihn lächeln sah. Er hatte einmal gelächelt, als ich sieben Jahre alt gewesen war und ihm sagte, dass ich es bei der Little League versuchen wolle. Ein zweites Mal, als ich neun war und endlich einwilligte, mit ihm auf die Jagd zu gehen. An weitere Male konnte ich mich nicht erinnern. »Habe gehört, Ihre Granny hatte einen Schlaganfall. Wie kommt Ihre Familie damit klar?«
»Sie meint, im Himmel wollen sie sie nicht haben und in der Hölle hätten sie Angst davor, dass sie das Ruder übernimmt«, erwiderte das Mädchen. Sie nahm Bestellblock und Stift aus der Schürzentasche und kam auf uns zu. »Aber die Physiotherapie ist anstrengend für sie.«
»Wenn es eine schafft, dann sie«, sagte Dad. Er schob der Bedienung die Speisekarte entgegen, ohne einen Blick darauf zu werfen. »Süßtee und einen Caesar Salad mit Huhn, bitte.«
Sie nickte. »Und wen haben Sie da mitgebracht?« Sie sah in meine Richtung. Mein Blick schnellte von ihr zu Dad.
»Ich bin Amanda«, sagte ich. Sie sah mich an, als ob sie gern ein bisschen mehr erfahren hätte, aber ich wusste ja nicht, was Dad ihr über seine Familie erzählt hatte. Vielleicht hatte er gesagt, er hätte einen Sohn? Mit zittriger Hand reichte ich ihr meine Speisekarte und sagte: »Ich hätte gerne eine Waffel und eine Cola light, Ma’am, danke.«
Nach kurzem Zögern sagte Dad ein wenig stockend: »Sie ist meine Tochter.«
»Sieht auch genauso aus wie Sie!« Dad und ich warfen uns einen unbehaglichen Blick zu, während Mary Anne unsere Getränke holen ging.
»Scheint nett zu sein«, sagte ich.
»Sie ist eine gute Kellnerin.« Er nickte steif. Ich trommelte mit den Fingern auf die Theke und wippte zerstreut mit den Füßen.
»Danke, dass ich bei dir wohnen darf«, sagte ich leise. »Das bedeutet mir viel.«
»Ist doch das Mindeste, was ich tun kann.«
Mary Anne brachte unser Essen und entschuldigte sich, um zwei ältere, weißhaarige Männer in karierten Arbeitshemden zu begrüßen.
Einer der beiden blieb stehen und fing ein Gespräch mit Dad an. Er hatte eine Knubbelnase, die von einem Spinnennetz aus violetten Adern überzogen war, und buschige Brauen, unter denen die Augen fast vollständig verschwanden. »Wer ist denn dieser kleine Sonnenschein?« Er beugte sich an Dad vorbei, um mir zuzuwinken.
»Amanda«, murmelte Dad. »Meine Tochter.«
Der Mann pfiff durch die Zähne und klopfte Dad auf die Schulter. »Na, kein Wunder, dass ich sie noch nie gesehen habe! So ’ne niedliche Tochter würd’ ich auch verstecken.« Ich wurde glühend rot und beugte mich schnell über die Theke, um mein Gesicht zu verbergen. »Brauchst bloß zu sagen, wenn einer von den Jungs hier frech wird, dann kannste dir mein Gewehr leihen.«
»Ich glaube nicht, dass es da ein Problem geben wird«, meinte Dad hölzern.
»Glaub’s mir«, sagte der Mann zwinkernd. »Ich hab drei Töchter und von denen ist, wie sie noch jung waren, keine auch nur halb so hübsch gewesen wie deine; trotzdem war’s das Einzige, was ich tun konnte, um ihnen die Burschen vom Hals zu halten.«
»Okay«, sagte Dad. »Danke für deinen Rat. Aber ich glaube, dein Kaffee wird kalt.«
Der Mann verabschiedete sich, zwinkerte mir noch mal zu und ging steifbeinig zu seinem Platz. Ich schaute angestrengt geradeaus. Aus dem Augenwinkel sah ich, dass Dad das Gleiche tat.
»Sollen wir dann mal?«
Er stand auf, ohne meine Antwort abzuwarten, und warf einen Zwanzigdollarschein neben unser erst halb verzehrtes Essen. Während wir ins Auto stiegen und vom Parkplatz fuhren, sahen wir uns kein einziges Mal in die Augen.
Das Krankenhausbett knarzte, als Mom sich setzte und über mein Bein unter der dünnen Decke strich. Trotz der rosigen Apfelbäckchen sah ihr Lächeln eingefroren aus. Sie konnte nicht mehr viel gegessen haben, seit man mich hier aufgenommen hatte, denn ihre Kleidung war ihr viel zu weit geworden.
»Ich habe mit dem Therapeuten gesprochen.« Ihr Tonfall klang so anders als meiner, leicht und melodisch.
»Worüber?« Meine Stimme klang nach nichts, flach, tonlos und eine winzige Spur dunkler als sonst. Am liebsten hätte ich nie wieder etwas gesagt. Mein Magen krampfte sich zusammen.
»Wann du guten Gewissens entlassen werden kannst. Ich habe ihm gesagt, dass ich mich nicht traue, dich allein zu Hause zu lassen, denn in der Arbeit kann ich mir nicht länger freinehmen. Und ich würde es nicht überleben, wenn ich heimkäme und dich wieder …« Sie verstummte und starrte an die zartgelbe Wand.
»Und was hat er gesagt?« Ein paar Tage zuvor hatte auch ich ein Gespräch mit dem Therapeuten gehabt. Als er mich fragte, was mir fehle, schrieb ich acht Wörter auf ein Blatt Papier, denn meine Kehle war von der Magenpumpe immer noch so wund, dass mir das Sprechen schwerfiel.
»Er meinte, es gäbe Mittel und Wege, dir bei deinem Problem zu helfen.« Sie sah mich prüfend an. »Aber er wollte mir nicht sagen, was es ist.«
»Du wirst nicht wollen, dass ich nach Hause komme, wenn ich es dir sage.« Ich schlug die Augen nieder. »Dann willst du mich nie wieder sehen.« So viele zusammenhängende Worte hatte ich seit Wochen nicht mehr von mir gegeben. Meine Kehle brannte vor Anstrengung.
»Das ist unmöglich«, sagte sie. »Nichts, was Gott geschaffen hat, kann mir die Liebe zu meinem Sohn nehmen.«
Ich hob die Hand und sah auf das Patientenarmband an meinem Handgelenk, auf dem Andrew Hardy stand. Wenn ich starb, würde man den Namen Andrew auf meinen Grabstein schreiben, das wurde mir soeben klar.
»Und wenn dein Sohn dir sagen würde, dass er in Wahrheit deine Tochter ist?«
Meine Mutter schwieg. Ich dachte daran, was ich für den Therapeuten aufgeschrieben hatte. Ich wollte, ich wäre als Mädchen auf die Welt gekommen.
Schließlich sah sie mich an. Mochten ihre Wangen noch so rund und rosig sein, der Ausdruck in ihren Augen war jetzt unerbittlich.
»Hör zu.« Sie packte mich so fest am Bein, dass es trotz der mich benebelnden Medikamente wehtat. Aber ich hörte ihr zu. »Alles und jeder ist besser als ein toter Sohn.«
KAPITEL 2
Lambertville High lag am Fuß eines Hügels und rund um die Zufahrt drängten sich Dutzende von Trucks und Kombis in ziemlich schlechtem Zustand. Kleine Schülergruppen hingen vor der Eingangstür herum; die Jungs betont cool, die Mädchen mit geradem Rücken und gerecktem Kinn, und alle strahlten so viel Desinteresse aneinander aus wie möglich.
Die Nacht zuvor hatte ich kaum geschlafen. Um fünf Uhr morgens gab ich es ganz auf und trank einen Nutritionalshake mit Schokogeschmack zu meinen Medikamenten: zwei Zwei-Milligramm-Östradiol-Tabletten, die winzig klein und blau waren und nach Kreide schmeckten. Sie sollten mein Äußeres femininer machen und das Testosteron ersetzen, das mein Körper jetzt nicht mehr produzieren konnte. Außerdem eine Zehn-Milligramm-Lexapro-Tablette, die rund, weiß und wachsartig war und mich beruhigen sollte.
Ich sah stur geradeaus, betrat die Schule durch die große Eingangstür und hoffte, dass der Concealer, den ich auf den inzwischen blasseren, gelblich verfärbten Überresten meines Veilchens aufgetragen hatte, seinen Zweck erfüllte. Der Boden im Schulgebäude bestand aus einem alternierenden Muster grüner, brauner und gold gesprenkelter weißer Fliesen. Neonröhren surrten laut, gaben aber trotzdem nur ein spärliches Licht auf den Gängen ab. An den Wänden standen Vitrinen mit Pokalen für Cheerleading, Marschkapelle, Baseball und vor allem Football und mit Urkunden, die zeitlich so weit zurückreichten, dass die Hälfte der Teamfotos darauf bereits verblichen war. Auf den roten Türen der Unterrichtsräume standen verblasste Zahlen, denen ich bis Nr. 118 folgte; das war der Klassenraum, den ich mir auf meinem Stundenplan notiert hatte.
Dort saßen mehr als ein Dutzend Schüler in Dreier- oder Vierergrüppchen zusammen und unterhielten sich so laut, dass ich sie schon vom Gang aus gehört hatte. Als ich den Raum betrat, verstummten die Gespräche. Die Mädchen sahen mich an und wandten schnell den Blick ab, aber ein paar Jungen starrten mich etwas länger an als nötig.
Während ich mich nach einem freien Platz umsah, bemerkte ich, dass einer der Jungs noch immer zu mir hersah: ein großer, schlanker Typ mit dunklen, wachen Augen und gewelltem schwarzen Haar. Unsere Blicke trafen sich und mein Herz machte einen kleinen Satz. Er saß neben einem Jungen, der genauso groß wie er, aber ziemlich massig war; er hatte kurze, helle Haare und seine Nase sah aus, als ob er sie sich schon mal gebrochen hätte. Er blickte mich mit einem sarkastischen Ausdruck in den nur halb geöffneten Augen an und sagte etwas, das ich nicht verstand, worauf sein Freund feuerrot wurde.
Alles in mir schrie, dass sie es gemerkt hatten, dass der Junge mit dem durchdringenden Blick sich zwar sekundenlang von mir angezogen gefühlt hatte, sein Freund aber, der mich durchschaute, sich über ihn lustig machte. Genau das Szenario, das Mädchen wie mir den Todesstoß gab. Ich hatte alles darüber gelesen. Ich wusste, wie oft so was passierte. Ich spürte die Narbe über meinem Ohr und dachte daran, dass ich mich nicht einmal jetzt, nach meiner Operation, nicht einmal jetzt, wo nur noch ein paar Dokumente meine Vergangenheit offenlegen konnten, wirklich sicher fühlen konnte.
Ich blickte auf meinen Schoß und versuchte, mich in Luft aufzulösen.
Cafeteria und Aula befanden sich in ein und demselben Raum. An den runden Tischen hatten maximal fünf bis sechs Leute Platz und die Hälfte davon stand auf der Bühne: eine eindeutig privilegierte Position und nur den Elft- und Zwölftklässlern vorbehalten.
Ich saß an einem der freien Tische oben, schlug den Sandman, einen Comic, auf, den mir meine Freundin Virginia empfohlen hatte, und nahm die am Abend zuvor zubereiteten Sushirollen aus meiner Tasche. Nach einer Weile markierte ich die Stelle, an der ich stehen geblieben war, beugte mich nach unten, um das Heft in die Tasche zu stecken, und als ich wieder aufsah, saß mir gegenüber der schwarzhaarige Junge aus meinem Klassenzimmer.
»Hi«, sagte er. Er war nicht so groß und wuchtig wie sein Freund, die Muskeln an seinen Armen waren eher sehnig und seine Bewegungen anmutig und lässig. »Was dagegen, wenn ich hier sitze?«
»Ja«, sagte ich und merkte dann erst, wie unhöflich ich war. »Ich meine, kein Problem.«
»Sieht mein Freund Parker anders«, erwiderte er.
»Wie?«, sagte ich und verschluckte mich dabei fast an meiner Wasabipaste. »Sorry«, sagte ich hustend. Ich trank einen Schluck Wasser. »Ist scharf.«
»Wo hast du denn in Lambertville Sushi aufgetrieben?« Er deutete auf die Reste meines Mittagessens.
»Hab ich selbst gemacht.« Ich spielte nervös mit den Stäbchen.
»Wow. Ich wusste nicht, dass man Sushi einfach so … machen kann.«
»So schwer ist das gar nicht«, log ich und dachte an die zahllosen Abende, an denen ich an unserem Küchentisch gesessen und mich abgeplagt hatte, damit der Reis richtig klebte. Als die Geschlechtsumwandlung zu belastend für mich geworden war, hatten meine Ärzte darauf bestanden, dass ich eine Auszeit nahm. Am Anfang hatte ich es noch genossen, ein Jahr zu Hause zu bleiben – ich kam mir wie in ausgedehnten Sommerferien vor –, aber nach und nach stellte sich Langweile ein. Mir war, als würde ich mich auf der Stelle bewegen, als würde das Leben da draußen an mir vorbeiziehen und ich für immer in unserem Haus eingesperrt sein, ohne Ziel und ohne Ansprechpartner. Da musste ich etwas finden, womit ich mich beschäftigen konnte.
Er sah mich überrascht an. »Die meisten Familien hier finden es schon abgedreht, wenn sie sich mal italienisches Essen holen und nicht nur immer TexMex. Ich heiße übrigens Grant.«
»Aha.« Ich spürte, wie es in meinem Nacken kribbelte. »Ich bin Amanda.«
»Tut mir leid, dass du an meinem lahmen Witz eben fast erstickt wärst, Amanda«, sagte er. »Sollte eigentlich ein Kompliment sein. Aber davon kriegst du bestimmt mehr als genug.«
»Was willst du denn damit sagen?«
»Na ja, ein Mädchen wie du.«
Ich sah ihn argwöhnisch an. Was meinte er damit, ein Mädchen wie ich? Schlagartig kehrten die alten Ängste zurück. »Verarschst du mich jetzt?«
»Du willst noch mehr Komplimente hören, stimmt’s?« Er schüttelte den Kopf und lachte. »Wenn schon, egal. Hast du heute im Klassenzimmer den Typen neben mir gesehen, den mit der schiefen Nase?« Ich nickte langsam und musste schlucken. »Das ist mein Freund Parker. Er will sich mit dir treffen, aber er ist ein großer Schisser und deshalb frage ich dich jetzt nach deiner Handynummer.«
»Du willst meine Handynummer?« Ich legte die Hände in den Schoß. An meiner Schläfe pochte es. Leute, die aussahen wie Grant, hatten noch nie das Wort an mich gerichtet ohne den Hintergedanken, mich verletzen zu wollen. So viele Jahre lang war ich das Opfer zu vieler dummer Scherze, Streiche und Konfrontationen gewesen. Zigmal war ich auf zig verschiedene Arten fertiggemacht worden. »Für deinen Freund.«
»Ja«, sagte er.
»Mein Dad ist, äh, ziemlich streng.« Ich dachte an Dads Blick, als ihm der alte Mann im Diner sein Gewehr angeboten hatte, um meine potenziellen Verehrer abzuschrecken. Direkt gelogen war es also nicht. Grant runzelte die Stirn, stützte die Ellbogen auf den Tisch und beugte sich nach vorn. Ich hatte das Gefühl, mehr sagen zu müssen. »Es ist etwas kompliziert … ich meine, ich bin kompliziert.« Ich presste die Lippen aufeinander.
»Okay«, sagte Grant völlig entspannt und lehnte sich zurück. Seine dunkelgrauen Augen glitten rasch über mein Gesicht und wir schwiegen beide. Ich sah Neugier in diesen Augen, aber keine Gefahr. Ob ein Junge wie er nachvollziehen konnte, was es bedeutete, wenn man so war wie ich? Was es hieß, die Highschool nur mit eisernem Überlebenswillen durchstehen zu können? Denn genau das war meine bisherige Highschoolzeit für mich gewesen – eine Aneinanderreihung von Tagen, die ich durchstehen, die ich wie Kästchen in einem Kalender abhaken musste. Nach Lambertville war ich mit einem klaren Plan gekommen: Ich würde hier auf Tauchstation gehen und mich ruhig verhalten. Ich würde meinen Abschluss machen. Danach auf ein College wechseln, das möglichst weit entfernt vom Süden lag. Ich würde leben.
»Um eins klarzustellen …« – Grant rieb sich den Nacken – »ich hab Parker gesagt, dass er mehr Chancen hat, wenn er selbst auf dich zugeht. Aber er ist nun mal mein Kumpel, verstehst du? Deshalb musste ich es wenigstens versuchen. Trotzdem ist er ein Idiot und dafür hältst du mich jetzt bestimmt auch.«
»Nein«, sagte ich. Ich begann, meine Sachen zusammenzupacken, und spürte, wie meine Hände dabei zitterten. Ich traute ihm, zumindest wollte ich das gerne, aber meine Ängste hatten sich all die Jahre über tief in mir eingebrannt und weder konnte ich ihnen gut zureden noch sie einfach ignorieren. »Wenn er selbst gekommen wäre, wäre es auch nicht anders gelaufen. Ich – ich kann einfach nicht.«
Über Grants Gesicht huschte ein Ausdruck, den ich nicht genau deuten konnte. Er vergrub die Hände in den Hosentaschen und stand auf. »Na ja, war jedenfalls sehr schön, dich kennenzulernen, Amanda.«
»Gleichfalls«, sagte ich.
Grant hob grüßend die Hand und ging davon. Nach ein paar Schritten blieb er stehen und drehte sich noch einmal um.
»Was liest du da eigentlich?« Er deutete mit dem Kinn zum Tisch.
»Heißt Sandman«, sagte ich und legte schützend meine Hand darüber. »Ist ein Comic.«
»Ist er gut?«
»Ich finde schon.«
»Cool«, sagte Grant, winkte noch mal und wandte sich zum Gehen. Meine Hände hörten auf zu zittern und ich atmete auch wieder ruhiger. Nur mein Herz hörte nicht auf zu rasen, aber darüber wollte ich gar nicht erst nachdenken.
KAPITEL 3
Kunst fand montags und dienstags in der letzten Stunde im Musikgebäude statt, das am Rand des Schulgeländes lag. Draußen schlug mir die sengende Hitze wie eine Ohrfeige ins Gesicht und meine Haut fühlte sich wie geföhnte Plastikfolie an.
»Geh ums Haus rum«, rief eine weibliche Stimme, als ich den Holzbau, der nicht viel größer als ein Schuppen war, erreichte. Ich folgte ihr und sah ein Mädchen, das allein im Gras saß. Sie trug eine ovale Sonnenbrille und knallroten Lippenstift, der sich auffällig von ihrer hellen Haut abhob. Kurze dunkle Borsten bedeckten das mittlere Drittel ihres Kopfes, der Rest war wilde Lockenmähne.
»Kunstkurs?«, fragte sie. Ich nickte und sah mich unsicher um. Sie stützte sich auf ihre Ellbogen. »Die Lehrerin ist nicht gekommen. Sie ist in Nashville. Ihr Sohn hat sich seine Hand bei einem Autounfall ruiniert.«
»Oh Gott.«
»Ja, nicht? Und dabei ist er Musiker. War Musiker, meine ich. He, es ist sauheiß hier draußen und du siehst aus, als ob dich gleich der Schlag trifft. Setz dich doch. Ich bin übrigens Bee.«
»Sollten wir nicht lieber ins Sekretariat gehen und Bescheid sagen?«
»Bloß nicht«, sagte sie schnell. »Die stellen sowieso keine Vertretung ein. Und erst recht keinen neuen Lehrer. Die befördern meinen fetten Arsch nur wieder auf direktem Weg in den Sportkurs, und die ganzen Kunstfördergelder fließen wie immer in den Fachbereich Sport. Ich nutz den Scheiß hier aus, solang es geht.«
Ich nickte zaghaft und setzte mich zu ihr ins Gras. Sie ließ sich auf den Rücken fallen und streckte beide Arme aus.
»Dann bist du wohl die Neue?«
»Ist das so offensichtlich?«, fragte ich und zog die Knie an mich heran.
»Spricht sich doch rum.« Ihre Arme und Beine glänzten vor Schweiß und sie blickte nach oben in den Himmel.
»Klar. Sorry.«
»Musst dich doch nicht entschuldigen«, sagte sie, ohne sich groß zu bewegen.
»Sorry«, sagte ich reflexartig und zuckte zusammen.
»Du hast mir noch gar nicht gesagt, wie du heißt.«
»Amanda«, beeilte ich mich zu sagen. »Schön, dich kennenzulernen.«
»Ja.« Sie kramte in ihrer alten, schon leicht verbeulten Silver Age X-Men-Lunchbox herum und angelte einen Joint heraus. »Stört’s dich, wenn ich rauche?« Sie wartete meine Antwort gar nicht ab. »Und?«, fragte sie und stieß gleichzeitig eine kleine Rauchwolke aus, die wie Mulch nach einem heftigen Regenschauer roch, erdig und ein wenig säuerlich. »Woher kommst du?«
»Aus Smyrna«, sagte ich. »Mein Dad ist nach der Scheidung hierhergezogen.«
»Dads …!«, bemerkte sie. Darauf wusste ich nichts zu sagen, aber das fiel ihr entweder gar nicht auf oder es war ihr egal. »Du bist ziemlich cool, Amanda. Ich glaube, wir beide könnten Freundinnen werden.«
»Weiß nicht, ob ich so cool bin.«
»Schauen wir mal.« Bee nickte und legte den halb gerauchten Joint wieder in die Lunchbox. »Schauen wir einfach mal.« Sie kicherte, legte sich ins Gras zurück und schloss die Augen.
Ich streckte mich neben ihr aus, nahm den Sandman aus dem Rucksack und hielt ihn mir über den Kopf, um mich vor der Sonne zu schützen. Schnell nahm mich die Geschichte gefangen. Während die Menschen auf der Erde in ewigen Schlaf fielen, verlor ich jegliches Zeitgefühl. Dem Lord of Dreams gelang es, aus seiner jahrzehntelangen Gefangenschaft zu entkommen und sich ein neues Leben aufzubauen. Die Sleepers erwachten in fremden Körpern, was daran lag, dass man sie im Zustand ihrer Hilflosigkeit missbraucht hatte. Als der Lord of Dreams schließlich in die Hölle hinabstieg, legte ich das Buch zur Seite. Ich richtete mich auf und spürte die sengende Nachmittagshitze noch intensiver. Ich sah zu Bee hinüber, die sich in tranceartigem Zustand befand, halb schlafend, halb wach. »Wie spät ist es überhaupt?«
»Vier«, sagte sie gähnend.
»Scheiße!« Ich kroch zu meiner Tasche hinüber, um den Comic darin zu verstauen. Dann sprang ich auf, hörte schon, wie sich die Busse laut zischend in Bewegung setzten, und als ich um die Ecke rannte, sah ich, dass sich der Parkplatz nahezu geleert hatte.
»Bus verpasst? Scheiße«, sagte Bee, die mir gefolgt war. »Gibt’s jemanden, den du anrufen kannst?«
»Dad hört erst um sechs auf zu arbeiten.«
»Ich würde dich ja fahren«, sagte sie, »aber ich fahre nie, wenn ich bekifft bin, und das bin ich gerade total.« Sie kicherte.
»Dann muss ich eben zu Fuß gehen.«
»Das würde ich dir nicht raten«, sagte Bee. »Heute hat es 45 Grad. Da herrscht auf dem Highway absolutes Hitzschlag-Risiko.«
»Teenager kriegen doch keinen Hitzschlag, oder? Ich meine, die Leute hier im Süden haben schließlich auch schon vor Erfindung der Klimaanlage überlebt.«
»Deine Sache«, sagte sie und winkte mir träge zu. »Bis demnächst, falls es dich dann noch gibt.«
Der Schweiß lief mir in Strömen den Rücken hinunter, als ich den Seitenstreifen der Autobahn entlanglief. Nach der ersten halben Stunde hatte ich erst zwei von sechs Meilen geschafft, keuchte aber schon und schleppte mich nur mühsam voran. Ich überlegte, ob ich Dad anrufen sollte, wollte ihn aber nicht gleich am ersten Tag belästigen. Ich ging noch eine weitere Meile, aber dann begann mein Knie zu schmerzen und meine nackten Waden, die ich mir an den Brombeerbüschen aufgekratzt hatte, brannten.
Deshalb nahm ich auch kaum wahr, dass ein schwarzes Auto an mir vorbeischoss, plötzlich zurücksetzte und neben mir auf dem Seitenstreifen hielt. Das Fenster wurde heruntergelassen und ein blasses Mädchen mit kurzen dunklen Haaren beugte sich zu mir heraus. »Willst du mitfahren?«
»Nein«, sagte ich nuschelnd, »will niemandem zur Last fallen.«
Das Mädchen drehte sich zu jemandem auf der Rückbank um. »Mir egal, was sie sagt, Chloe, schaff sie einfach hier rein, bevor sie uns aus den Latschen kippt.«
Ein Mädchen mit rotem Lockenkopf und Sommersprossen stieg aus und blinzelte gequält in die blendende Sonne. Sie trug ein kariertes Arbeitshemd mit aufgerollten Ärmeln, das über der Brust aufgeknöpft war. Wortlos nahm sie mich am Arm und führte mich zur Rückbank des Wagens.
»Wirklich, es geht schon«, sagte ich kraftlos and schloss die Augen, als mir ein Schwall kalter Luft aus der Aircondition ins Gesicht blies. »Hoffe, ihr Mädels seid keine Kidnapper.«
»Wir entführen dich doch nicht«, sagte ein zierliches, blondes Mädchen mit Unschuldsaugen, das vorne auf dem Beifahrersitz saß. Sie runzelte besorgt die Stirn.
»Die wird schon wieder«, sagte das Mädchen am Steuer, als wir auf die Straße zurückfuhren. »Gebt ihr mal was zu trinken.«
»Ich bin Anna«, sagte die kleine Blonde. Ich öffnete ein Auge und sah, wie sie mir begeistert zuwinkte. »In welche Kirche gehst du?«
»Beachte sie gar nicht«, sagte die Fahrerin. »Das fragt sie jeden, den sie kennenlernt. Ich heiße Layla. Die mit den Sommersprossen ist Chloe.«
Das rothaarige Mädchen nickte, legte ihren Sicherheitsgurt an und sagte: »Hi.«
Anna ließ sich nicht beirren. »Der Glaube eines Menschen sagt viel über ihn aus. Und er ist immer ein gutes Einstiegsthema.«
»Ehrlich gesagt gehe ich nicht mehr in die Kirche.« Mein schlechtes Gewissen rührte sich, wenn ich daran dachte, wie lange schon nicht mehr, obwohl ich immer hoffte, dass Gott meine Gründe dafür verstand. »Aber früher bin ich in die Calvary Baptist gegangen.«
Anna klatschte in die Hände und hopste wie ein Kind auf ihrem Sitz herum. »Sie ist Baptistin!«, rief sie beglückt. Die beiden anderen Mädchen verdrehten die Augen.
»Wer in dieser Stadt ist denn bitte schön kein Baptist?«, schnaubte Layla. »Vielmehr in diesem ganzen gottverdammten Süden?«
»Ich kenne durchaus ein paar Lutheraner«, protestierte Anna und straffte die Schultern.
»Hier.« Chloe reichte mir eine Wasserflasche aus ihrem Rucksack. Ich brachte ein krächzendes Danke zustande, schüttete die halbe Flasche in mich hinein und vergoss dabei Wasser über Kinn und Hemd.
Layla drehte sich zu mir um. »Hast du Hunger?«, fragte sie. »Ich wette, sie ist hungrig. Lasst uns was essen gehen.«
Über einem Restaurant mit Chromfassade im Stil der Fünfzigerjahre hing ein Schild, auf dem in grellen Neonfarben HUNGRYDAN’S stand. Als wir aus dem Auto stiegen, sah ich mir Layla und Anna genauer an. Layla war genauso groß wie ich, hatte schwarze Haare und eine Haut wie Samt. Anna ging Chloe kaum bis zur Schulter und hatte lange, glänzend blonde Haare, die bis zum Saum ihres roten Bibelcamp-T-Shirts reichten.
Im Diner hingen gerahmte Poster von Grease und … denn sie wissen nicht, was sie tun an schwarzen Wänden und auf den Tischen lagen Speisekarten mit rissigem, gefaktem Ledereinband und Gedecke aus Plastik.
Während die Bedienung unsere Bestellungen entgegennahm, checkte ich mein Handy und stellte fest, dass der Akku leer war. Ich wollte gerade fragen, ob eines der Mädchen mir ihres leihen könne, damit ich Dad schreiben konnte, dass es später würde, zögerte aber. Vielleicht schaffte ich es ja noch, bevor er von der Arbeit zurück war, und ich wollte ihm nicht sagen, dass ich schon an meinem ersten Schultag den Bus verpasst hatte.
»Übrigens«, sagte Layla mit feierlicher Miene, »am Donnerstag haben wir ein Footballspiel in der Schule.« Sie sah mich an. »Da kommst du doch auch, oder?«
»Oh ja!«, fiel Anna ein.
»Ich hab’s nicht so mit Sport«, erwiderte ich achselzuckend.
»Aber unser bester Linebacker steht auf dich.« Layla lächelte anzüglich.
»Wer?«
»Parker«, sagte Chloe. »Kennst du ihn schon?«
»Klar kennt sie ihn«, sagte Layla und hob vielsagend die Augenbrauen.
»Tu ich nicht …«, stammelte ich.
»Dumm stellen bringt nichts«, sagte Layla, die eine Pommes wie eine Zigarette zwischen ihren Fingern hielt. »Parker und Grant sitzen in Biologie neben mir. Ich hab sie darüber reden hören, wie du Grant abgeschossen hast.«
Meine Wangen fingen an zu glühen, als ich an Grants entspanntes Lächeln dachte. »Aber so war es gar nicht.« Ich schüttelte den Kopf und überlegte schnell, wie ich reagiert hätte, wenn Grant sich mit mir hätte verabreden wollen.
»Jetzt lasst sie doch mal in Ruhe«, sagte Anna. »Wie ist es dir denn bisher so in Lambertville ergangen? Sind alle nett zu dir?«
»Ganz okay soweit«, sagte ich. »Aber ich habe auch erst fünf Leute kennnengelernt, Grant und euch Mädels inbegriffen.«
Anna lächelte. »Und wer ist Nummer fünf?«
»Sie heißt Bee. Wir haben Kunst zusammen.«
Die Mädchen wechselten einen raschen Blick.
»Wieso, stimmt was nicht mit ihr?«
»Nein«, sagte Chloe.
»In homöopathischen Dosen ist sie ganz witzig«, sagte Layla. »Mit Betonung auf homöopathisch.«
Ich schlürfte den Bodensatz unter meinem Eis mit dem Strohhalm auf und wusste nicht recht, was ich sagen sollte.
»Mein Gott, ich bin so eine Zicke«, sagte Layla kurz darauf. »Du hängst natürlich ab, mit wem du willst. Wir haben uns ja gerade erst kennengelernt. Bei uns bist du jedenfalls immer willkommen.«
Als die Kellnerin die Rechnung brachte, wollten sie mich nicht zahlen lassen. Ich griff automatisch auf den alten Südstaatenbrauch zurück, den ich jahrelang bei Mom beobachtet hatte, ohne groß darüber nachzudenken: Du bietest an, für dich selbst zu zahlen, die anderen lehnen ab, du holst dein Geld raus und bestehst darauf, die anderen lehnen wieder ab; dann gibst du nach. Wäre schön, wenn jede Art sozialer Interaktion so klare Regeln hätte, dachte ich.
Zwanzig Minuten später hielten wir vor unserem Apartmentblock, einem fantasielosen Backsteinkasten mit hohem, von Kudzupflanzen überwuchertem Dachfirst.
»Dann kommst du also zum Spiel, oder?«, fragte Anna.
Die Zikaden zirpten hartnäckig in der zunehmenden Dämmerung. Ich hatte mal gelesen, dass sie fast ihr ganzes Dasein lang unter der Erde lebten und erst zum Vorschein kamen, wenn sie schon ausgewachsen waren, um ihre letzten Tage an der Oberfläche zu verbringen. Ob ich das gleiche Schicksal haben würde? Und den größten Teil meines Lebens im Untergrund verbringen musste, mich nie in der Welt zeigen konnte?
Der Motor lief und alle sahen mich erwartungsvoll an. Endlich sagte ich: »Ich sehe euch dann dort.«
Layla hupte vergnügt und sie fuhren davon.
Als sie hinter der Kurve verschwunden waren, stand ich allein auf dem glühend heißen Parkplatz. Es war weit nach sechs und Dad musste schon seit geraumer Zeit zu Hause sein und sich fragen, wo ich steckte und wieso er mich nicht erreichen konnte. Am liebsten wäre ich der Situation, die mich in der Wohnung erwartete, aus dem Weg gegangen; wäre bis Mitternacht in der Gegend herumgelaufen und hätte mich erst reingeschlichen, wenn er eingeschlafen war, aber selbst in der Abenddämmerung war die Hitze noch unerträglich.
Ich ging also die Treppe nach oben, schloss die Tür auf und betrat die Wohnung. Durch einen Spalt in der Balkonjalousie fiel ein einzelner Sonnenstrahl quer durchs Wohnzimmer und in seinem goldenen Meer sah ich rote Staubpartikelchen tanzen.
Dad trat ins Licht. »Wo bist du gewesen?«, fragte er schneidend.
»Tut mir leid«, erwiderte ich leise.
»Tut mir leid ist kein Ort.«
»Ich war mit ein paar Leuten unterwegs«, sagte ich und senkte den Blick. »Ich hatte den Bus verpasst.«
»Als ich nach Hause kam und du warst nicht da, habe ich immer wieder versucht, dich zu erreichen. Ich habe mir furchtbare Sorgen gemacht.«
Ich wollte ihm antworten, aber meine Kehle war wie zugeschnürt und ich musste erst mal Luft holen. »Du hast dir doch noch nie Sorgen um mich gemacht.« Ich dachte daran, wie die Krankenschwestern, Mom und der Fernseher meine einzige Gesellschaft gewesen waren – keine Freunde, keine Familie, kein Dad. Und daran, wie mir damals zum ersten Mal der Verdacht kam, dass es ihm vielleicht egal war, ob ich lebte oder starb.
Ich ballte die Fäuste und sah ihn an. »Du hast mir nie geschrieben. Ich wäre fast gestorben, aber du bist für mich wie ein Geist gewesen.«
»Was hätte ich denn auch sagen sollen?«
»Irgendwas.«
Er gab einen langen, tiefen Seufzer von sich.
»Ich wusste einfach nicht, wie ich mich verhalten sollte«, sagte er und rieb sich die Stirn. »Verstehst du, da hältst du dein Baby in den Armen, wenn es seinen ersten Atemzug tut, singst es in den Schlaf, wiegst es, wenn es schreit, und kaum siehst du mal eine Sekunde weg – denn so kommt es dir vor –, da will es plötzlich nicht mehr leben. Du bist doch mein Kind.«
»Ich bin deine Tochter«, flüsterte ich. »Und dazu fällt dir auch nichts ein.« Das dumpfe Zischen eines Sattelschleppers, der draußen auf der Schnellstraße vorbeifuhr, drang laut durch die Stille. »Tut mir leid, wenn du dir Sorgen um mich gemacht hast. Soll nicht wieder vorkommen.« Ich ging an ihm vorbei in mein Zimmer und schloss die Tür.
Das Büro des Therapeuten war in dem umfunktionierten Herrenzimmer einer alten Villa in einem der Stadtviertel untergebracht, die man nach dem Bürgerkrieg als erste wieder aufgebaut hatte. Es roch nach altem Holz und die Böden knarzten von dem Gewicht eines ganzen Jahrhunderts. Ein altmodischer Röhrenfernseher stand auf einem Rollwagen in der Öffnung eines riesigen Kamins. Auf den fein verzierten Regalen, die einst für ledergebundene Bücher entworfen worden waren, reihten sich Titel wie Ich bin o.k. – Du bist o.k. oder Kein Trauma muss für immer sein. Draußen vor der Tür tickte eine Standuhr vor sich hin.
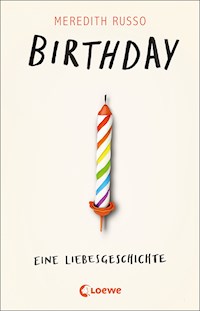













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)














