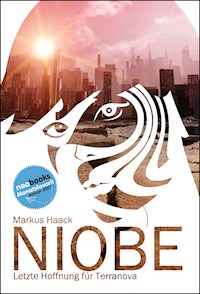2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In unserem ersten Sommer zu zweit malten wir unsere Zukunft in leuchtenden Farben an den Himmel. Ich war glücklich. Kindheitstraumata und Mutterkomplexe schienen nur noch in der Vergangenheit zu existieren. Dann wurdest du schwanger und unser Sommernachtstraum endete jäh. In einer neuen Realität aus Armut und Not verlor ich den Boden unter den Füßen. Angst war das Gefühl, das alles verschlang. Als du mich brauchtest, war ich nicht für dich da. Wir drifteten auseinander und das, was wir uns geschaffen hatten, drohte zu zerbrechen. Dann trat ich den Weg an, mich wiederzufinden und unsere Beziehung zu retten. "Es ist, glaube ich, gar nicht mal die Angst davor, dass wirklich etwas passiert. Es ist mehr die Angst vor der Angst an sich." Das sagte ich, ohne zu ahnen, wie sehr eben diese Angst in meinem Leben später an Gewicht gewinnen würde.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 230
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Markus Haack
Als ich mich verlor
© 2019 Markus Haack
Umschlag, Illustration: Markus Haack
Lektorat: Mentorium
Bildlizenz für Umschlagillustration:
fotolia_107312635 jakkapan
Verlag & Druck: tredition GmbH,
Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
978-3-7497-8811-8 (Paperback)
978-3-7497-8812-5 (Hardcover)
978-3-7497-8813-2 (e-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Davor
Ich kam zum ersten Mal in diese kleine Buchhandlung, die in einer Seitenstraße oder mehr einer Seitengasse entlang der Mauer des Schlosses lag. Man übersieht sie leicht, wenn man nur von einem Ort zum nächsten hastet, ohne aufzusehen. Wäre ich an diesem Tag nicht in der Laune gewesen, im Schlendergang ziellos umherzustreifen, dann wäre ich an der Gasse achtlos vorbeigegangen.
Ich betrat das Ladenlokal und meine Augen mussten sich erst an das Dämmerlicht gewöhnen. Dann sah ich Dich zum ersten Mal. Du sprachst mit einem älteren Herrn, dem seine vielen Gebrechen leicht anzusehen waren. Sein Stand wirkte instabil, er musste sich an einem der Bücherregale abstützen.
„Kann ich Ihnen etwas zeigen?“, fragtest du ihn.
„Ich suche das Lissabonner Requiem von Antonio Tabucchi“, sagte der Herr und stützte sich auf einen Spazierstock, als könnte ihn ein Wind erfassen, der in den Ecken der Buchhandlung auf ihn lauerte.
„Da haben Sie einen ausgezeichneten Literaturgeschmack, mein Herr. Das Lissabonner Requiem zu lesen, ist wie Träumen mit offenen Augen. Ich hole es Ihnen.“ Dann gingst du in einem der Gänge zwischen deckenhohen Regalen auf die Suche. Die Bücher standen nicht in einer Ordnung, die sich mir auf Anhieb erschloss. Der Dreh- und Angelpunkt der Buchhandlung warst du. Du hattest eine Landkarte im Kopf, auf der jedes Buch verzeichnet war. Du wolltest den Kunden wie in Seenot Geratenen helfen, aber du fordertest dafür auch etwas von ihnen. Du liebtest Geschichten mehr als alles andere und erfuhrst von fast jedem Kunden Dinge aus seinem Leben, während du ihn aus den Buchstabenfluten bargst und in einen sicheren Hafen geleitetest. Auf das Stichwort fin de siècle wärst du von deinem Platz an der Kasse zwei Meter geradeaus, einen Meter nach links und dann fünf Meter entlang all der Bücher gelaufen, die darauf warteten, entdeckt zu werden und einen Wirt zu finden, der ihre Geschichte in sich aufnahm. Sei es Marguerite Duras, Ernest Hemingway, Novalis oder Thackerey, du hättest sofort die Koordinaten gewusst.
„Hier habe ich ihr Buch. Kennen Sie denn auch Nachtzug nach Lissabon? Das dürfte Ihnen auch gefallen“, sagtest du.
Der ältere Herr nickte. „Ja, das kenne ich. Ich habe es gelesen, als ich tatsächlich im Zug nach Lissabon gesessen habe. Ich kam von Madrid, wo ich meine Nichte besucht habe“, antwortete er.
Ich stand noch immer im Eingang und sah dich unverwandt an. Irgendwie erschienst du mir vertraut, obwohl wir uns wahrscheinlich nie zuvor begegnet waren.
„Wie alt ist ihre Nichte?“, fragtest du.
Der Herr wurde redseliger. Er schien glücklich, ein offenes Ohr gefunden zu haben. „Sie wird in diesem Jahr 18. Wenn ich sie nur öfter sehen könnte. Ich komme nur einmal im Jahr dorthin und immer hat sie wieder neue Ideen und, wenn ich das als ihr Onkel sagen darf, sie sieht so hübsch aus. Wenn ich ein junger Mann wäre und nicht ihr Onkel, dann würde ich mich sofort in sie verlieben. Meine Marina, sie hat einen Kopf mit vielen Locken darauf und vielen Flausen darin. Sie lacht so viel und sie hat so einen Hunger auf das Leben, dass man sie eher bremsen muss. Manchmal habe ich aber das Gefühl, dass sie nicht weiß, in welche Richtung sie einmal gehen möchte. Sie fängt so vieles an, möchte dann aber schnell zum nächsten weiter, wenn sie wieder etwas gesehen hat, das sie interessiert“, erzählte der Herr und wurde mit jedem Wort lebhafter.
„Marina ist ein schöner Name. Da habe ich noch etwas für sie. Sie müssen unbedingt den Roman von Carlos Ruiz Zafón lesen. Der heißt wie ihre Nichte Marina und ich könnte mir vorstellen, dass Ihnen diese Marina auch gefallen wird. Außerdem glaube ich, dass sie darin den Wechsel zwischen Traum und Wirklichkeit finden, den Sie auch am Lissabonner Requiem mögen werden“, sagtest du.
Ich bewunderte dich vom ersten Tag an dafür, wie du Menschen glücklich machen konntest. Menschen, die als graue, frustbeladene Gestalten den Laden betraten, verließen ihn mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Ich lernte so vieles von dir und ich hatte mich nicht nur in dich verliebt, sondern auch in deinen Beruf.
Einmal sagtest du zu mir: „Du kannst einem Menschen kein größeres Geschenk geben als dein Gehör. Werfe ihm dann nur einen kleinen Brocken Leben hin und sehe dabei zu, wie er sich darauf stürzt.“ Das sollte ich nie vergessen. Wie es dann dazu kam, dass ich dein Auszubildender wurde, möchte ich als nächstes erzählen.
*
Ich war ja gerade erst 18 geworden und hatte nach dem Abitur keine Idee, was aus mir werden sollte. Ich lebte noch bei meinen Eltern und genoss noch immer die Vorzüge des Einzelkind-Daseins. Mein Zimmer war eine kleine Dachkammer in einem stattlichen Gründerzeithaus. Ich lebte gerne dort und, was mich ebenfalls dort festhielt, ich hatte Angst davor, in das Erwachsenenleben aufzubrechen, was auch immer das ist. Ich hatte keine genaue Vorstellung davon und wusste nur, dass es damit zu tun hatte, mehr Verantwortung für sich selbst zu übernehmen.
Was meinen Berufswunsch anbelangte, so wusste ich nur, dass ich nicht so werden wollte wie mein Vater. Sein beruflicher Erfolg kannte keine Grenzen, aber ich bildete mir ein, hinter die Fassade blicken zu können, hinter der ich nichts sah als seinen Egozentrismus. Heute weiß ich, dass mein Urteil über ihn, wenn nicht gar falsch, so doch zu hart gewesen ist. Ich war immer sehr parteiisch und hatte zu meiner Mutter gehalten, die mir ihre Sicht auf den Mann, den sie als Wurzel all ihres Leids sah, übergestülpt hatte. Dass sie dabei mehr unter sich selbst und ihren Dämonen litt, verstand ich damals nicht. Verübeln könnte ich dabei meinem Vater nur, dass er es ebenso wenig verstand, aber das hätte keinen Sinn, da er nun mal auch nicht aus seiner Haut herauskonnte.
Ich wusste und verstand damals nicht viel. Besonders wusste ich in allen Belangen des Erwachsenwerdens immer nur, was ich alles nicht wollte. Als ich dich am Tag zuvor in der Buchhandlung gesehen hatte, war es anders gewesen. Ich hatte etwas gespürt, ja vielleicht hatte ich mich selbst gespürt und wusste zum ersten Mal in ganz groben, noch schemenhaften Zügen, was ich wollte und vor allem, wer ich werden wollte. Das war mir damals so noch nicht klar gewesen, aber in der Rückschau erscheint es mir so. Ich dachte damals bloß, dass ich gerne las und dass ich dir, obwohl ich dich ja noch gar nicht wirklich kannte, unbedingt gerne nah sein wollte. Also nahm ich meinen besten Mantel, die Aktentasche meines Vaters und ging einfach wieder zu dir in den Laden und habe mir dabei, was ich dir nie erzählt habe, fast in die Hose gemacht, so viel Angst hatte ich. Ich kam herein, lief auf dich zu und bat einfach um einen Ausbildungsplatz, als ginge es um ein Taschentuch oder um irgendeine Kleinigkeit. Ich hatte es getan, ohne mit meinen Eltern zuvor darüber gesprochen zu haben. Ich wusste, dass ich von meinem Vater bloß eine gewaltige Standpauke zu erwarten hatte, dass ich all mein Potenzial, ja mein ganzes Leben achtlos wegwerfen würde. Meine Mutter würde nichts sagen, vielleicht würde sie es sogar verstehen, weil sie selbst als junge Frau einer romantischen Vorstellung von Liebe hinterhergerannt ist, die im Laufe ihres Lebens immer mehr in großer Enttäuschung aufgegangen ist. Es war mir in diesem Augenblick alles egal. Ich wusste seit langem zum ersten Mal, was ich tun musste.
Als ich vor dir stand, war ich trotzdem so unsicher, dass du dir ein furchtbares Stammeln anhören musstest. Als ich dann dastand und nicht wusste, was ich nach meiner Bitte noch sagen sollte, sagtest du, ich solle den Laden verlassen und erst dann wieder betreten, wenn ich wüsste, weshalb ich Buchhändler werden will und dazu noch in einer Literaturhandlung wie dieser. Ich fragte mich damals, warum du so streng warst und gab die Vorstellung, Buchhändler zu werden, beinahe wieder auf, so sehr fühlte ich mich verletzt davon, von dir zurückgewiesen worden zu sein. Die Angst vor dieser Zurückweisung sollte noch lange in mir nachwirken und verhindern, dass ich dir mein Herz offenbarte. Heute kann ich deine Reaktion aber gut nachvollziehen. Ich war allzu unbedarft und blauäugig an die Sache herangegangen.
Ich traute mich an diesem Tag nicht erneut, den Laden zu betreten. Auch am nächsten Tag überwand ich meine Angst nicht. Erst zwei Wochen später sollte mir etwas einfallen, was ich dir sagen konnte. Als ich dann wieder zu dir ging, stand ich mit erhobenem Kopf vor dir. In mir war ein Erdbeben, mein Herz raste und meine Knie zitterten, aber ich wusste, was ich wollte und das gab mir diesmal die nötige Kraft.
Ich weiß nicht mehr genau jedes Wort, das ich dir gesagt habe, aber es muss etwa so gelautet haben: „Ich will Geschichten verkaufen, die Menschen auf der Seele brannten, als sie sie niederschrieben. Ich will Buchhändler werden, weil ich Menschen glücklich machen möchte, indem ich ihnen das gebe, woraus sie ihre Träume, Ideen und Sehnsüchte gewinnen. Ich will in keiner Welt ohne Bücher leben, denn gute Bücher sind das, was die Menschen aufklärt und was sie zu humanen Wesen werden lässt. Solche Bücher will ich verkaufen.“ Nachdem ich geendet hatte, bliebst du zunächst still.
Dann begannst du zu lachen. Ich weiß nicht, ob du mich ausgelacht hast oder, ob du aus Freude gelacht hast, mich wiederzusehen und meine Entschlossenheit zu spüren. Wahrscheinlich war es eine Mischung aus beidem.
„Wie heißt Du?“, fragtest du und es fühlte sich für mich kurz schon so an, als hätte ich dein Herz erobert. Ich bemühte mich, meinen Blick aufrecht zu halten und dir in die Augen zu sehen, als ich meinen Namen nannte. Menschen in die Augen zu blicken, war mir als Kind sehr schwer und als Jugendlicher noch immer schwer gefallen. In der Lage, in der ich mich nun befand, fühlte ich mich wie ein Kind, dass etwas Unerhörtes zu einer erwachsenen Frau gesagt hat.
„Dann freue ich mich, Dich als neuen Auszubildenden begrüßen zu dürfen.“
Du lachtest erneut und ich sah in dein Gesicht und fühlte mich der Ohnmacht nahe.
*
Ich war in meinem ersten Ausbildungsjahr und erwog es nicht, aus der Dachkammer in der feudalen elterlichen Stadtwohnung auszuziehen. Diese Kammer war seit ich denken konnte mein Rückzugsort gewesen, der Ort, an dem ich ganz frei war, zu sein, wer immer ich sein wollte. Hier hatte ich in meiner Kindheit die ersten Bücher gelesen, meine ersten sexuellen Empfindungen gehabt, von einer Mitschülerin fantasierend, und hier hatte ich mich ausgeweint nach den heftigen Auseinandersetzungen mit meinem Vater, die während meiner Pubertät beinahe an der Tagesordnung gewesen waren. Das Zimmer hatte sich mit mir zu dem gewandelt, was es jetzt war. Vom Kinderzimmer mit bunten Bildern vom Sandmann und verpönt westlichen Mickymaus-Zeichnungen, hin zum Jugendzimmer mit Postern von Gothic-Bands und dann zum Zimmer eines jungen, romantisch verklärten Erwachsenen, ringsherum mit Bücherregalen, einem Schreibtisch, einem Computer und einigen Kunstdrucken von Arnold Böcklin, Caspar David Friedrich und Edgar Degas. Das Zimmer lag unter dem Dach eines Hauses, das der Besitzer einer Großdruckerei in der Aufbruchsstimmung der Gründerzeitjahre hatte bauen lassen und dessen beiden Obergeschosse meinen Eltern gehörten. Es hatte Bordüren, Friese und Gesimse und die hohen Fensterkreuze schauten aus Erkern auf das Kopfsteinpflaster der Straße.
Vor dem kleinen Dachfenster konnte ich nicht aufrecht stehen, da es in die Dachschräge eingefasst war. Der Ausblick ging über schwarze Schindeln und eine Regenrinne aus rotgoldenem Kupfer hinweg zur Orangerie des Schlösschens. Mir gefiel die kleine Kammer noch immer und ich verbrachte Stunden lesend und schreibend an meinem Pult. Das Gurren der Tauben hörte ich nicht mehr, wenn in meinem Kopf die Stimmen von Dumas, Dürrenmatt, Gogol, Sartre oder Grass laut wurden. Ich las alles, was mir an solcher Literatur mit ihren schweren Gedanken in die Hände fiel und begann eine Abscheu für den plumpen, unbedachten Umgang mit Sprache zu entwickeln. Literatur musste mich in Brand setzen und wenn ich an durchlesene Wochenenden mit Sartre zurückdenke, dann sehe ich, wie sehr mein Leben manchmal einem Fiebertraum geglichen hat. Ich suchte keinen Schutz vor Ideen, die den Boden vor mir aufrissen.
An manchen Tagen in den heißen Sommermonaten des folgenden Jahres hast du mich losgeschickt, um Eis für uns beide von dem Eiscafé zu holen, das in dem Glaspavillon am Waldrand lag. Der Bau mit seinen gusseisernen Verschlägen war wie ein Relikt aus dem fin de siècle. Ich freute mich schon am Morgen besonders heißer Tage darauf, weil die Arbeit kurz in den Hintergrund trat und du so zitronenfarbenleicht und mädchenhaft wirktest, wenn du Eis mit mir gegessen hast. Beim Eis warst du kurz ganz bei mir. Du sprachst meistens über Literatur, manchmal aber auch über Orte, die du gerne sehen wolltest. „Später einmal“, sagtest du dann immer. Wenn ich dich fragte, wann das sein möge, lächeltest du nur und sagtest, dass die Zeit dafür schon kommen würde. Wenn ich erwiderte, dass ich dich dann gerne begleiten würde, lachtest du und gabst zur Antwort “Wir beide, ja, schön wäre das, aber wer passt dann auf die Bücher auf?“ Ich weiß nicht, ob du mich zu dem Zeitpunkt schon insgeheim liebtest und dir hättest vorstellen können, später wirklich mit mir zu verreisen, aber ich klammerte mich an der Vorstellung fest, dass es so wäre. Ich hatte noch eine lange Ausbildungszeit vor mir und wollte nichts überstürzen, auch aus Angst, du könntest meine Liebe nicht erwidern.
Nur selten habe ich dich während meiner Ausbildungszeit nachdenklich erlebt und über dein Innerstes sprechen gehört. Einmal sagtest du etwas, das mir nicht mehr aus dem Kopf ging: „Ich wünschte, es käme noch einmal ein Kindheitssommer. Die Zeit draußen zu verbringen, Blumen zu pflücken und daraus Kränze zu flechten. Die einfältigen Spinnereien und die Rollenspiele, in denen das vorweggenommen wird, was die Erwachsenen tun.“ Ich ahnte in dem Augenblick, dass eine Schwermut auch dich manchmal heimsuchte.
*
Mein Weg zur Arbeit führte mich vorbei an gründerzeitlichen Stadtvillen und Pavillons. Ich lief durch den Park, am Zooschaufenster entlang. Zooschaufenster wurde ein Platz inmitten des Parks genannt, von dem aus die künstliche Savannenlandschaft, bevölkert von Giraffen und Antilopen, einzusehen war. Ich gelangte in das Waldstraßenviertel, wo die Literaturhandlung Lysander seit einhundert Jahren „wohlfeile Bücher“ verkaufte. So stand es auf dem Schild über dem Eingang geschrieben.
Jeder Tag spülte neue Schiffbrüchige an, denen wir nun gemeinsam rettende Hände boten. Für mich begannen die Tage damit, dass ich entlang der hohen Regalreihen lief und prüfte, wo Lücken entstanden waren, die wieder befüllt werden mussten. Täglich führte mein Weg auch ins Lager, einem schummrigen Raum in den Katakomben der Buchhandlung. Jede richtige Buchhandlung hat ihre Katakomben. In unserer Katakombe wartete auf engsten Raum der Nachschub für die Titel, die niemals ausgehen durften, weil du sie mehr als alles andere in deinem Herzen eingeschlossen hattest. Manchmal ging diese Liebe sogar so weit, dass sie in mir Eifersucht wachrief. Ich wusste, dass diese Regung unsinnig war, weil ich keinen Anspruch auf dich hatte und das Gefühl, dich zu lieben, oft noch einer diffusen Verwirrtheit glich, die sich nie richtig wirklich anfühlte.
Im ersten Lehrjahr erlaubtest du mir manchmal für eine Stunde am Tag, die Buchhandlung zu übernehmen. Ich war stolz. Während der Zeit arbeitetest du an den Verlagsvorschauen oder last in den Neuerwerbungen, ohne mich dabei aus den Augen zu verlieren. Im zweiten Lehrjahr waren es dann oft drei oder vier Stunden am Tag, währenddessen du in den Stapeln der Verlagsvorschauen so lange siebtest, bis nur wenige Juwelen in den Frühjahrs- und Herbstprogrammen übrig geblieben waren. In diesen Stunden versuchte ich, dir ebenbürtig zu werden und dadurch auf dich zu wirken. Manchmal gelang mir dies sogar.
*
Ich hatte bislang niemanden von meiner Liebe zu dir erzählt und unerfüllte Liebe hat bisweilen die Tendenz, zur Obsession zu werden und eine Obsession kann sehr quälend sein, wenn sie zum Schlafräuber wird, den freien Fluss der Gedanken blockiert und ein schmerzendes Druckgefühl in der Brust erzeugt. Ich spürte, dass es mir nicht gut tat, diese Last alleine zu tragen und mich mit niemanden darüber austauschen zu können. Da ich seit dem Ende der Schulzeit sehr wenig dafür getan hatte, mir meine Freundschaften zu erhalten, erschien mir niemand außerhalb der Familie für ein offenes Gespräch über meine Leidenschaft geeignet. Daher wandte ich mich an meine Mutter. Bei meinem Vater war das Unverständnis dafür, dass ich nicht studierte, so groß, dass es nichts genutzt hätte, mit ihm darüber zu reden. Ich fürchtete, dass er mich nur noch weniger würde verstehen können, wenn ich ihm offenbarte, dass es die Liebe war, die mich, nach seiner Auffassung, in mein Unglück laufen ließe. Er hatte einmal in einem Moment der Schwäche zugegeben, er wüsste gar nicht, was Liebe überhaupt sei und er habe nie so etwas empfunden. Dass jemand seinen beruflichen Ehrgeiz für so etwas wie die Liebe hintenanstellt, wäre für ihn unbegreiflich.
Ich trug den Gedanken, mit meiner Mutter darüber zu sprechen, eine Weile mit mir herum, wartete aber mit der Aussprache so lange, bis mein Leidensdruck so groß geworden war, dass ich meinte, ihn nicht mehr ertragen zu können. Als ich mich damals für den Schritt entschieden hatte, die Ausbildung ohne Einwilligung meiner Eltern zu beginnen, war dies für mich auch eine Form des Triumphs gewesen. Ich hatte mich zum ersten Mal erwachsen gefühlt, wenn auch nur kurz, da mich die vertraute Unsicherheit ob meines Handelns schnell wieder eingeholt hatte. Ich muss zugeben, dass ich zu der Zeit noch ein verwöhntes Muttersöhnchen war und es ein Novum darstellte, dass ich eine Weiche für mein Leben ohne das Zutun meiner Eltern gestellt hatte. Seither hatte ich aber immer förmlich das Verlangen danach gespürt, meiner Mutter alles zu erzählen. Gleichzeitig wusste ich, dass mein Verhältnis zur Mutter für meine Psyche sehr ungesund war. Wir waren schon seit dem Ausklang meiner Pubertät so vertraut miteinander gewesen und hatten selbst intime Details über unser Gefühlsleben ausgetauscht. Meine Mutter war früh dazu übergegangen, mir Dinge anzuvertrauen, die das Mutter-Sohn-Verhältnis in seinem natürlichen Gefälle empfindlich störten. Als Kind war ich immer in die Falle getappt, mich von so viel Vertraulichkeit geschmeichelt zu fühlen, ohne dabei zu verstehen, wie sehr meine Mutter ihre Depressionen, ihr unerfülltes sexuelles Verlangen und ihre Unfähigkeit, sich selbst zu akzeptieren, auf mich ausgeweitet hat. Ich war zu klein, um diese Last tragen zu können. Vielleicht hat sie damit viel zu dem psychischen Ungleichgewicht beigetragen, in das mich der Umstand, mich nie ganz abgenabelt zu haben und somit unreif zu sein für das Erwachsenenleben, einige Jahre später getrieben hat. Aber, ich möchte nicht vorausgreifen. An dem Tag, an dem ich beschloss, meiner Mutter alles zu erzählen, war dies zwar eine Niederlage in eben diesem Abnabelungsprozess, aber es war auch eine Befreiung von einer Last, die ich seither mit mir herumgetragen hatte. Sie hatte gespürt, dass ich ihr etwas verheimlichte und das, da es für sie ein neues Gefühl gewesen sein musste, hatte bereits genügt, um unser Verhältnis zueinander zu stören. Die Spannung zwischen uns zeigte sich nicht offen und wäre von einem Außenstehenden unbemerkt geblieben. Ich spürte aber deutlich, dass meine Mutter nicht bloß irritiert gewesen war über meinen plötzlichen Berufswunsch, sondern seither zu ergründen versuchte, was mich tatsächlich dazu bewogen hatte.
Ich wollte nicht zwischen Tür und Angel mit ihr darüber sprechen und nahm mir daher vor, bis zum nächsten Samstag damit zu warten, wenn wir beide die Zeit und Muße dazu hätten. Ich fand meine Mutter an dem Ort vor, an dem sie meistens anzutreffen war. Sie saß am Küchentisch und löste Kreuzworträtsel.
„Ein anderes Wort für Schwermut?“, fragte sie, während sie den Blick weiterhin auf die Zeitschrift richtete, als ich eintrat. „Melancholie?“
„Danke, das wird es sein. Guten Morgen.“
„Guten Morgen“, sagte ich und setzte mich zu ihr an den Tisch. Die Sonne tauchte die Küche in ein gleißendes Licht. Mit ihrem nostalgischen Kachelofen, der hölzernen Kassettendecke und dem rustikalen Steinfußboden hatte mir dieser Raum immer sehr gefallen.
„Wo wir schon beim Thema sind, ich möchte etwas mit dir besprechen.“
Meine Mutter schob die Zeitschrift ein Stück von sich weg. „Oh, geht es um deinen Job?“
„Wie kommst du darauf?“
„Naja, ich hatte in letzter Zeit den Eindruck, dass du mit deiner Entscheidung, die damals nicht nur deinem Vater etwas übereilt erschien, nicht mehr so glücklich warst.“
Wenn du damals dem Gespräch hättest lauschen können, dann hättest du wahrscheinlich lachen müssen über die umständliche Art, mit der ich versucht habe, meiner Mutter die einfache Botschaft zu vermitteln, dass ich dich liebe, anstatt einfach in medias res zu gehen.
„Ja und nein. Es geht nicht um die Arbeit an sich, sondern darum…“, ich hielt kurz inne und rang nach Worten, obwohl ich doch vorher das Gespräch einige Male im Geiste durchgespielt hatte. Ich suchte nach einer Steilvorlage, die es mir erleichtern würde. Weshalb es mir dann so schwer fiel, die Tatsache zu benennen, weshalb es mir gar peinlich war, das kann ich heute nur noch schwer nachvollziehen, aber es war so. Vermutlich hatte ich selbst das Gefühl, mich in eine große, weltferne, romantische Dummheit verstiegen zu haben und der pessimistische Teil von mir, also auch zugleich der beherrschende Teil meines Wesens, hat nicht daran geglaubt, dass ich deiner überhaupt würdig sein könnte.
„Du hast ja meine Ausbilderin einmal kennen gelernt, als du im Laden warst und mich besucht hast. Wie findest du sie eigentlich?“
„Nett, etwas verschroben, aber nett.“ Das war für mein Geständnis nicht hilfreich. Innerlich geriet ich ein wenig ins Kochen und spürte eine leise Wut gegen meine Mutter aufkommen, dass sie dir ein so belangloses Attribut wie „nett“ anheftete und dazu noch „verschroben“. Ich geriet in die Position, dich verteidigen zu müssen, jedenfalls hatte ich das starke Bedürfnis dazu.
„Nur nett? Was meinst du denn außerdem damit, sie sei verschroben?“
„Naja, ich weiß nicht, war nur so ein erster Eindruck. Vielleicht ist sie ja gar nicht verschroben. Du kennst sie ja viel besser.“ „Ja, und sie ist bestimmt nicht verschroben, jedenfalls nicht mehr als ich.“
„Also doch verschroben.“ Meine Mutter lachte. Dann kratzte sich am Kinn, was sie manchmal tat, wenn sie überlegte. „Es war vielleicht nur der Rahmen, in dem ich sie kennengelernt habe, der mir den Eindruck vermittelt hat. Wenn ich sie mir beim Spaziergang durch die Stadt vorstelle und ohne diese Hornbrille und den Stiftrock und vor allem ohne diese Meter von Büchern überall um sie herum, dann wirkt sie schon weniger verschroben auf mich.“ „Also“, platzte ich dann heraus, da ich es nicht mehr aushielt, „ich liebe sie.“
„Na, das ist doch schön, wenn du deine Ausbilderin gern hast. Während meiner kurzen Karriere als Bürokauffrau hatte ich nie das Glück, irgendetwas Positives an meinen Vorgesetzten zu finden.
„Nein, du verstehst nicht ganz, ich habe sie nicht bloß gern.“ Dann wiederholte ich, was ich zuvor schon ausgesprochen hatte und es fühlte sich besser an, als ich dachte, ja sogar richtig gut. „Ich liebe sie wirklich. Verstehst du?“
„Oh“, war alles, was sie darauf antwortete.
„Ich habe nie einen Menschen so geliebt und ich liebe sie, seitdem ich sie zum ersten Mal gesehen habe.“
„Und sie?“, fragte meine Mutter. „Liebt sie dich auch?“
„Nein, das heißt, ich weiß es nicht.“ Bevor ich weitersprechen konnte, fiel meine Mutter mir ins Wort.
„Ist das der Grund, weshalb du dort angefangen hast?“
„Ja und nein.“
„Schon wieder ja und nein. Du warst schon immer ein widersprüchlicher Charakter.“
„Ja, weil ich vom ersten Moment an den Drang hatte, in ihrer Nähe zu sein. Nein, weil ich sofort, als ich sie in ihrem ganzen wundervollen Wesen und in dem, was sie macht, erlebt habe, mich auch in ihren Beruf verliebt habe. Mit Büchern zu arbeiten und Menschen in ihrer Orientierungslosigkeit aus dem literarischen Dschungel hinaus zu helfen, das ist meine Leidenschaft geworden.“
„Okay, verstehe. Und nun bist du unglücklich, weil du dich nicht traust, ihr deine Liebe zu gestehen?“
„Ja, und weil ich solche Angst davor habe, dass sie mich auslacht.“
„Das ist doch Unsinn. Vielleicht wird sie dir sagen, dass sie dich nicht liebt, aber sie wird dich ganz bestimmt nicht auslachen. Wenn du jemanden so etwas Wunderschönes wie deine Liebe offenbarst, dann fühlt sich doch jeder zumindest geschmeichelt, selbst wenn die Liebe nicht gegenseitig ist. Und, vielleicht liebt sie dich ja auch und traut sich nicht, es dir oder sogar sich selbst einzugestehen. Immerhin ist sie deine Chefin und, wie ich schätze, einige Jahre älter.“
„Du hast ja Recht, aber ich habe trotzdem Angst.“
„Es wäre seltsam, wenn du die nicht hättest. Immerhin geht es um die Liebe und vielleicht um ein Leben, das ganz anders verlaufen könnte, je nachdem, wie die Antwort auf deine Frage ausfällt. Ich sage dir eins, auch aus meiner Lebenserfahrung heraus kann ich dir nur raten, schnell klare Verhältnisse zu schaffen. Frage sie.“ „Deine Lebenserfahrung, die du aus zwanzig Jahren todunglücklicher Ehe gewonnen hast?“
„Ja, genau aus der. Ich hatte jemanden geliebt, als ich zur Berufsschule gegangen bin. Er war samtherzig, musisch und überhaupt ein ganz anderer Typ als dein Vater. Was habe ich getan? Nichts. Ich habe mich nie getraut, ihn zu fragen, obwohl es Gelegenheiten gegeben hätte. Ich war sogar ein paar Mal mit ihm aus, aber ich habe einfach jede Gelegenheit verstreichen lassen. Es gibt einfach nicht die eine große Gelegenheit, bei der sich alles richtig anfühlt. Du musst einfach irgendwann zwischendurch zu ihr hingehen und ihr sagen, dass du mit ihr über etwas sprechen möchtest.“
Dann atmete sie lang und geräuschvoll aus, schüttelte sachte den Kopf und fing an zu lachen, als würde ihr erst jetzt bewusstwerden, was ich ihr gebeichtet hatte.
„Ich fasse es nicht. Du hast mir viele Rätsel aufgegeben in letzter Zeit, aber jetzt ist mir alles klar. Ich bin froh, dass du es mir erzählt hast. Ich freue mich auch für dich, dass du verliebt bist, auch wenn die Umstände, naja, etwas schwierig sind und dein Vater es nicht begreifen würde. Ich kann dir aber nur raten, warte nicht zu lange. Geh zu ihr hin. Du würdest es immer bereuen, wenn du jetzt nicht den Mut findest.“
Ich wusste, dass meine Mutter Recht hatte damit.
*
Ich wanderte am selben Tag allein und tief in Gedanken durch Straßen und Passagen. Kein Gesicht, das ich kannte, keine Verlockung, der ich folgte. Hier war ich tausend Mal gewesen, mit Freunden, mit der Mutter, erfüllt von Gegenwart. Jetzt fühlte ich mich einsam und dachte an dich, Isabella. Schauplätze großer Geschichte, an denen meine Eltern bei den Montagsdemonstrationen mitgelaufen waren, waren nur leere Plätze. Nichts hatte einen Sinn, solange ich das Geheimnis meiner Liebe zu dir in mir trug und vor dir verbarg. Und was wäre, wenn ich es dir gestehen würde und du mich auch liebtest? Der Gedanke daran ließ ein Kribbeln durch mein Bauch fahren, ein Gefühl, in das sich neben Liebestaumel auch Angst mischte. Was würde die Zukunft bringen? Wäre ich bereit für die Konsequenzen, die aus meinem Geständnis erwachsen würden? Ich hatte noch keine Freundin gehabt, ich hatte mich nie in Liebesdingen ausprobieren können. Was, wenn ich deiner Liebe nicht gerecht werden könnte, wenn ich versagen würde, dort, wo du einen starken, erwachsenen Mann suchen würdest?
Ich wusste nicht wohin, bog ab zum Augustusplatz. Es müsste irgendwann ein Schmetterling entschlüpfen, so groß, so hell leuchtend im Licht: Unsere Liebe zueinander.