
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Insel Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein packender Roman über zwei Frauen zwischen verlorenen Gewissheiten und neuen Zeiten, über Aberglaube im Deutschland der Nachkriegsjahre, inspiriert von wahren Begebenheiten.
Während des Krieges haben Edith und Annie zusammengehalten, vereint in der Hoffnung darauf, dass ihre Männer bald wieder unversehrt aus dem Krieg in das kleine Dorf im Moor zurückkehren. Doch nur einer kommt zurück: Josef, Annies Mann. Fünf Jahre nach Kriegsende steht er plötzlich vor Annies Tür, schwer versehrt und mit wenig Erinnerung, nur mit der wachsenden Gewissheit, dass er nicht Annie will, sondern Edith. In der verzweifelten Annie, die sich hingebungsvoll um Josef kümmert, obwohl er sich zunehmend von ihr abwendet, keimt ein alter Aberglaube auf: Was, wenn nicht ein böser Zauber, kann ihr Unglück bewirkt haben?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 324
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Cover
Titel
Helga Bürster
Als wir an Wunder glaubten
Roman
Insel Verlag
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
eBook Insel Verlag Berlin 2023
Der vorliegende Text folgt der Erstausgabe, 2023.
Originalausgabe© Insel Verlag Anton Kippenberg GmbH & Co. KG, Berlin, 2023
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: Designbüro Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Umschlagabbildung: Endre Penovác, Veszprém
eISBN 978-3-458-77801-1
www.suhrkamp.de
Widmung
Für Thomas
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Inhalt
Informationen zum Buch
Cover
Titel
Impressum
Widmung
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Epilog
Dank
Informationen zum Buch
Als wir an Wunder glaubten
1
Guste erzählte weiter.
»Am Teufelsloch versteckt sich eine verwitterte Moorkate zwischen Krüppelbirken und Brombeerbüschen. Du kennst sie. Da steht auch die Baracke. Es ist kein guter Ort.«
Betty wollte etwas sagen, aber Guste legte den Finger auf ihre Lippen. »Die Kate stand schon immer schief, als würde sie jeden Moment in sich zusammenfallen, aber sie duckt sich nur unter den Nebel. Sie schwimmt auf dem Moor, sonst wäre sie längst verfault oder mitten durchgebrochen.« Guste machte eine Pause, sie bekam heute schlecht Luft. Als sie weitersprach, war sie kaum zu verstehen und Betty rückte näher.
»Die ersten Siedler, die haben schon gewusst, wie man so eine Moorkate baut. Die haben nicht auf Zimmermannswinkel oder das rechte Lot geachtet, sondern darauf, dass die Hütte biegsam und geschmeidig ist. So eine Moorkate sieht zwar aus wie ein räudiges Tier, aber die kann nicht nur schwimmen, die tanzt auch.« Guste kicherte und musste dann gleich wieder husten. Sie war eine gute Geschichtenerzählerin und sie war wunderlich. Das gehörte wohl zusammen. Betty dachte sich nichts dabei, denn sie kannte Guste und sie kannte die Großen. Die hatten alle ihre Marotten, deshalb wollte sie lieber nicht erwachsen werden, aber was sollte man machen.
»Mutig mussten sie sein, die ersten Siedler. Wer anderswo auch kein Dach über dem Kopf hatte, konnte sich sein Leben nicht aussuchen. Also gingen viele ins Moor, weil der König von Preußen diese lumpige Landschaft nur an die Elenden verpachten konnte. Die hatten keine Angst vor dem Tod. Der hat ihnen sowieso geblüht. Schilf, Torfsoden und Lehm, ein paar Baumstämme, schief und krumm, daraus haben sie sich notdürftige Behausungen zusammengezimmert, gerade gut genug, um sich die Schwindsucht zu holen und zum Schäfer zu rennen, der sie mit seinen Sprüchen heilte oder auch nicht. Mehr konnten sie nicht verlangen.«
Guste keuchte. Sie hatte in ihrem langen Leben schon zu viele schwere Nebel eingeatmet. Betty fragte: »Warst du dabei, als die ersten Siedler gekommen sind?«
»In gewisser Weise.«
Sie musste steinalt sein. So sah sie auch aus. Ihr Gesicht war runzlig wie Eichenrinde. Wenn sie lachte, konnte man die Zähne sehen und die vielen Lücken dazwischen. Es reichte, um einen Kanten Brot zu kauen. Sie lebte allein in dem alten Rauchhaus, das nicht einmal einen Kamin hatte, nur eine offene Feuerstelle mit Kesselhaken, wie in den alten Zeiten. Keiner wohnte mehr so, nicht einmal hier, in diesem kleinen Moordorf, und so kurz nach dem Krieg. Die meisten hatten zumindest einen Schornstein und einen Ofen, auf dem die Suppe kochte. Bei Guste zog der Rauch noch durch das Eulenloch ab und wenn der Nebel wie ein nasses Tuch auf allem lag, wurde sie geräuchert, wie die Würste und Schinken, die im Giebel hingen. Die gehörten ihr nicht. Andere brachten das Fleisch, damit sie es in den Rauch hängte, dafür bekam sie etwas ab. Mal eine Wurst, mal einen Schinken.
Die Mutter schickte Betty hin und wieder mit einem Topf Kartoffeln oder Suppe. Zwar hatten sie selbst kaum genug zum Beißen, aber Guste hatte noch weniger und jemand musste sich kümmern. Sie hatte sonst keinen mehr. Außerdem war es eine mühselige Arbeit, sich über offenem Feuer etwas zu kochen, besonders für Guste, die es auf der Brust hatte. Sie schaffte es gerade noch, die Glut nicht ausgehen zu lassen und am Abend die eiserne Stülpe über das Feuer zu stellen, damit keine ihrer Katzen Feuer fing und das auch noch ins Dach trug. So waren schon viele Katen abgebrannt.
»Hundert Jahre«, sagte Betty. »Bist du so alt?«
»Ich hab’s vergessen. Und nun halt den Mund oder geh nach Hause.«
Aber Betty wollte nicht nach Hause. Da wartete die Mutter mit Arbeit. Sie wollte hören, wie es weiterging, nur noch ein bisschen, und Guste tat ihr den Gefallen.
»Von den alten Katen haben mal so viele hier gestanden, wie es Habenichtse in der Gegend gab. Nun fangen die Ersten schon an, in Stein zu bauen, da hinten, wo das Moor abgetorft ist.« Guste zeigte aus dem Fenster. Man sah nicht viel, denn das Dach hing zu tief, aber Betty wusste, dass der Spökenfritz da draußen baute, weil ihm sein Hof zu klein geworden war.
»Heißt ja, die neue Regierung schenkt ihm Geld für was Größeres und weil er außerhalb vom Dorf siedelt. De Düüvel schitt jümmers op den gröttsten Hopen.«
Der Spökenfritz hieß eigentlich Fritz Renken. Der war zwar kein Schäfer, aber mehr als Brot essen konnte er auch. Wen Dr.Till schon aufgegeben hatte, machte er gesund, und er machte auch, dass eine Kuh wieder Milch gab, aber man durfte nicht darüber reden. Niemals! Sonst passierte irgendetwas Schlimmes.
»Lass uns nicht weiter darüber reden«, sagte Guste. Als wenn sie Bettys Gedanken gelesen hätte! Vielleicht konnte sie das sogar, denn im Dorf war sie de oole Hex, die Kindern fürchterliche Geschichten erzählte. Betty hatte keine Angst vor ihr.
»Wolltest du nicht von der alten Kate erzählen?«, drängte Betty, denn Guste drohte, in Gedanken zu versinken. »Ja, ja. Du hast Recht. Das wollte ich. Also hör zu: Der dritte Sohn eines Bauern aus dem Bremischen und seine Frau, die haben die Kate damals gebaut. Bettelarm alle beide, die hatten nichts, nur eine große Hoffnung. Pioniere eben. Als die Frau das Herdfeuer angezündet hat und sie beide ihre Hände darüber gewärmt haben, da kam ihnen die Hütte vor wie ein Palast. Es musste ja nur zum Überleben reichen.«
»Haben sie überlebt?«
»Na ja. Man hat sie getäuscht und betrogen, wie das so ist. Der Mann, die Frau und alle anderen, die höchstderoselben Gnaden ins Moor gelockt hat, damit sie es trockenlegen. Die Wahrheit war: Er brauchte Land und er brauchte Geld für seine Kriege. Die Pacht war nicht zu schaffen. Darum heißt es: Den ersten sien Doot.«
Guste schloss die Augen.
»Wie geht die Geschichte weiter?«, wollte Betty wissen. »Heute geht nichts mehr weiter.« Sie legte den Kopf auf den Tisch, wie das alle Moorfrauen machten, wenn sie Mittagsruhe hielten, weil ihnen die Müdigkeit so tief in den Knochen saß, dass sie den Tod jederzeit fürchten mussten, auch am helllichten Tag. Darum legte sich keine hin.
»Geh jetzt nach Hause«, sagte Guste. »Ich muss mich noch ein bisschen ausruhen, denn gleich ist Weltuntergang.«
2
Am Donnerstag sollte es auch hier so weit sein. Es hatte sogar in der Zeitung gestanden. Theo wusste davon. Schließlich schrieb er für den Moorboten. Die wichtigsten Seiten hingen im Schaukasten aus, die Todesannoncen, die Familienanzeigen, die amtlichen Bekanntmachungen und Berichte über Unnenmoor. Die wenigsten bekamen das Blatt ins Haus, aber so kriegten alle das meiste mit. Edith und Betty Abels wussten von Theo, dass die Welt heute auch in Unnenmoor untergehen sollte. Theo kam oft rüber, er wohnte gleich nebenan. Er saß fast jeden Tag in der Küche, das schlimme Bein unter dem Tisch ausgestreckt, und guckte Edith beim Nähen und Wäschemachen zu. Dabei erzählte er, was es Neues gab, denn zu Hause saß er alleine. Seine Lise war letztes Jahr gestorben, Kinder hatten sie keine. Edith ging es ähnlich, denn Otto Abels galt als verschollen. Allerdings hatte sie Betty.
»In den Nachbardörfern ist die Welt auch schon untergegangen, aber keiner hat’s gemerkt.« Theo schüttelte den Kopf. »Was für ein malleriger Kram das ist. Als ob wir nicht schon genug vom Untergang gehabt hätten.«
Edith flickte gerade seine Manchesterhose. Da war eine Naht aufgerissen, also saß Theo in langer Unterwäsche da und wartete, dass die Hose fertig wurde. Er hatte nur zwei, die hier und die gute.
»Der soll ja auch alle Krankheiten heilen, dieser Professor«, meinte Edith. »Deshalb laufen ihm die Leute hinterher.« Sie biss den Faden ab. »Ich hab kurz überlegt, ob ich mit meinen Kopfschmerzen hingehen soll. Die sind wieder schlimmer geworden.« Sie hielt die Hose ins Licht und betrachtete ihr Werk. »Aber der soll ja auch nicht ganz billig sein, wie man hört.« Sie reichte Theo die Hose. »Hier. Fertig.«
»Sieht aus wie neu.« Theo zog sie wieder an.
»Wenn die Welt heute wirklich untergeht, stehst du wenigstens nicht in Unterhosen vor dem lieben Gott«, meinte Betty.
»Sei nicht immer so frech!«
Das mit dem Untergang grassierte wie eine Seuche. Prediger krochen aus allen Ecken und prophezeiten nicht nur das Ende der Welt, sondern auch das Jüngste Gericht. Gründe gab es genug und die Angst ging um, dass etwas dran war an der Sache. Schließlich war Krieg gewesen und die Sünden, die begangen worden waren, wogen so schwer, dass da nichts zu vergeben war. Der Teufel würde sie alle holen. Zwar sprach das keiner laut aus, aber viele dachten so. Wanderprediger lasen den Leuten die Leviten, sie riefen dazu auf, Buße zu tun und die Seelen zu reinigen, bevor das große Finale kam und Gott einen Kometen schickte, um zu richten, die Lebenden und die Toten. Wenn das Ende vom Ende kam, so die Prediger, sollte man besser heil sein, sonst schmorte man ewig im Fegefeuer und dann hatte man den Salat. Unter den Propheten gab es berühmte Männer, die füllten ganze Stadien.
Was den Professor Asmodi betraf, so eilte ihm kein großer Ruf voraus. Mit seinem berühmten Kollegen Conradi, der sogar im Radio sprach, konnte er nicht mithalten, obwohl er sich vieles abgeguckt hatte, nicht nur den klingenden Namen, auch die Art, wie er sprach und sich kleidete. Wer wollte, konnte die Kopie erkennen. Die Sehnsucht nach Erlösung reichte für alle und mehr. So wurde der Pennig schon seit dem frühen Morgen von denen umlagert, die den Professor sehen wollten, die auf Linderung ihrer Leiden hofften und auf ein Wunder. Einige waren schon am Vorabend gekommen, zu Fuß, mit dem Fahrrad, im Rollstuhl oder liegend auf dem Ackerwagen. Harm Cordugas, der Wirt, wusste nicht, wie ihm geschah, denn der Pennig platzte aus allen Nähten. Die Zimmer im oberen Stock waren mehrfach belegt. Seit dem Mittag hing ein Schild am Eingang. »Wegen Überfüllung geschlossen.« Die Leute drängelten sich im Saal, obwohl der Professor erst für drei Uhr nachmittags angekündigt war und der Eintritt fünfzig Pfennig kostete, Kinder frei. Das Bier ging schnell zur Neige, Frikadellen und Würstchen auch.
»Der Professor wird zuerst zu den Leuten sprechen, dann geht es zur Kapelle, da wird geheilt, und dann geht die Welt unter. So lautet der Plan.« Theo schloss die Gürtelschnalle.
»Eines verstehe ich nicht«, sagte Edith, »warum in dieser Reihenfolge? Wozu erst die Heilung und dann der Untergang?«
»Umgekehrt wär’s ja auch dumm. Aber frag den Professor. Der hat studiert.«
Edith lachte. »Ich geh da nicht hin. Vom Untergang hab ich die Nase voll.«
Der letzte lag gerade erst hinter ihnen, die Ruinen rauchten noch. Deshalb gingen Edith und Theo lieber tanzen. Gelegenheiten gab es genug. Jede noch so kaputte Scheune wurde zum Festsaal umfunktioniert. Gab es keine Musiker, sang man die alten Schlager selbst. Das ist die Liebe der Matrosen oder Veronika, der Lenz ist da. Einmal im Monat kam auch ein mobiles Filmtheater ins Dorf. Der Vorführer baute im Saal den Apparat auf, der so schön schnurrte. Am beliebtesten waren die alten Komödien mit Theo Lingen. Man hatte zu lange nicht mehr gelacht. Kuchen gab es auch und wenn die Bude einigermaßen voll wurde, gab Cordugas einen aus. Der Wirt ließ sich nicht lumpen. Er hatte vergangenen Winter sogar zum Grünkohlessen eingeladen. Es durfte wieder ganz offiziell geschlachtet werden. Nun musste man nicht mehr fürchten, dafür ins Gefängnis zu kommen. Die Fleischplatten hatten sich unter Speck und Pinkelwürsten gebogen, wie man sich später erzählte. Die Kapelle habe sich einen Wolf gespielt, bis sich die Ersten mit vollgefressenem Ranzen auf die Tanzfläche geschleppt hatten. Danach war es hoch hergegangen. Den Spökenfritz hatten sie später in eine Schubkarre verfrachten müssen, um ihn ins Bett zu kriegen, sternhagelvoll und mit blutiger Nase, weil er Anni an die Wäsche hatte gehen wollen. Ausgerechnet! Ihr linker Haken saß. Das hatte Fritz, der sonst alles wusste, nicht vorausgesehen.
Als Theo die Anekdote später an Ediths Küchentisch erzählte, lachend und mit Tränen in den Augen, hatte sie mit der Zunge geschnalzt und einen vielsagenden Blick in Bettys Richtung geworfen, weil ihre Tochter zwar alles essen, aber nicht alles wissen durfte. Sie war elf und noch ein Kind. Betty war anderer Meinung. Sie war bald zwölf und schon fast erwachsen, aber das sahen die Großen mal so, mal so, wie es ihnen gerade passte. So ging das mit allem. Heute Weltuntergang, morgen Tanztee, Hauptsache, es lenkte vom schlechten Gewissen ab, denn sie hatten alle versagt. Man musste sich nur angucken, was da auf den Professor wartete. Krüppel und Versehrte. Darüber hinaus war noch einiges mehr angerichtet worden. All die Heimatlosen, die Waisen, das ganze vagabundierende Gesindel, das kein Zuhause mehr hatte. Eine Völkerwanderung sondergleichen. Während viele einen Ort zum Bleiben suchten, mahlten die Steinmühlen in den Städten bis zum Sanktnimmerleinstag den ganzen Kriegsschrott zu Brei. Es war einfach zu viel kaputtgegangen, Städte, Dörfer, Menschen. Noch immer fand man unter den Trümmern Vermisste. Die saßen in den Kellern auf Stühlen mit ihren Koffern auf dem Schoß und warteten, dass jemand Entwarnung gab. Theo hatte sie gesehen. Der kam für die Zeitung viel herum. »Die kommen nie mehr zur Ruhe, da können die noch so tot sein. Denen geht es wie den Barackentoten im Teufelsloch.«
Bei Vollmond kamen die zum Vorschein, dann stiegen sie aus den Tümpeln mit ihren Spaten und Forken und verfluchten diejenigen, die sie da reingebracht hatten. Keiner wollte noch was davon wissen, doch die alte Guste fing immer wieder davon an. Cordugas hatte sie deswegen schon ein paar Mal aus dem Pennig geworfen. Dabei kam sie nur, um Leckbier zu kaufen, für eine Biersuppe, wie sie sagte. Meist saßen genug Leute in der Gaststube, die zuhören mussten, aber sie kam nie über die ersten Sätze hinaus.
»Haal dien Muul, du oole Hex!«
Theo ging und Edith nahm sich Annis alten Mantel vor.
»Was macht Guste?«, fragte sie, während sie einen neuen Faden in die Nähmaschinennadel fädelte.
»Die hustet viel.«
Betty holte sich die Pfanne vom Herd und stellte sie auf den Tisch. Ein kleiner Rest Bratkartoffeln war noch vom Mittagessen übrig geblieben und schon ein bisschen schwarz. Sie aß sie trotzdem, denn Hunger hatte sie immer.
Die Mutter klemmte den Mantelärmel unter den Nähmaschinenfuß und trat auf das Pedal. Die Maschine ratterte los. Sie seufzte. »Nochmal kann ich den nicht flicken. Durch den Stoff kann man schon Zeitung lesen.« Der Faden riss. Sie fädelte wieder ein. Als Betty die Pfanne zurückstellte und den Spültisch auszog, um abzuwaschen, war die Naht schon fertig. Edith faltete den Mantel zusammen. »Wird Zeit, dass Anni sich einen anderen besorgt.« Sie legte ihn in den Eierkorb, der stand schon bereit. »Lass mir den Abwasch. Lauf du zu Anni und bring ihr den Mantel. Die braucht den. Und lass dir Eier geben. Ein halbes Dutzend hat sie mir versprochen für die ganze Flickerei. Gegen ein Knickei obendrauf hätte ich auch nichts einzuwenden.«
Edith flickte auch Willis Hosen. Der war Annis Sohn, so alt wie Betty, und bei ihm ging immer was kaputt. Betty protestierte nicht. Wenn sie Glück hatte, würde sie noch etwas vom Weltuntergang sehen und wenn sie noch mehr Glück hatte, gab es am Abend Rührei.
3
Betty lief den Schwarzen Weg hinauf. Der Groll’sche Hof lag da, wo die Kopfsteinpflasterung schon längst aufgehört hatte und das Dorf auch. Auf halbem Weg stand die Kapelle, umsäumt von schlichten Gräbern. Da musste sie vorbei. Heute sollte noch ein Komet einschlagen, wenn man dem Professor glauben konnte. Sie hatte keine Angst. Die anderen Dörfer, die den Untergang schon hinter sich hatten, standen noch. Betty ging mitten auf der Straße, sie hüpfte von Stein zu Stein. Die Straße machte einen Knick, von hier aus konnte man nicht sehen, ob die Prozession schon losgegangen war, aber sie dachte gerade nur an Rührei und guckte nicht rechts und nicht links. Erst hinter der Kurve sah sie die Leute. Der Professor führte sie an. Sein schwarzer Mantel schleifte fast auf dem Boden, er stützte sich auf einen Stock. Betty blieb stehen. Die meisten kannte sie nicht. Von hier kamen die wenigsten, aber sie hörte Guste. Die stand auf der anderen Straßenseite, sie ließ die Leute vorbeiziehen und gab ihre bissigen Kommentare ab. »Hauptsache Untergang, was? Das ist doch auch nur so ein Rattenfänger! Aber ihr müsst ja immer jemandem hinterherrennen!«
»Geh nach Hause!«, riefen einige. Sie wandte sich um und ging, gestikulierend und vor sich hin schimpfend, wie man das von ihr kannte. Als sie außer Sicht war, schloss Betty sich der Prozession an, denn sie war neugierig. So ein Untergang passierte schließlich nicht alle Tage.
Vor der Kapelle blieb der Professor stehen und alle, die ihm folgten, hielten inne. Er richtete sich auf und hob den freien Arm. Er wollte etwas sagen. Alle wurden ruhig, bis auf einen, den Betty kannte. Irgendwo ganz vorne brummte Willi wie ein Automobil. Er imitierte gerne Motoren. Das konnte er gut. Willi war fast wie ein Bruder für Betty, sie passte oft auf ihn auf. Wenn ihre Mutter mit Anni auf dem Acker stand, um Rüben zu hacken, spielte sie mit Willi Autofahren, das freute ihn. Dass er hier war, inmitten dieser Prozession, das konnte nur eines bedeuten: Er war weggelaufen, denn Anni ließ ihren Sohn nie vom Hof und nahm ihn auch nirgendwohin mit. Er ging nicht einmal in die Schule.
Betty überlegte, was sie tun sollte. Sie fühlte sich verantwortlich, andererseits sollte sie etwas erledigen, und zwar schnell. Noch während sie überlegte, schwebte Willi plötzlich über allen Köpfen. Sie drängelte sich nach vorne durch. Da stand Anni, sie hatte ihren Sohn hochgestemmt. Er war viel zu groß, um noch auf den Arm genommen zu werden, aber er wog nicht viel und Anni war stark. Er musste sich mit den Händen auf ihren Schultern abstützen. Betty winkte ihm zu. Er sah in ihre Richtung, winkte zurück und schwankte gefährlich, aber Anni hielt ihn eisern umklammert und drängelte sich bis zum Professor vor. Da stellte sie ihn ab, wie einen Mehlsack. Betty war auf die Bank geklettert. Von hier aus konnte sie alles überblicken. Sie sah, wie Anni dem Professor etwas Längliches, in Zeitungspapier Eingeschlagenes überreichte. Betty vermutete eine Mettwurst. Der Professor nahm das Geschenk und Willi ließ vor Aufregung mit lautem Geheul und wilden Armbewegungen ein Flugzeug abstürzen. Anni packte ihn und hielt ihn fest, damit der Professor ihm die Hände auf den Kopf legen konnte. Es wurde ganz still, auch Willi schien die Luft anzuhalten. Asmodi schloss die Augen und rief Worte, die Betty nicht verstand. Vielleicht konnte er ja doch zaubern und heilen. Dann fing er an zu beten, das war zu viel für Willi, er wollte das nicht. Er riss seinen Kopf herum und biss die Hand, die ihn heilen sollte.
Der Professor brüllte auf und ließ ihn los. Anni hob vor Schreck die Hände, Willi floh.
Die Leute wurden unruhig.
Betty fiel ein, dass sie noch etwas zu erledigen hatte.
4
Wie immer bewachte Köter den Hof. Er kam Betty kläffend und mit wedelndem Schwanz entgegengesprungen. In der ganzen Gegend gab es wohl keinen hässlicheren Hund, klapperdürr, pechschwarz und struppig, aber groß wie ein Kalb. Seine Augen glühten und wenn er die Zähne bleckte, konnte man auf den Gedanken kommen, dass er wohl aus der Hölle weggelaufen sein musste. Wahrscheinlich stimmte das sogar. Eines Tages hatte er winselnd auf dem Hof gestanden und weil er als Wachhund taugte, schlug Anni ihn nicht tot. Sie machte sich nicht die Mühe, ihm einen Namen zu geben. Er wurde nur geduldet. Mehr konnte so ein dahergelaufenes Tier in diesen Zeiten nicht verlangen. Er schlief im Stall und bediente sich aus dem Schweinetrog. Manchmal kehrte er mit blutiger Schnauze und Federn im Maul aus dem Moor zurück, dann hatte wohl eine lahme Ente dran glauben müssen. Annis Hühner aber ließ er in Frieden. Er bewachte sie gut. Weder Fuchs noch Marder trauten sich in ihre Nähe. Er war schlau und passte auf das wenige auf, das noch übrig war. Der Groll’sche Hof hatte bessere Tage gesehen. Nun ging es bergab. Ein bisschen Vieh, ein bisschen Land, ein bisschen Torf, mehr konnte sie allein nicht erwirtschaften, denn das Reich hatte ihren Mann in den Krieg geschickt und bisher nicht wieder herausgegeben. Dabei wurde er hier gebraucht, auf dem Hof und bei ihrem mallerigen Sohn, der an ihm geklebt hatte wie Mist am Schuh. Die beiden! Nachdem ihr Josef zusammen mit Otto in den Zug gestiegen war, der sie an die Front brachte, war nichts mehr vorangegangen. Cordugas hatte ihr damals geraten, für den Hof eine Polin zu nehmen und Willi in eine Anstalt zu geben. Dr.Till war auch der Meinung gewesen, dass Willi dort besser aufgehoben war als zu Hause. Nur starben die Wichter in der Anstalt an Lungenentzündung. Anni hatte nachgehorcht und das Flüstern gehört. Zwar konnte sie nicht so gut mit Willi wie ihr Mann. Eigentlich konnte sie gar nicht mit dem Jungen, und sie liebte ihn doch auf ihre unbeholfene Weise. Sie lehnte jede Hilfe ab, ließ Willi bei sich auf dem Hof und ging nicht mehr ins Dorf wegen der Leute. Nur Edith kam ab und an, aber die Arbeit war nicht zu schaffen. Seit diesen Tagen fuhr ihr der blanke Zorn immer mal wieder in die Fäuste, sie wusste selbst nicht, wie ihr geschah, aber sie gewöhnte sich daran.
Betty blieb stehen und hielt Köter die Hand hin, damit er daran schnuppern konnte. Als er sie erkannte, leckte er mit der langen Hundezunge über ihren Handrücken, es kitzelte. Betty kraulte ihn hinter den Ohren. Das mochte er gern. Es war ihr Begrüßungsritual. Danach ließ er sie auf den Hof. Keiner war da, nur Köter folgte ihr. Den ganzen Weg von der Kapelle bis hierher war sie gerannt, um vor Anni hier zu sein. Bestimmt war sie wütend wegen Willi. Ganz sicher sogar, und einer wütenden Anni begegnete man besser nicht. Sie hatte eine ganze Mettwurst verschenkt, für nichts. Man konnte nur hoffen, dass Willi sich gut versteckt hielt, bis Anni sich wieder beruhigt hatte.
Betty stieß die Achterdöör auf und trat in die Waschküche, Anni schloss nicht ab, seit Köter den Hof bewachte. Er war ihr nicht ins Haus gefolgt, da durfte er nicht rein. Das hatte er nur einmal versucht und dann nie wieder. Über die Schwelle traute er sich nicht, aber die Nachbarn ließ er durch, wenn sie sich Eier oder Milch holen wollten. Eine henkellose Tasse mit Sprung diente als Kasse, in die legte man das Geld. Seit kurzem gab es neues.
Es dauerte, bis sich Bettys Augen an die Dämmerung im Haus gewöhnt hatten. So richtig hell wurde es hier nie. Bei den alten Höfen war das Dach tief heruntergezogen, zum Schutz vor Regen und Kälte. Die Fenster waren klein und elektrisches Licht gab es nicht. Die Oberleitung führte nicht ins Dorf, aber man kannte das nicht anders.
Sie atmete tief ein und aus, denn ihr Herz raste noch immer. Als sie sich beruhigt hatte, ging sie durch die Waschküche hindurch ins Haus. Links lag die Diele, gegenüber die Küche. Eine Holzwand trennte den Wohntrakt vom Stall. Die war auch nicht immer da gewesen. Dahinter hörte man die Kühe schnauben. Es roch nach Mist und Milch.
Betty klopfte an die Küchentür, nicht dass Anni doch schon zurück war und sie ins offene Messer lief. Es blieb alles still. Sie trat ein.
Eine muffige Kälte umfing sie. Der Ofen war ausgegangen und die Feuchtigkeit kroch allmählich von draußen herein. Sowas ging schnell. Wenn kein Topf auf dem Herd stand und kein Wasser im Kessel summte, nahm sich das Moor zurück, was ihm sowieso gehörte. Deshalb ließ keine Frau das Herdfeuer ausgehen, nicht einmal im Sommer, denn es musste gekocht werden und man brauchte heißes Wasser zum Waschen oder um ein Schlachthuhn hineinzutauchen, um es danach besser rupfen zu können. Es gab nur einen vernünftigen Grund für einen kalten Herd. Wenn man auszog. Dann ließ die Frau das Feuer erlöschen, damit die nächste es wieder entzünden und das Haus in Besitz nehmen konnte. Das wusste jedes Kind und es konnte nur bedeuten, dass Anni, die sonst einen Bogen um Kirche, Gott und Pastor machte, fest an den Kometen glaubte. Ob sie den Mantel trotzdem noch brauchte oder nicht, war Betty gleich, sie wollte wieder nach Hause. Sie hob ihn vorsichtig aus dem Korb und passte auf, dass er an keiner überstehenden Weidenrute hängenblieb. Das hätte den nächsten Riss gegeben. Sie legte ihn auf den blankgewischten Küchentisch. Nun musste sie nur noch die Eier einpacken. In der Waschküche stellte sie allerdings fest, dass der Eimer leer war. Anni hatte sich auch darum nicht mehr gekümmert. Langsam wurde ihr ein wenig bang.
Sie ging nach draußen. Der Hund hatte hinter der Tür gewartet, er winselte und stupste sie an, lief zum Hühnerstall und zurück, sie wusste schon, was er ihr sagen wollte. Keine Hühner scharrten im Sand, kein Hahn krähte, die Stalltür war verschlossen. Sie schob den Riegel zurück und zog die Tür auf. Da flatterten die Hühner ihr nur so um die Ohren und ins Gesicht. Draußen fingen sie sofort an, in der Erde zu picken. Betty holte den Futtereimer und streute Körner aus, es war nicht das erste Mal. Während die Hühner sich darum zankten, sammelte sie im Stall die Eier ein und brachte sie in die Waschküche. Nun wurde es höchste Zeit. Sie nahm das halbe Dutzend ab, legte die Eier in den Korb und noch ein Knickei obendrauf. Sie wollte schon gehen, denn Anni würde Willi hier zuallererst suchen. Da rissen die Wolken auf und eine bleiche Sonne stach durchs Fenster. In der Eiertasse lag ein bisschen Wechselgeld, das glitzerte im Licht, das schnell wieder verschwand. Nagelneue Münzen waren das. Zwar gab es das neue Geld schon eine Weile und sie hatte die eine und andere Münze in der Hand gehalten, aber so prächtig wie in diesem kleinen Augenblick war es ihr nie vorgekommen. Sie nahm eine der Münzen heraus. Fünfzig Pfennig. Das Geldstück hatte noch keinen einzigen Kratzer abbekommen und war so glatt und schier, als sei es von gestern. Sie betrachtete es von allen Seiten und las das wenige, das darauf geschrieben stand. 1949 und Bank deutscher Länder. Auf der Rückseite war eine Frau abgebildet, die einen Eichenschössling pflanzte. Sie trug ein Kopftuch wie bei der Feldarbeit üblich. Die Münze glitzerte auch ohne Sonnenstrahl wie ein kleines Irrlicht. Für Glanz hatte Betty schon immer etwas übriggehabt und sie konnte den Blick nicht abwenden. Sie war so versunken, dass sie nicht merkte, wie jemand hereinkam und als sie es dann doch hörte, schloss sie die Faust und steckte sie in die Schürzentasche. Als sie sich umwandte, stand Willi hinter ihr und grinste.
»Was ist denn so witzig?«, fuhr sie ihn an, weil er sie erschreckt hatte. »Lachst du mich aus?«
Sein Grinsen fiel in sich zusammen, er zog die Nase hoch und wischte sich mit dem Handrücken durchs Gesicht. Da tat es Betty leid, dass sie laut geworden war. Sie fragte: »Bist du alleine zurückgekommen?«
Er nickte.
»Und deine Mama? Wo ist die?«
Er hob die Schultern und ließ sie wieder fallen. Dabei starrte er auf ihre Schürzentasche und die Faust, die darin steckte. Sie umklammerte das Geldstück so fest, dass sie ihre Finger kaum noch spürte. Das Blut schoss ihr in den Kopf, ihr Gesicht brannte. Willi streckte die Hand aus, schob sie in die Schürzentasche und umklammerte Bettys Faust. Sein Blick war schwer zu deuten, aber eines konnte Betty herauslesen: Er wusste Bescheid. Sie stieß ihn weg. Er taumelte gegen die eiserne Wasserpumpe und schlug sich den Kopf am Schwengel an. Er gab keinen Laut von sich, guckte nur. Das hatte sie nicht gewollt. Sie griff nach dem Korb und floh nach draußen. Da stand Köter im Weg und knurrte sie an. Das machte er sonst nie. Bestimmt wusste er auch schon, was sie in der Schürzentasche verbarg, so wie Willi und die Hühner. Die hatten aufgehört zu picken und starrten in ihre Richtung. Sie dachte, dass sie das Geld zurücklegen sollte. Dann wäre alles wieder gut und fast nichts passiert. Als sie sich umwandte, stand Willi in der Tür. Rotz lief ihm aus der Nase und Tränen über die Wangen. Er hielt sich den Kopf. Sie war nicht nur eine Diebin, sie war auch eine Schlägerin und mindestens so schlimm wie Anni, die sie so sehr fürchtete. Wenn sie groß war, würde sie auch so eine sein. Ihr wurde übel. Sie rannte los, ohne nachzudenken, ohne zu gucken, und Anni direkt in die Arme.
»Wat maakst du denn hier!« Anni packte sie am Schlafittchen.
»Ich … wollte … ich hab … die Hühner und …«, Betty schnappte nach Luft, aber Anni hatte sowieso nicht zugehört, denn sie trat nach Köter, der hastig das Knickei fraß, das aus Bettys Korb gefallen war, während sie Betty weiter festhielt. Köter jaulte, leckte sich dann aber triumphierend die Schnauze, denn das meiste vom Ei hatte er schon geschafft.
»Ich hab dir den Mantel gebracht«, stammelte Betty.
Willi stand immer noch in der Tür. Er schmiss den Motor an, machte »Brumm, brumm, bruuuuuumm«, zuerst leise, aber dann gab er Gas und düste eine Runde um den Hühnerstall. Anni ließ Betty los. Sie stürzte sich auf ihren Sohn und fluchte, denn sie hatte eine Wut. Willis Motor verreckte, er wimmerte, als Anni ihn packte. Ihr Griff war fest wie ein Schraubstock, Betty hatte ihn gerade selbst gespürt. Anni brüllte, ihre Stimme überschlug sich. Was er sich denn dabei gedacht habe! Wohl nichts! Weil in seinem breegenklöterigen Eierkopp ja nix drin sei! Eine ganze Mettwurst! Damit der Professor ihn gesund mache! Aber das dösige Menschenkind habe nichts Besseres zu tun, als in seine heilende Hand zu beißen! An dieser Stelle wollte die Stimme nicht mehr mitmachen, sie hustete. So trieb sie Willi vor sich her bis zur Tür. Der stolperte und fiel über die Schwelle. Anni zog ihn hoch und schüttelte ihn durch, nun kamen auch wieder Worte. Schreckliche Worte, was Willi alles sei und was nicht. Die Worte taten auch Betty weh. Sie stellte sich dazwischen. »Bitte, Tante Anni. Lass ihn doch. Er kann nichts dafür.« Sie zerrte an Annis Arm, bis die endlich von ihm abließ und sich Betty zuwandte. Da wurde es ihr angst und bange. So einen wilden und traurigen Blick hatte Betty noch nie gesehen. Sie trat einen Schritt zurück und sah zu Boden. Man schaute den Großen in solchen Momenten besser nicht in die Augen, wenn man heil davonkommen wollte, andererseits hatte sie die Strafe verdient und nicht Willi. Ihre Hand umklammerte immer noch das Geldstück. »Ich wollte das nicht«, flüsterte sie. »Ich hab …«
»Was!«
Betty hätte den Fünfziger zurückgegeben, aber Anni würde sie totschlagen, wenn sie den Diebstahl jetzt beichtete. Ihr blieb jedes Wort im Hals stecken.
»Rede! Ich hab dich was gefragt!«, brüllte Anni sie an.
Betty fiel nichts Besseres ein. »Mama sagt, nochmal flickt sie den Mantel nicht.«
»Den Mantel?«
»Sie sagt auch, du brauchst einen neuen.«
»Ach! Und den will wohl die feine Edith selber nähen? Und was will sie dafür haben?«
Betty zuckte mit den Schultern. Davon hatte die Mutter nichts gesagt.
»Dann richte ihr mal schön aus, dass meine Hühner gar nicht so viele Eier legen können. Da muss sich die gnädige Frau Mutter schon feinere Kunden suchen. So einen wie den Zeitungstheo.«
»Aber der hat einen Mantel.«
»Jaha! Darum techtelmechtelt sie ja auch die ganze Zeit so schamlos mit dem rum und lässt ihn in Unterhosen am Tisch sitzen!« Anni lachte hässlich. »Ihr müsst nicht glauben, das sieht keiner. Eine Schande ist das. Wo dein Vater noch nicht mal für tot erklärt worden ist.«
»Du lügst.« Betty hatte nur geflüstert, aber Anni hatte gute Ohren. Betty wurde für einen Moment ganz schwarz vor Augen. Als sie wieder sehen konnte, kniete sie im Dreck. Ihr Kiefer brannte. Hinter ihr schlug die Achterdöör ins Schloss, Anni war verschwunden. Köter rannte hin und her und wusste nicht, wohin er sich zuerst wenden sollte. Drinnen fing Willi an zu brüllen. Der kriegte jetzt auch sein Fett weg.
Betty stand auf. Ihr war schwindlig. Sie wischte sich über das Gesicht. Ihre Lippe blutete. Der Korb lag vor ihr, die Eier waren herausgefallen, aber bis auf eines heil geblieben. Noch ein Festmahl für den Hund, der sein Glück kaum fassen konnte.
Betty tastete nach ihrem Kinn. Es schmerzte, aber die Zähne waren noch alle da. Es hätte schlimmer kommen können, denn dass sie eine Diebin war, hatte Anni gar nicht gemerkt.
5
Edith stand von der Nähmaschine auf, sie hatte eines von Bettys Kleidern aufgetrennt und ließ den Saum aus. Das Kind wuchs viel zu schnell, man musste ihr bald einen Stein auf den Kopf legen. Man sollte sie auch ans Tischbein binden, wie man das mit kleinen Kindern machte, damit die nicht abhauten. Nur war Betty kein kleines Kind mehr und sie hatte ihren eigenen Kopf. Edith dachte, dass sie ihr längst verloren gegangen war, wie Kinder in diesen Zeiten eben verschüttgingen. Manche lösten sich in Luft auf. Andere machten, was sie wollten. Wer hatte schon Zeit, sich um die Bälger zu kümmern, man war noch immer damit beschäftigt, sein Leben zusammenzusammeln nach diesem fürchterlichen Krieg. Sie hatte gedacht, dass das Schlimmste überstanden war, aber das dicke Ende kam danach. Die vielen Vertriebenen, der Hungerwinter, das kaputte Land, und überall lag noch scharfes Zeugs herum. Viele hatten noch schnell ihre Wehrmachtsrevolver samt Orden und Ausweise im Moor vergraben, damit »der Feind« die Beweisstücke nicht fand. Und welchem Kind konnte man die Neugierde austreiben, wenn es eine Waffe in die Finger kriegte? Stamms Friedrich hatte sich kürzlich mit einer Handgranate hochgejagt und Betty war immer noch nicht zurück. So langsam machte sie sich Sorgen. Vielleicht war sie im Wald, Hasen fangen. Bestenfalls hatte sie die ganze Zeit dem Weltuntergang zugesehen. Bei der kleinen Kapelle standen immer noch ein paar Unerschütterliche, obwohl es angefangen hatte zu regnen. Das wusste sie von Guste, die ihr vorhin den Topf zurückgebracht hatte.
»Die stehen da wie die Ölgötzen, lauschen andächtig diesem Asmodi und warten auf den jüngsten Tag.«
Betty hatte sie nicht gesehen. Warten war auch nicht ihre Stärke. Im Gegenteil. Dieses Kind war nicht zu bändigen. Der Lehrer hatte es ihr ins Zeugnis geschrieben. Neugierig, vorlaut und geschwätzig sei sie. Ihr fehlten die feste Hand des Vaters und die häusliche Erziehung der Mutter. Letzteres im Besonderen. Als ob Edith etwas dafür konnte, dass an Betty ein Junge verloren gegangen war. Statt Topflappen zu häkeln, fing sie Kaninchen. Gab man ihr ein Wollknäuel in die Hand, verwandelte sie es zuverlässig in einen unentwirrbaren Knoten. Edith gab sich alle Mühe, ihrer Tochter die Grundfertigkeiten einer guten Hausfrau beizubringen. Letztendlich gab sie auf und tröstete sich, weil man Topflappen nicht essen konnte, Kaninchen aber schon. Also quälte sie Betty nicht länger mit Handarbeiten und verkniff sich jede Bemerkung, wenn Betty mal wieder mit einem toten Hasen und kaputten Strümpfen nach Hause kam, denn es nützte alles nichts.
In solchen Momenten sehnte sie sich Otto herbei. Mit dem hatte sie immer alles besprochen. Sie war es leid, das Alleinsein. In den Nächten träumte sie von ihm. Sie sah ihn vor sich in dieser schrecklichen Uniform. Der Mann, der darin gesteckt hatte, war nicht mehr ihr Otto gewesen. Ihrer war Schneider und kein Soldat. Er konnte auch Torf stechen und Buchweizen aussäen. Er kannte sich mit schwankenden Böden aus, anders konnte man hier nicht überleben. Mit Kanonen und Bomben hatte er nicht umzugehen gewusst. Sie erinnerte sich an den Frühlingstag vor acht Jahren, wie er in den Zug gestiegen war, widerwillig, weil er wohl schon ahnte, dass die Sache für ihn nicht gut ausgehen würde. Einen einzigen Brief hatte er ihr geschrieben.
Zu Felde, April 1941
Meine liebe Edith!
Bestimmt hast du meine Gedanken gehört. Die ganze Bahnfahrt über, so eine Woche, habe ich an nichts anderes denken können als an dich. Ich bin nur halb hier und noch halb bei dir und unserer kleinen Elisabeth. Es ist so leer um mich, obwohl wir wie die Ölsardinen in der Dose leben, eng auf eng. Mein Heimweh ist so stark, das musst du spüren.
Wo ich bin? In Russland. Mehr kann ich dir nicht sagen, aber niemals hätte ich gedacht, so weit wegzumüssen in meinem kleinen Leben, aber ich muss nach vorn schauen.
Bisher konnten wir gute Gewinne machen. Wenn es so weitergeht, ist der Krieg bald gewonnen und ich werde wieder zu Hause sein. Ich wollte dir auch schon längst schreiben, nachdem wir angekommen waren, aber dann ging es gleich ins Feld. Später gab es Schnaps und Bier, Josef hatte Geburtstag, dabei war mir nicht danach zumute.
Meine liebe Edith, ich hoffe, es geht euch gut und ihr kommt zurecht. Blüht denn der Holunder schon vor dem Haus? Und hast du den Buchweizen gesät? Nun muss ich fürs Erste schließen. Ich drücke dich an mein Herz und küsse dich tausend Mal. Gib unserer kleinen Elisabeth etwas davon ab.
Dein dich liebender Otto
Edith hatte ihm wohl hundert Mal zurückgeschrieben. Nie war eine Antwort gekommen. Wie oft war sie später zu dem kleinen Bahnhof geradelt, wenn es hieß, dass Männer aus der Gefangenschaft heimkehrten. Jedes Mal hatte sie gehofft, dass ihrer dabei war, aber sie wurde immer enttäuscht. Sie konnte nur die Rückkehrer ausfragen, ob sie etwas von Otto Abels wussten. Reinke Cordugas, der Sohn vom Wirt, der hatte tatsächlich eine Geschichte zu erzählen gehabt.
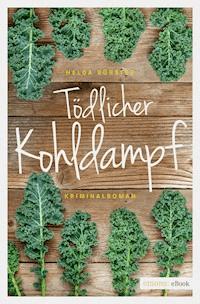
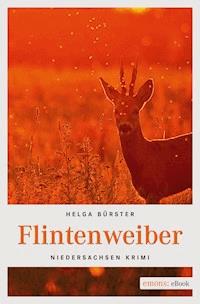


![Als wir an Wunder glaubten [Ungekürzt] - Helga Bürster - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/87d1cc78cb3b1554008d04ddc09e5363/w200_u90.jpg)
























